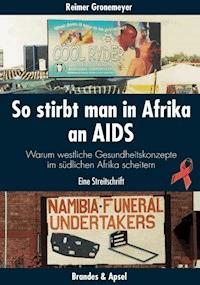14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Bedrohung, Erlösung, Tabu – von unserem Umgang mit dem Sterben Je älter unsere Gesellschaft wird, umso drängender stellt sich die Frage nach unserem Umgang mit dem Lebensende. Die medizinischen Möglichkeiten der Lebensverlängerung sind fast unbegrenzt, doch viele wünschen sich einen plötzlichen, schmerzfreien Tod. Prof. Dr. Dr. Reimer Gronemeyer, Experte für Sterbeforschung, Hospizarbeit und Palliative Care, zeigt, wie die zunehmende Institutionalisierung und Medikalisierung des Sterbens immer schwierigere ethische Fragen aufwerfen und welche Antworten es darauf geben kann. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Ähnliche
Reimer Gronemeyer
Sterben in Deutschland
Wie wir dem Tod wieder einen Platz in unserem Leben einräumen können
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Andreas Heller
Oh Herr, gib mir die Kraft, die Dinge zu bekämpfen, die ich bekämpfen kann. Gib mir die Geduld, mit den Dingen geduldig zu sein, die ich nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, zwischen den beiden zu unterscheiden.
Franz von Assisi
Zur Einführung
Früher ist man gesund gestorben
Der flexible Mensch und sein brüchiges Lebensende
Meine Großmutter hatte das Privileg, zu Hause sterben zu können. Ich nehme jedenfalls an, dass es ein Privileg war. Ich weiß genau, dass niemand auf die Idee gekommen wäre, sie ins Krankenhaus zu bringen. Sie hatte bei uns, bei ihrer Tochter mit deren Mann und drei Söhnen, ihren Enkeln, gewohnt. Sie war Eisenbahnerwitwe und hatte einen weißgrauen Knoten im Nacken, ein schwarzes Kleid mit einer kleinen weißen gestärkten Schleife. Eine neue Schleife, das war ihr immer wiederkehrender Geburtstagswunsch, sonst nichts. Außerdem wünschte sie sich von Zeit zu Zeit Gummiringe für ihr Brillenetui, das nicht mehr schloss. Diese Gummiringe schnitten wir Kinder dann aus alten Fahrradschläuchen. Sonst strickte sie in der Sofaecke und war bescheiden, aber selbstbewusst. Irgendwann begann sie unter Schwindelanfällen zu leiden, sie fiel manchmal um. Eines Tages erlitt sie einen Schlaganfall. Sie konnte nicht mehr richtig sprechen, nur noch lallen und sich kaum noch bewegen. Ihr weißes, metallenes Bettgestell stand an der Wand und ich, zwölf Jahre alt, bekam die Aufgabe, über sie hinwegzusteigen, damit wir gemeinsam ihren Kopf hochhalten konnten, um ihr etwas zu trinken einzuflößen, was nicht richtig gelang. Wir entnahmen ihrem Stammeln den Wunsch, man möge ihre eigene Tasse holen, eine sehr einfache, blassgelbe, dicke Porzellantasse mit breiter Öffnung. Ich meine, sie hätte schließlich etwas getrunken. In unmittelbarer Nachbarschaft gab es ein Heim für so genannte »gefallene Mädchen«, junge Prostituierte. Man hörte sie am Abend singen – 1953 sass man offenbar abends noch im Kreis und sang Lieder! – und sie sangen: »Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.« In der Nacht hörte ich plötzlich lautes Weinen, die Großmutter war gestorben. Das Zimmer, in dem sie gestorben war, fand ich am Morgen verschlossen. Später konnte ich in den Raum sehen, als eine Ärztin kam, die der Verstorbenen einen kleinen runden Taschenspiegel vor den Mund hielt, um den Atemstillstand zu prüfen (der Spiegel wäre sonst beschlagen). Das Fenster war geöffnet, »damit die Seele den Raum verlassen konnte«, sagte meine Mutter. Und die große alte Standuhr war angehalten worden. Die Ärztin wickelte der weißhaarigen Großmutter, im weißen, linnenen Nachthemd, im weißen Bett, eine weiße Mullbinde um den Kopf, die den Mund schließen sollte. Die Zahnprothese wurde eingesetzt und dann kam irgendwann im Laufe des Tages der Beerdigungsunternehmer und nahm sie im Sarg mit. Aus dem Fenster sahen wir, wie die Großmutter für immer weggefahren wurde.
Heute würde man sie nach dem Schlaganfall wohl sofort ins Krankenhaus bringen. Sie würde einen Tropf bekommen, vielleicht eine PEG-Sonde für die künstliche Ernährung. Möglicherweise würde sie sich sogar etwas erholen. Aber würde sie es wieder bis in einen Rollstuhl schaffen? Nach einer gewissen Zeit jedenfalls hätte man sie in ein Pflegeheim verlegt, um dort noch eine Zeit zu leben: ernährt, gepflegt, gewindelt, gewaschen. Sie, die nie viel für sich beansprucht hatte, wäre ein teurer Sozialfall geworden.
Die Situation der fünfziger Jahre ist nicht wieder herstellbar. Für die Großmutter gab es keine professionelle Pflege, keine medizinische Versorgung, keine Institution, in die man sie hätte bringen können. Vermutlich wäre ihr die moderne Variante des Lebensendes zuwider gewesen. Aber wir stehen heute vor einem Dilemma: Da es nun einmal die professionelle Pflege gibt, die Ambulanz, die Sonde, die Rehabilitation, das Pflegeheim und die Windeln, besteht gar nicht die Möglichkeit, »nein« zu sagen, weil das im Grunde unterlassene Hilfeleistung wäre. Kann man sich das noch vorstellen, dass ein Zwölfjähriger über die sterbende Großmutter klettert, ihren Kopf hält, damit ihr Tee eingeflößt werden kann? Wenn erst einmal die Wahlmöglichkeit da ist, führt nichts an der Professionalisierung vorbei. Und auf diesem Wege verschwimmen natürlich auch die Grenzen zwischen dem Sterben zu Hause und dem Sterben in der Institution: Der Trend geht dahin, die Menschen zwar möglichst zu Hause sterben zu lassen, wenn das der Wunsch ist – aber um den Preis, dass das Krankenhaus in die Familie kommt: Das Sterbezimmer wird personell und technisch so aufgerüstet, dass der Unterschied zwischen Krankenhaus und Zuhause fast verschwindet.
Meine Großmutter war als junge Frau von einer nordfriesischen Insel nach Hamburg gekommen. Der Beruf des Ehemannes brachte das mit sich. Sie war von einer rauen, störrischen Frömmigkeit, die im Abendgebet und im sonntäglichen Kirchgang zum Ausdruck kam. Daneben war sie aber auch offen für heidnische Bräuche: Sie las die Zukunft aus Teeblättern und bei Krankheiten kam jemand zum »Besprechen«. Zu diesen Anlässen wurde die Tür geschlossen und wir Kinder hörten ein geheimnisvolles Gemurmel. Die Warzen verschwanden dann bald von der Hand, ebenso wie andere kleinere Gebrechen. Und wenn man von Zähnen träumte, so hieß es, fürchtete man, dass jemand sterben würde. Das Leben und den Tod betrachtete die Großmutter als etwas, das aus Gottes Hand kommt. Sie hatte von ihrer Rente das Beerdigungsgeld auf die Seite gelegt, mehr Vorsorge konnte es nicht geben. Dass das Grab neben ihrem schon lange verstorbenen Mann für sie bestimmt war, das war ohnehin selbstverständlich. Dieses Grab hat sie in ihrer Witwenzeit sehr häufig besucht, sorgfältig gepflegt und mit Blumenschmuck versehen.
Was vor und was nach dem Tod geschieht, hat sich in dem halben Jahrhundert seit dem Tod meiner Großmutter in den fünfziger Jahren radikal umgekehrt. Aus dem unspektakulären, irgendwie selbstverständlichen Sterben ist heute ein medizinisch kontrolliertes Sterben geworden, das meist im Krankenhaus oder im Altenpflegeheim stattfindet: 80 Prozent der Deutschen sterben in einer Institution, obwohl 80 Prozent der Deutschen sagen, dass sie zu Hause sterben möchten. Außerdem ist Sterben der teuerste Lebensabschnitt geworden: Krankenversicherer sagen, dass zwei Drittel der Krankenhauskosten heute im Durchschnitt in den letzten Lebenswochen und -monaten anfallen. Teure Therapien, teure Schmerzmittel, teure Pflegeeinrichtungen oder äußerst kostspielige Intensivstationen. Das Lebensende ist oft noch einmal durch eine bisweilen absurde Mobilität gekennzeichnet, als würde die Beschleunigung, die unser Leben heute kennzeichnet, auch am Ende noch einmal triumphieren: Viele Sterbende werden mit der Ambulanz im letzten Augenblick noch aus ihrer Wohnung ins Krankenhaus gebracht, vom Pflegeheim ins Krankenhaus, vom Krankenhaus ins Pflegeheim oder vom Krankenhaus ins Hospiz, immer auf der Suche nach Rettung in letzter Sekunde oder nach Verbesserung der Situation durch Beatmungsgeräte, Morphium, Ernährungssonden. Es wäre im Sterbezimmer meiner Großmutter niemand auf die Idee gekommen, eine Ambulanz zu rufen: Erstens gab es überhaupt kein Telefon in der Wohnung und zweitens waren die Ambulanzen noch Krankenwagen, die keineswegs kurzfristig zur Verfügung standen.
Die Veränderung der Situation, die Menschen heute, im Vergleich zu meiner Großmutter, am Ende des Lebens erfahren, ist für mich greifbar in der Geschichte eines alten Ehepaars, die sich so oder ähnlich vielfach ereignet:
Friedrich H. ist 1903 geboren. Kurz nach seinem neunzigsten Geburtstag erleidet er 1993 einen heftigen Herzanfall. Seine Frau ruft den Notarzt und die Ambulanz kommt, um ihn ins Krankenhaus zu bringen. Er fleht seine Frau an, ihn zu Hause zu lassen. Die verzweifelt, weil sie nicht weiß, was sie tun soll. Sie fügt sich der Autorität der Ambulanzbesatzung und Friedrich H. wird mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren. Er stirbt im davonrasenden Wagen. Als sein Sohn am anderen Morgen ins Krankenhaus geht, wird ihm das Ableben des Vaters mitgeteilt, und gleichzeitig, dass es nicht mehr möglich sei, den Vater noch einmal zu sehen. Erst im kommenden Monat werde es möglich sein, gegen eine Gebühr von 80 Mark eine kurze Aufbahrung zu veranlassen. Er bekommt eine Plastiktüte in die Hand, in der sich die Kleidungsstücke, der Ehering und das Gebiss des Vaters befinden. Die Beerdigung findet im Familiengrab statt, wo bereits die Eltern des alten Mannes, seine Geschwister und deren Ehepartner beerdigt sind. Die ohnehin ängstliche Frau hatte es nicht vermocht, dem Wunsch des Ehemanns zu entsprechen, weil die Resthoffnung, er könne doch noch gerettet werden, stärker war. Er, der in seinem Bett zu Hause sterben wollte, stirbt den medikalisierten Tod in der Ambulanz. Seine Frau, 1909 geboren, lebt noch acht Jahre länger. Im letzten Jahr ihres Lebens wiederholt sie immer häufiger den Satz: »Ich möchte nicht mehr leben.« Am Grab ihres Mannes sagt sie: »Ich komme bald zu dir«. Sie lebt nun allein, ist durch ein Alarmsystem mit der Pflegezentrale verbunden. Trotzdem findet man sie eines Tages bewusstlos auf dem Boden in ihrer Wohnung. Sie hat die Zentrale nicht mehr alarmieren können, obwohl sie den Alarmknopf am Arm trug. Niemand weiß, wie lange sie dort gelegen hat. Sie wird in die KZP gebracht, in die Kurzzeitpflege, sehr teuer, sehr gut ausgestattet. Sie ist ein wenig verwirrt, aber sie erkennt ihre Kinder und ahnt, dass sie nicht mehr in ihre Wohnung zurückkehren wird. Die Frau war, wie gesagt, immer ein eher ängstlicher Mensch. Nun verweigert sie entschlossen die Nahrungsaufnahme. Sie presst die Lippen zusammen und öffnet sie nur noch, um zu sagen, dass sie nicht essen und nicht trinken will. Der Arzt bespricht mit den Söhnen die Frage, ob sie künstlich, das heißt in diesem Falle mit Zwang, ernährt werden soll. Die gemeinsame Entscheidung lautet: nein. Frau H. stirbt nach wenigen Tagen. Der Sohn, der aus dem Süden Deutschlands anreisen muss, erfährt, dass der Sarg vom Beerdigungsunternehmer schon verschlossen wurde, ein Abschied von der Mutter ist nicht mehr möglich. Das Familiengrab bietet keinen Platz mehr für einen Sarg. Sie wird verbrannt und ihre Asche neben dem Sarg ihres Mannes begraben. Die Pflege des Grabes übernimmt gegen eine Gebühr die Friedhofsverwaltung.
Innerhalb einer Generation, so kann man sagen, hat sich der Umgang mit Sterben und Tod radikal verändert:
Sterben hat sich aus der Familie und dem Zuhause in Krankenhäuser und Altenpflegeheime verlagert;
Sterben ist zu einer medizinisch begleiteten Angelegenheit geworden;
Sterben ist, weil in Institutionen verlagert, sehr kostspielig geworden;
Der Umgang mit den Toten dagegen wird »sparsamer«:
Die Feuerbestattung und die anonyme Beerdigung werden immer selbstverständlicher – weniger Kosten, weniger Nachsorge.
Hinter diesen Entwicklungen verbergen sich tiefgreifende Veränderungen. Vor allem machen sie die allmähliche Erosion der Familie erkennbar: Die schickt ihre Sterbenden in Einrichtungen, weil sie sich die Begleitung nicht zutraut, keine Zeit hat, oder weil überhaupt keine Familie mehr vorhanden ist. Jeder Zweite über 85-Jährige in Deutschland lebt allein und eine wachsende Zahl verfügt allenfalls über locker-distanzierte Verbindungen zu dem, was an Familie noch da ist.
Mit der Verlagerung des Sterbens in Einrichtungen ist der Tod aus dem Alltagsleben verdrängt worden. Wenn ich in meinen Veranstaltungen in der Universität frage, wer von den Studierenden schon einmal einen toten Körper gesehen oder gar angefasst hat, dann melden sich wenige. Dieses Tabu, das sich allmählich über den Tod gelegt hat, wird auf merkwürdige Weise dadurch konterkariert, dass unsere Medien – insbesondere das Fernsehen – den Tod zum Zentrum der Nachrichten und der Unterhaltung gemacht haben: Ein 15-jähriger Deutscher hat im Durchschnitt schon einige hunderttausend Menschen sterben sehen, auf dem Bildschirm nämlich. Aber seine Großmutter ist im Pflegeheim aus dem Leben geschieden, ohne dass er sie noch gesehen hätte.
Vom Rande der Gesellschaft her flackert bisweilen Widerstand gegen eine Mentalität auf, Körper so aseptisch und kontrolliert wie möglich zu beseitigen. Als sich eine türkische Frau von ihrem Mann verabschieden will, der im Keller eines Großkrankenhauses aufgebahrt ist, wird sie in einen Raum geführt, der den Toten durch eine Glaswand von den Besuchern trennt. Die Frau stürzt sich durch die Glasscheibe, um den Abschied auf ihre Weise zu vollziehen.
Ohne Übertreibung kann man sagen, dass wir modernen Menschen uns – in Deutschland und in nahezu allen Industriegesellschaften – in einer radikal neuen Situation befinden. Der Rückzug religiöser Orientierungen, der Fortschritt der Medizin und die Auflösung der Familie haben das Lebensende völlig verändert. Vieles hat sich ins Gegenteil verkehrt: In den meisten einfachen Gesellschaften steht der physische Tod am Anfang und der soziale Tod folgt in einem langen Prozess der Verabschiedung, der sich über Wochen hinziehen kann. Es gab Völker in Asien, bei denen der Ehepartner die Knochen des Verstorbenen über Jahre in einem Lederbeutel mit sich herumtrug. Bei uns ist es umgekehrt: Der soziale Tod geht oft dem physischen Tod voraus. Man denke an Menschen, die von Freunden und Angehörigen im Pflegeheim vergessen werden. Oder an Menschen mit Demenz, die bisweilen sozial bereits für tot erklärt werden und nur noch physisch am Leben sind.
Die medizinische Versorgung von Menschen am Lebensende ist immer perfekter, immer professioneller geworden – so professionell, dass die Menschen irgendwann begannen, misstrauisch zu werden. Die meisten Menschen wollen heute keine sinnlose Verlängerung ihres Lebens und versuchen, sich dagegen mit Patientenverfügungen zu wehren. Auf diese Ratlosigkeit, die durch die Veränderung des Sterbens entstanden ist, reagieren neue soziale, pflegerische, medizinische und kulturelle Bewegungen. Vor allem in der Hospizbewegung, die in England aufkam und in Deutschland ein großes Echo gefunden hat, wurde das Problem wahrgenommen und der Versuch unternommen, neue Wege zu gehen. Ambulante und stationäre Hospizdienste bieten Begleitung für Sterbende und werden dabei in Deutschland von 80000 ehrenamtlichen Kräften unterstützt. Es ging – jedenfalls am Anfang – um bessere, billigere und nicht entwürdigende Dienste für Menschen am Lebensende. In der Medizin wurde – auch angesichts der großen Resonanz auf die Hospizbewegung – ebenfalls reagiert: Hier entwickelte sich in den letzten Jahren ein neuer Zweig, die Palliativmedizin, die mit neuen Formen der Schmerzbekämpfung und mit palliativer Pflege alte Missstände beheben soll. »Pallium« heißt eigentlich »der Mantel« und »palliativ« bezeichnet heute den besonderen, pflegerischen und medizinischen, Umgang mit Sterbenden. Das Sterben im Krankenhaus war lange Zeit durch das berüchtigte Abschieben Sterbender in Badezimmer und auf Flure gekennzeichnet. Heute dagegen nimmt die Zahl palliativmedizinischer Abteilungen stetig zu. Das Sterben hat in vielen Krankenhäusern einen Ort gefunden.
Die moderne Gesellschaft, die das Sterben aus der Familie in Institutionen verlagert hat, hat das Sterben medikalisiert und dadurch ist es teuer geworden. Nun reagiert sie und bietet neue Lösungen. Das Sterben in abgelegenen Räumen, wie Badezimmern, dürfte selten geworden sein. Die Hospizbewegung versucht, das Sterben zu Hause wieder möglich zu machen und wo das nicht gelingt, bieten stationäre Hospize einen letzten Zufluchtsort. Hier wird zwar eine gute pflegerische und medizinische Betreuung angeboten, im Zentrum steht aber der Versuch, die Gäste menschlich auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Auch in Pflegeheimen wird neuerdings zunehmend die Frage nach einer guten Sterbebegleitung gestellt.
Wird also alles gut?
Die neue Hospizbewegung und die junge palliativmedizinische Kompetenz können nicht alle Schwierigkeiten lösen und sie sind auch bisweilen in der Gefahr, für andere Zwecke vereinnahmt zu werden.
Die Zahl der Hochaltrigen in Deutschland nimmt zu, das heißt: mehr Pflegefälle. Das heißt: mehr Menschen mit Demenz – und eine demenzielle Erkrankung führt fast zwangsläufig in absehbarer Zeit zum Tod. Wann stoßen die neuen Entwicklungen im Umgang mit dem Sterben an ihre Wachstumsgrenzen?
Wie sicher ist Palliativpflege vor Missbrauch? Weil Sterben so teuer ist, könnte mancher sich aufgefordert sehen, sie als preiswerte Alternative anzupreisen und zu instrumentalisieren. Dann liefe sie Gefahr, Teil einer Entsorgungsstruktur zu werden, die kostspielige Alte vor allem preisgünstig versorgt.
Hospizbewegung und Palliativmedizin mögen die Würde des Sterbenden im Blick haben und den »eigenen Tod« des Patienten zu fördern versuchen, von dem schon Rilke (»… gieb jedem seinen eignen Tod«) gesprochen hat. Bei einem Überangebot an Maßnahmepaketen droht allerdings genau das Gegenteil.
Es besteht die Gefahr, dass das eigene Sterben immer mehr zum Projekt der Planung und Vorsorge wird. Unser Leben zu planen, das haben wir gelernt. Kommt jetzt die Sterbeplanung dazu? Setzen sich in der Sterbebegleitung Modularisierung, Standardisierung, Qualitätskontrolle und Evaluation so durch, dass wir am Ende einem qualitätskontrollierten Sterben ausgeliefert sind?
Verliert damit das Sterben seinen lokalen Geschmack?
Orte und Kulturen hatten bisher ihre eigenen Formen des Umgangs mit Sterben und Tod. Die Weltgesundheitsorganisation hat Richtlinien formuliert, die auch als ein Schritt in Richtung »Gleichschaltung des Sterbens« gelesen werden könnten. Wir sterben dann zwar professionell versorgt, aber es ist gleichgültig geworden, ob wir in Riga, in London, in Rom oder in Frankfurt unser Leben aushauchen. Und dann hätten wir palliative Sicherheit gewonnen, wahrscheinlich um den Preis der Wärme, der Beheimatung und der Vertrautheit.
Also, Sterben in Deutschland, das hat sich in einem halben Jahrhundert dramatisch verändert. Aus dem »selbstverständlichen« Sterben zu Hause wurde der medizinisch überwachte Tod. Der Schrecken darüber ruft die Hospizbewegung und auch die Palliativmedizin auf den Plan, die beide die kritisierten Umstände verbessern wollen. Sie sind heute aber in der Gefahr, am Ende des Lebens das zu tun, was auch am Lebensanfang geschieht: Geburt und Tod werden zum Projekt, das von Planung und Kontrolle getragen wird.
Und wenn die Deutschen sich auf diesen Weg begeben, dann liegt der Gedanke nicht mehr fern, dass Geburt heißt: anschalten. Und dass Sterben heißt: abschalten. Die radikalste Form dieses »Trends« setzt sich gerade durch: Euthanasie und assistierter Selbstmord sind die letzte Konsequenz auf einem Weg, der den Tod nicht mehr als etwas erträgt, das kommt, sondern Sterben als die abschließende Planungsaufgabe des Menschen sieht, bei der möglichst nichts dem Zufall überlassen werden soll.
Der Verlassenheit des modernen, nachreligiösen Menschen im Angesicht des Todes kann eine gute Sterbebegleitung entgegenwirken, heilen kann sie diese aber nicht. Dieser Grenze sollten sich alle bewusst sein, die sich daran versuchen. Ob sich der Sterbende für Sterbebegleitung und für palliative Pflege wirklich interessiert, wissen wir nicht. Bemerkenswert häufig scheinen die Menschen dann ihr Leben zu beenden, wenn alle das Zimmer verlassen haben. In welchem Verhältnis stehen Versorgen und Gehenlassen können? Wir können bescheiden hoffen, dass die neuen Wege des Umgangs mit Sterbenden sinnvoll sind und wir können mit größtmöglicher Sensibilität zur Humanisierung des Sterbens beizutragen versuchen.
Der flexible Mensch und sein Ende
Es ist noch nicht so lange her, dass die Menschen in Mitteleuropa in eher stabile persönliche und soziale Verhältnisse eingebunden waren. Für die Mehrzahl der Menschen gab es Lebensgehäuse, in denen man sich einzurichten hatte. Ob man in diesen vorgegebenen Lebensgehäusen glücklich war oder nicht, das spielte keine große Rolle. Da war auf der einen Seite die Familie und da war auf der anderen Seite die Berufswelt für die Männer – für Frauen eher die eigenen vier Wände mit der Aufgabe, den Ehemann zu versorgen, die Kinder zu erziehen und das Haus in Ordnung zu halten. Der Charakter dieser Menschen, die in der Industriegesellschaft lebten, war durch stabile moralische Prinzipien gekennzeichnet, wie die »Zehn Gebote« oder die Bereitschaft zu Gehorsam, Fleiß, Sparsamkeit. Die alten Tugenden und Werte eben, die für Arbeitswelt und Familie überlebenswichtig waren. Wer sich in diese vorgegebenen Gehäuse nicht einfügen wollte, landete im Gefängnis, im Irrenhaus oder auf der Straße. Das Lebensende war in diese stabile, starre Welt eingebettet und nach dem subjektiven Empfinden wurde nicht gefragt. Das Lebensende begleitete der Priester oder Pastor, bisweilen ging die Gemeindeschwester der Familie zur Hand, wenn es einen Sterbenden im Hause gab. Das Sterben verlief gewissermaßen in den gleichen geordneten Bahnen wie das Leben selbst. Große Dramen um Liebe und Tod konnte man sich auf der Opernbühne ansehen.
An die Stelle dieses stabilen, als charakterfest gedachten Menschen ist der homo flexibilis getreten. Die Umwelt der modernen Menschen ist durch eine wachsende Beschleunigung gekennzeichnet – alles wird schneller, das Internet, das Auto, der ICE, die Abwicklung von Beziehungen, die Arbeit im Büro. Und diese Beschleunigung bleibt den Menschen nicht nur äußerlich. Die Beschleunigung geht in den Charakter des modernen Menschen über und setzt ihn selbst – und seinen Charakter – unter Flexibilisierungsdruck. Will man in der modernen Lebenswelt überleben und erfolgreich sein, dann muß man vor allem diesem Druck gewachsen sein. Das Innere des Menschen gerät ins Rutschen, der ehemals feste Charakter wird instabil und seine »Umwelt« nicht minder: Familien zerfallen, Arbeitsplätze gehen verloren und Prinzipien der Lebensführung gibt es nicht mehr, sie sind vielmehr durch eine Ad-hoc-Moral abgelöst.
Dieser moderne Mensch wird eher von diffuser Angst beherrscht als von konkreten Befürchtungen (Richard Sennett). Eng verbunden mit dieser Angst ist die Frage: Was ist meine Identität? Wie weit muss ich das Persönliche, mein Ich, zurücknehmen, damit ich in dieser beschleunigten, konkurrenzorientierten, leistungsbestimmten Welt überleben kann? Es kann ja kein Zweifel sein, dass dieser homo flexibilis sein Sterben, sein Ende anders erlebt als der Bewohner des 19. Jahrhunderts, dessen Lebensgebäude auf einem festen Fundament stand. Er konnte auf ein Lebenswerk zurückblicken: Auf die Schuhe, die er gemacht hatte, auf das Unternehmen, das er aufgebaut hatte oder eben auf die Stetigkeit, mit der er ins Bergwerk eingefahren war. Der Rückblick heute zeigt eher die Reste von Sandburgen, die das Meerwasser wegschwemmt. Das ist in jedem Detail spürbar. Fotoalben verschwinden in digitalen Speichern. Briefe werden nicht mehr in alten Kartons aufbewahrt, an die Stelle sind zigtausende von gelöschten E-Mails oder SMS getreten. Die Heimat? Man hat an vielen Orten gewohnt. Die Fremde? Man hat die halbe Welt bereist. Die Familie? In alle Winde zerstreut oder durch Beziehungswechsel verloren gegangen. Die Arbeit? Ein Patchwork, in dem allenfalls Architekten noch erkennen können, was sie eigentlich gemacht haben.
Auch die Ängste dieses modernen Menschen sind »flexibilisiert«. Sie sind diffus und nicht mehr auf eine konkrete Hölle oder einen konkreten Himmel bezogen. Ist der säkularisierte Zeitgenosse damit am Gipfelpunkt möglicher Ängste angelangt, weil er ja doch ein völlig Verlassener, Hoffnungsloser ist? Oder sind auch seine Ängste so fragmentiert wie seine Persönlichkeit, sodass er gewissermaßen ohne besondere Auffälligkeiten aus dem Leben scheiden kann, ein versagendes System, das sein Ende gar nicht beklagen kann, sondern mit Bedauern akzeptiert? Eines ist jedenfalls unübersehbar: Auch der letzte Lebensabschnitt gerät unter den Imperativ der Flexibilisierung. Man kann sein Leben im Krankenhaus, im Pflegeheim, im Hospiz oder bei ambulanter Betreuung zu Hause beschließen. Viele erwartet am Lebensende ein erneuter Umzug, der sie vom Krankenhaus ins Heim oder nach Hause, ins Hospiz, manchmal auch wieder zurück ins Krankenhaus führt. Bis zum Schluss bleiben wir mobil. So fragmentiert wie das Leben der Menschen heute ist, ist auch das Ende geworden: Das sieht man zuerst daran, dass auch die Versorgung selbst aufgeteilt ist, und oft sind die verschiedenen Dienstleistungen nicht aufeinander abgestimmt. Also bleibt der moderne Mensch auch am Ende nicht davon verschont, noch einmal zwischen verschiedenen Angeboten und Dienstleistungen wählen zu müssen. Das geht soweit, dass inzwischen hier und da schon Case-Manager für das Lebensende zurate gezogen werden. Das Lebensende ist keine Sackgasse, sondern eher ein Autobahnkreuz, auf dem man zwischen verschiedenen Richtungen zu wählen gezwungen ist. Welcher Ort ist der Richtige? Welches Pflegeheim hat einen guten Ruf? Brauche ich eine Patientenverfügung? Muss ich über den im Ausland möglichen assistierten Selbstmord nachdenken? Brauche ich Sterbebegleitung? Soll ich vielleicht sogar in eine Klinik mit alternativer Medizin gehen? Oder mache ich noch eine Chemotherapie?
Dieses Buch will kein Ratgeber auf diesem komplizierten letzten Weg sein. Vielleicht dauert es nicht mehr lange, bis man – wie in einem Reiseprospekt – die besten Angebote für die letzten Wochen des Lebens präsentiert bekommt. Zertifiziert womöglich? Nach dem Muster: Best Practice am Lebensende. Gibt es Informationsdefizite, die wir nun auch für die Situation rund um das Lebensende diagnostizieren müssen? Nein, so ist dieses Buch nicht gedacht. Aber vielleicht gibt das Buch dem einen oder anderen den Anstoß darüber nachzudenken, ob wir auf dem Holzweg sind? Wie verändern sich Sterben und Tod im 21. Jahrhundert und welchen Weg wollen wir einschlagen? Gegenwärtig bilden sich die Prozesse, die unser Leben ohnehin ausmachen, zunehmend auch im Sterben der Menschen ab. Konkurrenz zwischen den Anbietern, Wahl zwischen den Marktangeboten: Wie im richtigen Leben, könnte man sagen. Und die Gesundheitsreform betreibt eine Art »Outsourcing« sterbender Patienten nach Hause. Manche Ausbildungsangebote für Sterbebegleitung sind vom Modularisierungswahn ergriffen, von Flexibilisierung, Standardisierung, Qualitätskontrolle, Lebensqualität und Evaluation. Alle diese Plastikwörter finden sich in der Entwicklung einer »vernetzten« Versorgung am Lebensende wieder, eines Versorgungsprojektes, das wir dann schließlich noch »würdevolles Sterben« nennen.
Die Diskussion über das Sterben in modernen Zeiten hat bei uns erst begonnen, aber offensichtlich wächst die Bereitschaft über das, was zum Tabu geworden war, zu sprechen. Und das könnte sehr wichtig sein: In einem »alt« werdenden Europa, in dem die Zahl der Hochaltrigen viele, viele Millionen umfasst, wird die Frage nach dem Umgang mit diesen, die manche als unnütze Esser zu sehen geneigt sein könnten, zur zentralen kulturellen und humanen Frage.
»Mit dankbarem und wohligem Gefühl …
Geschichten vom Lebensende
Letzter Ortswechsel »Wir hatten keinerlei Erfahrung beim Absaugen und mit dem Rest der Maschinen«
»Mit dankbarem und wohligem Gefühl im Herzen kann ich jetzt zurückblicken auf die Zeit im St. Elisabeth Hospiz in M. Dorthin durften (mussten) wir meine an ALS erkrankte Mutter nach zehnmonatiger intensivster Pflege und Betreuung bei uns zu Hause geben. Die Pflege in unserem Haus bewältigten mein Mann, unsere drei Kinder (damals 7, 17 und 21 Jahre) und ich rund um die Uhr. Unterstützt (und auch sehr liebevoll begleitet) hat uns dreimal täglich für ca. 30–45 Minuten der Pflegedienst. Da meine Mutter ohne Aussicht auf Besserung von der Intensivstation zu uns entlassen wurde, entstand nun zu Hause ein regelrechtes Intensiv- und Krankenzimmer – für uns alle Neuland! Ich hatte bis dahin erst einmal die Trachealkanüle – unter Aufsicht einer Krankenschwester – gewechselt. Von nun an musste(n) ich (wir) das übernehmen!
Natürlich hatten wir gemeinsam beschlossen, die Pflege aus Liebe zu meiner Mutter, unserer lieben Oma, anzunehmen. Wir hatten keinerlei Erfahrung beim Absaugen und mit dem Rest der Maschinen. Die Belastung für unser Familienleben war enorm! Ich bin auch heute noch dankbar, dass wir diese Zeit überstanden und ausgehalten haben – gemeinsam!
Die Zeit im Hospiz war ein Ankommen, ein »Aufgefangen-werden«, mit allen Sorgen und Ängsten. Jetzt hatten wir endlich die Zeit, die uns fehlte – für uns als Familie, für mich als Tochter mit meiner Mutter, für meinen Mann mit seiner Schwiegermutter und für die Enkelkinder mit ihrer Oma! Es war wunderbar! Wir konnten ohne Verpflichtungen bei ihr sein, waren nicht mehr für alles verantwortlich. Im Hospiz gibt es die richtigen Ansprechpartner, bei denen man Zuspruch finden kann. Wir konnten sogar gemeinsam den Geburtstag meiner Mutter feiern; mit Tränen zwar und dem Wissen um Abschied, aber auch mit viel Lachen und Liebe! Wir konnten uns in dieser Zeit sehr nahe sein. Wir verständigten uns per Zeichensprache, ausgedrucktem Alphabet und konnten inzwischen ganz gut von den Lippen meiner Mutter lesen. Die Erkrankung, ohne Aussicht auf Heilung, war unabänderlich. Aber die Menschlichkeit, die Wärme und das liebevolle Miteinander, sowie die Offenheit und Ehrlichkeit (auch wenn dies manchmal wehtut) im Umgang mit dem Gast und den Angehörigen ist ganz wunderbar für uns gewesen. In der heutigen Zeit leider nicht mehr selbstverständlich. Herzlichen Dank dafür!
Leider durfte meine Mutter nicht so liebevoll aufgehoben einschlafen. Die Krankenkasse lehnte eine weitere Verlängerung des Aufenthaltes aus Kostengründen ab. Deshalb musste meine Mutter noch einmal in ein Pflegeheim umziehen. Dort ist sie dann nach nicht ganz zwei Monaten verstorben.
Dieser Umzug war, nach dem Auszug bei uns, für meine Mutter eine furchtbare Last, und für mich eine erneute große, seelische Belastung. Es wäre schön, wenn jeder, der es möchte, die Endphase seines Lebens und Leidens in einem Hospiz verbringen dürfte!«
Die meisten Deutschen möchten zwar zu Hause sterben, diese Geschichte zeigt aber, wie schwer das in Zeiten medizinisch begleiteten Sterbens oft ist: Wer traut sich schon den Wechsel einer Trachealkanüle (die nach einem Luftröhrenschnitt eingesetzt wird) zu? Was ist, wenn ein Betroffener und seine Angehörigen mit Erstickungsängsten konfrontiert werden? Wer übernimmt schwierige Pflegeaufgaben, wenn der Pflegedienst nicht da ist? Was ist zu tun, wenn es plötzlich zu einer Schmerzattacke kommt? Und überhaupt: Was geschieht in einer Krisensituation, wenn es dem Ende zugeht? Den Arzt rufen? Den Priester? Die Freunde und Angehörigen? Die Frau, von der hier die Rede ist, leidet an ALS, Abkürzung für Amyotrophe Lateralsklerose. Das ist eine Krankheit des Nervensystems, die zu einer nicht aufzuhaltenden Muskellähmung am ganzen Körper, einschließlich der Atemmuskulatur führt. Die Patienten können oft nicht mehr richtig schlucken, bekommen die Speisen in die Atemwege. Meistens sterben die Patienten innerhalb weniger Monate bis Jahre. Der Fall macht deutlich, dass ökonomische Fragen eine wichtige Rolle spielen: Die Krankenkassen zahlen im Regelfall nur eine begrenzte Zeit für den Aufenthalt in einem Hospiz. (Hospize sind Einrichtungen, in denen Menschen, bei denen das Lebensende absehbar ist und bei denen eine Heilung als aussichtslos angesehen wird, ihre letzten Tage, Wochen oder Monate verbringen können.) Es ist heute durchaus charakteristisch für Sterbeverläufe, dass ein oder mehrere Ortswechsel, die oft sehr belastend sind, stattfinden. In diesem Fall sind es vier Stationen: Vom Krankenhaus in die Familie, von der Familie ins Hospiz, vom Hospiz ins Pflegeheim. Nicht selten führt der Weg vom Pflegeheim dann auch noch ins Krankenhaus. In hessischen Altenpflegeheimen zum Beispiel werden noch mehr als 30 Prozent der Sterbenden vor ihrem Tod in ein Krankenhaus verlegt.[1] Manchmal gibt es erbitterte Auseinandersetzungen zwischen Pflegeheimleitung und Medizinern, wenn der behandelnde Arzt die Verlegung eines sterbenden Patienten ins Krankenhaus fordert.
Aber das Gegenteil kommt eben auch vor: Der Leiter eines privaten Altenpflegeheims in Hessen sagt im Telefoninterview: »Sterbebegleitung ist bei uns kein Thema, bei uns wird nicht gestorben.« Was ja wohl heißt: Wenn jemand in die Endphase kommt, schicken wir ihn fort, ins Krankenhaus.
Die Frau, die zu essen vergaß
Im Altenpflegeheim in S. lebt seit einigen Monaten Frau G. Sie leidet unter einer schweren Demenz, wie mehr als die Hälfte der Bewohner in deutschen Altenpflegeheimen. Die Leiterin des Pflegeheims beschreibt Frau G. als eine besonders heitere Person, die mit ihrer Fröhlichkeit die ganze Station anzustecken imstande ist. Es fehlt ihr nichts. Aber sie hat eben vieles vergessen. Zum Beispiel findet sie ihr Zimmer, nicht. Nachdem sie von einer Pflegekraft zurück in ihren Raum gebracht worden ist, läuft sie zum Bett, nimmt ihre Puppe in den Arm und begrüßt sie mit einem Küsschen. Das Bett ist unordentlich, nachdem sie die Puppe genommen hat. Das scheint sie zu stören, denn sie versucht, das Bett wieder herzurichten. Eine Praktikantin erzählt den Fortgang: »Frau G. wird von der Pflegekraft aufgefordert, ein Taschentuch aus dem Schrank zu holen. Frau G. nimmt eine Strumpfhose heraus und sucht nach Laufmaschen. Sie weiß nicht, was ein Taschentuch ist. Als ihr die Pflegekraft ein Taschentuch gibt, will sie es als Unterdecke für den Fernsehapparat verwenden. Die Pflegekraft bittet Frau G., sich mit dem Taschentuch die Nase zu putzen. Frau G. tastet ihr Gesicht ab. Sie weiss, dass sich die Nase im Gesicht befindet, jedoch nicht an welcher Stelle. Nachdem die Pflegekraft sie darauf hinweist, wo sich die Nase befindet, putzt sie ihre Nase. Frau G. geht nun wieder zum Bett, um nach ihrer Puppe zu sehen, die sie sehr liebevoll behandelt.«
Frau G. also fehlt nichts, sie ist nicht krank, sie ist verwirrt. Allerdings hat Frau G. vergessen, was »essen« ist. Sie will sich vom Personal auch keine Nahrung reichen lassen. Frau G. hat einen Sohn und eine Tochter. Die beiden werden zu der Situation ihrer Mutter befragt. Ihre Auffassung ist klar: Es soll nichts unternommen werden. Keine PEG-Sonde, die eine künstliche Ernährung ermöglichen würde. Die Pflegeheimleiterin ist eine katholisch erzogene Frau, die dieser Entscheidung, die absehbar den Tod bedeutet, nicht zustimmt. Sie wird, so teilt sie den Angehörigen mit, die Sonde legen lassen. Wenn Sohn und Tochter nicht zustimmen, dann möchten sie bitte ihre Mutter mit nach Hause nehmen und dort pflegen. Doch die Leiterin hat nicht die Verfügungsgewalt: Ein Gerichtsurteil hat jüngst klargestellt, dass den Angehörigen die letzte Entscheidung in solchen Situationen zusteht. Die Kinder nehmen Frau G. tatsächlich mit. Im Haus der Tochter ist Platz, Frau G. stirbt nach kurzer Zeit in der Obhut ihrer Tochter.
Wessen Partei will man ergreifen? Die der katholischen Leiterin, die das Leben der Frau G. mit medizinischen Mitteln erhalten will? Die der Kinder, die sagen, wenn die Mutter nicht mehr isst, dann heißt das für uns, sie will nicht mehr leben? Die eine hält die Frau für grundsätzlich gesund und lebenslustig, die anderen meinen, sie habe mit dem Leben abgeschlossen. Soll man einen Menschen gegen seinen Willen am Leben erhalten? So fragen die Kinder. Kann man einen Menschen einfach sterben lassen, nur weil er vergessen hat zu essen – die medizinischen Möglichkeiten aber vorhanden wären, den Betroffenen am Leben zu halten? Solche Situationen sind heute alltäglich.
»Es gibt ein Komplott zu Gunsten eines langsamen Sterbens«, sagt Bernard Lown, Träger des alternativen Nobelpreises. Er nennt fünf Faktoren:
Technologie kann heute das Leben fast unendlich verlängern.
Der ärztliche Berufsstand hat dem Tod den Krieg erklärt.
Das Krankenhaus hat ein althergebrachtes Interesse daran, den aussichtslosen Kampf gegen den Tod auszudehnen.
Patienten kennen ihre Rechte nicht und sind darauf eingestellt zu leiden.
Die Öffentlichkeit erwartet vom ärztlichen Berufsstand nur Siege.[2]
Aber es gibt eben auch die Gegenposition:
Angehörige, die schnell bereit sind, jemanden aufzugeben, weil sie sich Schwierigkeiten, Kosten und den Anblick des Leidens ersparen wollen.
Ärzte, die bei der Aufnahme im Krankenhaus die Angehörigen gleich mit der Frage empfangen: »Sie wollen vermutlich keine lebensverlängernden Maßnahmen?«
Betroffene, die ihre Schwäche als Anlass nehmen zu sagen: »Ich will nicht mehr leben, weil ich niemandem zur Last fallen will.«
Gesundheitspolitiker und Gesundheitsmanager, die angesichts der hohen Kosten am Lebensende oder bei Wachkomapatienten fragen, ob das denn alles bezahlbar sei.[3]
Die Demenz, die zunimmt und die gerade zu einem großen sozialpolitischen Thema in Deutschland wird, ist eine Krankheit mit tödlichem Ausgang. Vor dieser Krankheit haben die meisten Deutschen mehr Angst als vor dem Tod. Angesichts dieser Lage versucht sich Helmut G. durch eine Patientenverfügung zu schützen, die sagt: »Sollte ich an Demenz erkranken, wünsche ich keine künstliche Ernährung. Dies gilt auch, wenn ich als demenziell Erkrankter etwas anderes sage.«
Im Krankenhaus in W. liegen mehrere Menschen im Endstadium der Demenz. Sie haben eine embryonale Haltung eingenommen. Der Zivildienstleistende kommt ins Zimmer und stellt irgendeinen Sender im Radio an, versorgt die Schwerstpflegebedürftigen. Es gibt keine erkennbare Kommunikation mehr mit den Menschen auf den Betten. Ist da mehr als ein Körperklumpen? Eine Krankenschwester sagt mir im Gespräch: »Wenn ich diese Krankheit auf mich zukommen sehen würde, ich würde mich sofort vom Balkon stürzen.« Körperlichen Verfall können viele noch hinnehmen, aber, so denken und sagen viele: »Ich kann nicht damit leben zu verblöden.«
In den Niederlanden ist das Euthanasiegesetz auch auf Menschen mit schwerer Demenz ausgedehnt: Nach sorgfältiger Prüfung können Ärzte und Angehörige über das Ende entscheiden.
»Mein Tod gehört mir!«
Der Rechtsanwalt G. vertritt Dignitas juristisch. Dignitas ist jener Verein, der gegen anfänglichen Widerstand jüngst ein Büro in Hannover eröffnet hat. Dieser Verein organisiert assistierten Selbstmord in der Schweiz. Dort ist die Beihilfe zur Selbsttötung straflos. (In Deutschland stehen Suizid und Beihilfe zum Suizid nicht unter Strafe, die Ärzteschaft lehnt aber bisher eine ärztliche Beteiligung an der Selbsttötung ab.)
So gibt es inzwischen einen regelrechten Selbstmordtourismus in die Schweiz. Der Rechtsanwalt G. ist ein kluger, kultivierter und nachdenklicher Mensch. Die Vorwürfe, Dignitas wolle mit der von diesem Verein organisierten Sterbehilfe viel Geld verdienen, ist vordergründig und wohl auch falsch. Er sagt von sich: »Ich habe mein Leben lang selbst über mich entschieden. Warum sollte ich am Ende des Lebens andere über mich entscheiden lassen?« Rechtsanwalt G. ist über sechzig und lässt keinen Zweifel daran, dass er gegebenenfalls das Angebot des assistierten Selbstmords annehmen und in die Schweiz reisen würde, wenn sich in Deutschland nichts ändert. Dort würde er dann ein tödliches Mittel selbst einnehmen: Nicht einmal die Sterbehelfer helfen. Es ist die letzte eigenständige Tat, mit der sich der Individualist selbst entsorgt. »Mein Tod gehört mir!«, sagt eine Kandidatin für den assistierten Selbstmord. Das deutsche Wochenmagazin stern ziert im November 2006 ein Titelblatt mit zwölf Menschen, die den Entschluss gefasst haben, nach Zürich zu reisen, um ihrem Leben ein Ende zu setzen.[4] Untertitel in großen Lettern: »In Würde sterben.« In Würde sterben heißt hier, in den Räumen des Vereins Dignitas (lat. Würde!) sein Leben mit Hilfe von Gift, das es in der Schweizer Apotheke auf Rezept gibt, zu beenden. Aus den Äußerungen dieser Sterbewilligen tritt das Credo des modernen Menschen deutlich hervor:
Ich will mein Leben eigenverantwortlich gestalten, nicht von Geräten abhängig sein, keine Behandlungen bekommen, gegen die ich mich nicht wehren kann.
Ich will mein Leben nicht im Pflegeheim beenden und ich will nicht von meiner Tochter gewickelt werden.
Wenn Frauen heute mit einem konkreten Termin ins Krankenhaus gehen und ihr Kind auf die Stunde genau bekommen, warum soll mir das beim Sterben verwehrt sein?
Ich will keine unerträglichen Schmerzen erleiden.
Gehört assistierter Selbstmord bald auch in Deutschland zur Regel?
Der Nationale Ethikrat in Deutschland hat einhellig das Recht auf Ablehnung einer Behandlung betont, auch wenn dadurch die Lebenszeit verkürzt werden sollte. In einem Minderheitenvotum heißt es, dass es bei fortgeschrittener Krankheit Fälle geben kann, in denen der Arzt einem Suizidversuch nicht mehr entgegentreten muss. Die Strafbarkeit bei Tötung auf Verlangen soll dagegen ausdrücklich beibehalten werden.
Der Tod, der nicht mehr kommen darf
Das ist das Neue: Sterben und Tod sind für uns moderne Menschen zum »Problem« geworden. Der Tod kommt nicht mehr, sondern er wird zur letzten Gestaltungsaufgabe des Menschen. Wir können versuchen, den Tod mit Hilfe medizinischer Experten zu bekämpfen, oder ihn durch eine Patientenverfügung zu kontrollieren, oder ihn – diese Möglichkeit rückt mehr und mehr in den Vordergrund – regelrecht zu planen