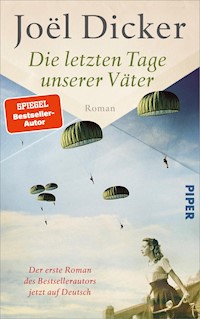10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Vielschichtig und mitreißend – Was ging in Zimmer 622 vor sich? In "Das Geheimnis von Zimmer 662" entfaltet der Schweizer Bestsellerautor Joël Dicker auf über 600 Seiten eine abgründige und schillernde Geschichte aus Mord, Intrigen und der ganz großen Liebe. Eine dunkle Nacht im Dezember, ein Mord im vornehmen Hotel Palace de Verbier in den Schweizer Alpen. Doch der Fall wird nie aufgeklärt. – Einige Jahre später verbringt der bekannte Schriftsteller Joël Dicker seine Ferien im Palace. Während er die charmante Scarlett Leonas kennenlernt und sich mit ihr über die Kunst des Schreibens unterhält, ahnt er nicht, dass sie beide in den ungelösten Mordfall hineingezogen werden. Was geschah damals in Zimmer 622, das es offiziell gar nicht gibt in diesem Hotel ... Nach seinen Bestsellern "Das Verschwinden der Stephanie Mailer" und "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert" Diesmal fügt der Bestsellerautor seinem gekonnten Spiel mit doppelten Böden noch eine weitere Ebene hinzu: Er lässt sein Alter Ego auftreten und verwischt auf schwindelerregende Weise Fiktion und Wirklichkeit. »Es ist nicht nur die Geschichte, die sich windende und wendende und überraschende Handlung, die dieses Buch – es ist mehr als ›nur‹ ein Krimi – zum Erlebnis macht.« Frankfurter Rundschau Krimi, psychologischer Thriller, Schurkenroman, Familiensaga, Liebesgeschichte: "Das Geheimnis von Zimmer 622" bietet alles auf einmal. Derart vielschichtig und zugleich fesselnd schreibt Joël Dicker. Diese aufregende Mischung macht den Roman zum Pageturner des Jahres!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 828
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher: www.piper.de/literatur
Aus dem Französischen von Michaela Meßner und Amelie Thoma
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Titel der franzöischen Originalausgabe: »L´Énigme de la chambre 622« bei Éditions de Fallois, Paris
Covergestaltung: Rothfos & Gabler
Covermotiv: plainpicture/JanJasperKlein und Motive von Shutterstock.com
Karte: © Peter Palm, Berlin
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht
Inhalt
Cover & Impressum
Stadplan Genf
Karte Südwestschweiz
Widmung
PROLOG
Der Tag des Mordes
ERSTER TEIL
Vor dem Mord
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
ZWEITER TEIL
Das Wochenende des Mordes
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
DRITTER TEIL
Vier Monate nach dem Mord
April
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
VIERTER TEIL
Drei Jahre nach dem Mord
September
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Für meinen Verleger, Freund und Lehrmeister
Bernard de Fallois (1926–2018).
Mögen alle Schriftsteller der Welt irgendwann einem so außergewöhnlichen Verleger begegnen.
PROLOG
Der Tag des Mordes
Sonntag, 16. Dezember
Es war halb sieben Uhr früh. Im Palace de Verbier war noch alles dunkel. Draußen war es stockfinster, und es schneite heftig.
Im sechsten Stock öffnete sich der Personalaufzug. Ein Angestellter des Hotels erschien mit einem Frühstückstablett und ging zur Suite 622.
Als er davorstand, sah er, dass die Tür nicht ganz geschlossen war. Licht sickerte durch den Spalt. Er machte sich bemerkbar, erhielt jedoch keine Antwort. Also beschloss er, einzutreten, da er annahm, die Tür sei für ihn offengelassen worden. Was er dann entdeckte, entriss ihm einen Schrei. Er rannte los, um seine Kollegen zu informieren und den Notarzt zu rufen.
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht im Palace, und überall auf den Etagen gingen die Lichter an.
Auf dem Teppichboden von Zimmer 622 lag eine Leiche.
ERSTER TEIL
Vor dem Mord
Kapitel 1
Liebe auf den ersten Blick
Zu Beginn des Sommers 2018, als ich mich ins Palace de Verbier begab, ein exquisites Hotel in den Schweizer Alpen, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich meine Ferien damit zubringen würde, ein vor Jahren in diesem Haus begangenes Verbrechen aufzuklären.
Der Aufenthalt sollte mir nach zwei kleinen persönlichen Katastrophen, die mir gerade zugestoßen waren, etwas Ablenkung bieten. Doch ehe ich Ihnen erzähle, was in jenem Sommer geschah, muss ich zunächst einmal auf den Ursprung der ganzen Geschichte zurückkommen: den Tod meines Verlegers Bernard de Fallois.
Bernard de Fallois war der Mann, dem ich alles verdankte.
Mein Erfolg, meine Bekanntheit waren sein Verdienst.
Dass man mich derSchriftsteller nannte, war sein Verdienst.
Dass man mich las, war sein Verdienst.
Als ich ihn kennengelernt hatte, war ich nichts als ein unveröffentlichter Autor gewesen. Er hatte aus mir jemanden gemacht, dessen Romane in der ganzen Welt gelesen wurden. Bernard, der immer wie ein vornehmer Patriarch gewirkt hatte, war eine der herausragenden Persönlichkeiten der französischen Verlagswelt gewesen. Für mich war er ein Vorbild und vor allem, trotz der sechzig Jahre Altersunterschied, ein guter Freund gewesen.
Bernard war im Januar 2018 verstorben, in seinem 92. Lebensjahr, und ich hatte auf seinen Tod reagiert, wie es jeder Schriftsteller tun würde: Ich begann, ein Buch über ihn zu schreiben. Ich widmete mich diesem Projekt mit Leib und Seele, zurückgezogen ins Arbeitszimmer meiner Wohnung in der Avenue Alfred-Bertrand Nr. 13 im Genfer Champel-Viertel.
Wie immer, wenn ich schrieb, duldete ich nur einen Menschen in meiner Nähe, meine Assistentin Denise. Sie war meine gute Fee. Stets guter Laune, organisierte sie meine Termine, sichtete und sortierte die Leserbriefe, las und korrigierte, was ich zu Papier gebracht hatte. Nebenbei füllte sie meinen Kühlschrank und versorgte mich mit Kaffee. Und dann übernahm sie noch die Funktion eines Bordarztes, indem sie in mein Arbeitszimmer platzte wie in die Kajüte eines Kapitäns auf großer Überfahrt und mir Ratschläge für meine Gesundheit angedeihen ließ.
»Gehen Sie doch mal raus!«, befahl sie freundlich. »Drehen Sie eine Runde durch den Park, um Ihren Kopf zu lüften. Seit Stunden hocken Sie hier drin!«
»Ich war heute Morgen schon joggen«, erinnerte ich sie.
»Ihr Hirn braucht in regelmäßigen Abständen frischen Sauerstoff!«, beharrte sie.
Es war beinahe schon ein tägliches Ritual. Ich fügte mich und ging auf den Balkon vor dem Büro. Dort füllte ich meine Lungen mit ein paar tiefen Zügen kühler Februarluft, um mir dann mit einem amüsierten und herausfordernden Blick eine Zigarette anzuzünden. Sie protestierte empört:
»Wissen Sie was, Joël, ich werde Ihren Aschenbecher nicht ausleeren. Dann sehen Sie wenigstens, wie viel Sie rauchen.«
Jeden Tag hielt ich mich an eine mönchische Routine, die ich mir in den Schreibphasen auferlegte. Sie bestand aus drei unausweichlichen Etappen: im Morgengrauen aufstehen, eine Runde laufen gehen und bis zum Abend schreiben. Indirekt machte ich die Bekanntschaft von Sloane also dank dieses Buches. Sie war meine neue Etagennachbarin. Sie war vor Kurzem eingezogen, und seitdem war sie das Lieblingsthema sämtlicher Hausbewohner. Ich für meinen Teil hatte sie noch nie gesehen. Bis zu jenem Morgen, an dem ich ihr, bei der Rückkehr von meiner täglichen Trainingseinheit, zum ersten Mal über den Weg lief. Auch sie kam gerade vom Joggen, und wir betraten gemeinsam das Gebäude. Ich verstand sofort, warum Sloane in der Nachbarschaft auf so einhellige Begeisterung stieß: Sie war eine hinreißende junge Frau. Wir grüßten einander nur höflich, dann verschwand jeder in seiner Wohnung. Ich blieb mit einem verzückten Lächeln hinter meiner Tür stehen. Diese kurze Begegnung hatte mir genügt, um mich ein bisschen in Sloane zu verlieben.
Bald hatte ich nur noch eines im Sinn: Sloane kennenzulernen.
Zuerst versuchte ich, ihr übers Laufen näherzukommen. Sloane ging beinahe jeden Tag joggen, doch zu unregelmäßigen Zeiten. Ich irrte Stunden durch den Bertrand-Park in der verzweifelten Hoffnung, sie zu treffen. Dann sah ich sie plötzlich einen Weg entlangrennen. Meist hätte ich sie nie einholen können, ich lief also stattdessen zu unserem Haus zurück, um sie am Eingang abzupassen. Vor den Briefkästen trat ich von einem Bein aufs andere, und wenn Nachbarn kamen, tat ich immer so, als wollte ich gerade die Post holen, bis Sloane endlich auftauchte. Sie ging lächelnd an mir vorbei, was mich zugleich dahinschmelzen ließ und aus der Fassung brachte. Bis mir etwas Intelligentes einfiel, was ich hätte sagen können, war sie längst in ihrer Wohnung verschwunden.
Von Madame Armanda, der Concierge des Hauses, erfuhr ich schließlich etwas mehr über Sloane. Ihre Mutter war Engländerin, der Vater Anwalt, sie selbst war Kinderärztin und zwei Jahre lang verheiratet gewesen, doch die Ehe hatte nicht funktioniert. Sie arbeitete in der Genfer Universitätsklinik, mal tagsüber, mal hatte sie Nachtdienst, was erklärte, warum es mir so schwergefallen war, ihre Routinen zu verstehen.
Nachdem das mit dem Joggen gescheitert war, beschloss ich, es anders zu probieren. Ich erteilte Denise den Auftrag, das Treppenhaus durch den Türspion zu überwachen und mir Bescheid zu geben, wenn sie sie sah. Sobald Denises Schrei ertönte (»Sie verlässt ihre Wohnung!«), stürmte ich, geschniegelt und gestriegelt, aus meinem Büro und erschien meinerseits auf dem Treppenabsatz, als wäre es reiner Zufall. Doch wir wechselten nie mehr als einen Gruß. Meist ging sie zu Fuß hinunter, was jede Konversation im Keim erstickte. Ich folgte ihr, doch wozu? Auf der Straße angekommen, verschwand sie. Die wenigen Male, die sie den Aufzug nahm, blieb ich stumm, und betretenes Schweigen breitete sich in der Kabine aus. In beiden Fällen kehrte ich anschließend unverrichteter Dinge in meine Wohnung zurück.
»Und?«, wollte Denise wissen.
»Nichts und«, maulte ich.
»Sie sind wirklich eine Niete, Joël! Nun geben Sie sich doch mal ein bisschen Mühe!«
»Ich bin eben schüchtern«, erklärte ich.
»Also bitte, erzählen Sie mir doch nichts! In den Fernsehstudios wirken Sie überhaupt nicht schüchtern!«
»Weil Sie im Fernsehen den Schriftsteller sehen. Joël dagegen ist ganz anders.«
»Hören Sie, Joël, es ist wirklich nicht so schwer: Sie klingeln an ihrer Tür, schenken ihr Blumen und laden sie zum Essen ein. Oder sind Sie nur zu faul, zum Floristen zu gehen? Soll ich mich darum kümmern?«
Und dann kam der Abend im April, in der Genfer Oper, wo ich mir allein eine Aufführung von Schwanensee ansah. Als ich in der Pause hinausging, um eine Zigarette zu rauchen, stand sie plötzlich vor mir. Wir wechselten ein paar Worte, und da die Glocke zum zweiten Akt bereits läutete, schlug sie vor, nach dem Ballett noch etwas trinken zu gehen. Wir trafen uns im Remor wieder, einem Café ganz in der Nähe. So trat Sloane in mein Leben.
Sloane war schön, witzig und intelligent. Ganz sicher eine der faszinierendsten Personen, die ich je getroffen hatte. Nach unserem Abend im Remor führte ich sie ein paarmal aus. Wir gingen ins Konzert, ins Kino. Ich schleifte sie zur Vernissage einer unsäglichen Ausstellung zeitgenössischer Kunst, die uns einen schlimmen Lachkrampf bescherte und von der wir flohen, um in einem vietnamesischen Lokal, das sie liebte, essen zu gehen. Wir verbrachten einige Abende bei ihr oder bei mir, hörten Opern, redeten und erfanden die Welt neu. Ich konnte nicht anders, als sie mit den Augen zu verschlingen. Ich fand sie einfach hinreißend. Wie sie den Blick senkte, sich die Haare aus dem Gesicht strich, lächelte, wenn sie verlegen war, mit ihren perfekt manikürten Fingern spielte, ehe sie mir eine Frage stellte … Alles an ihr gefiel mir.
Ich dachte bald nur noch an sie. Das ging so weit, dass ich vorübergehend sogar die Arbeit an meinem Buch vernachlässigte.
»Sie sind ja ganz woanders, mein armer Joël«, sagte Denise zu mir, als sie feststellen musste, dass ich keine Zeile mehr schrieb.
»Das liegt an Sloane«, erklärte ich, vor meinem ausgeschalteten Computer sitzend.
Ich wartete nur noch darauf, sie wiederzusehen und unsere endlosen Gespräche fortzusetzen. Ich hätte ihr stundenlang zuhören können, wie sie mir von ihrem Leben, ihren Leidenschaften, ihren Sehnsüchten und Zielen erzählte. Sie liebte die Filme von Elia Kazan und die Oper.
Eines Abends, nach einem Essen mit viel Wein in einer Brasserie im Pâquis-Viertel, fanden wir uns in meinem Wohnzimmer wieder. Amüsiert musterte Sloane den Nippes und die Bücher in den Wandregalen. Sie blieb lange vor einem Gemälde von Sankt Petersburg stehen, das ich von meinem Großonkel geerbt hatte. Dann inspizierte sie eingehend die Spirituosen in meiner Hausbar. Sie mochte das Relief eines Störs, das die Flasche Beluga-Wodka zierte, und ich servierte uns davon zwei Gläser auf Eis. Ich schaltete den Sender für klassische Musik ein, den ich oft abends hörte. Sie fragte mich herausfordernd, ob ich den Komponisten erraten könne, der gerade gespielt wurde. Nichts leichter als das, es war Wagner. Zum Klang der Walküre also legte sie die Arme um mich, zog mich an sich und flüsterte mir ins Ohr, dass sie mich begehre.
Unsere Liaison sollte zwei Monate dauern. Zwei wunderbare Monate. In deren Verlauf mein Buch über Bernard jedoch nach und nach wieder die Oberhand gewann. Zuerst nutzte ich die Nächte, in denen Sloane Dienst im Krankenhaus hatte, um voranzukommen. Doch je weiter der Roman gedieh, desto weniger konnte ich davon lassen. Eines Abends fragte sie mich, ob wir ausgehen wollten, und ich sagte zum ersten Mal Nein. »Ich muss schreiben«, erklärte ich. Anfangs zeigte sich Sloane absolut verständnisvoll. Auch sie hatte einen Beruf, der sie manchmal länger aufhielt als geplant.
Dann lehnte ich ein zweites Mal ab. Auch das nahm sie noch gelassen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Ich genoss jeden Augenblick, den ich mit Sloane verbrachte. Aber ich hatte das Gefühl, das mit Sloane sei für immer, unsere vertrauten Momente ließen sich unbegrenzt wiederholen. Während die Inspiration für einen Roman ebenso schnell verfliegen konnte, wie sie sich eingestellt hatte: Sie war eine Gelegenheit, die man unbedingt ergreifen musste.
An einem Abend im Juni hatten wir unseren ersten Streit, als ich, nachdem wir uns geliebt hatten, aus ihrem Bett aufstand und mich anzog.
»Wohin gehst du?«, fragte sie.
»Zu mir«, antwortete ich, als wäre es die normalste Sache der Welt.
»Du schläfst nicht bei mir?«
»Nein, ich möchte schreiben.«
»Soll das heißen, du schiebst deine Nummer und haust dann ab?«
»Ich muss mit meinem Roman weiterkommen«, erklärte ich kleinlaut.
»Aber du kannst doch nicht immer nur schreiben!«, regte sie sich auf. »Du schreibst jeden Tag, jeden Abend und sogar an den Wochenenden! Das wird langsam absurd. Mit mir unternimmst du gar nichts mehr.«
Ich spürte, dass unsere Beziehung Gefahr lief, ebenso schnell wieder in die Brüche zu gehen, wie sie begonnen hatte. Ich musste etwas tun. Und so lud ich Sloane ein paar Tage später, am Vorabend einer zehntägigen Lesereise durch Spanien, zum Essen in ihr Lieblingsrestaurant ein, den Japaner im Hôtel des Bergues, dessen Terrasse auf dem Dach des Etablissements einen atemberaubenden Blick über den gesamten Genfer Hafen bot. Es war ein traumhafter Abend. Ich versprach Sloane, weniger zu schreiben und mehr Zeit für uns zu haben, und sagte ihr immer wieder, wie viel sie mir bedeute. Wir schmiedeten sogar Urlaubspläne für August und Italien, das Land, das wir beide besonders liebten. In die Toskana oder nach Apulien? Nach meiner Rückkehr aus Spanien würden wir ein wenig recherchieren.
Wir blieben sitzen, bis das Restaurant um ein Uhr morgens geschlossen wurde. Die Frühsommernacht war warm. Während des gesamten Essens hatte ich das seltsame Gefühl gehabt, dass Sloane etwas von mir erwartete. Und tatsächlich, im Moment des Aufbruchs, als ich mich von meinem Stuhl erhob und die Angestellten begannen, um uns herum die Terrasse zu wischen, sagte Sloane:
»Du hast es vergessen, stimmt’s?«
»Was vergessen?«, fragte ich.
»Heute war mein Geburtstag …«
Als sie mein bestürztes Gesicht sah, wusste sie, dass sie recht hatte. Wütend lief sie davon. Ich versuchte, sie zurückzuhalten, entschuldigte mich tausend Mal, doch sie stieg in das einzige verfügbare Taxi vor dem Hotel und ließ mich unter den spöttischen Blicken der Wagenmeister wie einen Idioten auf der Vortreppe zurück. Bis ich mein Auto geholt und die Avenue Alfred-Bertrand Nr. 13 erreicht hatte, war Sloane längst in ihrer Wohnung, hatte das Telefon ausgeschaltet und machte auch die Tür nicht auf. Am nächsten Morgen fuhr ich nach Madrid, und während meines ganzen Aufenthalts dort blieben meine zahlreichen Nachrichten und Mails unbeantwortet. Kein Sterbenswörtchen von ihr.
Am Freitag, dem 22. Juni, kehrte ich vormittags nach Genf zurück, um zu erfahren, dass Sloane mir den Laufpass gegeben hatte.
Es war Madame Armanda, die Concierge, die mir die Botschaft überbrachte. Sie fing mich in der Haustür ab.
»Hier ist ein Brief für Sie«, sagte sie.
»Für mich?«
»Er ist von Ihrer Nachbarin. Sie wollte ihn nicht in den Briefkasten stecken, weil Ihre Assistentin doch die Post öffnet.«
Ich riss den Umschlag sofort auf. Darin fand ich nur ein paar Zeilen:
Joël,
es wird nicht funktionieren.
Bis bald.
Sloane
Diese Worte trafen mich mitten ins Herz. Mit hängendem Kopf ging ich hoch in meine Wohnung. Ich sagte mir, dass wenigstens Denise da sei, um mich in den nächsten Tagen aufzumuntern. Denise, die nette Frau, die wegen einer anderen von ihrem Mann verlassen worden war, das Sinnbild moderner Einsamkeit. Es gibt kein besseres Mittel gegen das Gefühl, einsam zu sein, als jemand, der noch einsamer ist als man selbst! Doch als ich meine Wohnung betrat, stieß ich fast mit Denise zusammen, die gerade aufzubrechen schien. Es war noch nicht mal Mittag.
»Denise, wo wollen Sie hin?«, fragte ich statt eines Grußes.
»Guten Tag, Joël. Ich hatte Ihnen doch gesagt, dass ich heute früher losmuss. Um fünfzehn Uhr geht mein Flug.«
»Ihr Flug?«
»Sagen Sie mir nicht, Sie haben es vergessen! Wir hatten vor Ihrer Abreise nach Spanien darüber geredet. Ich fliege mit Rick für vierzehn Tage nach Korfu.«
Rick war ein Typ, den Denise im Internet kennengelernt hatte. Wir hatten in der Tat über diesen Urlaub gesprochen. Das war mir komplett entfallen.
»Sloane hat mich verlassen«, verkündete ich.
»Ich weiß, es tut mir wirklich leid.«
»Wie, Sie wissen es?«
»Die Concierge hat den Brief geöffnet, den Sloane für Sie hinterlegt hat, und mir alles erzählt. Ich wollte es Ihnen nicht sagen, solange Sie in Madrid waren.«
»Und fliegen Sie trotzdem?«, fragte ich.
»Joël, ich werde wohl kaum meinen Urlaub absagen, weil Ihre Freundin mit Ihnen Schluss gemacht hat! Sie finden doch im Handumdrehen jemand Neues! Die Frauen schwärmen für Sie. Kommen Sie, wir sehen uns schon in zwei Wochen wieder. Sie werden sehen, das geht im Nu vorbei. Und außerdem habe ich für alles gesorgt. Ich war einkaufen, schauen Sie!«
Denise nahm mich rasch in die Küche mit. Als sie davon erfahren hatte, dass mit Sloane Schluss war, hatte sie meine Reaktion vorhergesehen: Ich würde mich zu Hause verkriechen. Offenbar besorgt, dass ich während ihrer Abwesenheit verhungern könnte, hatte sie beeindruckende Vorräte angelegt. Schränke und Gefriertruhe waren mit Lebensmitteln vollgestopft.
Damit verschwand sie. Und ich fand mich allein in meiner Küche wieder. Ich machte mir einen Kaffee und setzte mich an den langen Tresen aus schwarzem Marmor, an dem lauter verzweifelt leere Barhocker aufgereiht waren. Zehn Leute hätten locker in diese Küche gepasst, doch da war nur ich. Ich schleppte mich in mein Büro, wo ich lange die Fotos von Sloane und mir betrachtete. Dann nahm ich ein Stück Bristol-Papier und schrieb darauf Sloane, gefolgt von 22. 6., dem Datum dieses schrecklichen Tages, an dem sie mich verlassen hatte, und der Anmerkung ein Tag, den man vergessen sollte. Doch es war unmöglich, mir Sloane aus dem Kopf zu schlagen. Alles erinnerte mich an sie. Selbst das Sofa in meinem Wohnzimmer, auf das ich mich schließlich fallen ließ und das mir ins Gedächtnis rief, wie ich ein paar Monate zuvor genau hier, auf diesem Stoff, die außergewöhnlichste Beziehung begonnen und später dann erfolgreich an die Wand gefahren hatte.
Ich zwang mich, nicht an Sloanes Wohnungstür zu klopfen oder sie anzurufen. Am frühen Abend hielt ich es nicht länger aus und setzte mich auf den Balkon und rauchte eine Zigarette nach der anderen, in der Hoffnung, Sloane werde ebenfalls herauskommen und wir würden uns »zufällig« begegnen. Doch Madame Armanda, die mich vom Bürgersteig aus bemerkte, als sie mit ihrem Hund Gassi ging, und mich bei ihrer Rückkehr eine Stunde später noch immer auf dem Balkon sitzen sah, rief mir vom Eingang aus zu: »Es bringt nichts, zu warten, Joël. Sie ist nicht da. Sie ist in den Urlaub gefahren.«
Ich kehrte zurück in mein Arbeitszimmer. Ich verspürte den Drang, zu verreisen. Ich musste Genf für eine Weile verlassen, mich von meinen Erinnerungen an Sloane befreien, brauchte etwas Ruhe und Unbeschwertheit. In dem Moment sah ich auf meinem Schreibtisch, zwischen den Seiten über Bernard, eine Notiz zu Verbier. Er hatte diesen Ort geliebt. Der Gedanke, für eine gewisse Zeit nach Verbier zu fahren, in der Stille der Alpen wieder zu mir selbst zu finden, war verführerisch. Ich machte meinen Computer an und ging ins Internet. Dort stieß ich schnell auf die Website des Palace de Verbier, ein legendäres Hotel, von dem ich nur ein paar Fotos anzusehen brauchte, um überzeugt zu sein: die sonnige Terrasse, der Whirlpool mit Blick auf die prächtige Landschaft, die schummrige Bar, die behaglichen Salons, die Suiten mit Kamin. Das war genau die Umgebung, die ich jetzt brauchte. Ich klickte auf das Feld »Reservieren«, ehe ich in die Tasten zu hauen begann.
Und so fing alles an.
Kapitel 2
Ferien
Am Samstag, dem 23. Juni 2018, verstaute ich im Morgengrauen das Gepäck im Wagen und machte mich auf den Weg nach Verbier. Die Sonne stieg gerade über den Horizont und tauchte die menschenleeren Straßen des Genfer Stadtzentrums in ein strahlendes Orange. Nachdem ich die Mont-Blanc-Brücke überquert hatte, fuhr ich an der blühenden Uferpromenade entlang bis zum Sitz der Vereinten Nationen und dort auf die Autobahn Richtung Wallis.
Alles an diesem Sommermorgen bezauberte mich: Die Farben des Himmels erschienen mir frisch, die Landschaften, die links und rechts der Straße vorbeizogen, wirkten noch idyllischer als sonst, die kleinen, in den Weinbergen verstreuten Dörfer hoch über dem Genfer See waren das reinste Postkartenmotiv. Bei Martigny verließ ich die Autobahn und folgte der Landstraße, die sich ab Le Châble bis nach Verbier in engen Serpentinen den Berg hochwand.
Nach eineinhalb Stunden war ich am Ziel. Der Morgen hatte gerade erst begonnen. Ich durchquerte den Ort auf der Hauptstraße und brauchte mich dann nur noch von den Hinweisschildern zum Palace leiten zu lassen. Das Gebäude, ein typisches Alpen-Grandhotel mit seinen Erkern und dem ausladenden Dach, befand sich in unmittelbarer Nähe des Dorfes (nur wenige Minuten zu Fuß) und doch abseits genug, dass man sich an einem besonderen Ort fühlte. Ins Grüne gebaut, umgeben von Tannen wie von einer Wand, thronte es hoch über dem Bagnital, auf das es eine spektakuläre Aussicht bot.
Das Hotelpersonal empfing mich liebenswürdig und aufmerksam. In dieser unbeschwerten Umgebung fühlte ich mich sofort wohl. Als ich mich anmeldete, sagte der Rezeptionist: »Sie sind der Schriftsteller, nicht wahr?«
»Ja.«
»Es ist uns eine Ehre, Sie bei uns willkommen zu heißen. Ich habe all Ihre Bücher gelesen. Sind Sie hier, um Ihren neuen Roman zu schreiben?«
»Bloß nicht!«, erwiderte ich lachend. »Ich bin hier, um mich zu erholen. Urlaub, Urlaub, Urlaub!«
»Ich denke, das wird Ihnen gelingen. Sie haben eine unserer schönsten Suiten, die 623.«
Ein Page brachte mich mit meinem Gepäck in den sechsten Stock. Auf dem Weg den Flur hinunter streifte mein Blick die Zimmernummern. Verblüfft las ich ihre Abfolge: 620, 621, 621 a, 623!
»Das ist ja seltsam«, sagte ich zu dem Pagen, »gibt es kein Zimmer 622?«
»Nein«, antwortete er ohne eine weitere Erklärung.
Das Zimmer 623 war einfach hinreißend. Seine moderne Einrichtung bildete einen gelungenen Kontrast zum Ambiente des Palace. Es gab einen Wohnbereich mit gemütlicher Couch, Kamin, Schreibtisch mit Blick übers Tal und großem Balkon. Der Schlafbereich verfügte über ein riesiges Bett und einen Ankleideraum, der in ein Marmorbad mit italienischer Dusche und gewaltiger Badewanne führte.
Nachdem ich mich umgesehen hatte, kam ich noch einmal auf die Sache mit den Zimmernummern zurück, die mir keine Ruhe ließ.
»Aber warum 621 a und nicht 622?«, fragte ich den Hotelboy, der noch mit meinem Gepäck beschäftigt war.
»Sicher ein Versehen«, antwortete er ausweichend.
Ich vermochte nicht zu sagen, ob er es wirklich nicht wusste oder ob er mir etwas verschwieg. In jedem Fall schien er nicht darauf erpicht zu sein, das Gespräch fortzusetzen.
»Wünschen Sie noch irgendetwas, Monsieur? Soll ich jemanden vorbeischicken, der Ihnen den Koffer auspackt?«
»Nein, vielen Dank, das mache ich selbst«, erwiderte ich und entließ ihn mit einem Trinkgeld.
Er verschwand im Nu. Neugierig inspizierte ich den Flur: Außer meiner Nachbarsuite gab es kein anderes Zimmer »a« auf der gesamten Etage. Sehr seltsam. Doch ich zwang mich, nicht daran zu denken. Schließlich hatte ich Ferien.
Meinen ersten Urlaubstag in Verbier verbrachte ich mit einem Waldspaziergang zu einem Höhenrestaurant, wo ich zu Mittag aß und das Panorama bewunderte. Zurück im Hotel, genoss ich ein Bad im Thermalbecken, ehe ich mir Zeit für eine ausgiebige Lektüre gönnte.
Vor dem Abendessen im Restaurant des Palace trank ich einen Scotch in der Bar. Am Tresen plauderte ich mit dem Barkeeper, der jede Menge pikante Anekdoten zu den übrigen Gästen auf Lager hatte. Da sah ich sie zum ersten Mal: eine Frau in meinem Alter, sehr schön, offensichtlich allein, die sich am anderen Ende der Theke niederließ und einen Martini Dry bestellte.
»Wer ist das?«, fragte ich den Barmann, nachdem er sie bedient hatte.
»Scarlett Leonas. Sie ist seit gestern bei uns zu Gast. Sie kommt aus London. Sehr freundlich. Ihr Vater ist Lord Leonas, ein englischer Adliger, sagt Ihnen das etwas? Sie spricht aber perfekt Französisch, da erkennt man die gute Bildung. Angeblich hat sie ihren Mann verlassen und sich hierher geflüchtet.«
In den folgenden Stunden sollte ich ihr noch zweimal begegnen.
Zuerst im Restaurant des Hotels, wo wir ein paar Tische voneinander entfernt zu Abend aßen. Dann vollkommen unverhofft gegen Mitternacht, als ich zum Rauchen auf meinen Balkon ging und feststellte, dass sie im Nebenzimmer logierte. Ich glaubte mich zuerst allein in der blauschwarzen Nacht. Ich hatte aus Genf ein Foto von Bernard mitgebracht, das ich in der Hand hielt. An die Brüstung gelehnt, zündete ich mir eine Zigarette an und betrachtete wehmütig das Porträt. Plötzlich riss mich eine Stimme aus meinen Gedanken.
»Guten Abend«, hörte ich sie sagen.
Ich zuckte zusammen. Da saß sie, auf dem Balkon, der an meinen grenzte, unauffällig in einen Liegestuhl geschmiegt.
»Entschuldigen Sie, ich habe Sie erschreckt.«
»Ich hatte nicht erwartet, um diese Zeit noch jemanden zu treffen«, erwiderte ich.
Sie stellte sich vor: »Ich heiße Scarlett.«
»Ich heiße Joël.«
»Ich weiß, wer Sie sind. Sie sind der Schriftsteller. Sie sind hier in aller Munde.«
»Das ist nie ein gutes Zeichen«, bemerkte ich.
Sie lächelte. Ich hatte Lust, mich noch ein wenig mit ihr zu unterhalten, und bot ihr eine Zigarette an. Sie nahm an. Ich hielt ihr das Päckchen hin und gab ihr Feuer.
»Was führt Sie hierher, Herr Schriftsteller?«, fragte sie, nachdem sie ihren ersten Zug genommen und den Rauch genüsslich wieder ausgestoßen hatte.
»Ich musste einfach mal raus«, wich ich aus. »Und Sie?«
»Ich musste auch einfach mal raus. Ich habe mein Leben in London verlassen, meine Arbeit, meinen Mann. Ich brauche einen Tapetenwechsel. Wer ist das auf dem Foto?«
»Mein Verleger, Bernard de Fallois. Er ist vor sechs Monaten gestorben. Er hat mir sehr viel bedeutet.«
»Mein Beileid.«
»Danke. Ich merke, dass es mir schwerfällt, ein neues Kapitel zu beginnen.«
»Das ist ärgerlich für einen Schriftsteller.«
Ich zwang mich zu einem Lächeln, doch meine kummervolle Miene entging ihr nicht.
»Verzeihen Sie«, entschuldigte sie sich. »Ich wollte witzig sein, aber das ging daneben.«
»Machen Sie sich keine Gedanken. Bernard ist im Alter von zweiundneunzig Jahren gestorben, es war mehr als sein gutes Recht zu gehen. Ich muss mich wohl damit abfinden.«
»Trauer kennt keine Regeln.«
Das stimmte allerdings.
»Bernard war ein großartiger Verleger«, sagte ich. »Aber er war noch viel mehr als das. Er war ein großartiger, in jeder Hinsicht überragender Mensch, der während seiner Laufbahn in der Verlagsbranche mehrere Leben hatte. Er war Literat und Gelehrter und außerdem ein gewiefter Geschäftsmann von besonderem Charisma und außergewöhnlicher Überzeugungskraft: Wäre er Anwalt gewesen, hätten seine Anwaltskollegen keine Klienten mehr gehabt. Eine Zeit lang war Bernard der gefürchtete und geachtete Chef der bedeutendsten französischen Verlagsgruppen, gleichzeitig stand er den Philosophen und Intellektuellen der Stunde sowie politischen Machthabern nahe. In der letzten Phase seines Lebens, nachdem er über Paris geherrscht hatte, setzte er sich zur Ruhe, ohne ein Jota seiner Aura einzubüßen. Er schuf einen kleinen Verlag ganz nach seinem Bild: bescheiden, diskret, anspruchsvoll. Das war der Bernard, den ich persönlich kennengelernt habe, als er mich unter seine Fittiche nahm. Genial, neugierig, fröhlich, strahlend. Er war der Lehrmeister, von dem ich immer geträumt hatte. Ein brillanter, geistreicher, lebhafter und tiefsinniger Gesprächspartner. Sein Lachen lehrte mich Weisheit. Nichts Menschliches lag ihm fern. Er war eine Inspiration fürs Leben, ein leuchtender Stern in der Nacht.«
»Bernard scheint wirklich ein außerordentlicher Mensch gewesen zu sein«, sagte Scarlett.
»Das war er«, versicherte ich ihr.
»Schriftsteller ist aber auch ein faszinierender Beruf …«
»Das dachte meine letzte Freundin auch, bis sie sich auf eine Beziehung mit mir einließ.«
Scarlett lachte. »Ich dachte es wirklich«, sagte sie. »Ich meine: Jeder träumt doch davon, einen Roman zu schreiben.«
»Da bin ich mir nicht so sicher.«
»Ich auf jeden Fall.«
»Dann legen Sie los!«, ermunterte ich sie. »Sie brauchen nur einen Stift und Papier, und schon tut sich eine wunderbare Welt vor Ihnen auf.«
»Ich wüsste nicht, wie ich es anfangen soll, woher ich überhaupt die Idee zu einem Roman nehmen sollte.«
Meine Zigarette war aufgeraucht. Ich wollte gerade wieder in mein Zimmer gehen, da hielt sie mich zurück, was ich mir gern gefallen ließ.
»Wie finden Sie die Ideen zu Ihren Romanen?«, fragte sie.
Ich überlegte einen Moment, ehe ich antwortete:
»Die Leute denken oft, das Schreiben eines Romans würde mit einer Idee beginnen. Dabei beginnt ein Roman vor allem mit einem Drang: dem Drang zu schreiben. Einem Drang, der Sie packt und nicht mehr loslässt, der Sie von allem anderen abhält. Dieses fortwährende Bedürfnis zu schreiben nenne ich die Krankheit der Schriftsteller. Sie können das beste Szenario für einen Roman haben, wenn Sie keine Lust haben, ihn zu schreiben, werden Sie nichts damit anfangen.«
»Und wie erschafft man so ein Szenario?«, fragte Scarlett.
»Ausgezeichnete Frage, Dr. Watson. Das ist ein typischer Fehler, den Autoren anfangs oft begehen. Sie glauben, eine Romanhandlung bestünde aus miteinander verknüpften Fakten. Man denkt sich eine Figur aus, wirft sie in eine Situation und so weiter.«
»Ganz genau«, gestand Scarlett. »Ich hatte übrigens die Idee zu folgender Geschichte: Eine junge Frau heiratet und bringt in der Hochzeitsnacht ihren Mann im Hotelzimmer um. Aber es ist mir nie gelungen, die Idee weiterzuentwickeln.«
»Weil Sie einfach nur Tatsachen zusammenfügen, wie ich Ihnen schon gesagt habe. Doch ein Szenario, das Neugier weckt, muss aus Fragen bestehen. Beginnen Sie damit, den Handlungsfaden aus Fragen zu spinnen: Warum tötet eine junge Braut ihren Mann in der Hochzeitsnacht? Wer ist diese Braut? Wer ist ihr Mann? Was haben sie für eine Beziehung? Warum haben sie geheiratet? Wo haben sie geheiratet?«
Scarlett antwortete schlagfertig: »Der Mann war unermesslich reich, doch ein erbärmlicher Geizhals. Sie wollte heiraten wie eine Prinzessin, mit weißen Schwänen und Feuerwerk, und am Ende bekam sie ein Fest zum Schleuderpreis in einem schäbigen Gasthof. Rasend vor Wut, hat sie ihren Mann schließlich umgebracht. Sollte bei dem Prozess eine Richterin den Vorsitz führen, so wird sie sicher mildernde Umstände bekommen, denn es gibt nichts Schlimmeres als einen knausrigen Ehemann.«
Ich lachte laut auf. »Sehen Sie«, sagte ich, »allein Ihr anfängliches Szenario als Fragen zu formulieren, eröffnet eine endlose Fülle an Möglichkeiten. Indem Sie die Fragen beantworten, stellen sich die Figuren, die Schauplätze und Handlungen ganz von selbst ein. Sie haben bereits eine erste Skizze des Bräutigams und der Braut entworfen. Sie haben die Handlung sogar schon weitergesponnen, indem Sie an den Prozess gedacht haben. Geht es letztendlich um den Mord? Oder um den Prozess gegen die Frau? Wird sie freigesprochen? Die Magie des Schreibens besteht darin, dass eine simple Tatsache, egal welche, sobald man sie in Fragen übersetzt, die Tür zu einem Roman aufstößt.«
»Wirklich jede beliebige Tatsache?«, warf mir Scarlett in skeptischem Ton wie eine Herausforderung hin.
»Jede beliebige. Nehmen wir ein ganz konkretes Beispiel. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie das Zimmer 621 a, nicht wahr?«
»Genau«, bestätigte Scarlett.
»Und ich habe das Zimmer 623. Und das Zimmer vor Ihrem ist die 621. Ich habe auf dem gesamten Stockwerk nachgesehen: Zimmer 622 existiert nicht. So weit die Tatsache. Aber warum gibt es im Palace de Verbier ein Zimmer 621 a statt des Zimmers 622? Das ist ein mögliches Szenario. Und der Beginn eines Romans.«
Scarlett lächelte übers ganze Gesicht. Sie fand Gefallen an der Sache. »Aber Achtung«, wandte sie sofort ein, »es könnte eine rationale Begründung dafür geben. Manche Hotels verzichten zum Beispiel aus Rücksicht auf abergläubische Gäste auf ein Zimmer Nummer 13.«
»Wenn es eine direkte rationale Erklärung gibt«, sagte ich, »dann gibt es kein Szenario und damit auch keinen Roman. Hier kommt der Autor ins Spiel: Damit ein Roman entsteht, muss er die Mauern der Rationalität ein wenig beiseiteschieben, sich der Realität entledigen und vor allem ein Motiv schaffen, wo keines ist.«
»Wie würden Sie es im Fall dieses Hotelzimmers anstellen?«, fragte Scarlett, nicht sicher, ob sie ganz folgen konnte.
»In dem Roman würde der Schriftsteller auf der Suche nach einer Erklärung den Hotelportier befragen.«
»Na, dann los!«, schlug sie vor.
»Jetzt?«
»Natürlich jetzt!«
»Das Zimmer 622 ist das Markenzeichen dieses Hotels«, erklärte uns der Portier, amüsiert darüber, dass wir zu so später Stunde aufkreuzten, um ihm diese Frage zu stellen. »Als das Hotel gebaut wurde, brachte man das Schild mit der Nummer 621 versehentlich an zwei Türen an. Man hätte nur eins der Schilder durch ein anderes mit der Nummer 622 ersetzen müssen, und alles wäre in Ordnung gewesen. Doch der damalige Eigentümer, Edmond Rose, ein kluger Geschäftsmann, zog es vor, der Nummer 621 ein a hinzuzufügen, und so wurde daraus das Zimmer 621 a. Natürlich weckte das die Neugier der Gäste, die dieses Zimmer öfter verlangten als ein anderes, überzeugt davon, es sei etwas Besonderes daran. Der Trick funktioniert bis heute. Schließlich sind Sie mitten in der Nacht zu mir gekommen, um mich zu dem berühmten Zimmer zu befragen.«
Zurück in der sechsten Etage sagte Scarlett:
»Dann ist dieses Zimmer 621 a also nur ein Versehen.«
»Nicht für den Schriftsteller«, erinnerte ich sie. »Sonst würde die Geschichte hier enden. In dem Roman lügt der Portier, damit die Handlung weitergeht. Warum lügt der Portier? Was hat es in Wahrheit mit diesem geheimnisvollen Zimmer 621 a auf sich? Was ist geschehen, das die Leute vom Hotel verbergen müssen? So kann man, ausgehend von einem simplen Umstand, eine Idee entwickeln.«
»Und jetzt?«, fragte Scarlett.
»Und jetzt«, sagte ich scherzhaft, »sind Sie dran mit graben. Ich gehe ins Bett.«
Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, dass ich mir soeben meine Ferien ruiniert hatte.
Am nächsten Morgen um neun wurde ich von lautem Klopfen an meiner Zimmertür aus dem Bett gerissen. Ich öffnete, es war Scarlett.
Sie wunderte sich über mein verschlafenes Gesicht. »Habe ich Sie etwa geweckt, Herr Schriftsteller?«
»Ja, ich bin im Urlaub. Sie wissen schon, diese Erholungsphase, in der einen alle in Ruhe lassen.«
»Nun, Ihr Urlaub ist beendet«, verkündete sie mir, während sie mit einem dicken Buch unter dem Arm mein Zimmer betrat. »Denn ich habe die Antwort auf die Frage nach Ihrem möglichen Szenario: Warum gibt es im Palace de Verbier ein Zimmer 621 a anstelle des Zimmers 622? Weil dort ein Mord verübt wurde!«
»Was? Woher wissen Sie das?«
»Ich bin heute früh in eines der Cafés im Ort gegangen, um die Dorfbewohner zu befragen. Gleich mehrere Leute haben mir davon erzählt. Könnte ich einen Kaffee bekommen?«
»Wie bitte?«
»Kaffee, please! Neben der Minibar gibt es eine Espressomaschine. Sie legen eine Kapsel ein, drücken auf den Knopf, und schon rinnt der Kaffee in die Tasse. Sie werden sehen, es ist die reinste Magie!«
Ich war ganz hingerissen von Scarlett. Ich tat sofort, wie mir geheißen, und bereitete zwei Espressi zu.
»Das heißt noch lange nicht, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Mord und diesem merkwürdigen Zimmer 621 a gibt«, wandte ich ein, während ich ihr eine Tasse reichte.
»Sehen Sie sich erst mal an, was ich gefunden habe.«
Sie schlug das Buch auf, das sie mitgebracht hatte. Ich setzte mich neben sie.
»Was ist das?«
»Ein Buch über die Geschichte des Palace«, erklärte sie, wobei sie die Seiten durchblätterte. »Gefunden im Buchladen des Ortes.«
Bei der Abbildung eines Grundrisses des Hotels hielt sie inne und tippte mit dem Finger darauf.
»Das ist der sechste Stock«, sagte sie. »Ein ziemlicher Glücksfall, immerhin! Sehen Sie, hier ist der Flur, und da stehen die Nummern der einzelnen Suiten. Eine logische Abfolge, schauen Sie! Und die 622 gibt es sehr wohl, zwischen der 621 und der 623.«
Konsterniert stellte ich fest, dass Scarlett recht hatte.
»Was denken Sie?«, fragte ich, sicher, dass sie bereits ihre Schlussfolgerungen gezogen hatte.
»Dass der Mord im Zimmer 622 verübt wurde und dass die Hotelleitung die Erinnerung daran vertuschen wollte.«
»Das ist nur eine Hypothese.«
»Die wir überprüfen werden. Haben Sie ein Auto?«
»Ja, warum?«
»Dann mal los, Herr Schriftsteller!«
»Wie, dann mal los? Wo wollen Sie denn hin?«
»Zum Archiv des Nouvelliste, der großen Tageszeitung hier in der Gegend.«
»Es ist Sonntag«, bemerkte ich.
»Ich habe in der Redaktion angerufen. Sie sind sonntags da.«
Scarlett gefiel mir. Aus diesem Grund begleitete ich sie nach Sitten, etwa eine Stunde Wegs entfernt, wo sich der Sitz des Nouvelliste befand.
Die Dame am Empfangstresen informierte uns darüber, dass nur Abonnenten Zugang zum Archiv hätten.
»Dann müssen wir die Zeitung wohl abonnieren«, verkündete Scarlett, wobei sie mich mit dem Ellbogen anstieß.
»Wie, warum ich?«, protestierte ich.
»Kommen Sie, Herr Schriftsteller, wir haben keine Zeit herumzudiskutieren, abonnieren Sie die Zeitung, bitte!«
Ich gehorchte und zückte meine Kreditkarte, und schon durften wir das Archiv betreten. Ich hatte mir einen staubigen Keller vorgestellt, vollgestopft mit Tausenden von alten Zeitungen. Tatsächlich war es ein kleiner Raum, in dem vier Computer standen. Alles war inzwischen digitalisiert, was uns das Leben sehr erleichterte. Scarlett brauchte nur ein paar Schlagwörter einzugeben, um eine Reihe von Artikeln zu finden. Sie klickte den ersten an und stieß einen Triumphschrei aus. Die Meldung zierte die Titelseite des Blattes. Man sah ein Foto des Palace de Verbier mit Polizeiautos davor und dazu die folgende Schlagzeile:
Mord im Palace
Am gestrigen Sonntag, dem 16. Dezember, wurde im Zimmer 622 des Palace de Verbier ein Mann ermordet aufgefunden. Ein Hotelangestellter hatte die Leiche des Opfers entdeckt, als er ihm das Frühstück bringen wollte.
Kapitel 3
Wie alles begann
Sonntag, 9. Dezember, 7 Tage vor dem Mord
Das Flugzeug saß in Madrid auf der Startbahn fest. Über Lautsprecher hatte der Kapitän durchgegeben, dass heftige Schneefälle in Genf eine vorübergehende Schließung des Flughafens notwendig machten, bis das Rollfeld freigeräumt wäre. Eine Sache von höchstens einer halben Stunde, dann könne die Maschine abfliegen.
Was für die meisten Passagiere an Bord nur eine kleine Unannehmlichkeit ohne nennenswerte Folgen war, schien Macaire Ebezner, Fluggast der Businessclass in der ersten Reihe, größere Sorgen zu bereiten. Den Blick starr aufs Bullauge gerichtet, kippte er in zwei Zügen das Glas Champagner hinunter, das die Stewardess ihm gereicht hatte, um die Wartezeit zu überbrücken. Er war nervös. Irgendetwas stimmte nicht. Er war überzeugt, dass das Flugzeug nicht wegen des Schnees am Boden blieb: Sie hatten ihn gefunden. Sie würden ihn an Bord dieser Maschine schnappen. Das spürte er. Er saß in der Falle wie eine Ratte. Ohne einen Ausweg. Während er durchs Fenster auf die Rollbahn spähte, sah er plötzlich ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht angerast kommen. Sein Puls beschleunigte sich. Er war geliefert.
—
Am Vortag, im Madrider Salamanca-Viertel.
Macaire und Perez kamen nachmittags aus der Metro-Station Serrano. Sie hatten gerade den Informanten identifiziert und die Dokumente aus seiner Wohnung entwendet, ehe sie sich unauffällig mit der Metro aus dem Staub gemacht hatten. Doch beim Verlassen des Waggons hatte Perez plötzlich das Gefühl, dass ihnen jemand folgte. Als sie die Treppen zur Straße hochstiegen, bekam er die Bestätigung.
»Nicht umdrehen«, raunte er Macaire zu. »Da sind zwei Typen, die wir seit vorhin an den Hacken haben.«
Sein Ton sagte Macaire, dass es vorbei war. Dabei hatten sie doch gelernt, auf jede Kleinigkeit zu achten. Ihr Mangel an Wachsamkeit würde sie teuer zu stehen kommen. Macaire spürte, wie das Adrenalin in seine Adern schoss.
»Geh du rechts rum«, sagte Perez da. »Ich gehe nach links. Wir treffen uns später in der Wohnung wieder.«
»Ich lass dich nicht allein!«
»Los jetzt!«, befahl Perez. »Tu, was ich dir sage! Schließlich hast du die Liste.«
Sie trennten sich. Macaire bog rechts ab und ging schnell die Straße entlang. Er bemerkte ein Taxi am Bordstein, das gerade einen Fahrgast abgesetzt hatte, und sprang hinein. Als es losfuhr, drehte Macaire sich um: Perez war verschwunden.
An der Puerta del Sol ließ Macaire sich absetzen und mischte sich unter den Strom der Touristen. Er betrat eine Modeboutique, aus der er komplett neu eingekleidet wieder herauskam, für den Fall, dass man seine Personenbeschreibung durchgegeben hätte. Da er nicht wusste, was er tun sollte, rief er schließlich die Notfallnummer an. In zwölf Jahren war es das erste Mal, dass er sie benutzte. Er fand eine Telefonzelle in der Nähe des Retiro und wählte die Zahlenfolge, die er auswendig gelernt hatte. Nachdem er sich identifiziert hatte, stellte der Telefonist ihn zu Wagner durch, der ihm die schlechte Nachricht verkündete:
»Perez ist von der spanischen Polizei verhaftet worden. Aber sie haben nichts gegen ihn in der Hand, er kommt wieder frei. Außerdem hat er einen Diplomatenpass.«
»Ich habe die Liste«, sagte Macaire daraufhin. »Es war tatsächlich unser Mann.«
»Perfekt. Verbrennen Sie die Liste und halten Sie sich an das Protokoll. Gehen Sie wieder in die Wohnung, fliegen Sie morgen wie vorgesehen nach Genf zurück. Keine Sorge, es wird alles gut gehen.«
»In Ordnung«, erwiderte Macaire.
Ehe Wagner auflegte, bemerkte er in beinahe amüsiertem Ton, der nicht zum Ernst der Lage passte:
»Ach, und da ich Sie schon mal an der Strippe habe: Sie sind in der Zeitung. Es ist offiziell.«
»Ich weiß«, antwortete Macaire, etwas irritiert von der Unbekümmertheit seines Gesprächspartners.
»Bravo!«
Dann war die Verbindung abrupt weg. Entsprechend den gerade erhaltenen Anweisungen kehrte Macaire unter den gebotenen Vorsichtsmaßnahmen zum Appartement zurück und verbrannte die Liste. Er bereute es zutiefst, diese Reise angetreten zu haben, die die letzte sein sollte. Er fürchtete, es könnte die eine zu viel gewesen sein. Er hatte so viel zu verlieren: seine Frau, sein traumhaftes Leben und die Beförderung, die ihn erwartete. In einer Woche wäre er Präsident der Familienbank, einer der bedeutendsten Schweizer Privatbanken. Eine Indiskretion war zur Wochenendausgabe der Tribune de Genève durchgesickert, die heute erschienen war. Er hatte Glückwünsche aus der ganzen Welt erhalten, nur nicht von seiner Frau Anastasia. Sie war in der Schweiz geblieben, denn wie immer bei dieser Art von Reisen hatte er dafür gesorgt, dass sie nicht mitkam.
—
Auf der Startbahn des Madrider Airports fuhr das Polizeiauto am Flugzeug vorbei und setzte seinen Weg fort, ohne anzuhalten. Blinder Alarm. Erleichtert ließ Macaire sich in seinen Sitz zurückfallen. Plötzlich ruckte die Maschine und begann, langsam Richtung Startbahn zu rollen.
Als sich der Flieger wenige Minuten später endlich in die Lüfte erhob, stieß Macaire, der sich nun in Sicherheit fühlte, einen tiefen Seufzer aus. Er bat um einen Wodka und Erdnüsse, dann schlug er das Exemplar der Tribune de Genève auf, das er sich aus der Auswahl an Bord angebotener Zeitungen herausgefischt hatte. Auf der ersten Seite des Wirtschaftsteils entdeckte er sein Foto.
Macaire Ebezner wird am Samstag zum Präsidenten des Bankhauses Ebezner ernannt
Es gibt keinen Zweifel mehr: Macaire Ebezner, 41, wird die Zügel der bedeutendsten Schweizer Privatbank, deren Alleinerbe er ist, übernehmen. Das wurde von einem einflussreichen Mitglied der Bank, das ungenannt bleiben möchte, indirekt bestätigt. »Nur ein Ebezner kann das Bankhaus Ebezner leiten«, hatte es versichert.
Er bestellte einen weiteren Wodka, der ihn umhaute, und schlief ein.
Er dachte, er habe nur einen Moment die Augen zugemacht, doch als er wieder erwachte, befand sich das Flugzeug bereits im Landeanflug. Man sah den fein ziselierten Umriss des Genfer Sees und die Lichter der Stadt. Es schneite heftig, Flocken wirbelten durch die Luft. Der Winter war früh dran, und die Schweiz lag unter einer weißen Decke. Die Maschine aus Madrid war eine der ersten, die nach einer längeren wetterbedingten Unterbrechung des Luftverkehrs wieder am Genfer Flughafen landeten.
Es war 21 Uhr 30, als der Flieger auf der frisch geräumten Rollbahn aufsetzte. Nach dem Aussteigen durchquerte Macaire mit seinem Köfferchen in der Hand rasch die langen Gänge des Terminals, das er in- und auswendig kannte. Mit ungezwungener Miene verließ er den Ankunftsbereich. Die Zollbeamten, an denen er vorbeiging, stellten ihm keine Fragen.
Da der Schnee in der letzten Stunde den Flugbetrieb lahmgelegt hatte, wartete am Ausgang des Flughafens eine lange Taxischlange auf die vereinzelten Kunden. Macaire setzte sich in den vordersten Wagen. Der Fahrer hinter dem Lenkrad legte sofort die Zeitung beiseite, die er gerade durchgeblättert hatte.
»Chemin de Ruth, Cologny«, sagte Macaire.
Der Fahrer musterte seinen Gast im Rückspiegel neugierig und fragte dann, während er mit seinem Exemplar der Tribune de Genève wedelte: »Das sind Sie da, in der Zeitung, nicht wahr?«
Macaire lächelte, geschmeichelt, dass man ihn erkannte. »Ja, das bin ich.«
»Es ist mir eine große Ehre, Monsieur Ebezner«, sagte der Fahrer mit bewunderndem Blick. »Schließlich habe ich nicht alle Tage einen Star der Finanzwelt an Bord.«
Macaire, der sich selbst in der Scheibe betrachtete, konnte sich ein zufriedenes Lächeln nicht verkneifen. Er war auf dem Gipfel seiner Bankierskarriere angelangt. Vergessen war die Anspannung von Madrid: Er war aus dem Schneider, und ihm stand eine glänzende Zukunft bevor. Er konnte es kaum erwarten, morgen in die Bank zu gehen. Zu sehen, was sie alle für Gesichter machen würden! Auch wenn sein Aufstieg zum Präsidenten im Grunde seit Monaten feststand, würde dieser Artikel für Aufsehen sorgen. Von morgen an würde alle Welt vor ihm katzbuckeln. Nur noch ein paar Tage Geduld: Samstagabend, anlässlich des alljährlichen Bank-Wochenendes in Verbier, würde er an die Spitze des namhaften Geldinstituts gewählt werden.
Das Taxi fuhr die Rue de la Servette hinunter, dann die Rue de Chantepoulet und über die Mont-Blanc-Brücke. Die Ufer des Genfer Sees glitzerten. Die große Wasserfontäne Jet d’eau, stolzer Federbusch der Stadt, erhob sich majestätisch inmitten der Flocken. Genf im Schnee und in seiner Weihnachtsbeleuchtung sah märchenhaft aus. Alles wirkte so ruhig und friedlich.
Der Wagen fuhr nun auf den Quai du Général-Guisan und weiter nach Cologny, eines der vornehmsten Viertel der Stadt, wo Macaire und seine Frau Anastasia in einem traumhaften Anwesen mit Blick über den Genfer See lebten.
Und dort, in der Küche der Ebezners, kostete die Hausangestellte Arma den Kalbsbraten, den sie seit Stunden liebevoll schmoren ließ. Er war perfekt. Sie betrachtete noch einmal voller Bewunderung den Zeitungsartikel, den sie neben sich auf die Arbeitsplatte gelegt hatte, damit er ihr Gesellschaft leistete. Es war offiziell: Moussieu würde am kommenden Samstag zum Präsidenten der Bank ernannt werden! Sie war so stolz auf ihn. Sie hatte eigentlich an den Wochenenden frei, doch als sie am Vortag in ihrem Stammcafé den Artikel entdeckt hatte, hatte sie beschlossen, ihn bei seiner Rückkehr aus Madrid zu empfangen. Sie wusste, dass er allein sein würde, weil seine Frau das Wochenende bei einer Freundin verbrachte (Médém Anastasia blieb nicht gern in dem großen Haus, wenn ihr Mann auf Geschäftsreise war). Arma fand es traurig, dass niemand da sein sollte, um eine so große Neuigkeit mit ihm zu feiern, wenn er heimkäme.
Als sie die Scheinwerfer des Taxis bemerkte, das aufs Grundstück fuhr, stürzte sie ungeachtet des Schneegestöbers ohne Mantel hinaus, um ihren Chef willkommen zu heißen.
»Sie sind in der Zeitung!«, rief sie stolz und hielt Macaire, der aus dem Taxi stieg, den Artikel vor die Nase.
»Arma«, wunderte er sich, »was tun Sie denn hier am Sonntag?«
»Ich wollte nicht, dass alles dunkel ist und kein ordentliches Essen auf dem Tisch steht, wenn Sie nach Hause kommen.«
Er schenkte ihr ein warmes Lächeln.
»Präsident, jetzt ist es also offiziell!«, jubelte Arma.
Sie ergriff die Aktentasche, die der Fahrer aus dem Kofferraum holte, und folgte dann ihrem Chef ins Haus, während das Taxi davonrollte.
Kaum hatte der Wagen das Tor des ebeznerschen Anwesens hinter sich gelassen, tauchte im Scheinwerferlicht ein Mann auf. Der Fahrer hielt an und ließ die Scheibe herunter. »Ich habe alles genau so gemacht, wie Sie es mir gesagt haben«, teilte er dem Mann mit, der sich nicht um den unablässig fallenden Schnee zu kümmern schien.
»Haben Sie ihm den Artikel gezeigt?«, fragte er.
»Ja, ich habe Ihre Anweisungen aufs Wort befolgt«, beteuerte der Fahrer, der seine Belohnung erwartete. »Ich habe so getan, als würde ich ihn erkennen, genau wie Sie es mir aufgetragen haben.«
Der Mann machte ein zufriedenes Gesicht und reichte dem Chauffeur ein Bündel Hundertfrankenscheine, der daraufhin sofort losfuhr.
Im Haus saß Macaire am Küchentisch und ließ sich von Arma eine schöne Scheibe Braten servieren. Er war beunruhigt. Hauptsächlich wegen Anastasia. Er hatte ihr eine Nachricht geschrieben, um ihr zu sagen, dass er gut in Genf angekommen sei. Sie hatte ihm lakonisch geantwortet:
Schön, dass Du eine gute Reise hattest.
Glückwunsch zum Artikel in der Tribune.
Komme morgen wieder, es ist vernünftiger, nicht Auto zu fahren, bei all dem Schnee.
Während Macaire die Nachricht noch einmal las, fragte er sich, wer hier wen anlog. Er jedenfalls log sie seit zwölf Jahren an. Seit zwölf Jahren brannte ihm sein Geheimnis auf der Seele.
Arma riss ihn aus seinen Grübeleien. »Ich freue mich so für Sie«, sagte sie. »Als ich den Artikel gesehen habe, hätte ich beinahe angefangen zu weinen. Präsident der Bank! In Madrid waren Sie wegen der Arbeit?«
»Ja«, log Macaire.
Er schien mit den Gedanken ganz woanders zu sein und beachtete Arma gar nicht. Schließlich ging sie ihre Töpfe schrubben, wütend auf sich selbst. Wie dumm war sie gewesen, heute Abend herzukommen! Sie hatte gedacht, er werde sich darüber freuen. Es sei eine Gelegenheit, einen besonderen Moment miteinander zu teilen. Doch das interessierte ihn überhaupt nicht. Er hatte nicht mal bemerkt, dass sie beim Friseur gewesen war und sich die Nägel lackiert hatte. Sie beschloss, nach Hause zu gehen.
»Wenn Sie mich nicht mehr brauchen, Moussieu, dann würde ich jetzt gehen.«
»Natürlich, ab mit Ihnen, und danke für das köstliche Abendessen. Ohne Sie wäre ich mit leerem Magen ins Bett gegangen. Sie sind ein Schatz. Apropos, denken Sie daran, dass ich Sie das ganze nächste Wochenende hier brauche?«
»Das nächste Wochenende?«, presste Arma hervor.
»Ja, Sie wissen doch, es ist das Große Bank-Wochenende, zu dem die Ehepartner nicht eingeladen sind. Ich habe Skrupel, Anastasia schon wieder ganz allein zu lassen. Zwei Wochenenden hintereinander, das ist zu viel … Sie wissen, wie sehr sie es hasst, allein in diesem großen Haus zu sein. Sie könnten sogar in einem der Gästezimmer schlafen, das würde sie sehr beruhigen.«
»Aber Sie hatten mir ab kommendem Freitag Urlaub gegeben«, erinnerte Arma ihn. »Ich hatte vor, bis Montag wegzufahren.«
»Ach, verflixt, das hatte ich vollkommen vergessen! Können Sie das absagen? Bitte, es ist mir sehr wichtig, zu wissen, dass jemand hier bei Anastasia ist. Und außerdem wird sie vielleicht Freundinnen einladen wollen, da wäre es gut, Sie wären hier, um zu kochen und den Haushalt zu besorgen. Ich zahle Ihnen das Doppelte für jede Stunde, die Sie von Freitag bis Sonntagabend hier verbringen.«
Alles Gold der Welt hätte sie nicht überzeugen können. Dieses Wochenende bedeutete ihr sehr viel. Doch da sie außerstande war, ihrem Chef etwas abzuschlagen, sagte sie wider Willen trotzdem Ja.
Als Arma gegangen war, zog Macaire sich in den kleinen Salon zurück, ein Zimmer im Erdgeschoss, das ihm als Büro diente. Er nahm ein Gemälde von der Wand (ein Aquarell von Genf), hinter dem sich ein kleiner Tresor verbarg, dessen Zahlenkombination nur er kannte. Daraus holte er ein Heft hervor. Vor ein paar Wochen hatte er begonnen, sein Geheimnis niederzuschreiben. Für den Fall der Fälle. Damit jemand davon erführe. In der letzten Zeit hatte er sich beobachtet gefühlt. Überwacht. Die Ereignisse von Madrid schienen ihm recht zu geben. Seit zwölf Jahren war er enorme Risiken eingegangen. Irgendwo die Wahrheit zu hinterlassen, könnte sich als nützlich erweisen.
Er blätterte das Heft durch. Auf den ersten Seiten fanden sich nur Zahlenkolonnen und Geldbeträge, wie in einem Rechnungsbuch. Vielleicht unversteuerte Einnahmen, könnte man denken, falls das Heft in die falschen Hände fiele. Doch das war nur Tarnung. Die folgenden Seiten schienen leer zu sein, waren jedoch vollgeschrieben mit seinen Bekenntnissen. Für alle Fälle verfasste Macaire sie mit unsichtbarer Tinte. Dieser Trick war so alt wie die Menschheit, doch er funktionierte noch immer: Dank eines absichtlich nicht mit Tinte gefüllten Federhalters, dessen Spitze er in eine Mischung aus Wasser und Zitronensaft tauchte, wurde alles, was er schrieb, sofort vom Papier verschluckt. Die Seiten blieben weiß, obwohl sie ganz mit Schrift bedeckt waren. Sollte Macaire seinen Bericht eines Tages lesen wollen, genügte es, das Papier in die Nähe einer Licht- und Wärmequelle zu halten, und sofort würde der Text sichtbar werden.
Zu Anfang war es etwas mühsam gewesen, doch mit der Zeit bekam er Übung und wurde geschickter. Selbst ohne die Worte zu sehen, schrieb Macaire sehr leserlich. Er öffnete sein Heft, suchte die letzte beschriebene Seite, die er am Eselsohr erkannte, und tunkte seine Feder in die Schale mit dem Zitronensaft. Den im Dunkeln verborgenen Schatten, wenige Meter von ihm entfernt, bemerkte er nicht: Ein Mann beobachtete ihn heimlich durchs Fenster des Salons.
Reglos stand der Mann dort über eine Stunde und sah Macaire zu. Er sah ihn schreiben, dann das Heft zurück in den Tresor hinter dem Gemälde räumen, ehe er das Zimmer verließ, zweifellos, um schlafen zu gehen, angesichts der vorgerückten Stunde.
Der Mann verschwand in der Nacht. Leise und unsichtbar stahl er sich über die Mauer des Anwesens davon. Der beständig fallende Schnee würde seine Spuren zudecken. Auf dem Chemin de Ruth stieg der Mann in einen am Straßenrand geparkten Wagen. Alles war wie ausgestorben. Er startete und fuhr ein paar Minuten lang, bis er weit genug weg war, dann hielt er an, um zu telefonieren.
»Er ist nach Hause zurückgekehrt und ahnt nichts«, berichtete er seinem Gesprächspartner. »Ich habe sogar dafür gesorgt, dass ein Taxifahrer ihn auf den Artikel anspricht.«
»Sehr gute Idee, bravo!«
»Wie haben Sie es geschafft, diese Meldung in die Zeitung zu bringen? Mit einem Foto obendrein!«
»Ich habe meine Verbindungen. Der Arme, das gibt morgen ein böses Erwachen für ihn!«
Einen Kilometer entfernt wurde die Fassade des Hauses Ebezner bald ganz dunkel. Den ruhmreichen Artikel neben sich, schlief Macaire in seinem großen Bett den Schlaf des Gerechten. Noch nie war er so glücklich gewesen.
Er hatte keine Ahnung, dass die Scherereien gerade erst begannen.
Kapitel 4
Aufregung
Montag, 10. Dezember, 6 Tage vor dem Mord
6 Uhr 30 morgens. Als das Klingeln des Weckers ihn aus dem Schlaf riss, brauchte Macaire ein paar Sekunden, ehe ihm wieder einfiel, dass er zu Hause war. Im ersten Moment war er bei der Erinnerung an die Ereignisse in Madrid hochgeschreckt. Dann, sobald ihm bewusst wurde, dass er daheim und in Sicherheit war, durchströmte ihn ein Gefühl der Erleichterung. Es war alles in bester Ordnung.
Er hatte die Klappläden offen gelassen. Durchs Fenster sah er, dass es draußen noch stockfinster war und heftig schneite. Er hatte nicht die geringste Lust auf diese eisigen Temperaturen. Unter seine Decke gekuschelt, entschied er, sich noch ein paar Minuten Ruhe zu gönnen, und schloss die Augen wieder.
Im selben Moment betrat in der Rue de la Corraterie im Zentrum von Genf seine Sekretärin Cristina, pünktlich wie immer, das imposante Gebäude der Ebezner-Bank. Seit sie sechs Monate zuvor bei dem Geldinstitut angestellt worden war, erschien sie jeden Morgen um exakt 6 Uhr 30, sobald die Pförtner die Türen öffneten, bei der Arbeit. Zum einen, um ihre Zuverlässigkeit zu demonstrieren, zum anderen, weil sie so die verschiedenen Akten durchsehen konnte, ohne gestört zu werden und ohne dass man ihr Fragen stellte.
An diesem verschneiten Tag war sie zu Fuß gekommen, da sie nicht riskieren wollte, sich wegen schlecht geräumter Straßen zu verspäten. Ein Paar Pumps in der Tasche, war sie in Stiefeln von ihrer Wohnung in Champel durch die noch schlafende Stadt hergelaufen.
Elegant in ihrem taillierten Mantel, durchquerte sie die große Eingangshalle der Bank. Die hinter dem Empfangstresen aufgereihten Pförtner, die alle ein wenig in sie verschossen waren, staunten voller Bewunderung darüber, dass nichts den Eifer dieser ebenso hübschen wie pflichtbewussten jungen Angestellten bremsen konnte.
»Guten Morgen, Cristina«, grüßten sie sie wie aus einem Mund.
»Guten Morgen, meine Herren«, erwiderte sie lächelnd, wobei sie ihnen eine Tüte Croissants reichte, die sie in einer Bäckerei auf dem Weg gekauft hatte.
Gerührt von dieser Geste, überschlugen sie sich vor Dankbarkeit. »Haben Sie die Zeitung vom Wochenende gesehen?«, fragte einer von ihnen, während er mit einem Bissen sein halbes Croissant verschlang. »Sie werden Sekretärin des Präsidenten!«
»Ich freue mich sehr für Monsieur Ebezner«, sagte Cristina. »Er hat es verdient.«
Sie ging zum Aufzug und fuhr in den fünften Stock, die Etage der Vermögensverwaltung. Am Ende eines langen Flurs mit tapezierten Wänden erreichte sie das Vorzimmer, das ihr als Arbeitsplatz diente und das zu den Büros ihrer beiden Chefs führte: Macaire Ebezner und Lew Lewowitsch.
Das Vorzimmer war weder besonders groß noch besonders praktisch. Ein breites Pult, das den Durchgang versperrte, ein Schrank in einer der Ecken und ein stattlicher Kopierer standen darin. Trotzdem hatte Cristina selbst darum gebeten, sich hier einrichten zu dürfen. In allen Abteilungen, die Vermögensverwaltung inbegriffen, saßen die Sekretärinnen gemeinsam in großen, komfortablen Büros. Doch sie zog die unmittelbare Nähe zu ihren Chefs vor.
In der Bank hatte Cristina sich schnell unentbehrlich gemacht. Sie arbeitete hart und unermüdlich. Sie war intelligent, aufgeweckt, charmant. Immer gut gelaunt, immer entgegenkommend. Sie siebte Anrufe aus, sortierte aufmerksam die Post vor, meisterte Termine und Kalender.
Von ihrem ersten Tag an hatte Lew Lewowitsch ihr sehr imponiert. Er war einer der angesehensten Genfer Bankiers. Man schätzte ihn vor allem für seine Fachkenntnisse, fürchtete ihn aber nicht minder. Er war um die vierzig, sah unverschämt gut aus, hatte die Ausstrahlung eines Schauspielers und das Auftreten eines Königs. Er sprach zehn Sprachen fließend, war charismatisch, in allem begabt, kurz, nervtötend perfekt, ließ daher niemanden kalt und weckte gleichermaßen Bewunderung wie Neid. Seine Portfolios kannte er bis ins kleinste Detail. Er verstand die Märkte wie kein Zweiter und war in der Lage, ihre Bewegungen vorauszusehen. Selbst wenn die Börsen abstürzten, machten seine Kunden Gewinne.
Eine von Lewowitschs Besonderheiten war, dass er nicht aus den üblichen Kreisen stammte: Er war kein Spross einer Genfer Patrizierfamilie, sondern hatte bei null angefangen und hart gearbeitet, um sein Ziel zu erreichen, was ihm sowohl den Respekt der hohen Tiere einbrachte, zu denen er nun gehörte, als auch die Sympathie der kleinen Angestellten, die sich in seiner bescheidenen Herkunft wiedererkannten.
Verschlossen, zurückhaltend, machte er aus vielem ein Geheimnis und brüstete sich nie mit dem, was er tat, sondern ließ die von den Journalisten – und den Klatschbasen – kolportierten Fakten für sich sprechen. Er war Berater der Allerreichsten, Intimus der Mächtigen, Freund von Präsidenten, doch er vergaß nicht, woher er kam, und zeigte sich stets offen, hilfsbereit und großzügig gegenüber jenen, die Sorgen hatten oder in Schwierigkeiten oder Geldnot waren.
In Genf war er Stadtgespräch, alle wünschten sich, mit ihm zu verkehren. Und dennoch war er ein Einzelgänger ohne Bindungen. Er bewohnte eine riesige Suite im fünften Stock des überaus luxuriösen Hôtel des Bergues direkt am Ufer des Genfer Sees. Man wusste weder etwas über sein Privatleben noch, ob er Freunde hatte. Einziger Vertrauter war sein absolut diskreter Chauffeur und Butler Alfred Agostinelli. Sämtliche jungen Frauen der feinen Genfer Gesellschaft tuschelten über ihn, den heiß begehrten Junggesellen, und die großen europäischen Familien hofften, er werde einen Blick auf eine ihrer Töchter werfen. Doch Lewowitsch selbst schien mit alldem überhaupt nichts zu schaffen zu haben. Sein Herz war eine uneinnehmbare Festung: Es hieß, er habe noch nie für jemanden geschwärmt.
Lew Lewowitsch kam jeden Morgen um punkt 7 Uhr ins Büro. Doch an diesem Tag war er um 7 Uhr 40 noch immer nicht erschienen. Dabei wohnte Lew keine zehn Minuten von der Bank entfernt. Der Schnee konnte also nicht schuld an seiner Verspätung sein. Auf der Suche nach einer Erklärung für diese Abwesenheit dachte Cristina an einen möglichen Auswärtstermin. Als sie im Kalender ihres Chefs nachsah, stellte sie fest, dass die Seite für diesen Tag vollkommen leer war bis zu der Zeile für 16 Uhr, in der er selbst – sie erkannte seine Schrift – eine rätselhafte Notiz gemacht hatte: SEHR WICHTIGES TREFFEN.