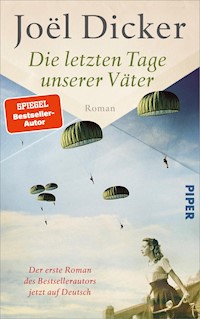18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Endlich - die Fortsetzung von Joël Dickers Weltbestseller »Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert« April 1999. Im friedlichen Mount Pleasant an der amerikanischen Ostküste wird die Leiche der jungen Alaska Sanders geborgen. Die Geständnisse eines Verdächtigen und seines Komplizen genügen, um die Ermittlungen zu einem raschen Erfolg zu führen. Juni 2010. Sergeant Perry Gahalowood, der seinerzeit von der Schuld des Verdächtigen restlos überzeugt war, erhält anonym eine verstörende Nachricht. Was, wenn er damals die falsche Fährte verfolgt hat? Gemeinsam mit seinem Freund, dem Schriftsteller Marcus Goldman, dessen Erfolg »Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert« vor der Verfilmung steht, rollt er den Fall neu auf – und fördert Details aus Alaskas Vergangenheit zutage, die die damaligen Ereignisse in ein völlig anderes Licht rücken ... »Eine großartige Fortsetzung, überbordend, sehr böse und virtuos. Lassen Sie sich drauf ein!« Le Parisien weekend
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Impressum ePUB
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
Übersetzung aus dem Französischen von Michaela Meßner und Amelie Thoma
© Joël Dicker 2023
Titel der französischen Originalausgabe:
»L´affaire Alaska Sanders«, Editions Rosie & Wolfe SA, Genf 2022
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Covergestaltung: Rothfos & Gabler
Coverabbildung: Edward Hopper, Gas (1940).© Heirs of Josephine N. Hopper/VAGA at ARS, NY/VG Bild-Kunst, Bonn 2022.Bridgeman Images und Shutterstock
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
–
DER TAG VOR DEM MORD
PROLOG
Was 2010 geschah
–
–
DER TAG DES MORDES
AUSZUG AUS DEM POLIZEIBERICHTBEFRAGUNG VON PETER PHILIPPS
ERSTER TEIL
Von den Folgen des Erfolges
–
KAPITEL 1
–
DER TAG DES MORDES
–
KAPITEL 2
DER TAG DES MORDES
–
KAPITEL 3
AUSZUG AUS DEM POLIZEIBERICHTBEFRAGUNG VON ROBERT UND DONNA SANDERS
–
DER MORGEN NACH DEM MORD
AM NACHMITTAG NACH DEM TAG DES MORDES
–
KAPITEL 4
AUSZUG AUS DEM POLIZEIBERICHTBEFRAGUNG VON WALTER CARREY
–
ZWEI TAGE NACH DEM MORD
–
KAPITEL 5
–
DREI TAGE NACH DEM MORD
–
KAPITEL 6
–
DREI TAGE NACH DEM MORD
–
KAPITEL 7
–
KAPITEL 8
ZWEITER TEIL
Von den Folgen eines Mordes
–
KAPITEL 9
–
KAPITEL 10
–
KAPITEL 11
–
KAPITEL 12
–
KAPITEL 13
–
KAPITEL 14
–
KAPITEL 15
–
KAPITEL 16
–
KAPITEL 17
–
KAPITEL 18
–
KAPITEL 19
–
Kapitel 20
–
KAPITEL 21
–
DER ABEND DES EINBRUCHS
–
KAPITEL 22
–
KAPITEL 23
–
KAPITEL 24
–
KAPITEL 25
DRITTER TEIL
Von den Folgen des Lebens
–
KAPITEL 26
–
KAPITEL 27
–
KAPITEL 28
–
KAPITEL 29
–
KAPITEL 30
–
KAPITEL 31
–
KAPITEL 32
–
KAPITEL 33
–
KAPITEL 34
–
KAPITEL 35
–
KAPITEL 36
–
KAPITEL 37
–
KAPITEL 38
–
KAPITEL 39
–
KAPITEL 40
–
KAPITEL 41
EPILOG
Ein Jahr nach der Lösungdes Falls Alaska Sanders
–
Copyright
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für Marie-Claire Ardouin,ohne die nichts möglich gewesen wäre
DER TAG VOR DEM MORD
Freitag, 2. April 1999
Als Letzter lebend gesehen hatte sie Lewis Jacob, der Besitzer einer Tankstelle an der Route 21, gegen 19:30 Uhr, als er seinen Shop neben den Zapfsäulen verließ. Er wollte seine Frau an ihrem Geburtstag zum Essen ausführen.
»Bist du sicher, dass es dir nichts ausmacht, den Laden nachher abzuschließen?«, sagte er zu seiner Angestellten, die hinter der Kasse stand.
»Das mach ich doch gern, Mr Jacob.«
»Danke, Alaska.«
Lewis Jacob ließ den Blick auf der jungen Frau ruhen. Sie war eine Schönheit. Ein Sonnenschein. Und so freundlich! In den sechs Monaten, die sie bei ihm arbeitete, hatte sie sein Leben verändert.
»Und du?«, fragte er. »Irgendwelche Pläne für heute Abend?«
»Ich habe eine Verabredung …« Sie lächelte.
»Wenn man dich so ansieht, scheint es doch mehr als eine bloße Verabredung zu sein.«
»Ein romantisches Dinner«, gestand sie.
»Walter ist ein Glückspilz«, sagte Lewis. »Dann läuft es also wieder besser zwischen euch?«
Als Antwort zuckte Alaska nur mit den Schultern. Lewis betrachtete sich in einer Fensterscheibe und rückte seine Krawatte zurecht.
»Wie sehe ich aus?«, fragte er.
»Perfekt! Gehen Sie nur, sonst kommen Sie noch zu spät.«
»Schönes Wochenende, Alaska. Bis Montag.«
»Ihnen auch, Mr Jacob.«
Sie lächelte ihn noch einmal an. Dieses Lächeln würde er nie vergessen.
Am nächsten Morgen um sieben Uhr war Lewis Jacob wieder da, um die Tankstelle aufzumachen. Gleich nach Betreten des Ladens schloss er die Tür hinter sich ab, um alles für die ersten Kunden vorzubereiten. Plötzlich trommelte jemand gegen die Glastür. Er drehte sich um und sah eine Joggerin mit angstverzerrtem Gesicht, die irgendetwas schrie. Er rannte zur Tür und öffnete ihr. Die junge Frau stürmte schreiend in den Laden: »Rufen Sie die Polizei! Rufen Sie die Polizei!«
Jener Morgen sollte das Schicksal einer Kleinstadt in New Hampshire wenden.
PROLOG
Was 2010 geschah
Die Jahre 2006 bis 2010 habe ich als schwierige Jahre in Erinnerung, trotz der Erfolge und trotz allen Ruhms. Sie waren gewiss die größte Achterbahnfahrt meines Lebens.
Ehe ich Ihnen also die Geschichte von Alaska Sanders erzähle, die am 3. April 1999 in Mount Pleasant, New Hampshire, tot aufgefunden wurde, und Ihnen erkläre, wie es dazu kam, dass ich im Sommer 2010 bei diesem elf Jahre alten Mordfall zu den Ermittlungen hinzugezogen wurde, muss ich zunächst ein paar Worte über meine damalige Situation und besonders über den Verlauf meiner jungen Schriftstellerkarriere verlieren.
Diese hatte im Jahr 2006 mit einem Romanerstling, der sich millionenfach verkaufte, fulminant begonnen. Mit gerade einmal sechsundzwanzig Jahren gehörte ich zum höchst exklusiven Club der reichen und berühmten Autoren und wurde in den Zenit der amerikanischen Literaturszene katapultiert.
Doch ich musste schon bald feststellen, dass der Ruhm seinen Preis hat: Wer meine Karriere von Anfang an verfolgt hat, weiß, wie sehr der immense Erfolg meines ersten Romans mich aus der Bahn werfen sollte. Erdrückt von meinen eigenen Lorbeeren, konnte ich nicht mehr schreiben. Schreibblockade, Inspirationsblockade, Angst vor dem weißen Blatt. Absturz.
Dann ereignete sich der Fall Harry Quebert, von dem Sie sicherlich schon gehört haben. Am 12. Juni 2008 wurde die Leiche von Nola Kellergan, die 1975 im Alter von fünfzehn Jahren verschwunden war, im Garten von Harry Quebert, einer legendären Gestalt der amerikanischen Literatur, ausgegraben. Dieser Fall traf mich sehr hart, denn Harry Quebert war mein ehemaliger Professor und zu jener Zeit vor allem mein engster Freund. Ich konnte nicht glauben, dass er schuldig war. Und so fuhr ich, allein gegen alle, kreuz und quer durch New Hampshire, um eigene Nachforschungen anzustellen. Doch obwohl es mir schließlich gelang, Harrys Unschuld zu beweisen, sollten die Geheimnisse, die ich über ihn entdeckte, unsere Freundschaft zerstören.
Die Ermittlung fasste ich in einem Buch zusammen: Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert, das im Herbst 2009 erschien und dessen Erfolg mich endgültig zu einem Schriftsteller von nationaler Bedeutung machte. Dieses Buch war die Bestätigung, auf die Leser und Kritiker seit meinem ersten Roman gewartet hatten, um mir endlich den Ritterschlag zu erteilen. Ich war kein flüchtiges Wunderkind mehr, keine von der Nacht verschluckte Sternschnuppe, kein bereits verglühtes Lauffeuer: Ich war nun ein von seinesgleichen und von der Öffentlichkeit anerkannter Schriftsteller. Darüber war ich sehr erleichtert. Es war, als hätte ich mich selbst wiedergefunden, nachdem ich drei Jahre lang durch die Wüste des Erfolgs geirrt war.
Und so überkam mich in den letzten Wochen des Jahres 2009 eine große Gelassenheit. Am Abend des 31. Dezember feierte ich inmitten einer fröhlichen Menschenmenge am Times Square den Beginn des neuen Jahres. Seit 2006 hatte ich diese Tradition nicht mehr gepflegt. Seit dem Erscheinen meines ersten Buches. Ich fühlte mich gut in jener Nacht, anonym unter Anonymen. Mein Blick kreuzte den einer Frau, die mir auf Anhieb gefiel. Sie trank Champagner. Lächelnd reichte sie mir die Flasche.
Wenn ich daran zurückdenke, was in den darauffolgenden Monaten geschah, erinnere ich mich immer auch an diese Szene, die mir die Illusion gab, endlich Frieden gefunden zu haben.
Die Ereignisse des Jahres 2010 sollten mich eines Besseren belehren.
DER TAG DES MORDES
3. April 1999
Es war sieben Uhr morgens. Sie lief allein entlang der Route 21, durch eine grüne Landschaft. Die Musik aus den Kopfhörern half ihr, das Tempo zu halten. Schnelle, lange Schritte, kontrollierte Atmung. In zwei Wochen würde sie beim Boston-Marathon an den Start gehen. Sie war bereit.
Der Tag fühlte sich perfekt an. Die aufgehende Sonne schickte ihre Strahlen über die Wildblumenfelder, hinter denen sich der endlose Wald des White Mountain erstreckte.
Kurz darauf kam sie zu Lewis Jacobs Tankstelle, die genau sieben Kilometer von ihrem Haus entfernt lag. Ursprünglich hatte sie hier umkehren wollen, doch dann beschloss sie, sich noch etwas mehr zu fordern. Sie lief an der Tankstelle vorbei und weiter bis zur Kreuzung von Grey Beach. Dort bog sie auf die unbefestigte Straße ab, die an den heißen Tagen von Sommerurlaubern überrannt wurde. Sie führte zu einem Parkplatz, von dem ein Wanderweg abzweigte, über den man durch den White Mountain Forest zum Grey Beach, einem breiten Kiesstrand am Skotam-See gelangte. Auf dem Parkplatz bemerkte sie ein blaues Cabrio mit dem Kennzeichen von Massachusetts, schenkte ihm aber keine weitere Beachtung. Sie bog in den Weg ein und lief Richtung Strand.
Sie hatte gerade den Waldrand erreicht, als sie am Ufer einen dunklen Schatten wahrnahm, der sie abrupt innehalten ließ. Erst nach ein paar Sekunden begriff sie, was dort geschah. Sie war vor Schreck wie gelähmt. Er hatte sie nicht gesehen. Jetzt bloß kein Geräusch machen, ihn nicht auf sich aufmerksam machen. Sonst würde er zweifellos auch sie angreifen. Sie versteckte sich hinter einem Stamm.
Das Adrenalin gab ihr die Kraft, möglichst geräuschlos den Weg zurückzuschleichen, und als sie sich außer Gefahr wähnte, nahm sie die Beine in die Hand und rannte. Sie rannte, wie sie noch nie zuvor gerannt war. Sie war absichtlich ohne Handy aufgebrochen. Jetzt bereute sie es!
Sie gelangte zur Route 21 und hoffte, es würde ein Auto vorbeifahren – aber nichts. Als wäre sie allein auf der Welt. Also sprintete sie zur Tankstelle von Lewis Jacob. Dort würde sie Hilfe bekommen. Doch als sie endlich ankam, völlig außer Atem, war der Laden geschlossen. Schließlich bemerkte sie drinnen den Tankstellenbesitzer und hämmerte so lange gegen die Tür, bis er ihr öffnete. Sie stürzte hinein und schrie:
»Rufen Sie die Polizei! Rufen Sie die Polizei!«
AUSZUG AUS DEM POLIZEIBERICHTBEFRAGUNG VON PETER PHILIPPS
[Peter Philipps ist seit etwa 15 Jahren Polizist in Mount Pleasant. Er war der erste Beamte, der am Tatort eintraf. Seine Zeugenaussage wurde am 3. April 1999 in Mount Pleasant aufgenommen.]
Als ich über den Ruf der Zentrale erfuhr, was am Grey Beach los war, dachte ich zunächst, ich hätte mich verhört. Ich bat den Telefonisten um eine Wiederholung. Ich befand mich gerade in der Gegend von Stove Farm, das ist in der Nähe des Grey Beach.
Sind Sie direkt hingefahren?
Nein, ich fuhr zuerst zur Tankstelle an der Route 21, denn von dort hatte die Zeugin den Notruf abgesetzt. In Anbetracht der Umstände war es mir wichtig, erst mit ihr zu sprechen, bevor ich eingriff. Ich wollte wissen, was mich am Strand erwartete. Besagte Zeugin war eine vollkommen verängstigte junge Frau. Sie erzählte mir, was passiert war. Ich bin jetzt schon seit fünfzehn Jahren Polizist, aber mit einer solchen Situation war ich noch nie konfrontiert.
Was taten Sie dann?
Ich machte mich unverzüglich auf den Weg zum Tatort.
Sind Sie allein hingegangen?
Ich hatte keine andere Wahl. Wir durften keine Minute verlieren. Ich musste ihn finden, bevor er die Flucht ergriff.
Was geschah dann?
Ich raste wie ein Irrer von der Tankstelle zum Parkplatz von Grey Beach. Als ich dort ankam, fiel mir ein blaues Cabrio auf, mit dem Kennzeichen von Massachusetts. Ich packte mein Gewehr und rannte den Weg zum See hinunter.
Und dann?
Als ich am Strand auftauchte, war er immer noch da und ließ nicht von dem armen Mädchen ab. Ich schrie, damit er aufhörte, er hob den Kopf und starrte mich an. Er begann sich langsam auf mich zuzubewegen. Mir war sofort klar: entweder er oder ich. Fünfzehn Dienstjahre, und ich hatte noch nie einen Schuss abgefeuert. Bis zu jenem Morgen.
ERSTER TEIL
Von den Folgen des Erfolges
Auf die riesigen Hallen am Ufer des Sankt-Lorenz-Stroms, in denen die Filmstudios untergebracht waren, fiel ein frühlingshafter Schnee. Seit einigen Monaten wurde dort mein erster Roman, G wie Goldstein, verfilmt.
KAPITEL 1
Nach dem Fall Harry Quebert
Montreal, Quebec5. April 2010
Der Zufall wollte es, dass der Beginn der Dreharbeiten mit dem Erscheinen von Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert zusammenfiel. Nach dem erfolgreichen Buch wurde der Film bereits überall begeistert gefeiert, und die ersten Bilder hatten in Hollywood Aufsehen erregt.
Während draußen ein kalter Wind die Schneeflocken umherwirbelte, hatte man im Studio fast das Gefühl, es wäre Hochsommer: In der erstaunlich realistisch wirkenden Kulisse einer belebten Straße schienen die Schauspieler und Statisten, die von starken Scheinwerfern angestrahlt wurden, unter einer sengenden Sonne zu brüten. Es war eine meiner Lieblingsszenen im Buch: Auf der Terrasse eines Cafés, an dem zahlreiche Passanten vorbeigehen, treffen sich die beiden Protagonisten Mark und Alicia endlich wieder, nachdem sie sich jahrelang aus den Augen verloren hatten. Worte sind überflüssig, ihre Blicke genügen, um die verlorene Zeit wettzumachen, die sie ohneeinander verbracht haben.
Ich saß hinter den Kontrollbildschirmen und verfolgte die Aufnahme.
»Schnitt!«, schrie plötzlich der Regisseur und zerstörte damit den Zauber des Augenblicks. »Die nehmen wir.« Der erste Assistent, der neben ihm saß, gab die Anweisung über Funk weiter: »Die nehmen wir. Ende der Dreharbeiten für heute.«
Sofort verwandelte sich das Set in einen Ameisenhaufen. Die Techniker packten ihre Ausrüstung zusammen, während die Schauspieler unter den enttäuschten Blicken der Statisten, die sich über ein paar Worte, ein Foto oder ein Autogramm gefreut hätten, in ihre Garderoben zurückkehrten.
Ich schlenderte durch die Kulissen. Die Straße, die Bürgersteige, die Laternen, die Schaufenster – alles wirkte so echt. Ich betrat das Café, voller Bewunderung für die Liebe, die man hier auf jedes Detail verwandt hatte. Ich hatte das Gefühl, in meinem Roman herumzuspazieren. Ich schlich mich hinter die Theke, die mit Sandwiches und Gebäck vollgepackt war: Alles, was man auf der Leinwand sehen konnte, musste realistisch wirken.
Dieser kontemplative Moment war nur von kurzer Dauer, denn eine Stimme riss mich aus meinen Gedanken:
»Bedienen Sie heute, Goldman?« Es war Roy Barnaski, der exzentrische Verleger von Schmid & Hanson, der meine Bücher publizierte. Er war am Morgen aus New York angereist, ohne jede Vorwarnung.
»Einen Kaffee, Roy?«, schlug ich vor und griff nach einer leeren Tasse.
»Geben Sie mir lieber eines dieser Sandwiches, ich sterbe vor Hunger.«
Ich wusste nicht, ob sie essbar waren, reichte Roy aber trotzdem kurzerhand eine Truthahn-Käse-Kombi.
»Wissen Sie, Goldman«, sagte er, nachdem er genüsslich in die dicken Scheiben gebissen hatte, »dieser Film wird ein Hit! Wir haben übrigens eine Sonderausgabe von G wie Goldstein geplant, das wird ein Hit!«
Falls Sie zu denen gehören, die Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert gelesen haben, ist Ihnen mein ambivalentes Verhältnis zu Roy Barnaski wohlbekannt. Die anderen brauchen nur zu wissen, dass er sich seinen Autoren umso wesensverwandter fühlt, je größer die Geldsummen sind, die er mit ihnen verdient. Mir hatte er zwei Jahre zuvor noch die Hölle heißgemacht, weil ich meinen Roman nicht rechtzeitig abgeliefert hatte, doch die Rekordverkäufe von Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert verschafften mir nun in seinem Pantheon der Goldesel einen Ehrenplatz.
»Sie müssen auf Wolke sieben schweben, Goldman«, fuhr Barnaski fort, der offensichtlich nicht merkte, dass er mir lästig war. »Erst der Bucherfolg und jetzt dieser Film. Erinnern Sie sich noch, wie ich vor zwei Jahren alle Hebel in Bewegung gesetzt habe, damit Cassandra Pollock die Rolle der Alicia bekommt, und Sie mich mit Vorwürfen überhäuften? Schauen Sie, wie sehr sich das gelohnt hat! Alle sind sich einig, dass sie sensationell ist!«
»Wie könnte ich das vergessen, Roy? Sie haben allen weisgemacht, wir hätten eine Affäre.«
»Sie sehen ja, was dabei herausgekommen ist! Ich habe eben einen guten Riecher, Goldman! Deshalb habe ich es so weit gebracht! Übrigens bin ich hier, um etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen.«
Schon in dem Augenblick, da ich ihn so unverhofft am Drehort auftauchen sah, war mir klar gewesen, dass er nicht ohne Grund nach Montreal gekommen war.
»Worum geht es?«, fragte ich.
»Eine Neuigkeit, die Sie freuen wird, Goldman. Ich wollte sie Ihnen persönlich überbringen.«
Barnaski fasste mich mit Samthandschuhen an, das war kein gutes Zeichen.
»Spucken Sie es schon aus, Roy.«
Er gab sich einen Ruck: »Wir stehen kurz davor, einen Vertrag mit MGM über die Verfilmung von Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert abzuschließen! Das wird ein Riesending! So riesig, dass sie ganz schnell eine Absichtserklärung unterzeichnen möchten.«
»Ich glaube nicht, dass ich es verfilmen lassen möchte«, antwortete ich schroff.
»Warten Sie, bis Sie den Vertrag gesehen haben, Goldman. Schon bei Unterzeichnung sind Sie um zwei Millionen Dollar reicher! Sie kritzeln Ihren Namen unten auf eine Seite und schwupps! – haben Sie zwei Millionen Dollar mehr auf Ihrem Bankkonto. Ganz zu schweigen von der Gewinnbeteiligung am Film und allem anderen!«
Ich hatte keine Lust zu diskutieren. »Besprechen Sie das mit meinem Agenten oder meinem Anwalt«, schlug ich vor, um die Sache abzukürzen, was Barnaski sehr ärgerte.
»Wenn mich die Meinung Ihres beschissenen Agenten interessieren würde, Goldman, wäre ich nicht hergekommen!«
»Konnte das nicht bis zu meiner Rückkehr nach New York warten?«
»Ihre Rückkehr nach New York? Sie sind schlimmer als der Wind, Goldman, Sie können nie an einem Ort bleiben!«
»Harry würde einem Film nicht zustimmen«, sagte ich und verzog das Gesicht.
»Harry?«, presste Barnaski hervor. »Harry Quebert?«
»Ja, Harry Quebert. Ende der Diskussion: Ich will keinen Film, weil ich mich nicht mehr damit befassen will. Ich will den Fall vergessen. Ich möchte ein neues Kapitel aufschlagen.«
»Hören Sie sich nur dieses Quengelbaby an!«, sagte Barnaski, der es nicht ertrug, wenn man ihm widersprach. »Man reicht ihm eine Schöpfkelle voll Kaviar, aber Baby Goldman ist trotzig und will den Mund nicht aufmachen!«
Ich hatte die Nase voll. Barnaski bereute sofort, dass er mich so überfahren hatte, und wollte es wiedergutmachen, indem er mit honigsüßer Stimme sagte: »Lassen Sie mich Ihnen das Projekt erklären, mein lieber Marcus. Sie werden sehen, wie schnell Sie Ihre Meinung ändern.«
»Ich brauche erst mal frische Luft.«
»Lassen Sie uns heute Abend zusammen essen gehen! Ich habe in einem Restaurant in der Altstadt von Montreal einen Tisch reserviert. Sagen wir, zwanzig Uhr?«
»Ich habe heute Abend eine Verabredung, Roy. Wir sprechen uns in New York.«
Ich ließ ihn mit seiner Sandwich-Attrappe in der Hand am Set stehen und ging zum Haupteingang des Studios. Kurz vor den großen Flügeltüren befand sich ein Imbissstand. Jeden Tag nach den Dreharbeiten trank ich dort noch einen Kaffee. Es bediente immer die gleiche Kellnerin. Sie reichte mir, bevor ich auch nur ein Wort sagen konnte, einen Pappbecher mit Kaffee. Ich dankte ihr mit einem Lächeln. Sie lächelte zurück. Ich werde oft angelächelt. Aber ich weiß nicht mehr, ob die Leute mich anlächeln, den Menschen, der vor ihnen steht, oder aber den Schriftsteller, den sie gelesen haben. Wie zum Beweis zog die junge Frau ein Exemplar von Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert hinter ihrem Tresen hervor.
»Gestern Abend habe ich es zu Ende gelesen«, sagte sie. »Dieses Buch kann man einfach nicht mehr aus der Hand legen! Würden Sie es mir signieren?«
»Mit Vergnügen. Ihr Vorname?«
»Deborah.«
Deborah, natürlich. Das hatte sie mir schon zehn Mal gesagt.
Ich holte einen Stift aus meiner Tasche und schrieb auf das Deckblatt den üblichen Satz, den ich immer für meine Widmungen verwende:
Für Deborah,
die jetzt die ganze Wahrheit über den Fall Harry Quebert kennt.
Marcus Goldman
»Einen schönen Tag, Deborah«, sagte ich und reichte ihr das Exemplar.
»Einen schönen Tag, Marcus. Bis morgen!«
»Da fliege ich zurück nach New York. In einer Woche bin ich wieder hier.«
»Dann also bis bald.«
Als ich gerade gehen wollte, fragte sie: »Haben Sie ihn wiedergesehen?«
»Wen?«
»Harry Quebert.«
»Nein, ich habe nie wieder etwas von ihm gehört.«
Ich ging durch die Tür des Studios hinaus und stieg in den Wagen, der dort auf mich wartete. Haben Sie Harry Quebert wiedergesehen? Seit dem Erscheinen des Buches wurde ich immer wieder danach gefragt. Und jedes Mal versuchte ich, diese Frage zu beantworten, als würde sie mich überhaupt nicht tangieren. Als würde ich nicht jeden Tag darüber nachdenken. Wo war Harry? Und was war aus ihm geworden?
Nach der Fahrt am Sankt-Lorenz-Strom entlang ging es bergauf Richtung Innenstadt von Montreal, deren Wolkenkratzer sich schon bald vor mir abzeichneten. Ich mochte diese Stadt. Ich fühlte mich wohl dort. Vielleicht weil dort jemand auf mich wartete. Seit ein paar Monaten gab es endlich wieder eine Frau in meinem Leben.
In Montreal wohnte ich im Ritz-Carlton, immer in derselben Suite im obersten Stockwerk. Als ich das Hotel betrat, sprach der Rezeptionist mich an, um mir mitzuteilen, ich werde an der Bar erwartet. Ich lächelte: Sie war angekommen.
Ich entdeckte sie an einem Tisch etwas abseits, neben dem Kamin, wo sie, noch immer in ihrer Pilotinnenuniform, an einem Moscow Mule nippte. Als sie mich sah, begannen ihre Augen zu strahlen. Sie küsste mich, ich umarmte sie. Sie gefiel mir jedes Mal besser.
Raegan war dreißig Jahre alt, genau wie ich. Sie war Pilotin bei Air Canada. Wir waren seit über drei Monaten zusammen. Mit ihr fühlte sich mein Leben ausgefüllter an, erfüllter. Ich empfand dies umso stärker, als ich mich sehr schwergetan hatte, eine Frau zu finden, die mir wirklich gefiel.
Meine letzte ernsthafte Beziehung – mit Emma Matthews – lag fünf Jahre zurück und hatte nur wenige Monate gehalten. Nachdem ich Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert beendet hatte, nahm ich mir vor, mich nun ganz meinem Liebesleben zu widmen. Ich stürzte mich in eine Reihe von Abenteuern, die jedoch alle nicht weit führten. Vielleicht hatte ich mich zu sehr unter Druck gesetzt. Jede dieser Begegnungen wurde schnell zu einer Art Einstellungsgespräch: Ich beobachtete die Frau, mit der ich mich erst seit ein paar Minuten unterhielt, und fragte mich, ob sie eine gute Partnerin, eine gute Mutter für meine Kinder sein würde. Und im nächsten Moment mischte sich auch schon meine eigene Mutter ein, die, meinen Gedanken entsprungen, wie ein ungebetener Gast aufkreuzte. Sie schnappte sich einen leeren Stuhl, setzte sich neben die arme junge Frau und begann, unzählige Fehler an ihr festzustellen. Und so gab meine Mutter – oder vielmehr ihr Gespenst – den Kampfrichter bei unserem Date. Markie, meinst du, sie ist die Richtige?, flüsterte sie mir ihre abgedroschene Lieblingsfloskel ins Ohr, als müssten wir uns fürs ganze Leben aneinanderbinden, dabei wussten wir doch noch nicht einmal, ob wir den Abend überstehen würden. Und weil meine Mutter sich große Dinge von mir erhoffte, fügte sie hinzu: Sag mal, Markie, kannst du dir vorstellen, wie dir im Weißen Haus die Medal of Freedom verliehen wird, mit diesem Mädchen an deinem Arm? Der letzte Satzteil wurde im Allgemeinen mit großer Verachtung geäußert, als wollte sie ihr damit den Todesstoß versetzen. Und das tat sie dann auch. So kam es, dass meine arme Mutter, ohne es zu ahnen, mein unbeweibtes Leben nur noch verlängerte. Bis ich, auch das dank ihr, Raegan kennenlernte.
Drei Monate zuvor31. Dezember 2009
Wie immer vor Silvester war ich nach Montclair, New Jersey, gefahren, um meine Eltern zu besuchen. Als wir im Wohnzimmer Kaffee tranken, sagte meine Mutter diesen dummen Satz, den sie manchmal von sich gab und der mich fuchsteufelswild machte:
»Was soll man dir fürs neue Jahr wünschen, mein Schatz, wo du doch schon alles hast?«
»Einen verlorenen Freund wiederzufinden«, gab ich patzig zur Antwort.
»Ist ein Freund von dir gestorben?«, erkundigte sich meine Mutter, die die Anspielung nicht verstanden hatte.
»Ich meine Harry Quebert«, erklärte ich. »Ich würde ihn gern wiedersehen. Ich will wissen, was aus ihm geworden ist.«
»Zum Teufel mit diesem Harry Quebert! Er hat dir nichts als Ärger gebracht! Echte Freunde bringen einem keinen Ärger.«
»Er hat mir geholfen, Schriftsteller zu werden. Ich verdanke ihm alles.«
»Du schuldest niemandem etwas, außer deiner Mutter, der du dein Leben verdankst! Markie, du brauchst keine Freunde, du brauchst eine Freundin! Warum hast du keine Freundin? Willst du mir keine Enkelkinder schenken?«
»Es ist nicht so einfach, jemanden kennenzulernen, Mama.«
Meine Mutter bemühte sich um einen milderen Ton: »Markie, Schatz, ich glaube, du strengst dich nicht genug an, jemanden zu finden. Du gehst nicht genug aus. Ich weiß, dass du dir manchmal stundenlang das Album mit Fotos von dir und diesem Harry Quebert ansiehst.«
»Woher weißt du das?«, fragte ich überrascht.
»Deine Putzfrau hat es mir erzählt.«
»Seit wann sprichst du mit meiner Putzfrau?«
»Seitdem du mir nichts mehr erzählst!«
In diesem Moment fiel mein Blick auf ein gerahmtes Foto, das meinen Onkel Saul, meine Tante Anita und meine Cousins Hillel und Woody in Florida zeigte.
»Weißt du, wenn dein Onkel Saul …«, flüsterte meine Mutter.
»Reden wir nicht darüber, bitte, Mama!«
»Ich möchte nur, dass du glücklich bist, Markie. Du hast keinen Grund, es nicht zu sein.«
Ich wollte einfach nur weg. Ich stand auf und schnappte mir meine Jacke.
»Was hast du heute Abend vor, Markie?«, fragte meine Mutter.
»Ich gehe mit Freunden aus«, log ich, um sie zu beruhigen.
Ich gab ihr und meinem Vater einen Kuss und ging.
Meine Mutter hatte recht: Bei mir zu Hause gab es ein Album, in das ich mich jedes Mal vertiefte, wenn mir wehmütig ums Herz wurde. Wieder zurück in New York, tat ich übrigens genau das. Ich trank ein Glas Scotch und blätterte darin. Ich hatte Harry genau ein Jahr zuvor das letzte Mal gesehen, an einem Abend im Dezember 2008, an dem er mich bei mir zu Hause besucht hatte. Seither gab es von ihm kein Lebenszeichen mehr. Durch meinen Versuch, die Mordanklage von ihm abzuwenden und seine Ehre wiederherzustellen, hatte ich ihn verloren. Ich vermisste ihn schrecklich.
Natürlich hatte ich mich bemüht, seine Spur zu finden – leider vergebens. Ich kehrte regelmäßig nach Aurora, New Hampshire, zurück, wo er die letzten dreißig Jahre gelebt hatte. Spazierte stundenlang durch die kleine Stadt. Irrte stundenlang um sein Haus in Goose Cove herum. Bei jedem Wetter, zu jeder Stunde. Ihn wiederfinden. Alles wiedergutmachen. Doch Harry tauchte nie dort auf.
Während ich in mein Album versunken war und mich wehmütig daran erinnerte, was wir einander bedeutet hatten, klingelte plötzlich mein Festnetztelefon. Einen kurzen Augenblick dachte ich, er wäre es, der anrief. Ich stürzte zum Hörer, um ihn abzunehmen. Es war meine Mutter.
»Warum gehst du denn ran, Markie?«, fragte sie vorwurfsvoll.
»Weil du mich anrufst, Mama.«
»Markie, es ist Silvester! Du hast mir gesagt, du würdest Freunde treffen! Sag mir nicht, dass du allein zu Hause sitzt und dir schon wieder diese teuflischen Fotos ansiehst! Ich werde deine Putzfrau bitten, sie zu verbrennen.«
»Ich werde sie entlassen, Mama. Deinetwegen hat eine tüchtige Frau gerade ihren Job verloren. Bist du nun zufrieden?«
»Du sollst rausgehen, Markie! Ich weiß noch, wie du früher, als du noch in der Schule warst, den Jahreswechsel immer am Times Square gefeiert hast. Ruf ein paar Freunde an und geh raus! Das ist ein Befehl! Seiner Mutter muss man gehorchen.«
Also machte ich mich auf den Weg zum Times Square, allein, denn in New York hatte ich keine Freunde, die ich hätte anrufen können. Als ich bei dem Platz ankam, auf dem die Menschen sich zu Hunderttausenden drängten, fühlte ich mich gut. Friedlich. Ich ließ mich mit der Menge treiben. Und da begegnete ich dieser jungen Frau, die aus einer Flasche Champagner trank. Sie lächelte mich an. Und war mir auf Anhieb sympathisch.
Als es Mitternacht schlug, küsste ich sie.
So trat Raegan in mein Leben.
Nach dieser Begegnung besuchte Raegan mich mehrmals in New York, und wir trafen uns in Montreal, wenn ich zu den Dreharbeiten fuhr. Im Grunde kannten wir uns immer noch kaum, dabei waren wir schon seit drei Monaten zusammen. Wir planten unsere nächsten Treffen zwischen zwei Flügen oder zwei Drehtagen. Doch an jenem Abend im April, in der Bar des Ritz in Montreal, merkte ich, wie viel ich für sie empfand. Und während wir uns über alles Mögliche unterhielten, bestand sie mit links den Test als zukünftige Ehefrau und Mutter meiner Kinder: Ich stellte mir verschiedene Lebenssituationen vor, und in jeder einzelnen konnte ich sie mir bestens an meiner Seite denken.
Raegan flog am nächsten Morgen um sieben Uhr nach New York-JFK. Als ich ihr vorschlug, irgendwo essen zu gehen, meinte sie, wir sollten lieber im Hotel bleiben.
»Gerne, das Hotelrestaurant ist sehr gut«, sagte ich.
»Dein Zimmer ist noch besser«, erwiderte sie lächelnd.
Wir zogen uns in meine Suite zurück, wo wir lange in der riesigen Badewanne lagen und im Schutz des heißen Schaumbades durch das Panoramafenster den Schnee bewunderten, der stetig auf Montreal fiel. Dann ließen wir den Zimmerservice kommen. Alles schien einfach, zwischen uns bestand eine Art Osmose. Ich bedauerte nur, dass ich nicht mehr Zeit mit Raegan verbringen konnte. Der Grund: die geografische Entfernung (ich lebte in New York und sie in einer kleinen Stadt eine Stunde südlich von Montreal, in der ich noch nie gewesen war), vor allem aber ihr straffer Flugplan, der ihr nicht viel Freizeit ließ. Auch dieses Treffen bildete keine Ausnahme von der Regel, und es wurde eine kurze Nacht: Um fünf Uhr morgens, als das Hotel noch schlief, waren Raegan und ich schon aufgestanden. Durch die Badezimmertür betrachtete ich sie. Sie trug ihre Uniformhose, aber sonst nur einen BH und schminkte sich, während sie eine Tasse Kaffee trank. Wir würden beide nach New York aufbrechen, jedoch getrennt reisen. Sie würde den Luftweg nehmen und ich die Straße, denn ich war mit dem Auto hergekommen. Ich fuhr sie bis zum Flughafen Montreal-Trudeau. Als ich vor dem Terminal anhielt, fragte mich Raegan: »Warum bist du nicht mit dem Flugzeug gekommen, Marcus?«
Ich zögerte einen Moment, denn ich konnte ihr ganz bestimmt nicht gestehen, warum ich diese Entscheidung getroffen hatte.
»Ich mag die Strecke zwischen New York und Montreal«, log ich.
Sie gab sich nur halb mit dieser Erklärung zufrieden.
»Sei ehrlich, du hast doch nicht etwa Flugangst?«
»Natürlich nicht.«
Sie küsste mich und beruhigte mich mit einem: »Ich mag dich trotzdem.«
»Wann sehe ich dich wieder?«, wollte ich wissen.
»Wann kommst du denn wieder nach Montreal?«
»Am 12. April.«
Sie sah in ihren Kalender: »Ich werde über Nacht in Chicago sein, und dann folgt eine Woche mit Schichtwechsel in Toronto.«
Sie sah meine enttäuschte Miene. »Anschließend habe ich eine Woche frei. Ich verspreche dir, dann werden wir Zeit füreinander haben. Wir werden uns in deinem Hotelzimmer einschließen und uns nicht vom Fleck rühren.«
»Wie wäre es, wenn wir ein paar Tage wegfahren würden?«, schlug ich vor. »Weder New York noch Montreal. Nur du und ich, irgendwohin.«
Sie nickte begeistert und schenkte mir ihr schönstes Lächeln. »Das würde mir sehr gefallen«, flüsterte sie, als wäre es ein beinahe anzügliches Geständnis.
Sie küsste mich lange, dann stieg sie aus dem Auto und ließ mich mit vielen Hoffnungen zurück, was aus uns beiden werden könnte. Während ich zusah, wie sie im Flughafengebäude verschwand, beschloss ich, einen romantischen Trip zu einem Hotel auf den Bahamas zu organisieren, von dem ich gehört hatte: Harbour Island. Sofort griff ich nach meinem Handy und suchte die Website des Hotels. Es lag auf einer Privatinsel und sah paradiesisch aus. Hier würden wir ihre freie Woche verbringen, am Sandstrand eines türkisfarbenen Meeres. Ich buchte sofort und machte mich dann auf den Rückweg nach New York.
Ich fuhr durch die Cantons-de-l’Est bis nach Magog – wo ich anhielt, um einen Kaffee zu kaufen – und dann hinunter in die kleine Stadt Stanstead, die an die USA grenzt und von der Sie vielleicht schon gehört haben, weil es dort die einzige Bibliothek der Welt gibt, die sich genau zwischen zwei Ländern befindet.
Als ich die Grenze überquerte, fragte mich der amerikanische Zollbeamte, der meinen Pass kontrollierte, mechanisch, woher ich kam und wohin ich wollte. Als ich antwortete, ich käme aus Montreal und wollte nach Manhattan, stellte er fest: »Das ist nicht der direkteste Weg nach New York.« In der Annahme, ich hätte mich verfahren, erklärte er mir, wie ich zur Route 87 gelangen konnte. Ich hörte ihm höflich zu und hatte nicht die geringste Absicht, seinen Anweisungen zu folgen.
Ich wusste genau, wohin ich wollte.
Ich war auf dem Weg nach Aurora, New Hampshire. Dorthin, wo mein Freund Harry Quebert den größten Teil seines Lebens verbracht hatte, bevor er verschwunden war, ohne eine Adresse zu hinterlassen.
DER TAG DES MORDES
3. April 1999
Ein Zivilfahrzeug der Polizei raste mit Blaulicht und Sirene über die Route 21, die die Kleinstadt Mount Pleasant mit dem Rest von New Hampshire verbindet. Der Asphaltstreifen führte durch eine Landschaft aus Wildblumenfeldern und seerosenbewachsenen Teichen, hinter denen sich der endlose White Mountain Forest erstreckte.
Sergeant Perry Gahalowood war der Fahrer des Chevrolet Impala. Neben ihm saß sein Partner, Sergeant Matt Vance, der auf eine Karte der Gegend starrte.
»Es kommt jetzt gleich auf der rechten Seite«, sagte Vance, als sie eine Tankstelle passierten. »Du müsstest einen kleinen Weg sehen, der in den Wald abzweigt.«
»Die örtliche Polizei dürfte da jemanden postiert haben, der uns zeigt, wo es langgeht.«
Die beiden Polizisten ahnten nicht, was für ein Empfangskomitee sie erwartete: Nach einer letzten Kurve gerieten sie plötzlich in einen Stau. Perry umfuhr ihn im Schritttempo auf der Gegenfahrbahn, wobei ihn vor allem die Dutzenden von Schaulustigen behinderten, die am Straßenrand standen.
»Was zur Hölle ist hier los?«, schimpfte Perry.
»Der übliche Rummel, wenn sich in einer Kleinstadt etwas Dramatisches ereignet: Alle wollen sich einen Logenplatz sichern.«
Schließlich gelangten sie auf Höhe der Abzweigung zum Parkplatz von Grey Beach an eine Polizeisperre. Perry hielt den Beamten durchs geöffnete Fenster seine Marke hin.
»Mordkommission der State Police.«
»Folgen Sie dem Feldweg, immer geradeaus«, wies ihn einer der Polizisten an und hob ein gestreiftes Absperrband hoch, um sie durchzulassen.
Nach einigen Hundert Metern erreichte der Chevrolet Impala den Waldrand an der weiten, grasbewachsenen Ebene. Ein Beamter der örtlichen Polizei ging dort auf und ab.
»Mordkommission der State Police«, verkündete Gahalowood erneut durchs offene Fenster.
Der Beamte schien von den Ereignissen völlig überfordert.
»Fahren Sie hier ran«, schlug er vor, »ich glaube, da drüben herrscht ein ziemliches Chaos.«
Die beiden Sergeants stiegen aus dem Auto und gingen zu Fuß weiter.
»Warum passiert so was immer ausgerechnet an den Wochenenden, an denen wir Dienst haben?«, fragte Vance schicksalsergeben, als sie die Schotterpiste überquerten. »Weißt du noch, der Fall Greg Bonnet? Das war auch ein Samstag.«
»Bevor ich dein Teamkollege wurde, waren meine Wochenenden vollkommen friedlich«, scherzte Gahalowood. »Ich glaube, du bringst mir Unglück, Alter. Helen wird nicht sehr erfreut sein, ich habe versprochen, ihr heute Abend beim Kistenauspacken zu helfen. Aber sollten wir einen Mordfall an der Backe haben …«
»Im Moment wissen wir noch gar nicht, ob es sich überhaupt um einen Mord handelt. Es wäre nicht das erste Mal, dass man uns auf einen einfachen Wanderunfall ansetzt.«
Kurz darauf erreichten sie den Parkplatz von Grey Beach, den verschiedene Einsatzfahrzeuge und Rettungswagen verstopften. Es herrschte allgemeine Aufregung. Sie wurden von Francis Mitchell, dem Polizeichef von Mount Pleasant, begrüßt, der sie gleich vorwarnte: »Das ist kein schöner Anblick, meine Herren.«
»Was genau ist passiert?«, fragte Gahalowood. »Uns wurde etwas von einer toten Frau erzählt.«
»Sehen Sie sich das lieber mit eigenen Augen an.« Chief Mitchell brachte sie zu dem Pfad, der zum See führte.
Sowohl Perry Gahalowood als auch Matt Vance waren den Anblick von Leichen und Tatorten gewohnt, aber als sie den Strand erreichten, verschlug es ihnen die Sprache: So etwas hatten sie noch nie gesehen. Vor ihnen lag die Leiche einer Frau, das Gesicht im Kies vergraben, neben ihr ein toter Bär.
»Wir wurden von einer Joggerin alarmiert«, erklärte Chief Mitchell. »Sie hatte den Bären dabei überrascht, wie er sich über die Frau hermachte.«
»Was meinen Sie mit hermachen?«
»Na, wie er sie fraß eben!«
So wie die Frau auf dem Kies lag, hätte man fast meinen können, sie schliefe. Das Plätschern des Sees und das frühlingshafte Zwitschern der Vögel verliehen dem Ort etwas Friedliches. Nur der Bär, dessen schwarzes Fell von seinem Blut glänzte, erinnerte daran, welches Drama sich hier vor Kurzem abgespielt hatte.
Matt Vance wandte sich an Chief Mitchell: »Es tut mir sehr leid für die arme Frau, aber ich wüsste wirklich gern, warum Sie wegen eines Bärenangriffs die Mordkommission gerufen haben.«
»Es gibt hier jede Menge Schwarzbären«, antwortete Chief Mitchell, »wir haben damit eine gewisse Erfahrung, glauben Sie mir. Es ist schon zu vielen Zwischenfällen mit ihnen gekommen, doch wenn sie Menschen angreifen, dann nur, um ihr Territorium zu verteidigen, nicht weil sie sie als Beute betrachten.«
»Worauf wollen Sie hinaus?«
»Wenn der Bär diese Frau angefressen hat, heißt das, er ist hier als Aasfresser aufgetreten. Sie war bereits tot, als er sie gefunden hat.«
Gahalowood und Vance näherten sich vorsichtig der Leiche. Aus dieser Entfernung sah sie nicht mehr aus wie eine friedlich Schlafende. Ihre Kleidung war zerfetzt und gab den Blick auf tiefe Bisswunden frei. Ihre Haare waren von geronnenem Blut verklebt.
»Was hältst du davon, Perry?«, fragte Vance.
Gahalowood betrachtete das Opfer. Die Frau trug eine lederne Hose und elegante Stiefeletten.
»Sie ist gekleidet, als wollte sie ausgehen. Ich denke, sie wurde in der Nacht getötet. Die Verletzungen durch den Bären scheinen allerdings frisch zu sein.«
»Sie war also bereits tot, als der Bär sie fand«, wiederholte Vance, »wahrscheinlich bei Tagesanbruch.«
Gahalowood nickte: »Das sieht nicht gut aus. Ruf die Kavallerie.«
Vance zückte sein Handy, um Verstärkung zu holen und die Spurensicherung zu verständigen.
Gahalowood stand immer noch über die Leiche der Frau gebeugt. Dabei fiel ihm ein Stück Papier ins Auge, das aus der Gesäßtasche ihrer Hose ragte. Er zog sich Latexhandschuhe über und nahm es an sich.
Es war ein zweifach gefaltetes Blatt mit einer knappen, computergeschriebenen Nachricht darauf:
ICHWEISS, WASDUGETANHAST.
Es war fast Mittag, als ich in Aurora ankam.
Die Kleinstadt war, wie der Rest Neuenglands, mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt, die in der strahlenden Sonne schmolz. Jeder Vorwand war mir recht, hierherzukommen und die Erinnerungen wachzuhalten, die mich mit Harry Quebert verbanden.
KAPITEL 2
Erinnerungen
New Hampshire6. April 2010
Ehrlich gesagt hatte ich zunächst geglaubt, dass ich mit dem Schreiben und der Veröffentlichung von Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert einen Schlussstrich unter die abrupt beendete Freundschaft ziehen könnte. Doch die allgemeine Begeisterung, die das Buch hervorrief, erinnerte mich nur umso mehr daran, wie sehr mir die Sache zugesetzt hatte. Weniger durch die mittlerweile abgeschlossenen Ermittlungen oder deren Ergebnisse, sondern durch die noch immer unbeantwortete Frage: Wo war Harry Quebert? Was war mit ihm geschehen? Und warum hatte er beschlossen, aus meinem Leben zu verschwinden?
Ich habe in Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert ausführlich geschildert, was Harry und mich miteinander verband. Man muss das hier nicht alles wiederholen, aber doch darauf hinweisen, dass Harry damals so sehr an meine Zukunft als Schriftsteller glaubte, dass er mich zu sich nach Hause einlud, um mit mir an meinen Texten zu arbeiten. Das erste Mal fuhr ich im Januar 2000 nach Aurora. Ich lernte sein außergewöhnliches Haus in Goose Cove kennen, ein Schriftstellerdomizil fernab der Welt, direkt am Strand, erfuhr aber auch, wie einsam er war, was ich nie vermutet hätte. Der berühmte Harry Quebert, eine charismatische Figur, von allen verehrt, war in Wirklichkeit ein erstaunlich einsamer Mann, ohne Frau, ohne Kinder, ohne irgendwen. Ich erinnere mich noch gut an jenen Tag: Sein Kühlschrank war hoffnungslos leer. Als ich ihn darauf aufmerksam machte, erklärte er mir, er sei es nicht gewohnt, Gäste zu empfangen. Anschließend ging er mit mir zum Essen ins Clark’s, das Diner an der Hauptstraße, das ein fester Bestandteil von Harrys Legende war. Dort lernte ich Jenny Quinn, die Wirtin, kennen, die seit fünfundzwanzig Jahren für Harry schwärmte. Er hatte in dem Lokal seinen eigenen Stammplatz, Tisch Nr. 17, wo Jenny Quinn ein Schild mit der Aufschrift hatte anbringen lassen:
An diesem Tisch verfasste der Schriftsteller Harry Quebert im Sommer 1975 seinen berühmten Roman Der Ursprung des Übels.
Das1976 erschienene Buch Der Ursprung des Übels hatte Harry Ruhm und Ehre eingebracht. Als ich ihn voller Bewunderung zu diesem Roman befragte, verzog Harry das Gesicht:
»Ich habe als Autor nur einen Erfolg erzielt. Ich bin nur für diesen einen Roman bekannt.«
»Aber was für ein Roman! Ein Meisterwerk!«
Jenny kam, um unsere Bestellung aufzunehmen. Harry stellte mich mit den Worten vor: »Wenn dieser junge Mann so schreibt, wie er boxt, Jenny, dann wird ein großer Autor aus ihm werden.«
Als sie gegangen war, fragte ich Harry, was er damit gemeint habe. Woraufhin er mir antwortete: »Man möchte immer, dass ein großer Schriftsteller so ist wie die, die vor ihm geschrieben haben, und denkt dabei nicht daran, dass er gerade deshalb ein großer Schriftsteller ist, weil er ihnen nicht ähnelt.«
Als er sah, dass er mich nicht überzeugen konnte, fügte er hinzu: »Wissen Sie, Marcus, ich habe Sie erst vorhin bei mir zu Hause dabei beobachtet, wie Sie ehrfürchtig die Klassiker in meinem Bücherregal betrachtet haben. Sie sehen diese Bücher und fragen sich, ob man in fünfzig Jahren Ihre Bücher genauso verehren wird. Schreiben Sie ein Buch, das wäre schon mal ein Anfang. Und hören Sie auf, uns mit der Nachwelt auf die Nerven zu gehen.«
»Ich wünschte, ich wäre wie Sie, Harry.«
»Sie haben keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich werde alles tun, damit Sie nicht so werden wie ich. Genau deshalb sind Sie hier.«
Die Bedeutung dieses Satzes hatte ich nicht verstanden. Ich war nur ein junger Mann, der seinen Mentor kennenlernte. Wie hätte ich mir damals in meiner Naivität ausmalen können, welcher Krimi sich im Sommer 2008 in dieser friedlichen Kleinstadt abspielen und dazu führen würde, dass Der Ursprung des Übels, ein Roman, der als Hauptwerk der amerikanischen Literatur galt, über Nacht aus den Regalen der Buchhandlungen und Bibliotheken verschwand?
An jenem Tag im April 2010, zehn Jahre nachdem ich zum ersten Mal hierhergekommen war, parkte ich vor dem Clark’s. Marcus, einst ein verträumter Student, war zurückgekehrt, im Glanz seines Ruhms, aber ohne Harry.
Nach den Ereignissen des Sommers 2008 war das Lokal verkauft worden. Von den Gästen kannte ich niemanden, was mir ganz recht war, denn die meisten Einwohner der Stadt waren mir gegenüber, seit ich im Rahmen meiner Ermittlungen in Aurora viele schlafende Hunde geweckt hatte, nicht gerade wohlgesonnen. Abgesehen vom Besitzerwechsel hatte sich nichts geändert. Weder die Einrichtung noch die Speisekarte. Harrys Tisch war frei, also nahm ich dort Platz. Für die Stammgäste war es fortan der Tisch der Aussätzigen. An dem nur Leute saßen, die auf Durchreise waren. Im Sommer 2008 hatte man das Schild entfernt. Nur die Löcher der Schrauben waren geblieben, sie glichen Einschusslöchern, Spuren einer Hinrichtung. Ich bestellte einen Cheeseburger mit Pommes und schaute beim Essen aus dem Fenster.
Als ich damit fertig war, setzte sich Ernie Pinkas, der Stadtbibliothekar, zu mir. Ernie war meine letzte Stütze in Aurora. Er hatte ein großes Herz und eine ebenso große Leidenschaft für Bücher, die, seit er Witwer war, seine einzige Gesellschaft waren. Ernie leitete das Harry-Quebert-Haus für Schriftsteller, ein Programm, das ich in Zusammenarbeit mit dem Burrows College ins Leben gerufen hatte und das Harry Queberts Haus in Goose Cove in eine Schreibresidenz für vielversprechende junge Autoren verwandelt hatte. Der Skandal des Sommers 2008 hatte Harrys Ruf geschadet, ein Anziehungspunkt war sein Haus dennoch geblieben: Die Bewerber rissen sich um einen Aufenthalt an diesem prestigeträchtigen und komfortablen Ort. Ernie Pinkas traf die Auswahl, zusammen mit der Literarischen Fakultät von Burrows, die für die Instandhaltung des Gebäudes aufkam. Das Haus bot Platz für bis zu sechs Schriftsteller, die dort drei Monate lang zusammenlebten. Aufgrund seiner neuen Funktion verfügte Ernie in Burrows über ein kleines Büro, was ihn mit Stolz erfüllte.
Ernie setzte sich mir gegenüber: »Marcus, was machst du denn schon wieder hier?«
Sein Erstaunen rührte daher, dass er mich bereits eine Woche zuvor hier gesehen hatte, als ich auf dem Weg nach Montreal gewesen war. Wir hatten in Goose Cove einen Kaffee getrunken, und ich hatte die Gelegenheit genutzt, die neuen Stipendiaten zu begrüßen, die bis zum Sommer bleiben würden.
»Ich bin auf der Durchreise«, antwortete ich, »und habe hier haltgemacht, um schnell noch etwas zu essen.«
»Aus Montreal?«
Die Art, wie er das betonte, gab mir zu verstehen, dass er Bescheid wusste. Dass ich hier Harry oder meinen eigenen Gespenstern hinterherjagte.
»Deine Wege sind Irrfahrten geworden, Marcus«, sagte er zu mir.
Ernie hatte den Finger genau auf die Wunde gelegt. Er fuhr fort: »Weißt du, wer das immer gemacht hat?«
»Wer was immer gemacht hat?«
»Im Clark’s rumhängen. Harry. Ich habe mich immer gefragt, warum er stundenlang hier am Tisch saß und ins Leere starrte, so wie du jetzt. Ich dachte, er sucht nach Inspiration. Aber in Wirklichkeit wartete er auf Nola.«
Ich stieß einen langen Seufzer aus. »Ich möchte nur ein Lebenszeichen, Ernie.«
»Harry wird nicht mehr nach Aurora kommen.«
»Wie kannst du dir da so sicher sein?«
»Er hat ein neues Kapitel aufgeschlagen. Das solltest du auch tun.«
»Wie meinst du das?«
»Dank dir hat er ein neues Kapitel aufgeschlagen, Marcus. Er weiß jetzt, was mit Nola passiert ist. Er muss nicht mehr hier auf sie warten. Er konnte endlich gehen. Aurora war sein Gefängnis, und du hast ihn daraus befreit.«
»Nein, Ernie, Aurora war …«
»Du weißt, dass ich recht habe, Marcus«, unterbrach mich Ernie. »Du weißt, dass Harry nie wieder herkommen wird. Man kann nicht auf seine Freunde warten, wie man auf den Bus wartet. Warum bist du so stur und kreuzt hier immer wieder auf? Genieße das Leben. Hör auf, dir das Hirn zu zermartern. Du bist ein netter Kerl, Marcus. Es ist an der Zeit, etwas Neues zu beginnen.«
Ernie hatte recht. Aber nachdem ich zu Mittag gegessen hatte, konnte ich es nicht lassen, noch nach Goose Cove zu pilgern. Ich lief ein paar Schritte am Strand unterhalb von Harrys Haus entlang, bevor ich mich auf einen großen Felsen setzte und den Ort auf mich wirken ließ. Ich betrachtete das beeindruckende Anwesen, das so viele Erinnerungen barg. Auf dem Sand hüpften Möwen herum. Der Himmel bezog sich allmählich mit grauen Wolken, und es begann leicht zu nieseln. Dann sah ich zwischen Nebelschwaden einen Mann auftauchen, den ich als lieben Freund betrachte: Perry Gahalowood, Sergeant bei der Mordkommission der State Police von New Hampshire. Er kam mit einem amüsierten Lächeln auf mich zu, in jeder Hand einen Becher Kaffee.
Wer das Buch gelesen hat, weiß, was mich alles mit Gahalowood verbindet. Ich hatte Perry zwei Jahre zuvor kennengelernt, als er den berühmten Fall Harry Quebert bearbeitete. Gemeinsam hatten wir den Tod von Nola Kellergan endgültig aufgeklärt. Manche würden sagen, die Aufklärung des Mordes an Nola habe es mir ermöglicht, meinen zweiten Roman zu schreiben. Vor allem aber hatte sie mir ermöglicht, mit diesem außergewöhnlichen Polizisten Freundschaft zu schließen, der einer Wüstenfrucht ähnelte: stachelig, geschützt von einer dicken Schale, aber mit süßem Fruchtfleisch und einem weichen Kern. So war Perry Gahalowood: rau, ungeschliffen, jähzornig, aber treu, aufrichtig und gerecht. Man sagt, die Qualität eines Menschen lasse sich an seiner Familie ablesen, und seine Familie, die ich gut kannte, strahlte Glück aus.
»Sergeant« – seit dem Tag, an dem wir uns kennengelernt hatten, nannte ich ihn Sergeant und er mich Schriftsteller, und an dieser Tradition hielten wir fest – »was machen Sie denn hier?«
Er reichte mir einen der beiden Kaffeebecher. »Das sollte ich eher Sie fragen, Schriftsteller. Wussten Sie, dass jedes Mal, wenn Sie hier auftauchen, mindestens eine Person die Polizei ruft? Das zeigt, welch guten Eindruck Sie in dieser Stadt hinterlassen haben.«
»Sie sind schlimmer als meine Mutter, Sergeant.«
Er brach in Gelächter aus. »Welcher miserable Grund führt Sie nach Aurora, Schriftsteller?«
»Ich war auf dem Rückweg von Montreal und habe nur kurz Station gemacht.«
»Das ist ein Umweg von zwei Stunden«, bemerkte Gahalowood.
Ich deutete mit dem Kinn auf das den Elementen trotzende Haus. »Ich habe dieses Haus geliebt«, sagte ich, »ich habe diese Stadt geliebt. Man kann sich nicht aussuchen, was man liebt, und wenn man etwas liebt, dann ist es für immer.«
»Wenn Sie glauben, dass Sie diese Stadt lieben, dann irren Sie sich, Schriftsteller. Sie lieben die Erinnerungen an diesen Ort, das nennt man Nostalgie. Nostalgie ist die Fähigkeit, uns einzureden, dass unsere Vergangenheit größtenteils glücklich war und unsere Entscheidungen folglich die richtigen waren. Jedes Mal, wenn wir uns an etwas erinnern und uns sagen ›das war schön‹, ist es in Wirklichkeit unser krankes Gehirn, das uns stetige kleine Dosen Nostalgie verabreicht, um uns davon zu überzeugen, dass das, was wir erlebt haben, nicht umsonst war, dass wir unsere Zeit nicht vergeudet haben. Denn seine Zeit zu vergeuden heißt, sein Leben zu vergeuden.«
Als ich das hörte, dachte ich, dass ich solche philosophischen Überlegungen von Gahalowood, der sonst nur das Nötigste sagte, gar nicht kannte, und ahnte nicht, dass es dabei um ihn ging. Da ich mich angesprochen fühlte, sagte ich zu ihm: »Es war trotzdem gut in Goose Cove.«
»Gut für Sie? Da bin ich mir nicht so sicher. Sie sind der Schriftsteller des Jahrzehnts und treiben sich andauernd in einem Kaff in New Hampshire herum. Das letzte Mal habe ich Sie im Oktober hier gesehen, erinnern Sie sich?«
»Ja.«
»Ich dachte, Sie wären gekommen, um sich von diesem Haus zu verabschieden. Wir haben ein Bier getrunken, mehr oder weniger am gleichen Ort wie jetzt, und Sie haben mir irgendeinen Unsinn erzählt, Sie seien auf der Suche nach der Liebe. Das hat ja wohl nicht geklappt! Oder sind Sie immer noch mit der Pilotin zusammen?«
Perry Gahalowood war von allen am besten über die Entwicklungen in meinem Liebesleben informiert: Nach jedem neuen Abenteuer hatte ich ihn angerufen. Und als ich Raegan kennenlernte, hatte ich mich zuallererst ihm anvertraut.
»Ich glaube, das mit Raegan und mir, das ist schon was Ernstes.«
»Na, endlich eine gute Nachricht, Schriftsteller. Verbringen Sie bloß hier keinen Urlaub mit ihr, wenn Sie wollen, dass das auch so bleibt.«
»Stellen Sie sich vor: Ich fliege mit ihr auf die Bahamas.«
»Pfft! Ich fasse es nicht, Schriftsteller.«
»Auf eine Privatinsel, an einen fantastischen Ort. Wollen Sie Fotos sehen?«
»Das würde ich gern verneinen, aber ich fürchte, Sie werden sie mir trotzdem nicht ersparen.«
Wir saßen auf unserem Felsen, unbeeindruckt von dem Sprühregen, der auf uns niederrieselte, und plauderten über Belanglosigkeiten, ein ganz banaler Austausch zwischen zwei Freunden, an dem allein erwähnenswert ist, dass ich Gahalowood nicht fragte, was es bei ihm Neues gab. Ich erkundigte mich nach seiner Frau Helen und seinen Töchtern Malia und Lisa, aber wie es ihm denn so ging, danach erkundigte ich mich nicht. Ich bot ihm keine Gelegenheit, sich zu öffnen, und so endete unser Gespräch, ohne dass ich auch nur ahnte, was sich in seinem Leben anbahnte.
Als Gahalowood seinen Kaffee ausgetrunken hatte, erhob er sich.
»Müssen Sie zurück zu Ihren Fällen?«
»Nein, ich treffe mich mit Helen. Lisa hat heute Geburtstag, und wir müssen ein paar Besorgungen machen. Sie wird elf.«
»Schon elf Jahre! Wie fühlt sich das an, Papa Sergeant? Fühlt man sich da nicht ein bisschen alt?«
Statt zu antworten, machte Gahalowood nur ein trauriges Gesicht. Ich fragte ihn:
»Alles in Ordnung, Sergeant? Sie sehen nicht sehr fröhlich aus.«
»Leider weckt dieses Datum schmerzvolle Erinnerungen in mir. Vor genau elf Jahren, am 6. April 1999, geriet mein Leben aus den Fugen.«
»Was ist damals geschehen?«
Wie so oft, wenn er über sich selbst sprechen sollte, wechselte Gahalowood kurzerhand das Thema: »Nicht so wichtig, Schriftsteller. Heute Abend veranstalten wir für Lisa bei uns zu Hause ein Essen mit der ganzen Familie. Kommen Sie doch auch vorbei. Um achtzehn Uhr.«
»Mit dem größten Vergnügen. Ich kann sogar früher kommen, wenn Sie möchten.«
»Auf gar keinen Fall! Vor achtzehn Uhr aufzukreuzen ist strengstens verboten!«
»Zu Befehl, Sergeant!«
Er entfernte sich ein paar Schritte, drehte sich dann zu mir um und sagte in seinem üblichen provokanten Ton: »Glauben Sie bloß nicht, dass ich Sie als Familienmitglied betrachte, Schriftsteller. Aber Helen bringt mich um, wenn ich Sie nicht einlade.«
»Ich glaube gar nichts«, antwortete ich lächelnd.
Schließlich ging er. Ich blieb noch eine Weile am Strand sitzen und fragte mich, was wohl vor elf Jahren in Perrys Leben geschehen war. Ich hatte keine Ahnung von dem Drama, das ihn seit Jahren verfolgte, bis zu den Ereignissen, von denen ich Ihnen hier gleich erzählen werde.
DER TAG DES MORDES
3. April 1999
In der Kleinstadt Mount Pleasant herrschte eine ungewöhnliche Aufregung. Jeder fragte jeden, ob er schon etwas Neues wisse. In allen Geschäften gab es nur dieses eine Gesprächsthema. Egal, ob im Season, dem beliebten Frühstückscafé, in Cinzia Lockarts Buchladen oder im Jagd- und Angelgeschäft der Familie Carrey, die Kunden fragten einander: »Haben Sie etwas gehört?« – »Nein. Sie etwa? Haben Sie gesehen, was am Grey Beach los ist?« – »Meine Frau war dort, aber die Polizei hat alles abgesperrt.«
Das Einzige, was man in Mount Pleasant wusste, war, dass man am Grey Beach eine Tote gefunden hatte. Lauren Donovan, die Tochter von Janet und Mark Donovan, den Inhabern des Lebensmittelladens, hatte die Leiche beim Joggen entdeckt. Als die Nachricht die Runde machte, strömten die Menschen zu Donovan Lebensmittel & Feinkost, vorgeblich um einzukaufen, vor allem aber, um etwas mehr zu erfahren. Der Laden war immerzu voll, es herrschte fast ein Gedränge. Die Kunden stellten sich Mark oder Janet Donovan in den Weg, um sie unverblümt zu fragen:
»Ist Lauren da?«
»Nein.«
»Wissen Sie irgendwas darüber, was am Grey Beach passiert ist?«
»Ich weiß auch nicht mehr. Lauren ist noch bei der Polizei. Entschuldigen Sie, aber all die Kunden hier wollen bedient werden.«
»Wenn Sie etwas erfahren, sagen Sie uns bitte Bescheid!«
Während in Mount Pleasant die Neugierigen auf ihren Fragen sitzen blieben, entwarfen die Ermittler am Grey Beach mögliche Antworten. Das Seeufer und der umliegende Wald wurden von gut fünfzig Beamten der örtlichen Polizei und der State Police durchkämmt. Am Strand arbeiteten Teams der Spurensicherung an der Leiche, die immer noch mit dem Gesicht nach unten im Kies lag. Und auf dem Parkplatz untersuchten die Kriminaltechniker das blaue Cabrio. Laut Nummernschild war das Auto auf eine gewisse Alaska Sanders zugelassen. Auf dem Beifahrersitz lag eine Handtasche, in der sich sogar ihr Führerschein befand.
Als ihr Name fiel, sorgte das unter den örtlichen Polizisten für Aufregung: Alaska war eine junge Frau aus Mount Pleasant.
»Wir müssten ihr Gesicht sehen, um sie eindeutig identifizieren zu können«, sagte Chief Mitchell zu Gahalowood und Vance, während der Gerichtsmediziner sich an dem leblosen Körper zu schaffen machte.
»Was können Sie uns über sie sagen?«, fragte Vance.
»Ein unauffälliges Mädchen. Vor ein paar Monaten ist sie hierher zu ihrem Freund gezogen. Sie arbeitete an einer Tankstelle in der Nähe.«
»Woher kennen Sie sie?«
»In Mount Pleasant kennt jeder jeden.«
Nachdem der Rechtsmediziner die ersten Untersuchungen abgeschlossen hatte, nahm er die Leiche und drehte sie um, sodass man ihr Gesicht sehen konnte. Chief Mitchell fluchte bei dem Anblick. Mehrere Polizisten aus dem Ort kamen dazu, und es erhob sich ein Geraune.
»Ist sie das?«, fragte Gahalowood.
»Ja.«
Gahalowood und Vance näherten sich der Leiche.
»Nun, Doc?«, fragte Vance den Rechtsmediziner.
»Sie kennen mich, Sergeant, ich äußere mich nicht gerne vor der Autopsie. Aber was ich Ihnen jetzt schon sagen kann, ist, dass der Tod mitten in der Nacht eingetreten sein muss. Gegen ein oder zwei Uhr. Wahrscheinlich verursacht durch einen Schlag auf den Hinterkopf. Das Opfer weist eine große Wunde im Schädelbasisbereich auf. Der Bär ist daran völlig unschuldig.«
»Dann handelt es sich also um Mord.«
»So viel steht fest. Sie wurde mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Den Rest erzähle ich Ihnen, sobald ich die Obduktion durchgeführt habe.«
»Und wann wird das sein?«
»Baldmöglichst.«
»Das ist keine Antwort«, bemerkte Vance.
»Für mich schon«, gab der Rechtsmediziner unbekümmert zurück.
Gahalowood und Vance standen eine Weile schweigend da und betrachteten die Leiche. Plötzlich rief eine Stimme: »Ich hasse Morde in Kleinstädten. Es stecken immer schmutzige Geschichten dahinter.«
Das war Captain Morris Lansdane, der Leiter der Mordkommission der State Police.
»Was machen Sie denn hier, Captain?«, fragte Vance. »Ich dachte, Sie hätten Urlaub.«
»Doch nicht, wenn hier die Hölle los ist! Der Oberhäuptling« – damit spielte Lansdane auf den Leiter der State Police von New Hampshire an, eine Position, die er einige Jahre später selbst übernehmen sollte – »will wissen, was los ist, und hat mich um einen Lagebericht gebeten. Womit also haben wir es zu tun?«
Gahalowood berichtete: »Das Opfer ist eine zweiundzwanzigjährige Frau namens Alaska Sanders, die aus Salem, Massachusetts, stammt. Sie wurde heute Nacht durch einen Schlag auf den Hinterkopf getötet.«
Vance fuhr fort: »Ihr Auto wurde auf dem Parkplatz in der Nähe des Strandes gefunden. Es war nicht abgeschlossen. Im Kofferraum befand sich eine Reisetasche mit einigen Kleidungsstücken, und auf dem Beifahrersitz lag ihre Handtasche.«
»Ein Gelegenheitsverbrechen?«, fragte Lansdane.
»Das bezweifle ich«, antwortete Gahalowood. »Bei dem Opfer wurde ein Drohbrief gefunden. Ein computergeschriebener Satz: Ich weiß, was du getan hast.«
»Hm. Mord aus Rache?«
»Vielleicht. Die Reisetasche deutet jedenfalls darauf hin, dass sie irgendwohin unterwegs war. Oder vor irgendetwas auf der Flucht.«
»Ich werde mir die Kontaktdaten ihrer Eltern besorgen«, sagte Vance. »Ich möchte sie gerne schnell benachrichtigen. Wir sind hier in einer Kleinstadt, die Polizisten aus dem Ort plaudern wahrscheinlich gern mal was aus. Ich möchte nicht, dass die Familie es aus den Nachrichten erfährt.«
»Sie haben recht«, stimmte Lansdane zu. »Ich lasse Sie weiterarbeiten. Das heißt, warten Sie … was ist das für eine Geschichte mit dem Bären? Davon reden hier alle.«
»Die Leiche wurde von einer Joggerin entdeckt, die einen Bären dabei überrascht hat, wie er sie zerfleischte«, erklärte Gahalowood.
Lansdane verzog angewidert das Gesicht. »Haben Sie mit der Joggerin gesprochen?«
»Noch nicht. Sie wartet an der Tankstelle in der Nähe auf uns. Wir wollten jetzt gleich mit ihr reden.«
Aber da wurden sie von einem Polizisten unterbrochen. »Sie werden im Wald gebraucht«, sagte er. »Man hat dort etwas gefunden. Kommen Sie, folgen Sie mir!«
Gahalowood, Vance und Lansdane folgten dem Polizisten, der in einen Trampelpfad einbog. Sie bahnten sich einen Weg durch den lichtdurchfluteten Wald, zwischen Farnen und jahrhundertealten Stämmen, bis sie zu einem ausgedienten, von Brombeeren und Gestrüpp zugewucherten Wohnwagen kamen, vor dem eine Gruppe von Polizisten wartete.
»Wir sind nicht reingegangen«, erklärte einer von ihnen, »wir haben nur einen Blick durch die halb offene Tür geworfen.«
»Und …?«, fragte Gahalowood.
»Sehen Sie selbst«, forderte der Polizist ihn auf und reichte ihm eine Taschenlampe.
Die Wohnwagenfenster waren abgedunkelt, und als Gahalowood seinen Kopf ins Innere streckte, sah er erst einmal nichts als Finsternis. Dann entdeckte er im Lichtkegel seiner Lampe ein großes Durcheinander: aufgeschlitzte Matratzen, Müll, Zigarettenstummel. Vor allem aber lag auf dem Boden ein Pullover mit braunroten Flecken. Gahalowood betrat den Wohnwagen, um ihn sich näher anzuschauen: Das Kleidungsstück war blutbefleckt.
»Die Spurensicherung soll diesen Ort sofort gründlich unter die Lupe nehmen«, entschied Gahalowood.
Vance und er erkundeten die Umgebung. Etwa zehn Meter weiter stießen sie auf einen Forstweg, der kaum breit genug für ein Fahrzeug war. Am Boden entdeckte Vance Splitter eines zertrümmerten Rücklichts und an einem Baumstamm frische Aufprallspuren.
»Sieht aus wie schwarzer Lack«, sagte er, nachdem er sich die Stelle genauer angesehen hatte.
Am Mittag erhielten Robbie und Donna Sanders einen Anruf von Sergeant Matt Vance. Nach dem Gespräch standen die Eltern wie betäubt mit dem Hörer in der Hand da. Am Boden zerstört. Ihre Welt war zusammengebrochen.
200 Kilometer entfernt, auf der Blumenwiese zwischen dem Wald von Grey Beach und der Route 21, klappte Vance sein Handy zu und kehrte zu Gahalowood zurück, der in ihrem Wagen auf ihn wartete.
»Scheißblumen«, fluchte er und zertrat absichtlich eine Forellenlilie. »Alaskas Eltern wollen am Abend zu uns ins Hauptquartier kommen.«
»Danke, dass du das übernommen hast«, sagte Gahalowood und klopfte ihm brüderlich auf die Schulter.
»Das ist doch selbstverständlich, Perry, bei euch ist ein Kind unterwegs. Du solltest überhaupt nicht hier sein und dir dieses Grauen ansehen müssen.«