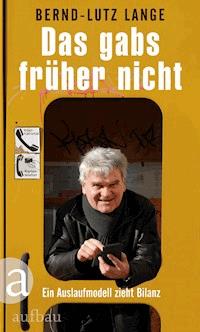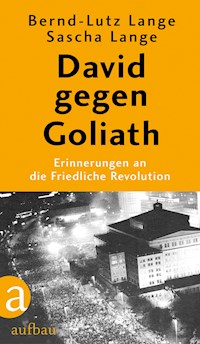7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
»Dass das Leben einem Purzelbaum sehr ähnlich ist, merkt man erst, wenn man sich im letzten Drittel befindet. Die Zeit dreht sich, so kommt es einem vor, immer schneller. Eben hatte ich doch die Weihnachtssachen erst in den Keller gepackt, und nun steht schon wieder ein Baum im Zimmer zum Anputzen bereit.« Von Mendelssohn bis Masur, von Ringelnatz über Reimann bis Rühmann, von Schorsch Mayer bis Wolfgang Mattheuer – hier kommen sie alle zu Wort. Der Autor und Kabarettist Bernd-Lutz Lange hat sich umgesehen in Geschichte und Gegenwart. Er hat nach Lutherscher Manier dem Volk aufs Maul geschaut, hat Literaten, Künstler und Wissenschaftler nach unvergesslichen Lebensmomenten befragt. Aus diesem reichen Material komponiert er eine Sammlung humorvoller, manchmal auch nachdenklicher Erzählungen und Anekdoten, die den Bogen von der Reformation bis in unsere Zeit schlägt. Bei der Lektüre bestätigt sich einmal mehr: „So wie die Erde aus den Kratern die Diamanten hochschleudert …, so hinterlässt das Menschenleben und das, was man die Geschichte nennt, die Anekdoten. Dass ich Diamanten zusammengetragen hätte, nehme ich für mich natürlich nicht in Anspruch – die wurden von den Meistern der Sprache vor hundert Jahren geschliffen. Ich gebe mich damit zufrieden, wenn diese Texte von Ihnen als farbige Glasperlen empfunden werden. Aber funkeln sollten sie schon …“ Bernd-Lutz Lange möchte seine Leser unterhalten, ihnen die Heiterkeit des Seins vor Augen führen – und das gelingt ihm auf diesem Spaziergang durch die Jahrhunderte ganz fabelhaft. In seinem Buch will er der Schnelllebigkeit der Zeit mit anekdotischen Fundstücken entgegenwirken. Ein heiteres Buch mit einer Prise Melancholie. "Lange begeistert als Beobachter der Zeitgeschichte." Dresdner Neueste Nachrichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Ähnliche
Bernd-Lutz Lange
Das Leben ist ein Purzelbaum
Von der Heiterkeit des Seins
Mit Illustrationen von Egbert Herfurth
Impressum
Mit Illustrationen von Egbert Herfurth
ISBN E-Pub 978-3-8412-0336-6
ISBN PDF 978-3-8412-2336-4
ISBN Printausgabe 978-3-351-02737-7
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Januar 2012
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die Originalausgabe erschien 2011 bei Aufbau,
einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung hißmann, heilmann, hamburg
unter Verwendung eines Motivs von Egbert Herfurth
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN - die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
Vorwort
Setzense sich!
Vom Geist der Alma mater Lipsiensis
Stammtische
Meister der Farbe
Schriftsteller in Leipzig
Vor und hinter den Kulissen
Musica, du holde Kunst
Messetrubel
Aus bunter und grauer Vorzeit
Über das wunderliche Leben im Osten Deutschlands
Verwendete Literatur
Personenregister
Dank
Fußnoten
|7|Vorwort
Dass das Leben einem Purzelbaum ähnelt, merkt man erst, wenn man sich im letzten Drittel befindet. Die Welt dreht sich, so kommt es einem vor, immer schneller. Die Jahreszeiten rauschen vorbei. Eben hatte ich die Weihnachtssachen in den Keller gepackt und nun steht schon wieder ein Baum im Zimmer zum Anputzen bereit …!
Beim Purzelbaum scheint sich die Welt um einen zu drehen, und man sitzt anschließend etwas benommen auf der Wiese. Was war da gleich?
Dieses Buch schlägt einen Purzelbaum von der Reformation bis in die Gegenwart. Ich habe dafür meine Anekdotenmappe geplündert.
Das Lexikon hat mich belehrt, dass »anekdota« aus dem Griechischen kommt und »nicht herausgegeben« bedeutet. Es geht um eine »knappe Erzählungsform für seltsame oder heitere Erlebnisse, oft in einer Pointe gipfelnd«.
Sie werden also Episoden aus dem Leben von bekannten und unbekannten Menschen und Begebenheiten aus historischen Epochen finden. Die Lektüre soll Sie möglichst zum Schmunzeln bringen. Wenn sich diese Absicht nicht erfüllt, hätte der Band seinen Zweck leider verfehlt.
Henri Bergson hat 1914 bei Eugen Diederichs in Jena ein Buch mit dem Titel »Das Lachen« veröffentlicht. 134 Seiten nur über das Lachen, aber leider überhaupt nicht lustig! Das schafft eben nur ein Philosoph.
Ein großer Geist, dessen Werk ich besonders schätze, war der Wiener Egon Friedell: Schauspieler und Kabarettist, |8|Theaterkritiker und Kulturphilosoph, Dramatiker und Regisseur, Satiriker und Aphoristiker. Mehr geht nicht. Ich glaube, diese Vielzahl von Talenten – in einem Menschen vereint – gibt es heute nicht mehr. Die Schnelligkeit unseres Lebens lässt universelle Bildung kaum mehr zu.
Friedell war auch Berufskollege, er wurde 1908 künstlerischer Leiter des Kabaretts »Die Fledermaus«. Das Wiener Multitalent hatte eine besondere Neigung zur Anekdote, zu dieser kleinen literarischen Form, in der er Meister war, und er sagte darüber: »Oft wird ein ganzer Mensch durch eine einzige Handbewegung, ein ganzes Ereignis durch ein einziges Detail schärfer, einprägsamer, wesentlicher charakterisiert als durch die ausführlichste Schilderung. Kurz: die Anekdote in jederlei Sinn erscheint mir als die einzig berechtigte Kunstform der Kulturgeschichtsschreibung.«
In unserer schnelllebigen Zeit ist die Anekdote bei den meisten Autoren auf der Strecke geblieben. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die Kultur des Kaffeehauses fehlt. Denn dort, in der Gesellschaft diverser Spötter, war die Geburtsstätte so manch heiterer Miniatur. Nicht umsonst stammen die besten Anekdoten aus dem Wien der K.u.k.-Zeit.
Der überragende Friedrich Torberg hat jener untergegangenen Welt in seiner »Tante Jolesch« ein faszinierendes Denkmal gesetzt.
Noch einen weiteren Zeugen für diese kurze literarische Form will ich aufrufen. Walter Kiaulehn war in den zwanziger Jahren in Deutschland ein sehr geschätzter und bekannter Feuilletonist. Er schrieb in seinem Buch »Mein Freund der Verleger« (damit ist Ernst Rowohlt gemeint) im Jahr 1967 folgendes: »Die schiefen Urteile über den Feuilletonismus kommen entweder aus böser Absicht oder sie beruhen auf dem Missverständnis, die Anekdote mit Tratsch zu verwechseln. Der Tratsch entsteht aus Schlüssellochguckerei, |9|doch die Anekdote ist der Ganzblick auf eine Persönlichkeit oder einen Zustand. So wie die Erde aus den Kratern die Diamanten hochschleudert …, so hinterlässt das Menschenleben und das, was man die Geschichte nennt, die Anekdoten.«
Dass ich Diamanten zusammengetragen hätte, nehme ich für mich natürlich nicht in Anspruch – die wurden von den Meistern der Sprache vor hundert Jahren geschliffen.
Ich gebe mich damit zufrieden, wenn diese Texte von Ihnen als farbige Glassplitter empfunden werden. Aber ein wenig funkeln sollten sie schon …
|11|Setzense sich!
Von ABC-Schützen, Pennälern und Paukern
|12|Wenn meine Patentante, eine Grundschullehrerin, zu Besuch kam, holte sie nach einer Weile meistens einen Zettel aus ihrer Handtasche, um uns die neuesten Stilblüten von ihren Schülern vorzulesen. Ihr herzliches Lachen, das sie manchmal den Satz bis zur Pointe kaum zu Ende bringen ließ, klingt mir noch im Ohr.
Haben heute die Lehrer keine Zeit mehr für das Sammeln solch kindlichen Humors?
Von den zwei, drei Pädagogen in meinem Bekanntenkreis habe ich noch nie eine Schulanekdote erzählt bekommen. Sind sie so mit Aufgaben eingedeckt, dass dafür keine Muße mehr bleibt?
Im »Leipziger Kalender«, der ab 1904 erschien und den die Dampfbuchbinderei Legel fertigte (da wurde ordentlich Dampf gemacht!), fand ich mehrere Artikel unter der Überschrift »Aus der Mappe eines alten Schulmannes«. Der namenlose Autor hat sich damals die Zeit für solche Aufzeichnungen genommen. Seinen Kuriositäten habe ich noch einiges aus meiner Sammlung des sächsischen Kindermundes hinzugefügt.
Adam und Eva sind aus dem Paradiese verstoßen! Bange folgen die Kinder der Erzählung des Lehrers. Ein Bild wird umhergereicht, auf dem die Schuldigen wehmütig das dornenbesäte Feld betreten. Ihr hartes Schicksal erregt allenthalben Mitleid. Nur der kleine Karl sagt ungerührt: »Da schdehnse nu un heiln! Häddnse de Äbbl nich gefrässn!«
|13|Bleiben wir noch in der Religionsstunde: Fritz träumt vor sich hin, als über die Vertreibung aus dem Paradies gesprochen wird. Der Lehrer bemerkt dies und fragt ihn: »Weshalb wurden Adam und Eva aus dem Paradiese vertrieben?«
Fritz überlegt kurz und sagt dann: »Sie werden wohl in die Beete getreten sein.«
Der Junge hatte vermutlich schon Erfahrung mit einem Schutzmann im kaiserlichen Deutschland gesammelt, denn da herrschte bekanntlich Ordnung!
Im Zusammenhang mit der Weihnachtserzählung sagt der Lehrer: »Abends, wenn es langsam finster wurde, dann setzten sich die Hirten gemütlich ans Feuer. Und was taten sie dann wohl?«
Ein Gastwirtstöchterchen weiß es aus Erfahrung: »Sie spielten bestimmt ein bisschen Skat!«
In der Weihnachtszeit hörte der Kantor einer Gohliser Kirche die Kinder singen: »Uns ist ein Kindlein heut gebor’n von einer Jungfrau aus dem Chor.«
Gar nicht unmöglich! Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn manche Kinder singen: »O du fröhliche, o du selige knabenbringende Weihnachtszeit.«
Nicht erfunden, das alles ist tatsächlich passiert.
Axel Hacke hat ja über solche Hörfehler, die besonders bei Kindern verbreitet sind, ganze Bücher geschrieben. Und da kann ich noch einmal meine Patentante ins Spiel bringen. Sie amüsierte sich einmal köstlich über den Text eines Liedes, das ich sang, holte sofort ihren Mann und bat mich Zehnjährigen, den Schlager zu wiederholen.
Das Original lautete (und das habe ich nach so vielen Jahrzehnten immer noch im Kopf!): »Bravo, bravo, beinah wie Caruso, ja, so singt Filippo, tralalalalalala.«
|14|Ich hatte aber verstanden und sang im Brustton der Überzeugung: »Bravo, bravo, Beine wie Caruso …«
Zurück zur alten Penne.
Ein Schüler in einer Klasse begreift den Lehrstoff prinzipiell etwas langsamer. Ehe der Lehrer im Unterricht etwas Neues durchnimmt, sagt er deshalb immer: »Wir können erst weitergehen, wenn es Fritzsche verstanden hat!«
Nach dem Examen nun hält der Schuldirektor eine feierliche Ansprache, gibt den Kindern gute Ratschläge für das weitere Leben. Schließlich will er als Mann der Religion auf die Bedeutung des Segens von oben verweisen und fragt: »Aber auf wen kommt doch zuletzt alles an?«
Da ruft der kleine Hans Schmalfuß durch den Saal: »Auf Fritzsche!«
Es werden die zehn Gebote wiederholt. Einen Jungen hat die Natur mit Verstand etwas sparsam ausgerüstet. Kurzum, er hat keine Ahnung, als er das siebente Gebot aufsagen soll. Der Lehrer spricht ihm in eindringlichem Tone vor: »Du sollst nicht stehlen!«
Da kommt plötzlich die Wahrheit ans Licht: »Ich hab bloß offgebaßd, genomm hadds mei Vaadr alleene!«
Die Sache wird wohl ein Nachspiel gehabt haben …
Ein junger Lehrer, das hatte sich herumgesprochen, ist heimlich verlobt.
Im Religionsunterricht will er darüber sprechen, dass Gott allgegenwärtig ist. So fragt er: »Wenn ich abends allein durch den Wald gehe, wer ist da doch bei mir?«
Zu seiner großen Verblüffung antwortet ihm darauf ein Mädchen: »Fräulein Schulze.«
Ein anderer Religionslehrer schildert den Weltuntergang in den düstersten Farben.
»Dann wird sich der Himmel verfinstern, Wolkenbrüche |15|überschwemmen das Land, Blitze zucken und ein gewaltiger Sturm braust über die Erde!«
Der Lehrer hält in seinen dramatischen Ausführungen inne. Da kommt es seelenruhig aus einer Bank: »Saachnse mal, wärn mir bei so een Sauwädder edwa ooch Schule hamm?«
Das wollen wir für den kleinen Frager nicht hoffen.
Nach der Schöpfungsgeschichte ist Anna etwas noch nicht klar: »Härr Lehrer, hadd Godd wärglich alle Diere geschaffn?«
»Natürlich.«
»Ooch die Rähchnwärmer, de Schnäggn un de Schbinn?«
»Auch die.«
»Ooch de Flieschn, de Miggn un de Moddn?«
»Selbstverständlich.«
Kurze Pause des Erstaunens. Dann kommt die lakonische Feststellung: »Wie gonnde dähr sich nur midd soä Fiebselgrahm abgähm?!«
Für so etwas hat man doch normalerweise seine Leute!
Ein Lehrer will den Kindern erklären, dass die Tiernamen verschiedene Geschlechter haben. Er fordert sie auf, Tiere zu nennen.
»Das Mäuschen.«
»Das Kätzchen.«
»Das Hündchen.«
Dem Lehrer platzt der Kragen. »Mäuschen, Kätzchen, Hündchen! Ihr sollt die Tiernamen nicht immer verkleinern! Es heißt die Maus, die Katze oder der Hund! Franz, nenn du mir ein Tier!«
Franz zögert und meint: »Wie wäre es mit – das Kanin.«
Der zweite Schultag bei den ABC-Schützen. Sie haben dem Lehrer schon ihre Namen gesagt. Nun heißt es Auskunft geben über den Beruf der Eltern.
|16|»Fellbaum, was ist denn dein Vater?«
Der kleine Held schweigt.
»Aber du musst doch wissen, was dein Vater ist!«, ermuntert ihn der Magister.
»Nee, das weeß ich nich! Mei Vater, der is egal ä was annersch!«
Es gab eben auch schon vor hundert Jahren dynamische Persönlichkeiten!
Sehen wir einmal in den Heimatkunde-Unterricht.
Vor den Kleinen hängt eine Abbildung vom Felde. Ein Landmann steht hinter dem mit zwei starken Pferden bespannten Pflug. Kräftig schwingt er die Peitsche.
Der Lehrer fragt: »Wie heißt der Mann, der so fleißig arbeitet draußen auf dem Felde?«
»Das ist der … Feldwebel!«
Möglich wäre ja auch der Generalfeldmarschall.
Der Lehrer spricht mit den ABC-Schützen in einer Dorfschule bei Leipzig über die Einrichtung der Schulstube. Da gibt es nicht – wie zu Hause – ein Sofa oder eine Wanduhr, sondern hier steht das Pult, dort hängt die Wandtafel, da ist ein Papierkorb.
»Wozu ist der Papierkorb da?«
Alle Schüler wissen Bescheid. Der Lehrer verweist darauf, dass vom Frühstücksbrot keine Reste in den Papierkorb gehören. In dem Moment fällt ihm ein, dass unlängst eine Maus von den Krümeln partizipierte. »Obwohl, ganz so schlimm ist es auch wieder nicht, denn wenn ihr auf den Hof hinausgeht und es ganz still in der Schulstube ist, dann dauert es nicht lange, da schleicht sich jemand ganz leise an den Papierkorb und ißt die kleinen Bröckchen geschwind auf. Wer ist das wohl?«
Da tönt es ihm im Brustton der Überzeugung entgegen: »Der Lehrer!«
Man traute denen eben schon von jeher allerhand zu.
|17|Die Schulanfänger, in Leipzig von älteren Schülern »Achtenkrutscher« genannt, haben ein Vierteljahr die Schulbank gedrückt. Da wird einer gefragt, was sie denn derzeit im Unterricht so machen würden. Die lakonische Antwort: »Nischd Neies, mir läsn immer noch!«
Der hatte keine Ahnung, dass sich das bis zum Ende durchziehen würde!
Am 8. Mai 1905, am Tag vor der Schillerfeier anlässlich des Dichters 100. Todestag, kommt ein Knabe nach Hause und meint zu seiner Mutter: »Wir haben morgen keine Schule, weil eine Feier ist, aber wir sind noch zu klein und dürfen nicht mitfeiern.«
»Und was ist das für eine Feier?«
»Vor hundert Jahren ist ein Schieler gestorben.«
Bleiben wir gleich bei dem großen deutschen Dichter. Der Lehrer zitiert Friedrich Schiller: »Da werden Weiber zu Hyänen.« Und er fragt: »Wo kommt das vor?«
»In den besten Familien!«, ruft ein Schüler.
Wo er Recht hat, hat er Recht!
In einer Klasse mussten die Knaben ein Rechenexempel lösen. Dabei ging es um den Salzgehalt des Meeres. Bei dieser Gelegenheit fragte sie der Lehrer, ob die Jungen überhaupt wüssten, woher der Salzgehalt des Meeres käme.
Großes Kopfzerbrechen. Allgemeines Schweigen.
Dann hatte einer der Jungs schließlich eine Erleuchtung: »Der kommt von den Heringen.«
Grammatik. »Wer von euch kann ›haben‹ im Präsens konjugieren?«
Der kleine Heinrich versucht es: »Ich habe … du hast … er hat … da hammrsch, da habdrsch, da hammses!«
Sozusagen sächsische Grammatik.
In der Oberklasse einer Schule werden die Leipziger |18|Denkmale behandelt. Als das Leibnizdenkmal dran ist, fragt der Lehrer, wer etwas von Leibniz wisse.
»Der hat den Keks erfunden.«
Also, ganz ehrlich: Das könnte bestimmt auch heute noch passieren …
Es soll ja Sachsen geben, die sich ihres Dialektes etwas schämen und ihre Kinder ermahnen, sich einer besseren Aussprache zu befleißigen. Manchmal geht es aber auch total daneben:
Große Hitze in der Stadt.
»Muddie, mir isses so heeß!«
»Schbrich nich so säggs’sch, mei Junge! Das heißd nich heeß. Heiß heeßds!«
|19|Soviel zu den kleinen Schülern, nun zu den großen und ihren mitunter unfreiwillig originellen Lehrern. Im Dezember 1997 schickte mir Fred Rose, den ich durch meine Beschäftigung mit der jüdischen Geschichte Leipzigs kennen gelernt hatte, aus dem fernen kanadischen Toronto einen Brief mit Stilblüten des Studienrats Kurt Reichenbach. Er unterrichtete am König-Albert-Gymnasium. Das stand einst gegenüber dem Zoo und wurde im Krieg zerstört. In Freds Klasse, damals hieß er noch Siegfried Rose, ging auch der später berühmte – und einzige in Leipzig geborene – Nobelpreisträger: Bernard Katz. Er wurde von der Queen geadelt. Katz floh 1934, nach seiner Promotion an der Leipziger Universität, vor den Rassendiskriminierungen der Nazis nach England.
Die Stilblüten des Lehrers Reichenbach hatte Helmut Jerusalem gesammelt, ein Mitschüler, der aber nicht, wie man bei solch einem Namen glauben könnte, jüdischer Herkunft war, sondern, wie Fred Rose schrieb, »anständiges Mitglied der HJ, und im Zweiten Weltkrieg leider verschollen – wie vier andere, aber jüdische Mitschüler unserer Klasse. Am Ende, nämlich 1937, wurde ich als letzter jüdischer Schüler herausgeschmissen – aus Leipzigs bestem humanistischem Gymnasium!
Von unserer Klasse leben nur noch acht und wir haben uns einige Male wieder getroffen. Die anderen sind gefallen, vergast oder nach dem Krieg verstorben. Ein Stück deutscher Geschichte.«
Auf der mitgeschickten Ablichtung eines Klassenfotos sehen den Betrachter 26 junge Burschen an, die meisten ziemlich ernst. In den Unterrichtsstunden vom Geschichtslehrer Kurt Reichenbach grinsten oder lachten sie ziemlich oft.
Der Chronist nannte die Sammlung: »Der neue Galletti« |20|bzw. »Gallettiana« nach jenem Professor Johann Georg Galletti, der im 18. Jahrhundert in einem Gymnasium in Gotha unterrichtete und mit seinem unfreiwilligen Humor die Schüler erheiterte.
Aussprüche wie »Alexander wurde einundzwanzig Jahre vor seinem Tod vergiftet« oder »Nach der Schlacht von Leipzig sah man Pferde, denen drei, vier oder noch mehr Beine abgeschossen waren, herrenlos herumlaufen« machten in Schulen die Runde. Besonders absurd ist auch diese Stilblüte: »Es gibt viele, die nicht reden, wenn sie verstummen sollten, und andere, die nicht fragen, wenn sie geantwortet haben.«
Die Aussprüche des Pädagogen Kurt Reichenbach blieben also der Nachwelt erhalten. Hier einige Kernsätze des teilweise sehr zerstreuten Lehrers (am Telefon meldete er sich einmal mit »Hier Studienbach Reichenrat«), der oft zur Bestätigung mitten im Satz oder am Ende ein »nich« mit einem leicht angehängten »a« folgen ließ:
»Wenn Sie denken, Sie können mir auf dem Kopf herumtrampeln, dann sind Sie aber auf dem Holzweg, nich’a!«
»Scharnhorst zog die Rekruten aus und bildete sie ein.«
»Als Ludwig XV. nach seinem Tode gestorben war, folgte ihm Ludwig XIV. auf den Thron … umgekehrt natürlich, nich’a …«
»Der Soldatenkönig gründete neben Kriegsschulen Mädchenpensionate, um der Verwilderung Einhalt zu gebieten.«
»Ich bin vielleicht dreimal so alt wie Sie – oder sogar zweimal!«
»Er war von Geburt an von schwankender Gesundheit.«
»Wenn Ihnen die Art, wie ich vortrage, nicht passt, können wir ja mal was lernen!«
»Joseph I. hatte zwei Töchter, eine davon war Karl VI.«
|21|»Es regierte zu dieser Zeit in Polen der … Bautzmann! Passen Sie auf!«
»Die Sonne kam, so daß Friedrich seinen Stuhl herausbringen ließ und sich da ruhte … Ich weiß wirklich nicht, was es da zu lachen gibt!«
»Südneuostpreußen oder – wie man auch sagen kann – Südneuostpreußen hatte …«
»Als Friedrich der Große von seinem Tode erfuhr, war er den ganzen Morgen sehr ernst und still …«
»Wenn ich Reich gefragt habe, habe ich eben nur Reich gefragt, nich’a, ich möchte es nicht bis hierher vorgesagt haben!«
»Aber die, die immer wie die Philosophen dasitzen und nur feixen, sollen sich über ihre Zensuren wundern.«
»Messejuseps, oder wie das Ding heißt, ist ein Land in Amerika …«
»Wer den natürlichen Anstand nicht von zu Hause mitbringt, dem werden wir das hier beibringen, nich’a, und wenn das nicht gelingt, dann geht er woandershin.«
»Busse! Wenn Sie müde sind, gehen Sie raus und legen sich beim Hausmeister aufs Sofa.«
»Man muß die Straße senkrecht überschreiten.«
»Das Mitnehmen von Personen auf Fahrrädern ist verboten, außer Personen über unter acht Jahren, aber es muß ein besonderes Gesäß, nein … ein … ein … Sattel angebracht sein …«
»Das sieht ja kümmerlich aus, wenn Sie Ihren edlen Leib so emporheben …«
»Er redete nicht nur von der Besiedlung des Volkes, sondern er suchte auch den Viehbestand zu heben durch Veredlung des Rindviehs …«
»Peter der Erste, nein, Zweite, vielmehr der Dritte, na, ich weiß es auch nicht mehr so genau, nich’a, also Peter von Russland …«
|22|»Wenn Sie so lange auf der Schule sind wie ich, nich’a, können Sie sich auch mal versprechen, nich’a.«
Der Lehrer Reichenbach scheint geradezu der »Feuerzangenbowle« entsprungen zu sein. Und mit diesem Buch hatte ja wiederum der Leipziger Schriftsteller Hans Reimann viel mehr zu tun, als in der Öffentlichkeit Deutschlands bekannt ist. Lassen wir dazu seinen Enkel Andreas zu Wort kommen, der in Leipzig als geschätzter Dichter lebt und in der Publikation »Beschreiben und Bezeichnen« aus dem Leben seines Großvaters und auch über die Vorgeschichte der »Feuerzangenbowle« einiges erzählt. Denn dass dieser als Autor unbekannt ist, hat ganz bestimmte Gründe …
»… Nun hatte Hans R. 1921 eine ätzende Parodie auf das antisemitische Elaborat ›Die Sünde wider das Blut‹ von Artur Dinter unter dem Titel ›Artur Sünder. Die Dinte wider das Blut‹ veröffentlicht. Zehn Jahre später unterschrieb er beim gleichen Verleger einen Vertrag, in dem er sich verpflichtete, Hitlers ›Mein Kampf‹ durch den Kakao zu ziehen. Von ›vorausschauenden‹ Nazis gewarnt, kniff er.«
Der Leipziger Publizist Wolfgang U. Schütte, ein Fachmann für – vor allem auch – vergessene Literatur der zwanziger Jahre, nannte mir in einem Gespräch dazu einen Namen: Hanns Johst, der 1935 Präsident der Reichsschrifttumskammer wurde. Mit diesem Johst spazierte Reimann irgendwann vor der sogenannten Machtergreifung der Nazis ein Stück des Weges und erzählte ihm von seinem Plan, Hitlers Kampfschrift zu parodieren. Das Buch sollte unter dem Titel »Mein Krampf« erscheinen. Johst sagte darauf in etwa zu Reimann: »Machen Sie das nicht. Man schlägt Sie tot!« Reimann hat das ernst genommen und dazu hatte er auch allen Grund. Mit seinem Verleger Paul Steegemann bekam er deshalb im Jahr 1932 noch Probleme, |23|denn Steegemann verklagte ihn wegen des nicht abgelieferten Manuskriptes.
Reimann hat schon früh Hitler satirisch angegriffen. In seinem 1925 erschienenen Buch »Sago« findet sich das Gedicht »Sein Bart«:
»Eines Morgens löste Hitlers Bart sich von der Lippe,
Wie ein mohrenschwarzer Schmetterling hob er die Flügel,
Schwebte adlergleich dahin zum Teutoburger Walde,
Armins, des Cheruskers, Denkmal mit Respekt zu grüßen,
Und sodann, von Völkischkeit erfüllt, zu Wotan eilend,
In den patentierten Allgermanengötterhimmel,
Richard Wagner saß zur Rechten, Felix Dahn zur Linken,
Um die Wette tranken süßen Met die drei Kumpane,
Und der mohrenschwarze Schmetterling trank heimlich mit,
Trank und trank, und trunken kehrte er zurück zur Erde,
Kehrte rück auf Adolf Hitlers ahnungslose Lippe,
Und wie teutscher Honig fleußt’s seitdem von seinem Munde.«
Als die Nazis 1933über Nacht an die Macht kamen, war Reimann natürlich wegen der geplanten »Verhohnepipelung ihrer Heilsschrift« (Andreas Reimann) mulmig zu Mute.
Sein Plan hatte sich ja durchaus da und dort herumgesprochen. Und nun kommen wir zum Eigentlichen – zur Geschichte der »Feuerzangenbowle«. Andreas Reimann schreibt weiter in der genannten Publikation: »1932 hatte Hans R. im Antiquariat das Reclam-Heftchen ›Besuch im Karzer‹ von Ernst Eckstein ergattert und erwog, zusammen mit Heinrich Spoerl ein Filmszenario daraus zu entwickeln. |24|Damit die Geschichte in sich stimmig würde, begab er sich hernach inkognito an ein Gymnasium in Neusalz an der Oder und spielte dort in etwa die Rolle des ›Pfeiffer mit drei f‹ durch. Da sich das Filmprojekt zunächst nicht realisieren ließ, schrieb er in kürzester Frist seinen Roman ›Die Feuerzangenbowle‹ und bat den ideell beteiligten Spoerl, das Buch mit dem Autorennamen Spoerl zu veröffentlichen, da er die Nazis vorerst nicht darauf aufmerksam machen wollte, dass er selbst noch existierte.«
So erschien die Geschichte unter Heinrich Spoerl.
Noch einmal Andreas Reimann: »1933 schrieb Hans R. dann das Drehbuch für den Rühmann-Film ›So ein Flegel‹ und später auch für den berühmtesten Aufguß des Stoffes, ›Die Feuerzangenbowle‹.«
Heinz Rühmann schreibt in seinen Memoiren: »Ich kannte den Roman von Heinrich Spoerl, denn ich hatte die Rolle schon einmal, 1934, gespielt. Damals hieß der Film ›So ein Flegel‹, und das Drehbuch war nicht von Spoerl …« Ansonsten lobt er Heinrich Spoerl, aber der Name Reimann fällt gar nicht. Die wahren Zusammenhänge scheinen ihm unbekannt zu sein. (Auch in einem anderen Fall wird Reimann vergessen: Er hat mit Max Brod zusammen den »Schwejk« dramatisiert, den Piscator mit großem Erfolg auf die Bühne brachte. Aber der berühmte Herausgeber der Wochenzeitung »Die Literarische Welt«, Willy Haas, nennt wiederum in seinen Erinnerungen nur Max Brod – Künstlerpech …)
Die beiden Autoren Reimann und Spoerl einigten sich jedenfalls, den Gewinn immer zu teilen. Das wurde auch bis zum Schluss praktiziert. Reimann hat nach dem Krieg versucht zu belegen, dass er der Hauptautor des Buches ist, und wollte auch, dass sein Name im Zusammenhang mit der »Feuerzangenbowle« erscheint, aber er konnte sich bei Gericht nicht durchsetzen.
|25|Dabei scheint mir der Beweis, dass Reimann der eigentliche Autor des Romans ist, schon eindeutig genug, wenn man nur den 1918 (!) erschienenen Band »Das Paukerbuch« – Skizzen vom Gymnasium – liest. Hier hat Reimann bereits ins volle Pennälerleben gegriffen und ähnlich kuriose wie auch böse Lehrer aus seinen Schuljahren an der Leipziger Nikolaischule beschrieben.
Lassen wir ihn einmal selbst zu Wort kommen: »Französisch gab Professor Ramsthaler.
Das war ein ganz kleines Männchen, aber ein arroganter, eingebildeter Patron«, »sein Spitzname war Caligula. Erstens des caesarischen Auftretens, zweitens seiner unberechenbaren Launen wegen und drittens, weil er in winzigen Stiefelchen einherstolzierte.
Auf die Dauer war Caligula zu lang und umständlich, und esverschliff sich – philologisch nicht einwandfrei – zu ›Kax‹.
Daß er ein Pflaumen=Männchen war, sagte ich bereits.
Was ihm an Größe abging, suchte er durch imponierendes Auftreten und hohe Absätze gutzumachen.
Er war grausam und gebärdete sich wie eine Gottheit.
Wer in seinen Stunden nieste oder sonstwie ein unbedeutendes Geräusch von sich gab, der wurde unweigerlich in Arrest gesteckt.
Die Folge dieser despotischen Überhebung war, daß im ›Französischen‹ der tollste Radau vollführt wurde. Man verstand mitunter sein eigenes Wort nicht.
So konnte keiner bestraft werden ...
... Der ›Kax‹ polterte beim Sprechen, wie wenn jemand die Wendeltreppe hinunterkullert, und sein drittes Wort war ›Schweunereu‹.«
Sein Spitzname war ihm natürlich bekannt – dafür sorgte die Klasse. Er stand groß an der Tafel, an der Wand oder am Fenster. Betrat der Lehrer das Zimmer, hörte man aus allen Bänken: Kax!
|26|Ganz Mutige wagten sogar noch mehr:
»… Einer zupfte ihn am Rockschoß:
Wuppdich schoß er herum und brüllte: ›Sö Flögöl!‹
Der Bösewicht begehrte auf: ›Ich weiß von nichts, Herr Professor!‹
›Lögen Sö nücht!‹
›Aber Herr Professor, ich versichere Ihnen …‹
›Sö dommer Jonge Sö!‹
›Herr Professor, ich versichere Ihnen ehrenwörtlich…‹
›Natörlich sönd Sö dör Frövler göwösn!‹
Der Rest des kurzweiligen Zwiegespräches erstickte in einer Lawine von Geheul und Gejaul.«
Reimann lernt in der »Nickelpenne« Lehrer kennen, die ihm als »von Psychologie unbelastete Dinosaurier« erscheinen, als »menschenunähnliche Reproduziermaschinen«. So zum Beispiel »der cand. rev. min. Heilemann. Der junge, rotgesichtige Herr mit dem Zwicker am Schnürsenkel, der nicht nur den kleinen Katechismus, sondern auch (aushilfsweise) Turnen lehrte. Dieser Heilemann hat mir in der Turnstunde (hintereinander ohne Pause, durch mein starres Erschüttertsein angefeuert) zwölf Ohrfeigen heruntergehauen, weil ich am Reck einen Klimmzug probierte, ohne Befehl dazu gehabt zu haben.«
Reimann gibt schließlich den inhumanen, stets missgelaunten Paukern die Schuld, dass sie durch ihr Verhalten aus ihm, »einem braven, arglosen Jungen«, letztlich einen solchen Flegel gemacht haben, der sogar in Betragen eine Vier verpasst bekam und von der Schule geworfen wurde. Das war bis dahin in der Nicolaitana noch nicht vorgekommen. Die pädagogische Anstalt befand sich übrigens Ecke König- (heute Goldschmidt-) und Stephanstraße am Johannistal.
Natürlich gab es auch ein paar freundliche Lehrer. Und |27|Reimann bekennt in einem Nachwort: »Richtig ist, dass ich die netten Lehrer verschwiegen habe. Wir hatten nämlich tatsächlich welche.«
Aber die geben für einen satirischen Autor nicht so viel her …
Kurios finde ich, dass Hans Reimann, der die alte deutsche Penne mit ihren teilweise kuriosen Lehrern so perfekt parodierte, sich ein Leben lang der exakten deutschen Sprache gewidmet, gegen deren Missbrauch gewettert und darüber auch humoristisch-satirisch geschrieben hat. Zum Beispiel in seinem »Vergnüglichen Handbuch der deutschen Sprache«. (Er würde heute mit seinen Texten über den Irrgarten der deutschen Sprache wie Bastian Sick Hallen füllen!) Und so ist er schließlich auch ohne Schule hinter dem Katheder gelandet. Lassen wir darüber Thomas Mann zu Wort kommen: »Die Deutschen haben nie einen so lustigen (und heimlich strengen) Deutschlehrer gehabt.«
Auch Georg Witkowski, Professor für deutsche Literatur an der Universität Leipzig, bis ihm die Nazis 1933 Lehrverbot erteilten, ging seinerzeit (einige Jahre vor Reimann) in die Nikolaischule. Sein Urteil über die Lehrer fiel allerdings in den Erinnerungen »Von Menschen und Büchern« nicht so verheerend aus wie bei Hans Reimann. Er lobte den Direktor Theodor Vogel, einen »wahrhaft vornehmen Charakter, in dessen Wesen sich tiefe Gläubigkeit mit edelstem Humanismus einte«. Erwähnte positiv Mehlhorn, Pfarrer an der Reformierten Gemeinde zu Leipzig. Weiterhin den tapferen »Atheist Niedermüller, der sich beim Morgengebet stets schweigend zum Fenster wandte«, und den durch seine »Sprachdummheiten« berühmt gewordenen Wustmann.
»Feuerzangenbowle«-Niveau besaß offensichtlich der Physiklehrer von Georg Witkowski, »wegen seiner hochroten |28|Gesichtsfarbe ›Krebs‹ genannt.« Der tauchte auch schon bei Reimann auf: »Er wurde ›Kröps‹ genannt, weil er aussah wie ein gekochter Krebs, und weil er das Wort Krebs aussprach wie ›Kröps‹.«
Jener Lehrer scheint vor seinen physikalischen Versuchen immer sehr aufgeregt gewesen zu sein. Und das Ende vom Lied war, dass die Experimente zumeist misslangen – sehr zum Gaudi der Nikolaischüler. In solchen Situationen »wiederholte er noch öfter als sonst sein stetes Verlegenheitswort ›nemmlich‹.« Einmal bedrängten ihn die Schüler am Tisch bei seinen Versuchen, er wurde in der Enge immer nervöser und sagte den schönen mißverständlichen Satz: »Sie sehen doch nemmlich, wie beschränkt ich bin.«
Der »Krebs« war mehrere Jahre in Java gewesen und hatte auch darüber Erheiterndes zu berichten: »Nemmlich als ich nach Java kam, gab es daselbst noch viele wilde Esel, als ich aber die Insel verlassen hatte, war nemmlich nicht ein einziger mehr da.«
Eines Tages erhielt ich aus den USA Post von einem ehemaligen Pfarrer, der nahe der kanadischen Grenze bei einem Freund Urlaub machte, sich als Leser meiner Bücher vorstellte und gern einmal mit mir sprechen würde, um mir Erinnerungen an seine Zeit als Schüler der Thomasschule zu erzählen. Die hatte er in politisch wahrlich brisanten Zeiten besucht: von 1940 bis 1948. Wir trafen uns im Café Grundmann. Gottfried Wolff war viele Jahre Pfarrer in Holzhausen gewesen und lebt nun bei Magdeburg. Er wirkte in seiner lebhaften Art auf mich überhaupt nicht wie ein 80jähriger.
Mit sieben Jahren hatte er ein ganz besonderes Erlebnis. Er war mit einer Gruppe Kinder auf einer Wanderung im Bayrischen, als plötzlich Angehörige der SS angefahren kamen und zwölf Kinder auswählten, denen ihrer Meinung |29|nach eine große Ehre widerfuhr. Die Gruppe befand sich nämlich in der Nähe des legendären Berghofes … und dann kam er auch schon, der merkwürdige Mann mit dem kleinen Bärtchen unter der Nase, und schnarrte Gottfried an: »Wie heißt du? Woher kommst du?«
Der kleine Leipziger Bub machte seinen Diener, sagte »Guten Tag« und beantwortete brav die Fragen, aber eins fühlt er noch nach so vielen Jahrzehnten: »Ob Sie es mir glauben oder nicht, Herr Lange, sein Händedruck war mir schrecklich unangenehm. Er hatte eine wabblige Hand, die verursachte mir so ein komisches Gefühl, dass ich noch genau weiß, wie ich mir anschließend instinktiv meine Hand an der Hose abgewischt habe.«
Von der Aktion wurden Fotos gemacht und dann war der ganze Tross schon wieder wie ein Spuk verschwunden.
Gottfried Wolff, der 1942 unter Günther Ramin die Matthäuspassion mitgesungen hat, erzählte mir von einem mutigen Geografielehrer in der Thomasschule, der mit den Schülern die Kriegs- und vor allem Frontsituation auf besondere Weise besprach. In die Aussprache flossen von den Schülern Informationen, die sie zum Beispiel von der BBC erfahren hatten. »Ich kann mich noch an die Rede von Thomas Mann erinnern, an die Informationen von Radio Beromünster aus der deutschsprachigen Schweiz oder dem Moskauer Rundfunk, wo die Akteure des Nationalkomitees Freies Deutschland sprachen. Und die ganze Klasse hat über Jahre dichtgehalten! Kein Denunziant! Da ist nie etwas herausgekommen! Wenn der Lehrer mit der Ankündigung zur derzeitigen Situation begann, klopften alle Schüler auf der Bank das Pausenzeichen des Londoner Rundfunks.«
Unglaublich! Und das mitten im Nazi-Deutschland!
Ich wollte von Pfarrer Wolff unbedingt den Namen dieses Lehrers erfahren, aber da ließ ihn leider sein Gedächtnis |30|im Stich. Am selben Tag begann ich zufällig ein Buch zu lesen, das vom Schulmuseum Leipzig herausgegeben wurde: »Kinder in Uniform – Generationen im Gespräch über Kindheit und Jugend in zwei deutschen Diktaturen«. Darin stieß ich auf ein Interview mit Hans-Jürgen Bersch, der ebenfalls in der Nazizeit, allerdings in einer anderen Klasse als Wolff, Schüler der Thomasschule war: »… Für den Erdkunde-Unterricht war damals vorgeschrieben, in den ersten zehn Minuten auf die Geografie einzugehen, in der sich die aktuellen Kampfhandlungen abspielten. Unvergessen sind uns bis heute die mutigen und kaum verschlüsselten Interpretationen, die unser damaliger Geografielehrer für die ›planmäßigen Absetzbewegungen‹, die ›Frontbegradigungen‹ und ähnliches fand – reines Wortgeklingel in den täglichen Berichten des Oberkommandos der Wehrmacht, mit dem Verluste und Rückzüge umschrieben wurden. Dass dieser mutige Dr. Alfred Martin …« – da hatte ich also plötzlich den Namen! – »… dem ich hier ein Denkmal setze, jede seiner Stunden stereotyp mit einem donnernden ›Bericht zur Lage‹ begann und fein lächelte (aber nie einschritt), wenn die ganze Klasse darauf unisono mit vier Faustschlägen auf die Tische reagierte, bummbummbummbumm, eine Imitation des Kennungssignals für deutsche Nachrichtensendungen der Londoner BBC –, und daß dies nie verpfiffen wurde, empfinde ich im Nachhinein als wahres Wunder.«
Es sei noch ergänzt, dass sich diese Töne auf eine Stelle der 5. Sinfonie von Beethoven beziehen und damit letztlich aus London vom anderen, humanistischen deutschen Geist Kunde gaben.
Gottfried Wolff erzählte mir auch, dass sein Deutschlehrer 1942 die Klasse ein Diktat über den Feldzug Napoleons gegen Russland schreiben ließ. Er zog so absichtlich unabsichtlich eine Parallele zu den Ereignissen des Krieges. |31|Dieser Deutschlehrer hatte keine Illusionen, als er der Klasse den Text mit dem bekannten Ausgang diktierte: Für Napoleon endete der Feldzug im Chaos.
Anfang Januar kamen Werber von der SS in die Klasse und versuchten, die 14jährigen Schüler für jenen teuflischen Verein zu gewinnen. Allein, die Klassenkameraden von Gottfried Wolff hatten alle Ausreden parat, es fand sich niemand.
Eine der letzten kriegerischen Auseinandersetzungen in Leipzig fand am Felsenkeller statt. Und Wolff kannte einen der Hitlerjungen, die mit der Panzerfaust einen amerikanischen Panzer angriffen, und er weiß, dass der später – wie er – Theologie studierte. Vielleicht seine Art der Sühne …
Am 18. April begrüßte er mit seinen Freunden die Amerikaner. Am Abend genossen sie erstmalig wieder nach Jahren der Verdunklung eine helle Stadt. Die Jungs fanden kleine Pappkartons mit Pistolenmunition und tauschten sie mit den Amis gegen Schokolade.
Bald rubelte Gottfried in einem Geschäft in der Ritterstraße Silberbestecke in Zigaretten um. Eine Zigarette brachte 7 Mark, ein Dreipfundbrot kostete 70 Mark.
Und noch etwas aus jener Zeit ist ihm unvergesslich: »Das habe ich noch nie irgendwo gelesen. Am 20. April 1945 kam ich zum Hauptbahnhof. Da haben die Amis die Bevölkerung an einer bestimmten Stelle vorbeigetrieben. Dort waren aus Latten drei Verschläge gebaut. Darin kauerte jeweils eine Person. SS-Offiziere. Es erinnerte mich etwas an den Zoo.«
Vielleicht, so kam mir in den Sinn, waren diese SS-Leute an dem Verbrechen in Abtnaundorf beteiligt gewesen, wo Häftlinge kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner entweder auf den Todesmarsch getrieben oder bestialisch ermordet worden waren.
|33|Vom Geist der Alma mater Lipsiensis
Kuriositäten von gelehrten Herren und gelehrigen Studenten
|34|Ich hätte gedacht, dass es in der 600jährigen Geschichte der Leipziger Universität eine Fülle von Anekdoten über Professoren und Doktoren geben würde. Allein dies stellte sich als Irrtum heraus – sie wurden vermutlich in den Studentenkneipen am Abend erzählt, wo man sich dann darüber erheiterte, aber sie wurden selten aufgeschrieben. Und oft waren sie am nächsten Tag, vermutlich wegen des Alkoholkonsums am Vorabend, schlichtweg vergessen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!