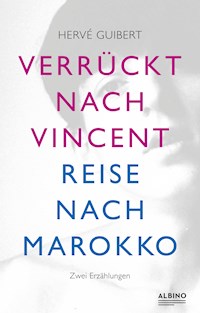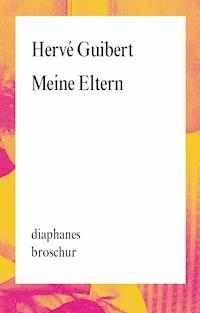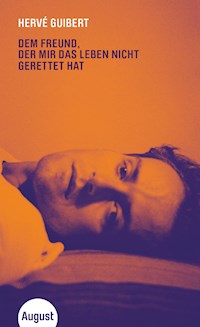
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: August Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Freundschaften in Zeiten von HIV/Aids: Der Roman einer Epoche – wieder erhältlich! In erschütternder Klarheit schildert "Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat" die Erfahrung einer Aids-Diagnose in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre. Wir folgen dem Erzähler von einem Arzttermin zum nächsten. Wir erfahren vom Fortschreiten der Krankheit, den Reaktionen der Freunde und Freundinnen und immer wieder von den Versprechen auf Heilung, an die sich der Erzähler klammert, wie von der tiefen Verzweiflung, in die ihn ihre Enttäuschung stürzt. Das Buch, 1990 bei Gallimard erschienen, löste in Frankreich einen Skandal aus. Schnell wurde Michel Foucault als der im Buch beschriebene Freund des Erzählers identifiziert, von dessen letzten Monaten der Roman parallel berichtet. Binnen kürzester Zeit wurde das Buch ein Bestseller. Guibert setzte seine Dokumentation des Lebens mit der damals sicher tödlich verlaufenden Krankheit in zahlreichen Texten fort, die vielfach erst nach seinem Tod 1991 veröffentlicht wurden. Es ist der intime, zugleich kühle wie zärtliche Ton, der bei aller ungeschönten Brutalität die besondere Qualität dieser Texte ausmacht: Wie wenige andere Autor*innen rang Guibert mit den Möglichkeiten der Sprache, um der ganzen Spannweite des Krankseins Ausdruck zu verleihen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HERVÉ GUIBERT
DEM FREUND, DER MIR DAS LEBEN NICHT GERETTET HAT
Aus dem Französischen von Hinrich Schmidt-Henkel
Roman
August Verlag
Der Roman Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat erschien 1990 im französischen Original bei Gallimard. 1991 wurde er in der Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel im Rowohlt Verlag veröffentlicht. Die vorliegende Ausgabe wurde auf Grundlage der Übersetzung von 1991 an die neue deutsche Rechtschreibung angepasst und vom Übersetzer durchgesehen.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
1
Ich hatte drei Monate lang Aids. Genauer, ich glaubte drei Monate lang, ich sei durch die tödlich verlaufende Krankheit verurteilt, die Aids genannt wird. Und in der Tat war es keine Einbildung, ich war wirklich erkrankt, ein Test mit positivem Ergebnis bestätigte es, ebenso Analysen, die bewiesen, dass mein Blut schon auf dem Weg des Verfalls war. Doch nach drei Monaten ließ mich ein unerhörter Glücksfall glauben, ja gab mir beinahe die Gewissheit, dass ich dieser Krankheit entkommen könnte, die alle Welt noch für unheilbar hielt. So, wie ich niemandem außer einigen Freunden, man kann sie an den Fingern einer Hand abzählen, anvertraut hatte, dass ich verurteilt war, so vertraute ich niemandem außer diesen wenigen Freunden an, dass ich davonkommen, dass ich, durch diesen unerhörten Glücksfall, weltweit einer der Ersten sein würde, die diese unerbittliche Krankheit überleben.
2
Heute, da ich dies Buch beginne, am 26. Dezember 1988, in Rom, wohin ich allein gefahren bin, gegen den Willen aller, auf der Flucht vor dieser Handvoll Freunde, die, um meine seelische Gesundheit besorgt, mich zurückzuhalten versuchten, am heutigen Feiertag, da alle Läden geschlossen haben und jeder Passant ein Ausländer ist, in Rom, wo mir endgültig klar wird, dass ich die Menschen nicht liebe, wo ich also, bereit zu allem, sie zu fliehen wie die Pest, nicht weiß, mit wem noch wohin ich essen gehen soll, mehrere Monate nach jenen drei Monaten, in denen ich mir nach bestem Wissen meiner Verurteilung sicher war, und nach den darauf folgenden Monaten, da ich dieses unerhörten Glücksfalls wegen glauben durfte, begnadigt zu sein, zwischen Zweifel und Hellsicht, mit der Mutlosigkeit wie auch mit der Hoffnung am Ende, weiß ich nicht, woran ich mich bei irgendeiner dieser entscheidenden Fragen oder bei dieser Alternative von Verurteilung und Begnadigung halten soll, weiß ich nicht, ob diese Rettung eine Falle ist, in die man mich wie in einen Hinterhalt gelockt hat, um mich zu beruhigen, oder wahrhaftig ein Science-Fiction-Abenteuer mit mir als einem der Helden, weiß ich nicht, ob es nicht lachhaft menschlich ist, an diese Gnade und an dies Wunder zu glauben. Ich ahne die Architektur dieses neuen Buchs, das ich all die vergangenen Wochen in mir zurückgehalten habe, aber seinen Verlauf von Anfang bis Ende kenne ich nicht, ich kann mir mehrere Möglichkeiten vorstellen, wie es ausgeht, die im Augenblick sämtlich schlimmen Vorahnungen oder einem Wunschdenken entspringen, doch der Zusammenhang seiner Wahrheit ist mir noch verborgen; ich sage mir, dass dies Buch seine Existenzberechtigung aus nichts anderem bezieht als aus jenem schmalen Rest von Ungewissheit, der allen Kranken der Welt gemeinsam ist.
3
Ich bin allein hier, und man bemitleidet mich, man ist um mich besorgt, man findet, ich schade mir, jene Freunde, die man, wie Eugénie meint, an den Fingern einer Hand abzählen kann, rufen mich regelmäßig voll Mitgefühl an, mich, der ich gerade entdeckt habe, dass ich die Menschen nicht liebe, nein, ich liebe sie entschieden nicht, ich hasse sie, und das könnte alles erklären, diesen von jeher zähen Hass, ich beginne ein neues Buch, um einen Gefährten zu haben, einen Gesprächspartner, jemanden, mit dem ich essen und schlafen, neben dem ich träumen und Alpträume haben kann, der einzige noch erträgliche Freund. Mein Buch, mein Gefährte, das ursprünglich, vom Vorsatz her, so streng sein sollte, hat schon begonnen, mich nach seiner Pfeife tanzen zu lassen, obgleich doch dem Anschein nach ich der unumschränkte Kapitän auf dieser Sichtfahrt bin. Ein Teufel hat sich in meinen Schiffsbauch eingeschlichen: T. B. Ich habe aufgehört, ihn zu lesen, um die Vergiftung aufzuhalten. Es heißt, jede erneute Einspritzung des Virus durch Flüssigkeiten, Blut oder Sperma, greife den schon infizierten Kranken erneut an, man behauptet das vielleicht, um den Schaden zu begrenzen.
4
Der Zerstörungsprozess, der in meinem Blut begonnen hat, greift von Tag zu Tag weiter um sich und lässt meinen Fall zurzeit als Leukopenie erscheinen. Die jüngste Analyse, sie stammt vom 18. November, gibt mir 368 T4-Zellen, ein Mann verfügt bei guter Gesundheit über rund 1000 bis 1300 davon. Die T4-Zellen sind jene Gruppe weißer Blutkörperchen, die das Aids-Virus hauptsächlich angreift und wodurch der Immunschutz nach und nach geschwächt wird. Die schwersten Attacken, die Pneumocystis, welche die Lungen, und die Toxoplasmose, welche das Hirn befällt, schalten sich im Bereich unter 200 T4-Zellen ein; mittlerweile verzögert man sie mittels Verschreibung von AZT. Zu Beginn der Geschichte von Aids nannte man die T4-Zellen „the keepers“, die Hüter, und die T8-Zellen, eine andere Fraktion der Leukozyten, „the killers“, die Mörder. Vor dem Auftauchen von Aids hatte ein Erfinder von Computerspielen das Umsichgreifen der Krankheit im Blut vorgezeichnet. In seinem Spiel für Jugendliche erschien das Blut auf dem Bildschirm als Labyrinth, in dem der Pac-Man umherschweift, ein gelber, von einem Hebel gesteuerter Shadok, der im Vorbeigehen alles frisst, die verschiedenen Gänge von Plankton leert und dabei zugleich von immer zahlreicher umherwimmelnden roten, noch gefräßigeren Shadoks bedroht wird. Wollte man das Pac-Man-Spiel, das sich einige Zeit gehalten hat, bevor es aus der Mode kam, auf Aids übertragen, so bildeten die T-Zellen die Urbevölkerung des Labyrinths, die T8-Zellen wären die gelben Shadoks, bedrängt von HIV, dies wiederum durch die roten Shadoks verkörpert, die danach gieren, mehr und mehr Immunplankton zu vertilgen. Lange bevor die Untersuchungen mir die Gewissheit meiner Erkrankung bestätigten, hatte ich das Gefühl, mein Blut sei plötzlich freigelegt, entblößt, als sei es immer von einem Kleidungsstück oder einer Kapuze beschützt worden, ohne dass es mir bewusst gewesen wäre, da es selbstverständlich war, und als habe etwas, ich begriff nicht was, diesen Schutz entfernt. Ich musste fortan mit bloßgelegtem, ausgesetztem Blut leben, wie der entkleidete Körper einen Alptraum durchqueren muss. Mein Blut war entlarvt, überall, allerorten und für immer, es sei denn, unwahrscheinliche Transfusionen würden ein Wunder bewirken, mein Blut war nackt zu jeder Zeit, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn ich auf der Straße ging, war unablässig von einem Pfeil bedroht, der zu jeder Zeit auf mich zielte. Sieht man es den Augen an? Meine Sorge ist weniger, ob ich mir einen menschlichen Blick bewahren kann, sondern ob mein Blick womöglich allzu menschlich wird, wie jener der Gefangenen in NACHT UND NEBEL, dem Dokumentarfilm über die Konzentrationslager.
5
Ich spürte das Nahen des Todes im Spiegel, in meinem Blick im Spiegel, schon lange bevor er sich in ihm wirklich festgesetzt hatte. Trieb ich diesen Tod schon mit meinem Blick in die Augen der anderen? Ich habe es nicht allen gesagt. Bis jetzt, bis zum Buch, hatte ich es nicht allen gesagt. Wie Muzil hätte ich gern die Kraft gehabt, den unsinnigen Stolz und auch die Großmut, es überhaupt niemandem zu sagen, um die Freundschaften frei wie die Luft leben zu lassen und sorglos und ewig. Doch wie soll das gehen, wenn man erschöpft ist und es der Krankheit gelingt, sogar die Freundschaft zu bedrohen? Einigen habe ich es gesagt: Jules, dann David, dann Gustave, dann Berthe, Edwige wollte ich es nicht sagen, doch ich spürte schon beim ersten Frühstück, wie das Schweigen und die Lüge sie grauenhaft weit von mir entfernten, und dass, würden wir uns nicht augenblicklich wieder der Wahrheit unterordnen, es unwiederbringlich zu spät sein würde, also habe ich es ihr gesagt, um treu zu bleiben, ich habe es unter dem Druck der Ereignisse Bill sagen müssen, und mir schien es, als verliere ich im selben Augenblick alle Freiheit und alle Kontrolle über meine Krankheit, und dann habe ich es Suzanne gesagt, denn sie ist so alt, dass ihr vor nichts mehr graut, sie hat niemals jemanden geliebt außer einem Hund, um den sie an dem Tag weinte, als sie ihn ins Tierheim abschob, Suzanne, die dreiundneunzig Jahre alt ist und deren Lebenserwartung ich mit diesem Bekenntnis einholte, welches ihr Gedächtnis auch unwirklich werden lassen oder von einem Augenblick zum anderen auslöschen konnte, Suzanne, die ohne Weiteres bereit war, etwas so Ungeheures auf der Stelle zu vergessen. Ich habe es Eugénie nicht gesagt, ich esse mit ihr in der Closerie, sieht sie es mir an den Augen an? Ihre Gesellschaft langweilt mich mehr und mehr. Ich habe den Eindruck, nur noch zu Menschen interessante Beziehungen zu haben, die Bescheid wissen, alles ist null und nichtig geworden und zusammengebrochen, wertlos und reizlos, alles rings um diese Mitteilung, wenn ihr nicht mehr Tag um Tag freundschaftlich begegnet wird, wenn mein Sträuben mich im Stich lässt. Es meinen Eltern sagen, das hieße mich dem aussetzen, dass mir die ganze Welt im selben Augenblick die Fresse zuscheißt, es hieße, mir von allen Arschlöchern dieser Erde die Fresse vollscheißen, mir die Fresse mit ihrer stinkenden Scheiße zukacken zu lassen. Meine allererste Sorge in dieser Geschichte ist, vor den Blicken meiner Eltern geschützt zu sterben.
6
Es wurde mir einfach so klar, und ich sagte es Dr. Chandi, sobald er die Entwicklung des Virus in meinem Körper zu verfolgen begann, Aids ist nicht wirklich eine Krankheit, und es als eine solche zu bezeichnen, vereinfacht die Dinge, sondern es ist ein Zustand von Schwäche und Ergebung, welcher dem Tier, das man in sich trug, den Käfig öffnet, dem Tier, dem ich gezwungenermaßen unumschränkte Vollmacht gebe, damit es mich verschlingt, ich muss mir lebendigen Leibes antun lassen, was an meinem Leichnam zu tun es sich anschicken würde, um ihn zu zersetzen. Die Pneumozystis-Pilze, würgende Boas für Lunge und Atem, und die Toxoplasmose-Erreger, die das Hirn zerrütten, leben im Inneren jedes Menschen, nur verwehrt ihnen das Gleichgewicht seines Immunsystems schlicht und einfach das Bürgerrecht, während Aids ihnen grünes Licht gibt und die Schleusen der Zerstörung öffnet. Ohne Wissen um die Zähigkeit dessen, was ihn zerfraß, hatte Muzil es im Krankenhausbett ausgesprochen, bevor die Forscher es entdeckten: „Das Ding ist wohl aus Afrika herübergekommen.“ Aids, das aus dem Blut der grünen Meerkatzen stammte, ist eine Krankheit von Zauberern, von Hexern.
7
Dr. Chandi, den ich seit mindestens einem Jahr konsultierte, nachdem ich Dr. Nacier, ohne ihn davon in Kenntnis zu setzen, verlassen hatte, ich hatte ihn der Indiskretion bezichtigt, weil er über die mehr oder weniger hängenden Eier einiger berühmter Patienten tratschte, in Wahrheit aber nahm ich ihm noch viel stärker übel, dass er, als er bei mir die Gürtelrose diagnostizierte, bemerkte, man könne bei HIV-positiven Patienten mit zunehmender Häufigkeit diese erneute Äußerung des Windpocken-Virus feststellen, während ich bis dahin den Test verweigert und seit Jahren in irgendwelchen Schubladen seine diversen, auf meinen eigenen oder auf Decknamen ausgestellten Rezepte für den Test zum Nachweis des Aids-Virus gesammelt hatte, das zuerst LAV, dann HIV genannt wurde, unter dem Vorwand, das hieße ein ohnehin unruhiges Gemüt wie mich in den Selbstmord zu treiben, überzeugt wie ich war, das Ergebnis des Tests zu kennen, ohne ihn überhaupt durchführen zu müssen, schön klarsichtig oder schön genasführt, und zugleich der Ansicht, die mindeste Verantwortung bestehe darin, sich bei Intimkontakten, die wohl mit dem Alter seltener würden, wie ein Infizierter zu verhalten, in Phasen der Hoffnung insgeheim mit dem Hintergedanken, dies sei auch das Mittel, sich selbst zu schützen, doch stets darauf beharrend, der Test sei zu nichts nutze, als die Unglückseligen in die schlimmste Hoffnungslosigkeit zu stürzen, solange noch kein Heilmittel gefunden sei, genau das hatte ich meiner Mutter entgegnet, der grässlichen Egoistin, die mich in einem Brief gebeten hatte, ihr diese Sorge zu nehmen, Dr. Chandi, der praktische Arzt, zu dem ich jetzt also ging und den Bill mir empfohlen hatte, indem er seine Verschwiegenheit rühmte und dabei sogar ausdrücklich zu verstehen gab, ein gemeinsamer Freund, der an Aids erkrankt sei, befinde sich bei ihm in Behandlung, wodurch mir sofort klar war, um wen es sich handelte, und den die unbedingte Verschwiegenheit des Arztes, trotz des Bekanntheitsgrades seines Patienten, bislang vor der Gerüchteküche bewahrt habe, unterzog mich jedesmal, wenn er mich untersuchte, in derselben Reihenfolge denselben Prozeduren: Nachdem er mir wie üblich den Blutdruck gemessen und mich abgehört hatte, inspizierte er die Fußsohlen und die Hautritzen zwischen den Zehen, zog dann behutsam den Ausgang der besonders empfindlichen Harnröhre auseinander, dann erinnerte ich ihn, nachdem er mir die Leistengegend, den Bauch, die Achselhöhlen und den Hals unter dem Kiefer abgetastet hatte, daran, dass es zwecklos sei, mir das helle Holzstäbchen hinzuhalten, mit dem meine Zunge seit meiner Kindheit jede Berührung beharrlich verweigert, und dass ich es vorzöge, den Mund bei der Annäherung des Lichtkegels sehr weit zu öffnen und durch eine Kontraktion der Rachenmuskeln das Zäpfchen ganz nach hinten an den Gaumen zu drücken, doch Dr. Chandi vergaß jedesmal, wie viel leichteren Zugang ihm das verschaffte als das glatte, mit mentalen Splittern gespickte Stäbchen, er hatte im Verlauf der Untersuchung nicht nur das Gaumensegel inspiziert, sondern hatte auch, und zwar recht nachdrücklich, als läge es fortan bei mir, durch stete eigene Beobachtung zu kontrollieren, ob sich in dieser Region ein deutliches Zeichen für die Entfaltung der unheilvollen Krankheit eingenistet hat, aufmerksam den Zustand der Schleimhaut in Augenschein genommen, die das oft bläulich oder lebhaft rot gefärbte Gewebe umkleidet, welches die Zunge mit dem Bändchen verbindet. Indem er dann meinen Hinterkopf mit der einen Hand festhielt und Daumen und Zeigefinger der anderen mit starkem Druck mitten auf die Stirn presste, fragte er mich, ob das schmerze, und beobachtete dabei die Reaktionen meiner Iris. Er beschloss die Untersuchung, indem er sich erkundigte, ob ich letzthin häufige, andauernde Durchfälle gehabt hätte. Nein, alles war in Ordnung, dank der Einnahme von Trophisan-Ampullen auf Glycolbasis hatte ich mein Gewicht aus der Zeit vor der Abmagerung während der Gürtelrose wiedererlangt, nämlich siebzig Kilo.
8
Bill war es, der mir als Erster von der sagenhaften Krankheit erzählte, ich würde sagen, 1981. Er war gerade aus den Staaten zurückgekehrt, wo er in einer Fachzeitschrift die ersten klinischen Berichte über Todesfälle mit dieser eigentümlichen Vorgeschichte gelesen hatte. Er selber sprach davon wie von einem Mysterium, realistisch und skeptisch. Bill ist Manager eines großen Pharmalabors, in dem Impfstoffe produziert werden. Als ich anderntags unter vier Augen mit Muzil zu Abend aß, berichtete ich ihm von der alarmierenden Nachricht, die Bill herumerzählte. Er ließ sich, von einem Lachanfall gekrümmt, vom Sofa fallen: „Ein Krebs, der ausschließlich Homosexuelle trifft, nein, das wäre zu schön, um wahr zu sein, das ist zum Totlachen!“ Der Zufall wollte, dass Muzil zu dem Zeitpunkt schon von dem Retrovirus befallen war, dessen Inkubationszeit, Stéphane hat es mir kürzlich erzählt, man weiß es mittlerweile, verbreitet die Tatsache aber nicht, um nicht unter den Tausenden von Positiven Panik zu säen, recht genau sechs Jahre betragen soll. Einige Monate, nachdem ich bei Muzil jenen Lachanfall ausgelöst hatte, fiel er in eine schwere Depression, es war Sommer, ich bemerkte am Telefon seine veränderte Stimme, von meinem Appartement aus beobachtete ich verzweifelt den Balkon meines Nachbarn, so hatte ich, ohne dass es bemerkt worden wäre, Muzil ein Buch gewidmet, „Meinem Nachbarn“, bevor ich dann das folgende „Dem toten Freund“ widmen musste, ich befürchtete, er werde sich von diesem Balkon stürzen, ich spannte unsichtbare Netze von meinem Fenster zu seinem, um ihm zu Hilfe zu kommen, mir war unbekannt, woran er litt, doch hörte ich an seiner Stimme, dass es schlimm war, ich erfuhr später, dass er es niemandem anvertraute außer mir allein, er sagte mir an jenem Tag: „Stéphane krankt an mir, endlich habe ich begriffen, dass ich Stéphanes Krankheit bin und es sein Leben lang bleiben werde, was ich auch anstelle, es sei denn, ich verschwinde; das einzige Mittel, ihn von seiner Krankheit zu heilen, da bin ich sicher, wäre, mich umzubringen.“ Doch da waren die Würfel schon gefallen.
9
Dr. Nacier, mit dem ich noch befreundet war und der sich nach einem längeren Aufenthalt im Krankenhaus von Biskra, wo er als Assistenzarzt seinen Wehrdienst leistete, der Geriatrie zugewandt hatte, arbeitete zu jener Zeit in einem Altenpflegeheim am Pariser Stadtrand, wohin er mich auf einen Besuch einlud, zu dem ich einen Fotoapparat mitbrachte, der leicht in der Tasche des weißen Kittels zu verstecken war, welchen ich auf sein Geheiß anzog, damit er mich während der allgemeinen Sprechstunde als Kollegen ausgeben konnte. Wegen des Fotoromans über meine Großtanten, die damals fünfundachtzig beziehungsweise fünfundsiebzig Jahre alt waren, meinte Dr. Nacier, ich hegte eine geheime Neigung für todgeweihtes Fleisch. Er lag da völlig falsch, was mich anging, denn ich machte in jenem Altenpflegeheim nicht eine einzige Aufnahme, außerdem reizte es mich nicht im Geringsten, eine zu machen, diese Visite in Verkleidung flößte mir Scham und Abscheu ein. Dr. Nacier, dieser hübsche Kerl, der den alten Frauen so gefiel, dies ehemalige Model, das sich glücklos als Schauspieler versucht hatte, bevor es geknickt in die medizinische Fakultät eintrat, dieser Beau, der damit prahlte, er sei als Fünfzehnjähriger im Grand Hôtel von Vevey, wo er mit seinen Eltern abgestiegen war, kurz vor dem Autounfall, dem sein Vater zum Opfer fallen sollte, von einem der Schauspieler, die den James Bond gespielt hatten, vergewaltigt worden, dieser Ehrgeizling konnte sich einfach nicht zu einer Laufbahn als praktischer Arzt herablassen, um in einer Stadtteilpraxis, die leicht zur Jauchegrube verkommen könnte, von seinen schmerbäuchigen, stinkenden, kleinkarierten Patienten fünfundachtzig Francs pro Konsultation zu kassieren. Aus diesem Grund versuchte er zunächst, sich mit der Kreation eines durchgestylten Sterbehauses mit eingetragenem Warenzeichen einen Namen zu machen, wo er in einer Art Hightech- oder Baukastenklinik die endlosen, widerlichen Agonien durch ein reibungsloses, märchenhaftes Hinübergleiten auf einer Reise zum Mond erster Klasse ersetzen wollte, ohne Erstattung durch die Kasse. Um an die Bankbürgschaften zu kommen, musste Dr. Nacier eine moralische Autorität ausgraben, die dafür sorgen sollte, dass man sein Vorhaben nicht für zwielichtig hielt. Muzil war hier der ideale Pate. Durch meine Vermittlung bekam Dr. Nacier leicht einen Termin bei ihm. Nach ihrer Unterredung sollte ich mit Muzil zu Abend essen. Zu meiner Überraschung hatte er strahlende Augen und war irrsinnig aufgekratzt. Dieser Plan, auf den er im Ernst keinen Pfifferling geben wollte, juckte ihn wie ein Floh. Nie hat Muzil so viele Lachanfälle gehabt wie als Todkranker. Als Dr. Nacier gegangen war, sagte er zu mir: „Weißt du, was ich deinem Kumpel geraten habe: Seine Bude da dürfte nicht eine Einrichtung sein, in die man zum Sterben kommt, sondern in die man kommt, um so zu tun, als stürbe man. Natürlich müsste alles prunkvoll sein, mit prächtigen Bildern und sanfter Musik, aber nur, damit des Pudels Kern besser versteckt wird, denn ganz hinten in dieser Klinik gäbe es eine kleine Tür, vielleicht hinter einem von diesen Bildern, die einen ins Träumen bringen, man würde in der einlullenden Melodie des Nirwana aus der Spritze verstohlen hinter das Bild schlüpfen und schwups! wäre man verschwunden, tot in aller Augen, und man würde auf der anderen Seite der Wand wieder auftauchen, im Hinterhof, ohne Gepäck, mit nichts in den Händen, ohne Namen, und müsste sich eine neue Identität erfinden.“
10
Sein Name war für Muzil zum Schreckgespenst geworden. Er wollte ihn tilgen. Ich hatte bei ihm für die Zeitung, bei der ich arbeitete, einen Text über die Kritik bestellt, er sträubte sich, wollte mich gleichzeitig nicht enttäuschen, schob entsetzliches Kopfweh vor, das seine Arbeit lähme, bis ich ihm schließlich vorschlug, diesen Artikel unter falschem Namen zu veröffentlichen, zwei Tage darauf erhielt ich mit der Post einen Text von seiner Hand, klar und scharf, mit diesem Brief: „Welches Wunder an Verständnis hat dir eingegeben, dass nicht der Kopf Ärger macht, sondern der Name?“ Als Deckname schlug er Julien de l’Hôpital vor, und jedes Mal wenn ich ihn zwei, drei Jahre später im Krankenhaus besuchte, wo er im Sterben lag, dachte ich an jenes düstere Pseudonym, das nie das Licht des Tages erblickte, denn natürlich scherte sich die große Tageszeitung, bei der ich angestellt war, nicht im Geringsten um einen Text über die Kritik aus der Feder eines Julien de l’Hôpital, eine Kopie lag noch lange im Ordner einer Sekretärin, als Muzil sie von mir zurückverlangte, war sie daraus verschwunden, ich fand das Original bei mir zu Hause und gab es ihm, Stéphane stellte nach seinem Tod fest, dass er es vernichtet hatte, wie so viele Schriften, überstürzt, in den wenigen Monaten, die seinem Zusammenbruch vorausgegangen waren. Ich trug zweifellos die Schuld an der Vernichtung eines kompletten Manuskripts über Manet, dessen Existenz er einmal erwähnte und um das ich ihn bei anderer Gelegenheit anging, mit der Bitte, es mir leihweise anzuvertrauen, denn es könne mir vielleicht Stoff zu einer Arbeit liefern, die ich unter dem Titel „Die Malerei der Toten“ begonnen hatte und die unvollendet blieb. Um meiner Bitte nachzukommen, nahm Muzil, der mir versprochen hatte, sie zu erfüllen, die Mühe auf sich, das Manuskript in seinem Durcheinander zu suchen, spürte es auf, las es erneut und vernichtete es noch am selben Tag. Seine Zerstörung bedeutete für Stéphane den Verlust von mehreren Zehntausend Francs, obgleich Muzil als einziges Testament ein paar lakonische, ohne Zweifel reiflich überlegte Sätze hinterließ, die seine Arbeit vor jedem Zugriff bewahrten, materiell vor dem der Familie, indem er die Manuskripte seinem Gefährten vermachte, und zugleich ideell vor dem seines Gefährten, indem er ihn durch das Verbot jeglicher posthumer Veröffentlichung daran hinderte, die eigene Arbeit auf den Trümmern der seinen zu errichten, und ihn so zwang, einen deutlich getrennten Weg zu verfolgen, wodurch er von vornherein den Schaden, den man seinem Werk etwa zuzufügen die Absicht hatte, begrenzte. Hingegen gelang es Stéphane, Muzils Tod zu seiner Arbeit zu machen, vielleicht hatte Muzil ihm auf genau diese Weise seinen Tod zum Geschenk machen wollen, indem er den Posten des Verteidigers dieses neuen, originellen und schrecklichen Todes erfand.
11
So wie er darauf achtete, außerhalb der Grenzen, die er um sein Œuvre zog, seinen Namen, den die Berühmtheit allzu sehr in der ganzen Welt hatte anschwellen lassen, zu tilgen, so zielte er darauf ab, sein Gesicht verschwinden zu lassen, das doch durch einige Merkmale und der zahlreichen Aufnahmen wegen, die die Presse von ihm seit gut zehn Jahren verbreitete, so besonders leicht erkennbar war. Lud er selten einmal einen der wenigen Freunde, deren Zahl er in den Jahren, die seinem Tod vorausgingen, drastisch verringert hatte, indem er die Bekanntschaften in einen Bereich fern der Freundschaft verbannte, der ihm erlaubte, sie zu vernachlässigen und den Kontakt auf einen Brief dann und wann oder einen Anruf zu beschränken, ins Restaurant ein, so steuerte er, kaum hatte er das Lokal betreten, auf die Gefahr hin, einen jener wenigen Freunde, mit denen er noch gern essen ging, beiseite zu rempeln, auf geradem Weg den Stuhl an, der ihm erlaubte, dem Publikum den Rücken zuzukehren und zugleich einem Spiegel zu entgehen, dann besann er sich und bot höflich den Stuhl oder die Bank an, die er verschmäht hatte. Er wandte dem Publikum den rätselhaften, in sich gekehrten Schimmer seines Schädels zu, den er sorgfältig jeden Morgen rasierte und auf dem mir manchmal, wenn er mir die Tür öffnete, Spuren getrockneten Blutes, die seiner Kontrolle entgangen waren, auffielen, zugleich mit der Frische seines Atems, in dem Moment, wenn er mich mit zwei winzig kleinen, sonoren Küssen rechts und links des Mundes begrüßte, was mich daran erinnerte, dass er die Aufmerksamkeit besaß, sich kurz vor der verabredeten Zeit nochmals die Zähne zu putzen. Paris hinderte ihn am Ausgehen, hier fühlte er sich zu bekannt. Ging er ins Kino, so richteten sich alle Blicke auf ihn. Manchmal sah ich ihn nachts von meinem Balkon in der Rue du Bac 203 aus vor das Haus treten, in schwarzer Lederjacke, mit Ketten und Metallringen in den Schulterklappen, und über die offene Galerie, die die verschiedenen Aufgänge der Rue du Bac 205 verbindet, zu der Tiefgarage gehen, von der aus er mit seinem Auto, das er unbeholfen steuerte, wie ein Kurzsichtiger verängstigt hinter der Windschutzscheibe klebend, Paris durchquerte, um zu einer Bar im 12. Arrondissement zu fahren, Le Keller, wo er seine Opfer aushob. Stéphane fand in einem Schrank in der Wohnung, die durch das handschriftliche Testament vor dem Eindringen der Familie bewahrt blieb, eine große Tasche voller Peitschen, Ledermasken, Gurte, Knebel und Handschellen. Diese Gerätschaften, von denen er nichts gewusst haben will, flößten ihm angeblich einen überraschenden Widerwillen ein, als seien auch sie nun tot, eiskalt. Auf Anraten von Muzils Bruder ließ er die Wohnung desinfizieren, bevor er sie in Besitz nahm, dank des Testaments, noch ohne zu wissen, dass die meisten Manuskripte vernichtet waren. Muzil liebte leidenschaftliche Saunaorgien. Die Angst, erkannt zu werden, hinderte ihn daran, die Pariser Saunen zu frequentieren. Wenn er jedoch zu seiner alljährlichen Tagung nach San Francisco reiste, stürzte er sich in den zahlreichen Saunen dieser Stadt ins Vergnügen, die heute wegen der Epidemie stillgelegt und zu Supermärkten und Parkhäusern umgewandelt sind. Die Homosexuellen San Franciscos lebten in diesen Einrichtungen die irrwitzigsten Fantasien aus, sie installierten an Stelle der Urinale alte Badewannen, in denen die Opfer ganze Nächte in der Erwartung verbrachten, besudelt zu werden, sie hievten schrottreife Trucks in die engen Räume und richteten darin ihre Folterkammern ein. Als Muzil im Herbst 1983 von der Tagung zurückkam, hustete er sich die Lungen aus dem Leib, ein trockener Husten griff ihn immer mehr an. Dennoch, zwischen zwei Anfällen, schwärmte er genüsslich von seinen jüngsten Eskapaden in den Saunen von San Francisco. Ich sagte an jenem Tag zu ihm: „Wegen Aids ist wohl kein Mensch mehr dort?“ – „Von wegen“, entgegnete er, „im Gegenteil, nie waren so viele Leute in den Saunen, es ist ganz fantastisch geworden. Diese schwebende Bedrohung hat ein neues Gefühl der Zusammengehörigkeit geschaffen, neue Zärtlichkeiten, eine neue Solidarität. Früher hat keiner ein Wort gesagt, jetzt reden wir miteinander. Jeder weiß sehr genau, wofür er dort ist.“
12
Sein Assistent, den ich am Tag seiner Beerdigung kennenlernte, wohin ich Stéphane begleitete, und den ich einige Tage darauf im Autobus wieder traf, machte mir verschiedene aufschlussreiche Mitteilungen. Man wusste noch nicht, ob Muzil sich der Art der Krankheit, die ihn umbrachte, bewusst war oder nicht. Sein Assistent versicherte mir, er sei sich jedenfalls der Unheilbarkeit dieser Krankheit bewusst gewesen. Im Lauf des Jahres ’83 nahm Muzil regelmäßig an den Sitzungen einer humanitären Organisation teil, in einer Hautklinik, deren Chefarzt jener Vereinigung angehörte, die Ärzte in die ganze Welt entsendet, je nachdem, wo sich politische oder elementare Katastrophen ereignen. In dieser Klinik wurden wegen der dermatologischen Symptome die ersten Aidsfälle behandelt, vor allem wegen des Kaposi-Sarkoms, das rote, eher bläulichrote Flecken verursacht, zunächst auf den Fußsohlen und an den Beinen, dann über den ganzen Körper bis hin zur Haut des Gesichts. Muzil hustete während dieser Versammlungen, bei denen es um die Lage in Polen nach dem Staatsstreich ging, wie ein Verrückter. Obwohl Stéphane und ich es ihm wiederholt dringend nahegelegt hatten, weigerte er sich beharrlich, einen Arzt aufzusuchen. Schließlich gab er dem Drängen des Chefarztes der Hautklinik nach, den dieser trockene, heftige, hartnäckige Husten beunruhigte. Muzil ging für einen Morgen zu Untersuchungen ins Krankenhaus, er berichtete mir, in welchem Maß, er habe es vergessen gehabt, der Körper alle Identität verliert, wenn er erst einmal in den Krankenhausbetrieb gerät, und nichts mehr von ihm bleibt als ein willenloser Fleischklumpen, der hin- und hergeschoben wird, gerade noch eine Karteinummer, ein Name, der durch die Verwaltungsmühle gedreht wird, es saugt ihm seine Geschichte und Würde aus. Man schob ihm einen Tubus durch den Mund, der seine Lungen erkunden sollte. Der Chefarzt der Hautklinik war nach diesen Untersuchungen bald in der Lage, auf die Art der Krankheit zu schließen, tat jedoch alles Nötige, um den Namen seines Patienten und Vereinskollegen zu schützen, kontrollierte den Umlauf der Krankenzettel und Untersuchungsergebnisse, die diesen berühmten Namen mit der neuen Krankheit verknüpften, fälschte und zensierte sie, damit das Geheimnis bis zum Schluss gewahrt blieb und er bis zu seinem Tod Ellenbogenfreiheit für seine Arbeit hatte, ohne die Behinderung durch ein Gerücht, auf das er würde reagieren müssen. Er beschloss, gegen das übliche Verfahren, nicht einmal Stéphane, Muzils Lebensgefährten, zu informieren, den er ein wenig kannte, um ihre Freundschaft nicht durch dieses Schreckgespenst zu beeinträchtigen. Hingegen informierte er Muzils Assistenten, damit dieser sich mehr als je dem Willen seines Meisters unterordnete und ihn bei seinen letzten philosophischen Projekten unterstützte. Der Assistent berichtete mir im Autobus, seine Unterredung mit dem Chefarzt der Hautklinik habe stattgefunden, kurz nachdem der Chefarzt und Vereinskollege Muzil das Untersuchungsergebnis mitgeteilt und erläutert hatte. Muzils Blick sei in jenem Augenblick, so hatte der Chefarzt der Hautklinik dem Assistenten erzählt, der es Monate später mir berichtete, unverwandter und schärfer gewesen denn je, mit einer Handbewegung habe er jede weitere Diskussion abgeschnitten: „Wie lange?“ habe er gefragt. Das war die einzige Frage, die ihn bewegte, um seiner Arbeit willen, er wollte sein Buch fertigstellen. Ob der Chefarzt ihm da die Natur seiner Krankheit enthüllte? Heute zweifle ich daran. Vielleicht ließ Muzil ihn nicht zu Wort kommen? Ein Jahr zuvor, während eines unserer Abendessen in seiner Küche, hatte ich ihn auf die Frage der Ehrlichkeit zwischen Arzt und Patient im Falle tödlicher Krankheiten gelenkt. Ich fürchtete, von einer nachlässig behandelten Hepatitis Leberkrebs davongetragen zu haben. Muzil hatte gesagt: „Der Arzt sagt dem Patienten nicht unvermittelt die Wahrheit, sondern bietet ihm durch eine ungefähre Darstellung die Mittel und die Freiheit, sie selbst zu erfassen, indem er ihm genauso erlaubt, nichts davon zu wissen, wenn er diese Möglichkeit im Grunde seines Herzens bevorzugt.“ Der Chefarzt der Hautklinik verschrieb Muzil höchstdosierte Antibiotika, die, indem sie den Husten unterdrückten, den fatalen Ausgang in ungewisse Zukunft verschoben. Muzil nahm die Arbeit an seinem Buch mit neuem Schwung auf, er beschloss sogar, die Vortragsreihe zu halten, die er eigentlich bis auf Weiteres hatte verschieben wollen. Weder Stéphane noch mir gegenüber erwähnte er dieses Gespräch mit dem Chefarzt der Hautklinik. Eines Tages verkündete er mir, indem er mich seltsam prüfend anblickte, er habe beschlossen, doch an seinem Blick sah ich sehr wohl, dass er mich um Rat fragte, dass der Entschluss nicht wirklich feststand, mit einer Delegation jener humanitären Organisation, die er unterstützte, ans Ende der Welt zu reisen, zu einer gefährlichen Mission, von der er, so gab er mir zu verstehen, vielleicht nicht zurückkehren würde. So wollte er am Ende der Welt jenen kleinen Ausschlupf hinter dem Bild suchen, den er für das ideale Sterbehaus erträumt hatte. Entsetzt von diesem Plan und zugleich bemüht, ihm das Ausmaß meines Entsetzens nicht zu zeigen, antwortete ich ihm leichthin, er täte besser daran, sein Buch zu vollenden. Sein Buch ohne Ende.
13
Er hatte seine Sittengeschichte begonnen, bevor ich ihn kennengelernt hatte, Anfang ’77, denn mein erstes Buch, La Mort propagande