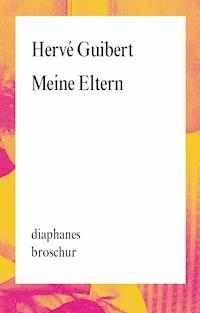
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diaphanes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: diaphanes Broschur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
»Für einen Schriftsteller ist die Familie eine wahre Goldgrube: anstatt seinen Erbteil einzufordern, verzichtet der Autor lieber darauf und lässt sich diesen direkt in Form von Fiktion (?) auszahlen«. Was genau in dem nun erstmals in deutscher Übersetzung vorliegenden Schlüsseltext Hervé Guiberts autobiografisch ist und was fiktiv, auch dafür steht das Fragezeichen in obigem Zitat. Als brennende Unbekannte formt und deformiert es die autofiktionale Projektionsfläche einer »Familien-Live-Show« aus Kindheits- und Jugendszenen. Der Leser sieht sich einem flirrenden Spiegel aus Literatur gegenüber, in dessen ätzend-scharfen, traurig-matten, fleischig-sinnlichen Bildern er nicht nur Guibert als radikalen Autor, sondern vielleicht auch sich selbst wiederzuerkennen vermag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 197
Ähnliche
Hervé Guibert
Meine Eltern
Aus dem Französischen übersetzt
Inhalt
Am Donnerstag, dem 21. Juli 1983, während ich auf der Insel Elba bin und meine Großtante Suzanne sich in ihrem Landhaus in Gisors befindet, wird deren sechsundsiebzigjähriger Schwester Louise im Bus Nummer 49 Richtung Gare du Nord, wo sie eine Fahrkarte für eine bevorstehende Reise kaufen soll, schlecht. Sie fühlt sich dem Tod nahe. Sie steigt aus dem Bus. Sie fühlt sich etwas wohler. Sie beschließt trotzdem bis zum Bahnhof zu fahren, sie nimmt die Metro, vielleicht hat das Schlingern im Bus, so kurz nach dem Mittagessen, die Übelkeit verursacht. Dabei war das Gefühl, dem Tod so nah zu sein, noch nie so deutlich, so heftig gewesen. In ihrem Kopf entsteht ein neuer Beschluss, eine Gewissheit. Bei ihrer Rückkehr bleibt sie auf dem Treppenabsatz im zweiten Stock stehen und dreht den Schlüssel, der immer außen im Schloss von Suzannes Wohnungstür steckt. Die Wohnung ist leer, die Läden sind geschlossen, in diesem Dämmerlicht ist es weniger heiß, sie fasst sich wieder an die Stirn, die eindeutig zu feucht ist. Sie weiß, dass sie es schnell hinter sich bringen muss, wenn sie keine Skrupel und vor allem keine Reue aufkommen lassen will. Diese religiöse Frau führt sich auf wie eine Vandalin. Sie reißt eine Schublade nach der anderen aus Suzannes Schreibtisch heraus, knickt Eselsohren in den Haufen der heiklen Unterlagen, knüllt diese nervös, während sie sie überfliegt, legt die beiseite, die ihr verdächtig erscheinen, gerät in Wut, nicht diejenigen zu finden, an die sie immer denken muss, stößt zufällig auf Suzannes Reisetagebücher, wo ihr unverzüglich eine obszöne Stelle ins Auge springt, legt sie zu den ausgesonderten Unterlagen und läuft wie eine Furie zu dem riesigen Schrank im Schlafzimmer, sie scheint auf die Kleider einzuprügeln, greift nach einem zu alten, ein Stück Seide zerbröselt in ihrer Hand, während die Schultern auf dem Bügel kleben bleiben, und endlich, in der kleinen geheimen Schublade ganz hinten, von der sie wusste, aber an die sie sich nie gewagt hatte, findet sie diese Unterlagen, diesen Dreck, der auch zum Dreck gehört, sie macht sich nicht die Mühe, sich den genauen Wortlaut anzusehen, die bloße Erinnerung an die Gerüchte kommt ihr schändlich vor, sie stapelt die Unterlagen auf die Reisetagebücher und steigt in den dritten Stock, um sie im Herd zu verbrennen. Sie ist müde, zum ersten Mal mischt sich in ihr das Gefühl, Schuld auf sich geladen und ihre Schuldigkeit getan zu haben.
Als ich von der Insel Elba Suzanne anrufe, die aus Gisors zurück ist, um mich nach ihrem Befinden zu erkundigen, höre ich an ihrer Stimme, dass sie erschüttert ist: Sie erzählt mir, was Louise, der sie immer vertraut hatte, getan hat. Bei meiner Rückkehr frage ich sie aus. Ich verstehe gut, dass sie mir nicht sagen will, um welche Unterlagen es sich handelt. Ich lasse nicht locker. Sie fragt mich: „Liebst du deine Mutter?“ Selbstverständlich antworte ich nicht. „Dann darfst du es nicht wissen“, sagt sie, „deine arme Mutter ist so krank, ich kann ihr das nicht antun.“ Ich sage ihr, dass die Fantasie immer schlimmer ist als die Wahrheit. „Nun, dann stell dir vor, dass deine Mutter ein Dämon, ein Vampir, ein Satansweib ist“, sagt sie zu mir.
Am 8. September feiern wir den Geburtstag von Suzanne, die wieder in Gisors ist. Nach dem Mittagessen spricht sie, die nicht christlich ist, im Garten in ihrem Korbsessel sitzend, von Schuld und Strafe, von Sühne, von Buße. Und auf einmal fällt mir wieder die Frage nach der von meiner Mutter begangenen Schandtat ein, die sie mir noch immer nicht gestanden hat. Ich sage ihr, dass ich die Niedertracht liebe. Sie sagt zu mir: „Dann wirst du das Buch schreiben, das ich nicht schreiben konnte.“ Ich frage sie, ob meine Mutter mit einem ihrer Hunde gesündigt habe, ich frage nach den Namen der Opfer ihrer Tat, sie sagt mir, dass sie keine Opfer verursacht hat, aber, mit einem Ausdruck des tiefsten Ekels, dass sie einfach schmutzig war. Sie sagt, sie wird mir alles nach meiner Rückkehr aus Mexiko erzählen…
Als mein Vater neunundzwanzig ist – das Alter, in dem ich heute diese Erzählung in Angriff nehme –, lebt er in Nizza: Ihm stehen eine Tierarztpraxis, zwei Pferde, ein grüner Ford und ein Segelboot zur Verfügung, er ist der Verlobte einer jungen Frau aus der Bourgeoisie. Sein Onkel Raoul eröffnet der Person, die es mir fünfunddreißig Jahre später berichtet, dass er sich anschickt, einen Frack für die Hochzeit zu kaufen. Einige Monate danach verlässt mein Vater Nizza Hals über Kopf; er ist wieder in Paris, ohne ein zweites Paar Socken, er lässt sich wieder von seiner Mutter durchfüttern, die bei der Sozialversicherung arbeitet, und nimmt erneut sein Studium der Medizin auf.
Zur gleichen Zeit hat sich meine Mutter, die Optik studiert, in den Pfarrer von Courlandon verliebt; sie stiehlt ihrer Tante Geld, das sie ihm gibt; sie lässt sich von ihrer Schwester Gisèle und ihrer Cousine Michelle mit dem Fahrrad bis zum Pfarrhaus begleiten; die beiden Komplizinnen halten Wache, während meine Mutter die paar Scheine, die sie geklaut hat, gegen die Umarmungen des Pfarrers tauscht.
Meine Mutter gesteht ihrer Tante, welche sie als Kind aufgenommen hat – eine kleine Waise in schwarz, ihr Vater war im Kanal in seinem Auto ertrunken –, dass sie vom Pfarrer schwanger ist. Meine Großtante Suzanne, die diesen Vorfall als größte Schande empfindet, wagt es nicht, sie ihrem Mann zu beichten, und vertraut sich stattdessen einer ihrer Freundinnen an, einer Geigerin, Suzanne, der Tante meines Vaters. Die beiden Suzanne werden sich schnell darüber einig, die zwei jungen Leute, die sich als Jugendliche begegnet sind – mein Vater war fünfzehn und meine Mutter acht – einander vorzustellen.
Knapp einen Monat später wird ein Treffen im Büro des Onkels und der Tante meiner Mutter, die beide Apotheker sind, vereinbart. Die Tante Suzanne meines Vaters ist ebenfalls anwesend. Meine Mutter eröffnet ihrem Onkel, dass sie von dem jungen Mann, Serge, schwanger ist. Im selben Moment verlangt mein Vater eine Summe von vierzehn Millionen – er will sich wieder als Tierarzt niederlassen und eine Klinik in der Avenue Mozart aufkaufen. Der Onkel brüllt ihn, der sein Schwiegersohn werden könnte, an (er hat meine Mutter immer als seine Tochter betrachtet): „Sie sind ein Nichtsnutz, ein Hochstapler, verschwinden Sie! Wir brauchen Sie nicht, um Jeannines Kind großzuziehen…“ Meine Mutter bricht in Tränen aus und schleppt meinen Vater, der tatsächlich die Flucht ergreifen will, einen Stock höher, wo sie ihn anfleht zu bleiben: „Du bekommst das Geld, ich schwör’s dir! – Wie willst du das anstellen?, fragt mein Vater. – Ich werde sie erpressen, entgegnet meine Mutter, sie besitzen Gold, das sie auf illegale Art erlangt haben, sie werden es uns geben oder wir zeigen sie an!“ Meine Mutter und mein Vater heiraten am 28. April 1951, fünf Monate vor der Geburt meiner Schwester Dominique.
Bei meiner Rückkehr aus Mexiko schildert Suzanne mir die ganze Geschichte: diese Liebesgeschichte meiner Mutter mit dem Pfarrer, der sie schwängerte, das Komplott der beiden Freundinnen, die ihre Nichte und ihren Neffen verheiraten, noch bevor diese sich getroffen haben, die Erpressung mit dem Geld und die Drohung, sie zu denunzieren. Sie sagt mir, dass mein Vater ein Ganove ist, ein Abenteurer, und dass er deshalb mit Schimpf und Schande aus Nizza fort musste: auch dort Erpressung, Schwängerung eines jungen Mädchens aus guter Familie, um ihr dann Geld abzuknöpfen. Aber der Plan ging nicht auf, und genau deswegen stand mein Vater plötzlich ohne alles da. Ich müsste also in Nizza einen Halbbruder haben, manchmal kam dies in den Gesprächen meines Vaters diskret zur Sprache. Und meine Schwester ist nicht meine Schwester, sondern meine Halbschwester, das Kind des Pfarrers. Meine Eltern haben geheiratet, ohne sich zu lieben. Daraufhin wirft Suzanne ein: „Weil du Jude bist, weißt du, ihr seid Juden.“ Ich fasse es nicht: Mein Vater war stets bemüht, sich unauffällig von den Juden abzugrenzen. Suzanne versichert mir: „Ihr seid Juden, dein Vater musste übrigens vor den Deutschen fliehen, weil er den Namen seiner Mutter trug, Neethofer ist ein jüdischer Name; sein Vater, Lucien Guibert, hat ihn nicht anerkannt, und er hat diesen Namen, der nicht der Seine war, viel zu spät erst annehmen können; Guibert ist nicht dein wahrer Name, ein weiterer Beweis dafür, dass ihr Juden seid: Er hat dich beschneiden lassen.“ Ich sehe mich in diesem Augenblick dazu gezwungen, mich mental mit meinem Glied zu befassen und festzustellen, dass meine Eichel von der Vorhaut mehr als bedeckt ist. Louise steuert ein weiteres Detail bei: „Du bist beschnitten, ich erinnere mich, als du klein warst, kam ich eines Tages bei euch vorbei, und du hast mir gesagt, dass du ein kleines Wehwehchen hast und wolltest es mir zeigen …“ Irgendetwas stimmt an dieser Geschichte nicht.
Meine Eltern ziehen zu der Tante meines Vaters, Suzanne Logeart, die seit dem Tod ihres Mannes Raoul in einem Sanatorium allein in ihrer Wohnung in der Rue Michel-Ange Nummer 68 lebt. Mein Vater leiht sich bei einem guten Freund seiner anderen Tante Geneviève – Boby, der in Tananarive lebt, wo er eine Kakaoplantage verwaltet – Geld. Dieser Mann, der spürt, dass er erblindet, setzt sich am Strand an das Wasser und schießt sich mit der Flinte eine Kugel in die Schläfe. Suzanne erzählt mir, dass sich mein Vater die Hände gerieben habe, seine Schulden los zu sein. Mit dem Geld kauft er sich Röntgengeräte und belegt die Küche der Tante, ihr Büro und einen Teil des Salons; um es wie eine Praxis aussehen zu lassen, bringt er am Haus ein Schild an. Meine Mutter spielt die Sekretärin und Assistentin, sie zieht sich einen weißen Kittel über, um die Hundepfoten festzuhalten und die Maulkörbe abzunehmen. Kunden kommen nur wenige, manche sind berühmt (Brigitte Bardot, der Fürst Jussupow, der Rasputin getötet hat: Später, als Kind, werden diese Namen der Kunden meines Vaters märchenhaft klingen), viele bezahlen ihre Rechnungen nicht. Mein Vater entwickelt eine schreckliche Angst, die er zunächst geheim hält: von den Röntgenstrahlen der Geräte verseucht zu werden. Jeden Monat fährt er nach Villejuif, um sein Blut und seine Lungen untersuchen zu lassen. Er kann noch so sehr darauf achten, dass seine Gliedmaßen nicht in das Strahlenbündel gelangen und Handschuhe anziehen, er sieht sich gezwungen, das Tier auf die Platte zu drücken. Als seine Zwangsvorstellung auf dem Höhepunkt ist, sieht er die ganze Wohnung von den Strahlen verseucht, vom kleinsten Sessel bis hin zu den von radioaktiver Materie durchtränkten Haaren seiner Frau. Er begibt sich ins Ministerium für den Öffentlichen Dienst, um seine Bewerbung für eine Stelle als Veterinärmediziner abzugeben. Die Röntgenstrahlen und die unregelmäßigen Bezahlungen seiner Kunden haben ihn klein beigeben lassen. Er hat Angst. Er will einen Sohn.
Meine Schwester wird am 26. September 1951 geboren. Kurze Zeit später beginnt mein Vater seine Arbeit bei der Polizeipräfektur, man händigt ihm eine blauweißrote Karte aus; beim kleinsten Zwischenfall mit einem Ordnungshüter wird er mit tiefer, gleichmäßiger und überzeugter Stimme sagen: „Wir sind doch Kollegen.“ Zur selben Zeit beantragt er bei der zentralen Behörde in Paris eine Sozialwohnung: ein bescheidenes Beamtengehalt, eine Tochter, die er zu ernähren hat, und eine Frau, die nicht arbeitet. Monatelang sucht er diese Büros auf und jammert, kleidet sich mit Absicht schäbig, damit seine Behördengänge ihre Wirkung erzielen, notfalls schmeichelt er ein wenig oder steckt ein paar anderen Beamten etwas zu. Endlich ziehen meine Eltern und meine Schwester um, sie richten sich in einer Dreizimmerwohnung mit Küche und Bad ein, im sechsten Stock der Rue de l’Amiral-Mouchez Nummer 52 – einer Straße, deren Besonderheit darin besteht, dass sie zum Teil zum 13. und zum Teil zum 14. Arrondissement gehört –, in einem Haus aus gelbem Backstein mit roten Säulen, ziemlich hässlich, aber nicht allzu schlecht für eine Sozialwohnung, zwei Fenster gehen auf die Straße, zwei andere auf den Hof, nach Süden gelegen, ganz wie mein Vater es sich gewünscht hatte.
Diese drei Jahre im Leben meiner Familie ohne mich kann ich nur aus den von meinem Vater gedrehten Filmen kennen, im 16-mm-Format, schwarz-weiß, mit einer Paillard-Kamera von meinem Onkel Raoul, die heute in meinem Besitz ist: Meine Schwester hat eine leichte Hakennase, an ihr ist ein Junge verlorengegangen, und schon bald schlägt sie sich die Stirn an einem Steingeländer auf, sie wird immer diese senkrechte Narbe haben, genau zwischen beiden Augenbrauen, die sie unter ihrem Pony zu verstecken sucht. Die Weihnachtsferien werden in Ézanville verbracht, bei der Mutter und Großmutter meines Vaters, Alice Fortoul und Eugénie Neethofer (zu der Zeit wird jeglicher Kontakt mit der Familie meiner Mutter vermieden); in den Sommerferien in Croix-de-Vie mieten sich meine Eltern bei einer Fischerfamilie, den Cortuis, ein. Lange Zeit spielen sie ihnen gegenüber die Rolle der reichen, philanthropischen Stadtmenschen, die jedes Jahr mit Kartons voller abgetragener Kleidung und altmodischem Spielzeug zurückkommen. Und so erlebe ich, dass die Sachen, die auf meiner Haut lasten, von ihrem Schweiß getränkt werden und sich an ihr abscheuern, bald schon auf die meines kleinen Alter Ego aus der Vendée übergehen, der ein wenig älter ist als ich und der immer zu kurze Kleidung tragen wird, ich trage sie genau passend, und darüber verspüre ich zugleich die stolze Genugtuung meiner Eltern, ihr Mitleid, wie auch eine Art sinnlichen Schauder, der nicht so leicht erklärlich ist. In Croix-de-Vie besitzt mein Vater bereits eine Jolle, an Tagen mit starkem Wind verfrachtet er meine Mutter an Bord und lässt sie das Wasser aus dem Boot schöpfen.
Ich komme am frühen Morgen des 14. Dezember 1955 zur Welt und zwar, sei es aufgrund eines freien Platzes in der Klinik oder aus Treue zu einer Hebamme, in Saint-Cloud, an einem Ort, wo heute laut meiner Mutter Autos auf einer Schnellstraße entlangfahren. In der Wiege und dann im Bett umschlingt mich ein großes, schmuddeliges, fusseliges Tuch aus weißer Wolle, es lässt sich nicht mehr sagen, an welchem Ende sich die Kapuze befand, so oft ist es gewendet worden, es ist mein Burnus, mit meinen Zähnen habe ich die Nähte aufgetrennt, er gürtet mich, ich hülle mich in ihn ein, ich reinige mich mit ihm, ich ergieße mich in ihm, ich lecke ihn ab, ich sauge an ihm, ich reibe mich an ihm, ich verschwinde unter ihm, ich liebe es, in seinem Geruch von Wolle und Brei keine Luft zu bekommen, ich verschlinge ihn, er wird zerfetzt, je zerschlissener er ist, desto mehr liebe ich ihn, desto mehr hänge ich an ihm, ich brülle, wenn man ihn mir wegnehmen will und einen neuen Burnus hinhält, der geradezu stinkt vor Sauberkeit, ich verbringe, ohne es zu wissen, meine letzten Nächte im Wahn der Liebe mit ihm, in meinem Bauch müsste man ihn verstecken und retten, hat er mir doch so sehr als Bauch gedient, er ist mein kleiner flacher Wollzwilling, wir umklammern und umarmen uns, ich pisse auf ihn drauf und er lacht darüber, eines Morgens erwache ich schrecklich nackt, die Haut ist abgezogen, abgetrennt von ihrer zweiten Haut, ich brülle nicht mehr, ich bin ernst, ich ahne vielleicht, dass er in den Müllschlucker gelangt ist, dass man ihn als Knäuel aus dem sechsten Stock auf die Essensreste und die aufgeplatzten Staubsaugerbeutel geworfen hat, man sagt mir, man habe ihn nur zu Madame Hélène gebracht, der Wäscherin, und ich könne ihn dort selbst abholen, blitzblank und wie neu, ich gehe hin, die Wäscherin, die eingeweiht ist, reicht mir, täuschend echt in Plastikfolie verpackt, den neuen Burnus, den ich verschmäht hatte, ich will nicht, dass er meine Finger erniedrigt, meinen Schlaf, ich nehme ihn nicht; die erste Vorstellung vom Tod, das erste Gefühl der Verachtung.
Oft geht von den Bildern eine teuflische Wirkung aus. Meine Eltern haben aus Illustrierten herausgerissene Abbildungen zweier recht berühmter Bilder völlig unüberlegterweise und sorglos an die Wand gepinnt: die Terrasse eines Cafés in einer Sommernacht in Arles von van Gogh, die sich in ein geradezu abstraktes Bild verströmender Wärme verwandelt hat, des Zerfließens, der Schwerelosigkeit, des Sommers (ein Vorgeschmack auch auf die Lust, die mein Erwachsenenkörper mir schenken könnte), und Der Schrei von Munch – diese langsame Entstellung einer bereits entstellten Gestalt –, ein Bild der Angst und des Todes. Die Ausstrahlung dieser beiden Bilder auf meinen kindlichen Körper ist derartig stark, dass ich mir antrainiert habe, blind zu werden, wenn ich an ihnen vorbeigehe. Bald werden sie wieder wie Zeitschriftenseiten sein, hässliche Nachdrucke, x-beliebige Farben auf elendem Glanzpapier: Sind sie erst einmal von der Hitze des Heizkörpers angesengt, angegilbt und von den Reißzwecken durchlöchert, wandern auch sie in den Müllschlucker.
Eines Tages – so erklären es mir meine Eltern voller Eifer – haben die Deutschen die Franzosen gefoltert, sie erzählen es mir, als hätte man sie persönlich gefoltert, und ersparen mir keine Einzelheiten in der Schilderung der Folter: Die Franzosen werden mitten aus ihrem elenden Hungerschlaf gerissen und aneinandergekettet wie Vieh in einen großen Raum geführt, wo man sie zusammenpfercht; die Wände und der Boden sind mit Metall verkleidet. Dann wird der Raum von außen verschlossen, und der Boden beginnt sich zu erwärmen: Die Männer und Frauen steigen aufeinander, um der Hitze zu entkommen, denn sie wurden mit nackten Händen und Füßen hier hereingebracht, sie trampeln aufeinander herum, versuchen die Wände hochzuklettern, in diesem fensterlosen Raum, aber nun glüht auch die Decke rot auf. Die Nazis, die sich draußen hinter der Tür verkrochen haben, weiden sich an den Ausdünstungen verbrannter Haut, denen auch Gebete entweichen.
Mein Vater geht früh am Morgen zum Schlachthof, der sich damals noch in den Pariser Hallen befindet, er frühstückt allein und hört Radio dabei, bei besonderen Anlässen hinterlässt er uns eine Nachricht auf dem Küchentisch, am denkwürdigsten: „Kennedy ermordet“ und „Edith Piaf ist tot“. Nun weichen seine Füße den Blutlachen aus, er hört das Gebrüll des Schlachtviehs nicht mehr, das zu den Schussanlagen und zum Abstechen getrieben oder gezogen wird, an manchem Morgen voller Jubel über all das Brüllen entsteht in seinem Kopf eine Melodie, er zieht sich den weißen Kittel über, prüft, ob die Stempel in der Tasche sind, setzt sich die Brille auf und kontrolliert die Schlachtkörper, er stempelt sie ab, er „stiert vor sich hin“: Er schneidet die Stierhoden an. Wenn er am Nachmittag nach Hause kommt, bringt er manchmal ein in Zeitungspapier eingewickeltes Hirn oder eine Rinderzunge mit, die er als Gegenleistung für eine zweifelhafte Zollfreigabe bekommen hat. Alles muss gegessen werden. Einmal müssen meine Schwester und ich uns Kalbsbries einverleiben, mein Vater hat seine Uhr auf den Tisch gelegt und gibt uns fünf Minuten, um unsere Teller zu leeren: Es regnet Ohrfeigen, wir geben das weiße Gewebe von uns und käuen es, mit Tränen und Rotz vermischt, wieder.
Ich schlafe zunächst im Zimmer meiner Schwester. Meine allerersten Erinnerungen sind die Albträume, von denen ich erwache, ich kämpfe gegen das erneute Einschlafen an, um nicht wieder mit ihnen konfrontiert zu werden, ich bleibe im Bett sitzen und warte darauf, dass der Tag anbricht. Plüschlämmchen begleitet mich damals schon: Man erzählt mir, dass ich es zu meinem ersten Geburtstag geschenkt bekam. Es ist ein kleines weißes Lamm mit einer Blume im rosa Maul, die ich schnell abgerissen habe, und dem ich die Kleidung der Puppen meiner Schwester anziehe: die Pullover und Steghosen zum Skifahren, aber auch die Kleider und Badeanzüge, denn ich nehme es jedes Jahr ans Meer mit. Meine Schwester, die sich erst vor Kurzem in meiner Gesellschaft an diese Zeit erinnerte, beklagt sich noch heute, dass ich die Kleidung ihrer Puppen stibitzte und auch – eine Tatsache, die mich erstaunte, denn in meiner Erinnerung bin ich ein kleiner ängstlicher Junge – darüber, dass ich sie oft erschreckte, indem ich mich im Dunkeln ihres Schranks versteckte. Eines Tages schenkt man meiner Schwester ein gelbes Kleid für ihre Puppe, die Ärmel und der Saum sind mit einer Borte aus Angora eingefasst: Ich berühre die borstige Wolle, irrsinnig viel weicher, ohne das elektrisch Aufgeladene der Mohairwolle, aber voll heimtückischer Wollust: Sofort träume ich davon, während meine Finger zum ersten Mal über den Stoff streichen, eines Tages mein Glied daran zu reiben oder es einfach nur darauf zu legen, ist es doch, und dies weiß ich nur zu gut, denn ich erdulde es, der empfindsamste Teil meines Körpers. Ich habe es mir bereits angewöhnt voller Kühnheit, denn meine Mutter ist oft in einem Nebenraum beschäftigt, meine Hose zu öffnen und mein Glied an etwas Ungewohntem zu reiben: an der flauschigen Fellwalze einer Farbrolle, die herumliegt, und noch heute schwillt meine Lust an, sowie ich das Futter einer Jacke oder einen Kragen aus Lammfell sehe und berühre. In meiner Kindheit werde ich dieses winzige Stück Stoff nie besitzen, das ich am liebsten vom Kleid abgetrennt hätte, um mit dieser Schleife mein Glied zu verzieren. Aber mein Zimmer wird in dem Raum eingerichtet, der einmal das Esszimmer gewesen sein muss, und so kann ich, als Ersatz, die Wollknäuel meiner Mutter entwenden und sie wie aus Versehen neben meinem Bett platzieren, sowie das Licht ausgeschaltet ist, hole ich mit angehaltenem Atem ein Knäuel unter die Decke und schmiege meinen Penis hinein. Damals, ich muss so um die vier oder fünf Jahre alt gewesen sein, stelle ich mir im Traum auch eine Art Vergnügungsetablissement vor, grau wie Rohrleitungen, in dem die Männer sich entkleiden, um sich dann jeder auf einer Säule niederzulassen, wo ihre Lust von einem Feuer entfacht wird, die Flammen lecken an den Schwänzen.
Meine Schule befindet sich in der Rue de la Tombe-Issoire. Meine erste, bleibende Erinnerung an diese Schule ist der Auftritt einer Musikgruppe eines Nachmittags, die, so glaube ich, aus zwei Personen bestand: eine der beiden, vermute ich zumindest, spielte auf einer singenden Säge, die Frau im langen Kleid jedoch, das weiß ich noch genau, spielte auf einer Harfe. Es ist meine erste Aufführung, der ich auf einer Holzbank sitzend beiwohne, und ich bin begeistert. Ich erinnere mich auch an den Geschmack des Kokosnusspulvers, das in die Krüge gegeben wurde, um das Wasser einzufärben, an die Röhrchen sowie die kleinen runden und flachen Metalldosen mit dem gelben Lakritzpulver. Einmal in der Woche gibt es anstelle des Wassers eine Dose Kakaomilch – ein wahrer Luxus. Einer der Großen, er ist rothaarig, packt mich, drückt mich an sich und läuft mit mir zu den Toiletten, wo er uns im Dunkeln einschließt: Ich bleibe an seine Brust, seinen Ausschnitt gepresst stehen, wo es nach dem warmen Schweiß eines Rothaarigen duftet und nach ranziger Wolle, er trägt einen bunt verzierten Pullover aus grober Wolle mit V-Ausschnitt, der dreckig ist und schlaff sitzt, in der Wolle, an die Wärme seiner Brust gelehnt, trinke ich mit klopfendem Herzen diesen Duft, ich stille mich an ihm, ich bin in Ekstase. Am nächsten Morgen prahle ich beim Frühstück mit diesem Ereignis, meine Schwester beschwert sich bei meiner Mutter darüber, die gerade die Schuhe putzt und sofort beunruhigt ist: „Hervé, du sollst nicht mit den großen Jungs auf die Toilette gehen, das ist nicht gut für dich, der Junge meint es nicht gut mit dir…“ Wenn ich vier Jahre alt bin, dann muss der andere sechs oder sieben sein. Er heißt Christian, er ist bekannt dafür, mit den Kleinen in den Toiletten zu verschwinden und sich dort mit ihnen einzuschließen, er drückt sie in der stinkenden Dunkelheit an sich, ohne weiter etwas zu unternehmen. Ich lass mich nicht mehr mitnehmen, aber ich ziehe Plüschlämmchen einen V-Pullover an, der dem Modell, das mir so viel Lust bereitet hat, ungemein ähnelt, und ich nenne Plüschlämmchen Christian und auch meine Liebe.





























