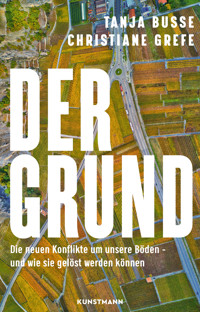
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Der Wert des Bodens, das Wunder der Unterwelt, jene Abermillionen von Wurzeln und Würmern, Käfern, Bakterien und Pilzen, die in symbiotischem Zusammenwirken immer wieder neues Leben schaffen, wurde lange unterschätzt und missachtet. Fruchtbare Böden sind weltweit gefährdet. Wie wir mit dem Land, mit den Flächen umgehen, ist die zentrale Zukunftsfrage. Wofür soll der Boden, der Grund genutzt werden: für Beweidung, Ackerland oder klimaresiliente Wälder? Für Wind- und Solarkraftwerke oder Naturschutzgebiete? Für Wohnungen und Gewerbegebiete in wachsenden Städten? Lassen sich Energiewende, Klimaschutz, Biodiversität und Ernährungssicherheit in Einklang bringen? Darf man Flächen für den Anbau von Energiepflanzen nutzen, wenn Menschen hungern? Wer entscheidet darüber: Bauern, Landbesitzer, Investoren, wir alle? Wie ließe sich Verantwortungseigentum für den Boden regeln? Davon erzählen Tanja Busse und Christiane Grefe spannend, mit Engagement und wissenschaftlicher Genauigkeit. Vor allem zeigen sie Wege auf, wie Zielkonflikte im Sinne des Gemeinwohls politisch gelöst werden können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 313
Ähnliche
TANJA BUSSE | CHRISTIANE GREFE
DER GRUND
Die neuen Konflikte um unsere Böden – und wie sie gelöst werden können
Verlag Antje Kunstmann
INHALT
1 Bodenlos
Wie wir mit Böden und Flächen umgehen ist die Überlebensfrage des 21. Jahrhunderts
2 Der Urgrund alles Lebendigen
Wurzeln und Würmer, Mikroben und Pilze, die gemeinsam ständige Wiederauferstehung schaffen: Das Wunder der Unterwelt
3 Von Krisenstürmen verweht
Klimawandel, Artensterben und schleichende Vergiftung zerstören unsere Existenzgrundlage
4 Spannungsfelder
Stromerzeuger, Autofahrerinnen, Investoren, Landwirte, Naturschützerinnen: Alle wollen die knappen Flächen
5 Verplant
Die Beschleunigung der Raumplanungsverfahren bremst Naturschutz, Landwirtschaft und Demokratie
6 Wem gehört das Land?
Landgrabbing, steigende Bodenpreise, Höfesterben: Droht die Refeudalisierung?
7 Wem gehört die Stadt?
Wohnungsbau, Straßen, Grünflächen: Dient der Raum den Bürgern oder den Investoren?
8 Globale Landnahmen
Agrarland, Wasser und Bodenschätze sind begrenzt: Weltweit werden die Konkurrenzkämpfe härter
9 Land in Sicht
Agroforstwirtschaft und Schwammstädte, Entsiegelungsprämien und Bodensteuern: Lösungen, die Hoffnung machen
10 Die geerdete Gesellschaft
Ein Ausblick
Anmerkungen
Zum Weiterlesen
Dank
1
BODENLOS
Wie wir mit Böden und Flächen umgehen ist die Überlebensfrage des 21. Jahrhunderts
»Was wir dem Land antun, tun wir uns selbst an.«
Wendell Berry
»To be a good ancestor, you have to build good soil.«
Robin Wall Kimmerer
Viele Menschen, hohe Ansprüche, knappes Land: Das ist der Stoff, aus dem die Konflikte der Zukunft sind. Während der letzten sechzig Jahre hat sich die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland laut dem Umweltbundesamt mehr als verdoppelt, und der Druck wächst und wächst. Alle wollen mehr Grund und mehr Boden: Fast 1000 Kilometer neue Straßen plant die Bundesregierung, dazu 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, »auf der grünen Wiese«, wie der Kanzler tönte. Dort müssten Siedlungen »wie in den 70er-Jahren«1 gebaut werden – so ökologisch gestrig denkt die »Fortschrittskoalition«. Die gleiche grüne Wiese wird auch von der Agrarindustrie reklamiert, für Tierhaltung und Getreideanbau, für die Welternährung und den Fleischkonsum, der weltweit noch immer steigt. Dabei sind landwirtschaftliche Flächen schon jetzt umkämpft, denn auf ihnen wachsen nicht nur Nahrung und Futter, sondern auch Mais für Biogasanlagen und Autotanks. Die Wälder stehen ebenso unter Druck, alle wollen Holz: für Bauplatten, Möbel, Paletten, Papier. Für Häuser, weil Zement und Beton hohe Treibhausgasemissionen verursachen, Holz dagegen Kohlenstoff bindet. Schließlich sind da noch die Tagebaue, Gruben und Minen, aus denen Kohle, jedenfalls noch eine Zeit lang, sowie Sand, Kies, Gipsstein oder Seltene Erden aus dem Boden geholt werden.
Alle diese Flächenansprüche richten sich an eine kollabierende Natur (Kapitel 3). Wälder brennen, ganze Landschaften leiden unter Hitze und Fluten, und überall auf der Welt verschwinden Insekten, Vögel, Säugetiere in einem atemberaubenden Tempo. Um die biologische Vielfalt zu retten, müssten 30 Prozent der Landoberfläche bis 2030 unter Schutz gestellt und zehn Prozent davon völlig ungestört gelassen werden, so haben es die Regierungen der Welt beim UN-Gipfel in Montreal im Dezember 2022 beschlossen. Der Biologe E. O. Wilson fordert sogar: die halbe Erde. Sie soll so in Ruhe gelassen werden, dass Pflanzen, Tiere, Landschaften sich neu entfalten können.
Kurz, wir leben in einer »vollen Welt«, so hat der Umweltpionier Ernst Ulrich von Weizsäcker die große Herausforderung unserer Zeit beschrieben. Es ist eng geworden, in Deutschland, in Europa, auf diesem Globus. Überall kollidieren unumstößliche Naturgesetze mit fossilem Raubbau und neuerdings, bei besten Absichten, auch mit der notwendigen Ausbreitung einer klimaverträglicheren Wirtschaft. Denn auch die Energiewende, die Agrarwende und die Bioökonomie beanspruchen Land oder Flächen am Meeresgrund. Auch die Große Transformation gründet im Boden, will auf ihm anbauen, ihn bebauen.
Eine Liste der neueren Interessenten: Die Lebensmittelindustrie und die Regierungen zielen auf eine geringere Abhängigkeit von Importen, also mehr Produktion im eigenen Land. Aus Klimaschutzgründen müssen Moore wieder vernässt werden, auf denen heute Lebensmittel erzeugt werden. Für die Energiewende müssen schnellstens Windkraft- und Photovoltaikanlagen aufs Land gestellt werden. Einige Klimaschützer nehmen die unterirdische Speicherung von CO2, die bislang in Deutschland verpönt war, angesichts der Geschwindigkeit der Erderwärmung wieder in den Blick. Unternehmen und Investoren, die ihre Treibhausgasemissionen kompensieren oder Nachhaltigkeitsansprüche dokumentieren müssen, brauchen Land dafür. Die Industrie will auf biologische Ressourcen für Flugtreibstoffe, Kunststoffe, Textilien und Energie umsteigen und Bioraffinerien bauen. Wenn man alle Nutzungswünsche zusammenrechnet, dann ist potenziell jeder Quadratmeter mehrfach verplant. Wie soll das gehen?
Politischer Sprengstoff
Der Boden ist unsere Existenzgrundlage, als Grund wird er ausgemessen und in Besitz genommen, als Fläche im Raum unterschiedlich genutzt, alles zusammen ist es Land – und das war schon immer ein knappes Gut. Aber noch nie war die Konkurrenz so groß. »Buy land, they’re not making it any more«: Mit einem Tempo, das selbst Mark Twain in Schwindel versetzt hätte, wird daher die Erde – in der doppelten Bedeutung des Wortes als Planet und als fruchtbare Krume – neu vermessen und in Besitz genommen. Investoren suchen Land, wo sie es kriegen können, zu Hause, in aller Welt. Land, das früher dem Staat und meist den Bäuerinnen und Bauern, die es bewirtschafteten, gehörte oder das von indigenen Bevölkerungsgruppen gemeinschaftlich genutzt wurde: Es ist heute auch ein Rendite- und Spekulationsobjekt. Man kann es kaufen, besitzen, pachten, kann damit handeln wie mit anderen Waren.
Doch Land ist kein Gut wie alle anderen. Einer Definition der UN zufolge ist es das »biologisch produktive terrestrische System, das den Boden, den Pflanzenbestand, andere Teile der belebten Umwelt sowie die ökologischen und hydrologischen Vorgänge umfasst, die innerhalb des Systems ablaufen«.2 Das ist eine spröde Beschreibung für etwas Unabdingbares: die Grundlage allen Lebens. Wie das Land gepflegt und genutzt wird, bestimmt, wie viel Kohlenstoff der Boden speichert oder emittiert, wie viele Früchte er hervorbringt, welche Qualität das Trinkwasser hat, ob Sturzregen versickern kann oder zu zerstörerischem Hochwasser wird, ob die Böden in der Sommerhitze ihre Umgebung kühlen oder alles verdorren lassen, ob biologische Vielfalt gedeiht oder verdirbt und ob die Ökosysteme den menschengemachten Bedrohungen standhalten werden. Wie wir unser Land nutzen, prägt die Gestalt unserer Landschaften, die kulturelle Identität der ländlichen Regionen, der Städte und der Menschen, die darin wohnen. Wie wir unser Land nutzen, bestimmt, was wir essen, wie wir wohnen und reisen, kurz, wie wir leben.
Und wir haben es nicht gut genutzt. Regierungen, Landwirte, auch wir Konsumenten und Stadtbewohner haben das Land mit stetig anspruchsvolleren Konsum- und Wohnansprüchen unter Asphalt und Beton vergraben und seiner Lebendigkeit beraubt (Kapitel 8).
Wie lässt sich die wachsende Gefährdung dieses wertvollen Gemeingutes mit der wachsenden Konzentration des Landes in den Händen weniger Vermögender vereinbaren? Wer entscheidet zukünftig über das Land, wenn es immer enger wird, weil immer mehr Menschen weltweit versorgt werden müssen, mit Wasser, Nahrungsmitteln, Kleidung, Behausung, Mobilität; wenn die Ansprüche der Menschen steigen – aber die Reichen nicht teilen wollen und der Planet und seine Natur Grenzen setzen? Wie weiten Regierungen den Blick fürs Ganze und denken all diese Wissens- und Interessenswelten kreativ zusammen, statt sie teils widersprüchlich nebeneinanderher zu steuern? Wie lösen sie die unzähligen neuen Zielkonflikte um Grund und Boden? Diesen Fragen gehen wir in diesem Buch nach. Es geht also um politischen Sprengstoff, denn die Kämpfe um das Land und seine Nutzung sind längst entbrannt.
Im Jahr 2020 wurden weltweit 200 Menschen ermordet und Tausende staatlichen Repressalien ausgesetzt, teils in Haft genommen, weil sie gegen Bergbauprojekte, Waldrodungen oder die Vertreibung von Kleinbauern vorgingen, »an der Verteidigungslinie gegen den ökologischen Kollaps«3, wie es die Organisation Global Witness nennt. In Europa leben Umweltaktivisten und Naturschützerinnen zwar nicht so gefährlich wie in Mexiko, Kolumbien oder Brasilien. Aber viele Kämpfe um Landressourcen im globalen Süden sind mit unseren Konsumansprüchen unmittelbar verbunden (Kap. 8). Und auch hierzulande prallten Staat und Bürger im besetzten Hambacher Forst und im kleinen Dorf Lützerath aufeinander, als Tausende Aktivistinnen und Aktivisten fruchtbaren Boden vor den Schaufeln der Braunkohlebagger retten wollten. Umweltschützer versammelten sich in Protestcamps gegen geplante Gewerbegebiete auf der besagten grünen Wiese. Oder sie versuchten, Pläne des Autokonzerns Tesla einzudämmen, dessen »Gigafactory« für Elektroautos mitten in der dürregefährdeten Brandenburger Grünheide ein Wasserschutzgebiet gefährdet. Fast 200 Hektar Wald fielen der »grünen« E-Mobilität zum Opfer. Und das sind nur die spektakulärsten Konflikte.
Wer entscheidet über das Land?
Auch ohne überregional Schlagzeilen zu liefern, verstärkt sich der Streit um das Land. Zum Beispiel im Hamburger Klövensteen, einem idyllischen Waldgebiet vor den Toren der Stadt, wo der Milchbauer Hauke Jaacks seinen Hof an einen Immobilienmakler verloren hat. Die Familie Jaacks hatte den Moorhof seit vielen Jahren gepachtet, ihre große Herde rotbunter Milchkühe auf den Weiden am Wald gehörte für die Erholung suchenden Hamburgerinnen zum Landschaftsbild wie die Knicks, die langen Hecken entlang der Weiden und die alten Eichenalleen. Als die Eigentümer sich zum Verkauf ihres Hofes entschlossen, meldete Jaacks sein Interesse an. Er wähnte sich sicher, den Hof kaufen zu können, schließlich haben landwirtschaftliche Pächter ein Vorkaufsrecht. Doch ein Hamburger Immobilienmakler überbot den Milchbauern und bekam den Zuschlag für einen Pferdehof – trotz Gerichtsverfahren und einer bundesweiten Petition mit 170.000 Unterschriften für den Erhalt des Bauernhofs. Hauke Jaacks blieb, hoffte auf neue Flächen in der Nähe, widersetzte sich einer ersten Zwangsräumung und gab nach zwei Jahren Kampf schließlich auf. Sein Lebenswerk, die rotbunte Herde, wurde größtenteils verkauft und geschlachtet.
Zum Beispiel im Trebeltal unweit von Rostock. Hier lebt eines der letzten hundert Schreiadlerpaare in Deutschland. Gerd und Gerda, so haben Naturschützer sie getauft. Die Greifvögel nisten im »Wilden Wasdow«, einem in Teilen noch 400 Jahre alten Wald mit mächtigen Buchen und Eichen, Erlen und Hainbuchen, Flatterulmen und Vogelkirschen. In der grünen Kathedrale kann man Schwarzspecht und Raufußkauz finden, Siebenschläfer und Wolf, zwischen zartgrünen Jungbäumen gedeihen Buschwindröschen und Scharbockskraut. Dass hier Schreiadler brüten, ist auch ein Erfolg der Michael Succow Stiftung. Zwölf Jahre lang arbeitete sie für ein Ziel: Der Wald sollte sich zu einer Wildnis entwickeln können. Möglich wurde das, weil der Staat den Wasdow als Nationales Naturerbe dem Bodenmarkt entzogen hatte. Und das nicht isoliert, nicht als Insel, sondern in Verbindung mit den benachbarten Fluss- und Offenlandbiotopen, die der scheue Waldvogel zum Jagen braucht. Die Naturschützer konnten die Pflege übernehmen, weil ihnen 21 Hektar aus dem vormaligen Treuhandbesitz übertragen worden waren und damit die Verantwortung, etwa die Hälfte des Waldgebietes in seiner Ursprünglichkeit zu erhalten und zu erneuern. Bis diese Flächen unter den Hammer kamen. Einer von 23 MiteigentümerInnen hatte eine Zwangsversteigerung erwirkt. Für ihn war der Wald unter anderem deshalb so attraktiv, weil er sich mit angrenzenden Flächen zu einem Eigenjagdbezirk aufrechnete und damit eine enorme Wertsteigerung erfuhr. Denn nur ab einer bestimmten Größe darf ein Besitzer das Jagdrecht ausüben. Im Privatbesitz könnte der Wasdow nun forstwirtschaftlich genutzt werden, womöglich sogar intensiv angesichts der wachsenden Holznachfrage. Das brächte Unruhe in den Wald, die der Schreiadler nicht gut verträgt. Über Jahre verhandelte die Succow-Stiftung, schließlich mobilisierte sie Spenden, um ihr Waldstück kaufen und den Naturschutz absichern zu können. Doch das Geld reichte am Ende nicht aus.
Drittes Beispiel: das Münchner Umland. Dort könnten die Pioniere vom Kartoffelkombinat, das über 2000 Münchner Haushalte mit Gemüse versorgt, ihre Pachtflächen verlieren – an Photovoltaik-Investoren. Die Genossenschaft gilt als Vorzeigemodell dafür, wie der Umbau der Agrar- und Ernährungssysteme gelingen kann. Sie hat nicht einfach Kunden, sondern teilt die regionale, ökologische Gemüseernte unter den Genossen auf, arbeitet selbstbestimmt und zahlt ihren Gärtnerinnen und Gärtnern faire Löhne. Das alles sei nun in Gefahr, sagt der Gründer und Vorstand Daniel Überall. »Der Pächter hat uns gekündigt. Ende 2025 läuft der Vertrag aus. Investoren, die Photovoltaik pflanzen wollen, bieten Summen, die sich mit fair produzierten Lebensmitteln nicht erwirtschaften lassen.«
Und noch ein Beispiel, das ebenfalls in Bayern spielt. Zwischen den Gemeinden Straßkirchen und Irlbach in der Nähe seines Werkes in Dingolfing hat der BMW-Konzern große Flächen aufgekauft, um seine Fahrzeugproduktion mit dem Bau eines Batteriemontagewerks auf E-Mobilität umzurüsten. 2024 ist der Bau geplant, 3000 Menschen sollen am Ende dort arbeiten, junge Leute dort ausgebildet werden für eine Zukunftstechnologie. Ein Pumpwerk für den Wohlstand der Region, so sehen es viele, und ein »Bekenntnis« des mächtigen Autoherstellers »zum Wirtschaftsstandort Bayern«, wie der Minister für Wohnen, Bau und Verkehr, Christian Bernreiter, schwärmte. Er sei »fast vom Stuhl gefallen, dass Leute dagegen sein können«, sagte er fassungslos in der populären Sendung »Jetzt red i«4. Doch der Bayerische Rundfunk berichtet dort über »hitzige Stimmung«, denn es gibt sie durchaus, Leute, die dagegen sind, die fruchtbarsten Böden Bayerns unwiederbringlich zu versiegeln. Etwa den Bauern Hans Ringlstetter, der nachdenklich vorbrachte, in einer »Kornkammer«, deren Boden beste Fruchtbarkeitswerte aufweise, dürfe man heutzutage nicht mehr 105 Hektar Land für die Erzeugung von Lebensmitteln einfach preisgeben: »Von Beton kann man nicht runterbeißen.« Oder es sind Naturschützer wie Richard Mergner vom BUND, der eine neu gebaute »Kiste auf besten Böden« und Parkplätze zu ebener Erde in Zeiten vielfacher ökologischer Krisen als »eigentlich ein Verbrechen« bezeichnet – »in den Böden muss Wasser versickern!« – und eine fantasievollere Planung mit der Umnutzung vorhandener Standorte forderte, »Intelligenz statt Beton«.
Man könnte bei so einer Deutschlandreise an vielen Baustellen anhalten, die legitimen Interessen, ja wichtigen Zielen dienen, aber Ackerflächen, Moore, Sümpfe, Heideflächen oder Wälder gefährden (Kapitel 4). Die Fragen, die all die scheinbar lokalen Konflikte aufwerfen, sind tatsächlich übergreifend und strukturell, und sie spitzen sich ähnlich, ja oft noch drastischer im Rest der Welt zu: Hat das Menschenrecht auf Wohnen Vorrang oder das Lebensrecht eines Tieres, einer Art? Zählen Straßen und Ställe mehr oder revitalisierte Moore? Solaranlagen oder Äcker? Holznutzung oder wilder Wald? Wasser für die Landwirtschaft, für die Industrie, für Kraftwerke, zum Trinken? Wer zuerst kommt, mahlt zuerst?
Die Knappheit und Überbuchung des Grundes war lange der Elefant im Raum. Erstaunlich spät, aber jetzt immer öfter ist die Rede von der Fläche als »neuer Währung«, so formuliert es der Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Stefan Tidow, oder immer wieder vom »neuen Gold«. Um jeden Hektar Erde wird gebuhlt. Immer schneller wird Land deshalb immer kostbarer und laufend teurer. Das gilt für Baugrundstücke in den Städten, für den Wald. Im Wasdower Wald etwa lag die Versteigerungssumme am Ende fast doppelt so hoch wie der Verkehrswert. Und laufend teurer wird besonders das Ackerland. Familienbetriebe können beim Kauf von Agrarflächen kaum mehr mithalten, da die Preise auf dem Bodenmarkt drastisch viel höher gestiegen sind als die Einkommen. Ein Viertel der Äcker, die in den vergangenen Jahren den Besitzer gewechselt haben, wurde von Käufern ohne agrarwirtschaftliche Vorgeschichte erworben. Dazu gehören Finanzfonds, Immobilienunternehmen oder Firmenbesitzer wie der kürzlich verstorbene Brillenhersteller Fielmann. Immer mehr Grund und Boden gehört immer weniger Menschen oder Organisationen (Kapitel 5).
Ein Elefant im Raum ist das immer noch, weil man nicht gern darüber redet, dass die Verfügungsmacht über Eigentum beschränkt werden müsste. Sonst droht eine Refeudalisierung des Landes, national wie weltweit. Seit einigen Jahren gehen Unternehmen aus reichen Ländern auch in Afrika, Asien oder Südamerika auf Boden-Shopping-Tour. »Sollen Sie doch Kolonien fressen«, spottet David Montgomery, Professor für Geomorphologie und Autor des Buches »Dreck – Warum unsere Zivilisation den Boden unter den Füßen verliert«5, in Anspielung auf das legendäre Kuchenzitat aus der Französischen Revolution.
Bodenversiegelung – ein Kavaliersdelikt?
Die Folge der enorm steigenden Nachfrage nach »Biomasse«, wie Ökonomen Pflanzen gerne nennen, war bislang allzu oft ein gleichförmiger, großflächiger Anbau von anfälligen Kulturen auf Kosten der Böden – während der Energie-, Mobilitäts- und Bauhunger der Städte weitere Flächen frisst. In Deutschland sind schon rund 45 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsfläche zubetoniert. Von 2017 bis 2020 wurden im Durchschnitt täglich 54 Hektar pro Tag zusätzlich für Gebäude, Straßen, Windräder oder PV-Anlagen ausgewiesen und damit potenziell oder schon real versiegelt. Das sind weniger als um die Jahrtausendwende, da lag der tägliche Betonierungszuwachs wegen des Baubooms bei 190 Hektar. Doch 2021 drehte sich der Trend wieder, die Zahl stieg erneut auf 55 Hektar, eine Fläche, die mehr als 78 Fußballfeldern entspricht. Und es ist kein Ende in Sicht, im Gegenteil: Die neue, beschleunigte Bau-Euphorie der Ampelkoalition lässt weitere Betonierung befürchten. Eine Vielzahl kommunaler Einzelentscheidungen, die dem zugrunde liegen, summieren sich zu einem klaren Verstoß gegen die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Sie fordert das Gegenteil: Bis zum Jahr 2030 sollten noch höchstens 30 Hektar täglich zusätzlich in Anspruch genommen werden. Die fatale Entwicklung wird hingenommen wie ein Kavaliersdelikt. Dabei fordern Experten schon lange eine Null-Expansions-Politik. Netto null auch für den Landverbrauch.
Und besser noch wäre ein Minus, denn hinzu kommt, wie gesagt: Der Boden ist die existenzielle, unersetzliche, faszinierende, verletzliche Ressource, der Quell allen Lebens, »wertvoller als Diamanten«, so versucht der grüne Agrarminister Cem Özdemir die Goldmetapher noch zu toppen (Kapitel 2). Aber diese Ressource ist nicht nur knapp, sondern vielerorts dramatisch geschädigt, erodiert, vergiftet, ja existenziell bedroht. »Gut möglich, dass der Boden das komplexeste unserer lebenden Systeme ist«, schreibt der renommierte englische Umweltjournalist George Monbiot in seinem Buch »Neuland«6 – »und wir behandeln ihn wie Dreck«, bestenfalls wie »totes, passives Substrat«.7 Die Folge sind Wassermangel, Artensterben, drohende Nahrungsmittelknappheit.
Die US-Amerikaner haben das schon einmal erlebt, in den Dreißigerjahren des letzten Jahrhunderts, als sich weite Teile der Great Plains nach einer Dürre in eine Staubwüste verwandelt haben – nachdem das Präriegras gerodet und der Boden falsch beackert worden war. John Steinbeck hat in seinem Roman »Die Früchte des Zorns« über die »dust bowl« und die Not, die sie ausgelöst hat, geschrieben. Daran erinnert man sich jetzt angesichts der dramatischen Bedrängnisse und Konflikte in Teilen des globalen Südens. Dort holen Kleinbauern, um die sich jahrzehntelang kein Staat mit Beratung und Hilfe gekümmert hat, aus dem Boden, was geht – bis nichts mehr geht. Der Klimawandel verschärft die Degradierung. Schon bis 2050 werden laut dem Weltatlas der Desertifizierung 500 bis 700 Millionen Menschen gezwungen sein, ihre Dörfer zu verlassen, weil ihr Land sie nicht mehr ernähren kann8.
Dabei werden gute Böden dringend gebraucht, um die vielen, lange bekannten und mittlerweile existenziellen Krisen zu lösen. Ohne gesunde Böden keine Wälder, die wieder Wasser speichern und Wolken bilden, keine Feuchtgebiete und Wiedervernässung der Moore, keine Ausdehnung begradigter Flüsse, keine Erneuerung der Anbausysteme, keine Rettung der biologischen Vielfalt mit summenden Wiesen, keine Steigerung der ökologischen Funktionen von Nutzflächen und Naturräumen. Längst geht es darum, die Böden, die alle Ökosysteme miteinander verbinden, nicht mehr nur zu erhalten, sondern sie zu erneuern. George Monbiot schreibt kategorisch: »Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Flächennutzung die wichtigste aller Umweltfragen ist.« Die Landnutzung als Ursache für die sozialen und ökologischen Krisen und zugleich als Kern der Lösung: Dieses komplexe Überlebensprojekt ganz neu zu steuern, ist tatsächlich entscheidend, es ist eine politische Mammutaufgabe. Und diese Aufgabe ist hochbrisant. Schließlich geht es dabei auch um eine im kapitalistischen System besonders heilige Kuh: das Eigentum.
In Deutschland implodiert der Konflikt im Spannungsfeld zwischen zwei Grundgesetz-Artikeln. Auf der einen Seite schützt der Staat laut Artikel 20a »auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere«. Auf der anderen Seite gewährleistet Artikel 14 das Eigentums- und Erbrecht. Allerdings mit einer oft übersehenen Einschränkung, die es in sich hat: »Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.« Diese Anforderung empfinden die einen als Übergriff in ihre Freiheit. Sie sehen die Entscheidung darüber, wie man Land und Boden nutzt, allein in der Macht und Verantwortung der EigentümerInnen. Die anderen wertschätzen den Boden vorrangig als existenzielles Gemeingut (Kapitel 6).
Neue Gesetze für den Boden
Politik für den Boden: Über Jahrzehnte haben die meisten Regierungen diese Aufgabe schlicht vernachlässigt. Man erkennt es schon daran, dass Land und Boden im Gegensatz zum Wasser, zum Klima oder auch zur Artenvielfalt lange durch kein starkes globales Abkommen geschützt worden sind. Seinem Erhalt diente nur die UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung. Aber deren Programme widmeten sich, noch dazu beschämend unterfinanziert, vorrangig Ländern wie Burkina Faso oder Mauretanien, die seit jeher in aller Härte mit den Folgen von Erosion und Austrocknung konfrontiert sind.
Erst seit sich auch im Mittelmeerraum Wüsten entwickeln und Dürren bis nach Deutschland auszubreiten drohen, seit der Boden von Indien über die Po-Ebene bis zu den amerikanischen Great Plains geringere Ernten bringt, verhärtet, erodiert, weggeschwemmt wird und zugleich auf der Positivseite endlich auch als Gesundheitsquell, Kohlenstoffspeicher und damit Klimaschützer anerkannt wird, rückt seine Erneuerung auf unterschiedlichen Ebenen in den Fokus der politischen Aufmerksamkeit. Seit 2015 ist der Boden in der Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen verankert, auch in der Klimarahmenkonvention der VN wurde er zum Thema. Der Ruf nach einer umfassenderen globalen Boden-Konvention wird lauter. Mit dem europäischen Green Deal soll endlich auch eine EU-Bodenschutz-Richtlinie verabschiedet werden; auch wenn der vorliegende Entwurf sich bisher vor allem auf Messungen und Monitoring beschränkt. Um die gefährdeten Böden – unsere Lebensgrundlage – wirklich zu schützen, bräuchte es Auflagen für ihre Wiederbelebung, einen De-facto-Stopp für jede neue Versiegelung, eine Obergrenze für die Größe einzelner Besitztümer, damit auch kleine und mittelständische Betriebe erhalten bleiben. Bislang haben sich die Bundes- und Landesregierungen an solche Ziele noch nicht herangewagt. Hoch bedeutsam für die Qualität der Böden sind zudem die europäische Agrarreform und die Renaturierungs- und Natur-Flächen-Gesetze, die gerade abgestimmt werden. Große Hoffnung für besteht nicht, gemessen am aktuellen Fokus der Koalition auf einen flächenfressenden, planungsbeschleunigten Infrastrukturausbau. Gemessen auch daran, dass der Bundeshaushalt mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom November 2023 zur Finanzierung des Klima- und Transformationsfonds unter heftigen Druck geraten ist. Immerhin widmen sich neben den Regierungen und Parlamenten auch immer mehr gesellschaftliche Initiativen dem Ziel, die Wirtschaft, vom Boden her gedacht, im Wortsinn Grund legend umzugestalten (Kapitel 9).
Vorrang für »Mehrgewinnstrategien«
Zusammendenken, das ganze System in den Blick nehmen: das ist angesichts der beschriebenen Konflikte und Widersprüche eine Schlüsselqualifikation der Zukunft. Dass an einem solchen geerdeten Rundum-Blick kein Weg vorbeiführt, hat der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen der Bundesregierung (WBGU) bereits in seinem Gutachten »Landwende im Anthropozän« gefordert. Die unterschiedlichen Formen, Land zu nutzen, müssten sich »von der Konkurrenz zur Integration« bewegen, heißt es darin. Gesetze, Planung und Praxis sollten mit Vorrang »Mehrgewinnstrategien« vorantreiben, also praktische Lösungen und Programme, die viele Probleme und mehrere Wenden zugleich hebeln (Kap. 9).
Solche »soziotechnischen« Innovationen sind oft experimentell, auch sie können im Gewirr der Zielkonflikte unvorhergesehene Nebenwirkungen mit sich bringen. Die systemischen Reformen erfordern daher auch neue wissenschaftliche Begleitgremien, Entscheidungs- und Korrekturwege, zudem eine politische Fehlerkultur und so viel demokratische Beteiligung wie möglich. Je mehr Augen auf ein Problem schauen, je mehr Menschen mitreden, desto schärfer wird der Blick fürs falsche Detail und richtige Ganze. Für die »Landwende zur Nachhaltigkeit« seien »politischer Wille, Kreativität und Mut« gefordert, schreiben daher die Gutachter des WBGU: »Es braucht Pionier*innen, die neue Wege testen und beschreiten, Staaten, die Rahmenbedingungen setzen, notwendige Maßnahmen durchsetzen und miteinander kooperieren, sowie Mechanismen eines gerechten Ausgleichs zwischen Akteuren.«
Doch Kreativität? Mut? Politischer Wille? »Die vermag ich bislang nur bei wenigen Themen zu erkennen«, resümierte die Umweltjuristin und Co-Vorsitzende des WBGU Sabine Schlacke drei Jahre nach Erscheinen des Gutachtens. In der politischen Praxis erweist sich auch die schöne Formel des WBGU, die Transformation müsse »systemisch, synergistisch, solidarisch« in Angriff genommen werden, bislang als schöner Traum. Im Gegenteil: Statt integrierter Planung präsentierte Wirtschaftsminister Robert Habeck ein Eckpunktepapier zu Windenergie und Artenschutz, das er mit der Umweltministerin Steffi Lemke ausgehandelt hatte, ausdrücklich als »Trenngesetzgebung«. Klimaschutzanlagen hier, Artenschutz da. Technisch verbaute Schmutzgebiete hier, Schutzgebiete da. »Von vorgestern«, so urteilt Thomas Potthast, Professor für Ethik, Theorie und Geschichte der Biowissenschaften in Tübingen. Und dann gilt auch noch meist: Klima first, Arten second. Das ist das Gegenteil von Zusammendenken, es ist ein Rückschritt ins Eindimensionale.
Er hat viele Gründe: Die Pandemie, Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, als Folge die weltweite Inflation und dann seit Oktober 2023 der Nahost-Konflikt haben mit kurzfristigen Prioritäten die langfristigen Notwendigkeiten zu einem Teil wieder in die zweite Reihe gedrängt. Aus einem schnell aufgelegten Sondervermögen sind 100 Milliarden in die Verteidigung geflossen, und als first gilt jetzt Geopolitik. Zweitens sind die ökologischen Probleme drei Jahrzehnte lang aufgeschoben worden, »der Handlungsdruck ist im Anthropozän größer als je zuvor in der Menschheitsgeschichte«, schreiben die Gutachter des WBGU. Die Zielmarke 2030, die für den Green Deal und viele andere Herausforderungen festgelegt wurde, lässt in Europa nur noch sechs Ernten und eineinhalb Legislaturperioden Zeit. Dass dementsprechend nun alles gleichzeitig geschehen muss, überfordert viele.
Drittens denken und wirken Wissenschaftlerinnen, Ministerialbeamte, Manager, Naturschützerinnen oder Bauernverbandsfunktionäre meist in den Logiken ihrer Organisationen. Den eigenen Silo zu verlassen, die anderen Perspektiven in Entscheidungen einfließen zu lassen, ist kaum eingeübt. Vierter Grund: Verwaltungen sind kolossal überfordert. Ihnen fehlen Mitarbeiter, die einen schon jetzt detailwütigen Regelwust praktisch umsetzen und seine Einhaltung kontrollieren sollen; ganz zu schweigen von fachübergreifenden Planungsnetzwerken. Schließlich der fünfte Grund: Das alte System leistet erheblichen Widerstand. In allen Industrien gilt zwar Nachhaltigkeit mittlerweile als »Megatrend«. Aber Lobbyisten der herkömmlichen Energie-, Finanz- und Agrarsysteme blockieren immer wieder Innovationen, die auf der Höhe der Probleme stehen, sie diffamieren soziale Ansätze und versuchen stattdessen, vermarktbare technologische Lösungen durchzusetzen. Diese folgen oft eher einer wirtschaftlichen Logik als jener der Nachhaltigkeit. Die Spreu vom Weizen zu trennen: Auch dazu soll dieses Buch anregen.
Das klingt ganz schön kühn, denn: Alles verwirrend, alles kompliziert, wie soll man derart viele, derart vielschichtige Herausforderungen gleichzeitig bewältigen? Wie eine solche Herkulesaufgabe stemmen, wenn doch mögliche Transformationsverlierer wie die Gegner der Heizungsgesetze schon jetzt erfolgreich medialen und politischen Widerstand mobilisieren? Wie verhindern, dass Teile der Gesellschaft überfordert werden und nach rechts abdriften, so wie in der Bauern-Bürger-Partei in den Niederlanden oder wie hierzulande in der AfD? Wie Komplexität managen, wenn zugleich der Zeitdruck steigt? Immer schneller geben die Beschleunigung des Klimawandels und des Artensterbens, die Digitalisierung, die Globalisierungs- und Renationalisierungsprozesse den Takt vor – während zugleich weite Teile der Gesellschaft die Dimension der Probleme noch immer verdrängen oder leugnen und bei Dürren nicht Hunger und Durst befürchten, sondern »leere Pools und Duschverbote«, wie das Magazin Stern im Sommer 2023 warnte.
Auch wir unterliegen diesem Zeitdruck, schon deshalb können wir nicht bei allen Aspekten tief bohren. Vieles werden wir nur exemplarisch herausgreifen, internationale Aspekte etwa nur streifen, auch der Wald und seine Gefährdung hätte mehr Raum verdient. Die rasant schnelle politische Entwicklung bei all diesen Themen mag manche Aussage, manches Datum schon wieder überholt haben, wenn dieses Buch erscheint. Aber die strukturellen Probleme und existenziellen Gefahren bleiben, und es hilft nichts: Wir dürfen die Augen vor dem Druck auf Böden und Flächen nicht länger verschließen. Je mehr wir zögern, desto mehr Menschen und andere Lebewesen wird es treffen. Bei der Europawahl müssen Grund und Boden Thema werden, bei den Landtagswahlen im Herbst 2024 und ebenso im Jahr 2025, wenn in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt wird.
Im Dickicht widersprüchlicher Aufgaben und Anfeindungen helfen vielleicht am besten jene Ratschläge, die Hermann Scheer, der SPD-Politiker, Vordenker und Gestalter des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, eines Welterfolgs, sich und anderen gab: Nicht aufhören, unermüdliche Überzeugungsarbeit zu leisten. Den »Knackpunkt« suchen. Nicht überall gleichzeitig wirbeln, sondern Prioritäten setzen.
Bei Land und Boden liegt der Knackpunkt im Dreieck der Nachhaltigkeit. Viel zu lange wurden der Ökologie, der Ökonomie und dem sozialen Ausgleich Gleichrangigkeit zugeschrieben. Ungekannte Dürren, Fluten, Stürme und Ressourcenkrisen als Folgen des Klimawandels zeigen aber immer klarer, von Pakistan bis ins Ahrtal, von der Po-Ebene bis nach Kanada, von Slowenien bis Kenia und Haiti: Naturgesetze sind unerschütterlich. Wir müssen die Priorität unzweifelhaft klarer setzen: Ecology first. Es geht nicht mehr um die viel zitierte »Versöhnung« von Ökonomie und Ökologie, das war schon immer ein Euphemismus.
Gerade wer sich mit dem Boden beschäftigt, diesem Medium des großen Zusammenhangs, der erkennt unmissverständlich: Wir leben in einer üppigen, erfindungsreichen Natur – aber sie setzt uns Grenzen. Das mechanisch fortgeschriebene Wachstum des Bisherigen ist auch mit grünem Anstrich zukunftsblind. Wir müssen vielmehr einen neuen »frugalen Wohlstand« (Wolfgang Sachs) erfinden (Kapitel 10). Was dabei Vorrang hat, wo man beginnen muss, das weiß, wer den Problemen auf den Grund geht und sie dann tiefgründig an den Wurzeln löst.
2
DER URGRUND ALLES LEBENDIGEN
Wurzeln und Würmer, Mikroben und Pilze, die gemeinsam ständige Wiederauferstehung schaffen: Das Wunder der Unterwelt
Was sind das für Geräusche, welche seltsamen Lebewesen äußern sich so? Da kommt ein Schnarren aus der Stille, rhythmisch, wie aus einem alten Funkgerät. Dann nähern sich langsam tiefe Töne, entfernen sich wieder, als wäre eine fremde Kreatur vorbeigelaufen, unterwegs zu einem unbekannten Ziel. Stille. Jetzt rumpelt es plötzlich, als würde mit höchster Anstrengung ein Stein weggeschoben. Ein zarter Fußspitzengalopp, zittriges Mähen, Grunzen, Gekicher, Geknister. Solche Beschreibungen können sich einer Welt nur annähern, die man nicht hört und sieht und eigentlich mit nichts als Ruhe verbindet. Mit Grabesruhe.
Es sei denn, man stieße ein Rohr mit feinsten Sensoren in den Grund hinein, um herauszufinden, wie der Boden klingt. Marcus Maeder, Umweltwissenschaftler an der ETH Zürich, hat das gemeinsam mit Kollegen verschiedener Bio-Disziplinen an mehreren Orten der Schweiz gemacht. Was er da unten zu hören bekam, hat er vor einigen Jahren im Kunstmuseum Bern präsentiert: »Sounding Soils«, tönende Böden, hervorgebracht von Maulwürfen, Springschwänzen, Milben, Tausendfüßlern, Käfern, Würmern, Spinnen, Heuschrecken und Zikaden, begleitet vom fernen Pianissimo eines sanft eindringenden Landregens.
Was sind das für Botschaften: Warnungen, Arbeitskommandos, Lockrufe auf Brautschau? Wird da überhaupt kommuniziert oder unabsichtlich vor sich hin gelärmt? Die Forscher wissen es nur teilweise, das regt die Fantasie dazu an, etwas zu tun, was bei der Betrachtung der Natur eigentlich fragwürdig ist: sie zu vermenschlichen. So viel aber ist gewiss: Da unten tobt das Leben. Die Fress- und Buddelgeräusche kleiner und größerer Tiere vereinen sich zu einem vielstimmigen Untergrund-Konzert, ähnlich wie es überirdisch schön die Vogelgesänge, das Insektensummen oder das Quaken der Frösche im Wald tun. Die Schweizer Forscher stellten fest, dass einige Krabbeltiere, die auf der Oberfläche leben, den Boden nutzen, um sich über Vibrationen miteinander zu verständigen. Auch diese Erkenntnis kann man hören: Jeder Boden klingt anders. Im Waldboden ist es stiller, weil die Tiere in dieser kühleren Lebenswelt etwas weniger aktiv sind. Ein Acker, der konventionell bewirtschaftet wurde, weist laut den Wissenschaftlern des Sounding-Soils-Projektes weniger Geräuschvielfalt, also weniger Lebewesen auf als ein kunstdünger- und pestizidfreies Bio-Pendant.
Markus Maeder ist nicht der Einzige, der den Untergrund mit bioakustischer Empirie auf überraschende Weise zugänglich macht. Auch französische Forscher sind den Lauten auf der Spur, die Wurzeln beim Wachsen hervorbringen oder Regenwürmer, wenn sie ihren Weg durch die Erde graben. Über die Töne des subkulturellen Orchesters wollen sie den Boden und seine Bewohner genauer verstehen. Aber zugleich sind ihre Aufnahmen Versuche, möglichst vielen Menschen den existenziellen Wert dieser fremden Lebenswelt zu vermitteln, Neugierde und Faszination für sie zu wecken.1 Wie viele andere Experten zielen sie darauf, »dem Boden eine Sprache zu geben«. Das Umweltbundesamt ließ aus dem gleichen Beweggrund sogar eine »Bodenkantate« in drei Sätzen komponieren.2 Didaktische Kammermusik. Ein Sänger intoniert zu Piano, Gitarre, Tuba und allerhand Percussion ein Hohes Lied auf Fadenwürmer, Rädertiere und andere Lebewesen.
Denn dass der Boden eine große biologische Gemeinschaft beherbergt und eine, wie die EU-Kommission knapp formuliert, »vitale, begrenzte, nicht erneuerbare und unersetzliche Ressource« ist, die man nicht mit Füßen treten darf, das liegt einer weitgehend urbanen Gesellschaft immer noch fern, gelinde gesagt. Der Journalist Peter Härlin hat sich schon vor einem Dreivierteljahrhundert, also vor der exponentiellen fossilen Wachstumsdynamik und der vollen Entfaltung der Grünen Revolution, über diese Entfremdung Gedanken gemacht. »Grundstück – das ist einem jeden ein wohlgefüllter Begriff«, schrieb der Stuttgarter seinerzeit in einer Kolumne, die er mit dem Titel »Erde, Sonnenschein und Regen« überschrieb. »Es ist die Oberfläche, das Substrat für Maß und Zahl, unpersönlich und seelenlos wie das Meter selbst, nach dem man es mißt. Erde aber, das ist der Inhalt, die Tiefe, der Ur-Grund alles Lebendigen, nicht nur mechanisch seine Unterlage. Das ist der Körper des Globus, wenn nicht beseelt, so doch dem Lebendigen nahe verwandt, das in ihm wurzelt. Rohstoff der Schöpfung ist das, Station im Kreislauf alles Irdischen, in aller Welt Symbol alles dessen, was uns, die wir zwischen Diesseits und Jenseits wandeln, dem Diesseits verknüpft.«
Don’t look up, look down
Härlins Sohn Benedikt ist heute in der Zukunftsstiftung Landwirtschaft ein unermüdlicher Vordenker und Aufklärer der globalen und lokalen Notwendigkeit, die Böden wieder zu beleben. Denn noch immer übersehen die meisten Leute den Grund, ignorieren ihn, missachten ihn, als erinnere er sie zu sehr an ihr eigenes Ende. Oder er gilt als totes Zeug, schlichtweg: als Dreck. Eklig. In diese Blackbox fasst man höchstens mal mit Plastikhandschuhen, um Topfblumen hineinzupflanzen. Die Bodenhaftung fehlt nicht nur den Laien, sondern auch vielen Wissenschaftlern, politischen Entscheidungsträgern und sogar manchen Praktikern in der Landwirtschaft. Auch über die professionelle, ja innige Nähe der Bauern zu ihrem wichtigsten Produktionsmittel machte sich Peter Härlin in den Fünfzigerjahren Gedanken: »Warm, kalt, hitzig, das sind Fachausdrücke, die sozusagen den Charakter des Bodens bezeichnen«, schrieb er, »sie bezeichnen Valeurs, die der Kundige fühlt, die er prüft und wertet wie der Weber den Stoff zwischen seinen Fingern. Er fühlt, wie die Erde schafft, wie sie gar wird, erneute Fruchtbarkeit versprechend, wie schlechter Boden sich nicht rührt, ›träge‹ daliegt, endlosen Fleißes bedürftig, um fruchtbar zu werden.«3
Dann kam die Agrarchemie, und lange haben auch viele Landwirte und vor allem ihre Berater die schwarze, kaffee- und rostbraune oder schlammgraue Erde zu sehr als neutrales, lebloses Substrat betrachtet. In dieses Zeug musste man nur Saatgut, Dünger und andere chemische Produkte hineinstecken, damit es große Mengen von meistens Weizen, Mais oder Zuckerrüben hervorbringt, als billige Rohstoffe für die bunte Produktwelt der Lebensmittelindustrie. Der intensiven Landwirtschaft, die oft irreführend als konventionell bezeichnet wird, ist das eindrucksvoll gelungen, immer ertragreicher haben sie den Boden gemacht, die Ernten um ein Vielfaches gesteigert, doch mit dramatischen Folgen: In vielen Regionen ist der Grund am Boden zerstört. 60 bis 70 Prozent der europäischen Böden seien aus dem Gleichgewicht oder geschädigt, bilanziert die Europäische Kommission auf Basis von Schätzungen, denn, auch das ist ein Indiz für die Missachtung der Böden: systematische Daten haben nur einige EU-Länder erfasst. Demnach sind 2,8 Millionen Standorte potenziell vergiftet, ein Viertel davon nachgewiesenermaßen. 83 Prozent der Ackerböden enthalten Pestizidrückstände, drei Viertel sind überdüngt, vor allem mit Stickstoff, der mit gigantischem Energieaufwand erzeugt werden muss und Böden übersäuert. 23 Prozent der Böden sind bis auf die unteren Schichten durch Landmaschinen und Bearbeitung verdichtet, sodass Staunässe und Sauerstoffmangel das unterirdische Leben ersticken. 25 Prozent haben nicht mehr genug Wasser, 25 Prozent drohen zu verwüsten. Das Bundesamt für Naturschutz beschreibt bei seinen Blicken »unter den Tellerrand« schon die Gefahr, dass bestimmte im Boden lebende Organismen aussterben könnten, noch ehe sie überhaupt taxonomisch erfasst wurden.4 Damit ist die intensive Landwirtschaft »die vielleicht einzige Branche, die ihre eigene Grundlage zerstört«, so hat es der luxemburgische Agrarminister Fernand Etgen einmal formuliert. Und die Böden, unsere »stummen Verbündeten«, so der frühere Direktor der Welternährungsorganisation FAO Graziano da Silva, haben »keine Stimme, und nur wenige nehmen lautstark für sie Partei«.5
Es wäre zu einfach, das Wegdämmern und Dahinfliegen unserer Lebensgrundlagen den Landwirtinnen und Landwirten vorzuwerfen. Verantwortlich sind wir alle, als KonsumentInnen, als Wähler. Verantwortlich ist vor allem das kurzfristig denkende und handelnde Agrobusiness. Erst seit die Schäden nicht mehr zu übersehen sind, beginnt endlich eine ernsthafte Suche nach Auswegen und die Perspektive ändert sich allmählich, mit dem Titel der amerikanischen Klimawandel-Komödie gesprochen: Don’t look up, look down! Oder besser: Look up, but look down as well … Die Perspektive ändert sich in Konzernetagen, bei Landwirten und Forschern.
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich die Wissenschaft vor allem um eine chemische Optimierung des Anbaus und biotechnologische Diagnostik gekümmert, mit dem Ziel, Pflanzen besser zu schützen und zu ernähren. Doch die einseitige Düngestrategie habe die von ihr selbst mit verursachte Ermattung der Böden nur verdeckt, kritisierte der mittlerweile verstorbene äthiopische Biologe und Träger des Alternativen Nobelpreises Tewolde Berhan Gebre Egziabher einmal im Interview.6 Dieser Ansatz ähnele »der Einnahme von Aspirin gegen Kopfschmerzen: Düngen beseitigt die Symptome, und am Ende ist der Kranke zu schwach, als dass Medikamente noch wirken könnten«. Hinterlassen hat das oft Badlands, schlechtes Land, wie im Titel eines Songs von Bruce Springsteen. Die Biologie des Bodens hingegen haben Forscher in Universitäten und Industrielaboren weitgehend übersehen, ja sogar als Ideologie des Biolandbaus belächelt. Dessen Anhänger mussten sich immer schon stärker um die Böden kümmern, um ohne die gängigen Mittel der Agrarchemie und nur mit wenigen erlaubten Stoffen wie Kupfer arbeiten zu können. Damit wurden sie marginalisiert, »obwohl alle Bodenökosysteme, die Geburtshelfer aller terrestrischen Ökosysteme und eines komplexen Lebens an Land, aus der Bodenbiologie hervorgegangen sind«, wie eine Vielzahl europäischer Experten kürzlich in einem Appell an die EU-Kommission schrieb.7 Seit wenigen Jahren kommen Bodenleben, Kohlenstoff und Klimaschutz aber auch im wissenschaftlichen und politischen Mainstream in den Blick.
Das Wunder der Unterwelt
Der Blick wandert von den Halmen, Blüten, Sträuchern und Bäumen hinab und richtet sich endlich auf die ganz eigene Mitwelt darunter. Wer dorthin schaut, der reibt sich wie ein blinder Maulwurf, der sehend wird, die Augen, wenn er das große Wunder der Unterwelt erkennt: ständige Erneuerung. All die krabbelnden und kriechenden Erdreichbewohner, denen Marcus Maeder auf der akustischen Spur ist und die teils bis metertief unter die Oberfläche dringen, zersetzen dort immer wieder abgestorbene Pflanzenteile, um daraus immer wieder neues Leben zu schaffen. Nur ihrem Geben und Nehmen, ihrem Fressen und Gefressenwerden ist zu verdanken, dass dies ein grüner Planet ist, ein »Planet der Pflanzen« (Stefano Mancuso). Pflanzen, die im Boden wurzeln, wandeln über die Photosynthese Licht, Wasser und Kohlendioxid in Sauerstoff und Biomasse um und ermöglichen erst, dass Menschen und Tiere sich davon ernähren und atmen, dass sie existieren können.
Der Boden ist nicht weniger als der große, atmende, lokale und planetarische Zusammenhang. Er verbindet alles: die Atmosphäre, die Gesteinsdecke, den Wasserkreislauf, die Vielfalt aller Ökosysteme vom Wald über die Flussaue bis zum Acker. Das demütig anzuerkennen wäre ein erster Schritt für uns Boden-Ignoranten. Den Boden noch viel besser zu verstehen, bietet die Chance für eine große Erneuerung unseres Umgangs mit ihm in der Landwirtschaft und zugleich für die Wiederherstellung gesunder Ökosysteme.





























