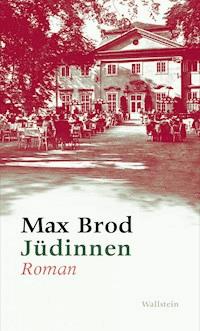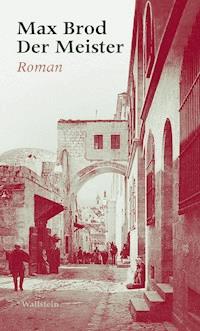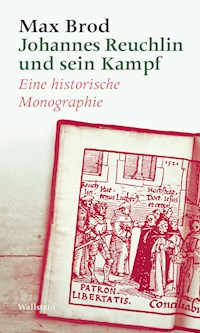Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Max Brod - Ausgewählte Werke
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
In der farbenprächtigen sommerlichen Seelandschaft des Ostseebades Misdroy auf der Insel Wollin erlebt eine kleine Prager Familie um das Jahr 1899 einen fröhlichen Ausnahmezustand. Selbst die strenge Mutter ist hier erträglich, wo die vornehme Atmosphäre des alten Österreich auf die rauhere des Nordens trifft. Das gesellige Leben der Prager deutschsprachigen Juden, hier wird es wieder lebendig, wie auch im zweiten Roman dieses Bandes, »Beinahe ein Vorzugsschüler", einer Reminiszenz an Brods Schulzeit und eine Brücke zur untergegangenen Welt Prags in der Habsburger Monarchie. Die beiden kleinen Romane sind meisterhafte Zeitbilder und gehören zur schönsten Prosa, die Brod geschrieben hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max BrodAusgewählte Werke
Herausgegeben von Hans-Gerd Kochund Hans Dieter Zimmermannin Zusammenarbeit mit Barbora Šramkováund Norbert Miller
Max Brod
Der Sommer den manzurückwünscht
Beinahe einVorzugsschüler
Romane
Mit einem Vorwort vonSigrid Brunk
Gefördert von der Fritz Thyssen Stiftung Köln undunterstützt vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfondssowie dem deutschen Auswärtigen Amt
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnetdiese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internetüber http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2014www.wallstein-verlag.deVom Verlag gesetzt aus Aldus RomanUmschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf© SG-Image u.a. unter Verwendung eines Fotos von Frank M. Sutcliffe© SSPL / National Media Museum / Süddeutsche Zeitung PhotoDruck und Verarbeitung: Hubert & Co, GöttingenISBN (Print) 978-3-8353-1338-5ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-2631-6ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-2632-3
Inhalt
Vorwort(Sigrid Brunk)
Der Sommer den man zurückwünscht. Roman aus jungen Jahren.
Beinahe ein Vorzugsschüler oder Pièce touchée. Roman eines unauffälligen Menschen.
Nachwort(Radka Denemarková)
Editorische Notiz
Über den Autor
Vorwort
Jeder hat einmal im Gespräch über einen Dichter plötzlich gesagt oder sagen hören: »Kennen Sie die kleinen Bücher, die kleinen Erzählungen von ihm? Die sind ganz einmalig!« Oder über einen Maler: »Aber haben Sie auch die kleinen Zeichnungen gesehen, die sind fast schöner als die großen Gemälde. Wenn ich nur so eine kleine Skizze besäße, die wäre mir lieber als das ganze Werk.« Jeder kennt das Staunen über eine kleine vollkommene Stelle inmitten eines großen Werkes, und es scheint ihm, als sei in dieser Kostbarkeit, die von anderen sogar oft übersehen oder nicht genug gewürdigt wird, auf geheimnisvolle Weise das ganze Lebenswerk des Künstlers schon enthalten, alles, was er vor dieser »kleinen« Sache machte, aber auch alles, was später kam. Als habe sich hier sein ganzes Wesen und sein ganzes Können in einem Punkt gezeigt. Das heißt nicht, dass man die anderen Werke nicht auch schätzt, und vielleicht macht man es sich nur so einfach, das Werk, in dem man sich der eigenen Art entsprechend mit dem Künstler ganz einig weiß, zum vollkommensten zu erheben und zum geliebtesten.
So verfahre ich mit jenen Büchern Max Brods, die ich die »kleinen« nenne. Es sind, obwohl der Kreis damit kaum geschlossen sein dürfte, die autobiographischen Erzählungen über seine Kindheit und frühere Jugend im kaiserlich königlichen Österreich, in die die Vorboten der Weltkriege und des Rassenmordes als Randerscheinungen, als Ahnungen einbrechen. Gröbere Gemüter als das angstvoll-kühne des durch lange Krankheit gegangenen Kindes hätten das sich noch als harmlos tarnende Böse sicher gar nicht bemerkt. Es aber war wach und empfindlich geworden und hatte durch geistige Leidenschaft seinen Vorrat an Phantasie und an Wissen, was dem Menschen sowohl an Gutem wie an Bösem möglich ist, enorm erweitert. Schon früh hatte man es lesen gelehrt, damit es sich während des Krankseins beschäftigen konnte. Und während der Körper stillliegen oder bis etwa zum zwölften Lebensjahr in einem Stützkorsett stillhalten musste, spielte der Geist, wurde unersättlich, kannte auch Perioden der Ausschweifung. Mit diesem feinen Instrument nahm der Junge in dem teils strahlenden, teils morbiden Glanz des sterbenden Kaiserreiches, in der Stadt, in der drei Nationalitäten aufeinandertrafen, sich bekämpften, sich stumm duldeten oder Symbiosen eingingen, Gefahren wahr, Zeichen, die auf das Spätere, nach 1938 Geschehende, hinweisen. Diesen Zeichen, die das Kind erschreckten, begegnet man auf Schritt und Tritt in den Büchern. Es sind oft wirklich nur Nuancen, ein gehässiges Wort, eine hochmütige Geste, falsche Ideale, Egoismus, Chauvinismus. Die Summe all dieser Nuancen ist nicht von ihm gezogen worden. Sie wird, da es Erinnerungsbücher sind, in Tel-Aviv geschrieben, an ganz wenigen Stellen oder am Schluss des Buches eingesetzt. Diese Summe, Auschwitz, Theresienstadt …, ist das Einzige, was nachträglich in diese bis ins kleinste Detail genau gezeichnete Jugendwelt hineingebracht wurde. Alles andere ist unter den spezifischen Bedingungen der Dichtung authentisch. Man würde es ja auch spüren, wenn etwas verändert, manipuliert, übertrieben worden wäre. Das war auch gar nicht seine Art. Außerdem wehrt sich die Wirklichkeit solch intensiver Erlebnisse gegen Eingriffe.
Er hasste alles Gewaltsame, Künstliche, Übertriebene. Auch das Wort »hassen« hätte ihm nicht gefallen. Er war im Alter doch wohl seinem Vater ähnlich geworden, dem Kampf und Krampf vermeidenden, ausgleichenden Vater, dessen Fotografie er stets bei sich trug. Sie waren sich auch äußerlich ähnlich. Er wusste, dass das Leben, sofern es nicht gewaltsam gebrochen wird, von den unmerklichen Dingen bestimmt wird, dass es wächst. Nie hat man von zarteren Kindheits- und Jugenderlebnissen gelesen als bei ihm. Oft so zart, so sehr vom Geistigen, besonders von der Musik bestimmt, dass man es heute, in dieser raueren Zeit, nicht gleich verstehen und nachfühlen kann. Solcher geistigen Glut, die den von unerhörten Gewissensskrupeln gequälten Jungen beherrschte, der, obwohl er auch gern wie ein richtiger Junge tobte und spielte, sich sogar für unerlaubte Gedanken strafte wie etwa für den kurzfristigen Unglauben an die charakterliche Einheit des Bruders oder für falschen Ehrgeiz, solcher Glut weicht der Mensch von heute aus, das ist »Romantik«. Längst ist heutigen Schriftstellergenerationen die Achtung vor der eigenen rauschhaften und doch leisen, nach innen gekehrten Entwicklung, des oft peinlichen oder als peinlich empfundenen Grenzbezirks, verlorengegangen.
Dabei bleibt Max Brod mit diesen »kleinen« Büchern Beinahe ein Vorzugsschüler und Der Sommer den man zurückwünscht« so modern wie zum Beispiel Hamsun oder Joseph Roth. Die persönlichen Äußerungen eines Menschen bleiben immer lebendig, wenn sie auch mit ihm altern. Zwar ist das alte Österreich längst vergangen, zwar sind die Jugenderlebnisse an ein bestimmtes Jahrzehnt in einem bestimmten Jahrhundert geknüpft, aber sie sind kraft des Persönlichen niemals muffig, niemals »Theater«, als das manches einem Zeitstil Angepasste oft schon nach einigen Jahren erscheint, nämlich dann, wenn die Mode gewechselt hat. Er hat sich um das, was Mode war, nicht gekümmert, außer vielleicht in frühen Gedichten, die nach Heine klingen. Aber ich weiß nicht einmal genau, ob das dem Zeitgeschmack oder seiner eigenen Bewunderung für Heine entsprang.
Er gibt seine persönlichen Anmerkungen zum Zeitgeschehen unbefangen und mit größter Selbstverständlichkeit. Er misstraute sich nicht, hatte nicht die Abneigung heutiger junger Schriftsteller gegen sich und seine Emotionen, die er auch als solche ausgab und nicht verfremdete. Es war die humanistische Schule, es war Goethe vor allem, der es ja liebte, vom Kleinen, Intimen auf das Allgemeine zu schließen, das Große im Kleinen zu entdecken, dem er darin folgte. Er wusste und konnte es, bei seiner trainierten Gewissenhaftigkeit, von sich sagen, dass er gerecht war. Er war auch behutsam. Deshalb, weil man sich so sehr auf seine Behutsamkeit verlässt, sind die Anklagen, die er gegen die Grausamkeit der Zeit, der Menschen dieser Zeit, gegen die Vernichtung des europäischen Judentums erhebt, besonders schmerzlich. Man windet sich, man wehrt sich als Leser, gerade war man in einer so zauberhaften Jugendbeschreibung drin und nun? Nun wird sie zerrissen von etwas, das kein Gehirn je ganz begreifen kann. Der Schrecken ist da. Den will man jetzt nicht. Er hat manchen Feind gehabt, manche Anfeindung erlebt. Er glaubte, weil er, wie er es nennt, aus einer »polemischen« Stadt stamme, weil er zum Polemisieren neige. Ich glaube aber, dass es geschah, weil sein Polemisieren meist ein Kämpfen für einen hohen Menschlichkeitsbegriff war, der sich, ob ausgesprochen oder nicht, strahlend abhob von dem, was in der Nazizeit geschehen und vielen seiner Freunde und Verwandten, gegen deren Vergessen er in den »kleinen« Büchern angeht, geschehen ist. »Gegen große Vorzüge eines andern gibt es kein Rettungsmittel als die Liebe«, sagt Goethe. Das stimmt nicht. Liebe ist anstrengend, ist unbequem. Einer, der große Vorzüge hat, ist unbequem und wird ignoriert oder bekämpft. Die Abwehr und die Feindschaft mancher Leser ist eine Vergiftungserscheinung, die die Nazizeit hinterlassen hat.
An Flaubert bewunderte er die Genauigkeit der Beobachtung und strebte ihm nach. Er verwob die geistigen Kämpfe seiner Jugend in ein Netz von sinnlich wahrnehmbarer Schönheit. Man staunt über die vielen Eindrücke, die er durch die Natur und durch die äußere Erscheinung anderer Menschen empfing. Besonders dicht ist das Buch Der Sommer den man zurückwünscht in dieser Hinsicht.
Es erzählt von der Sommerreise nach Misdroy an der Ostsee, einer strapaziösen und umständlichen Expedition, die die Familie jedes Jahr unternahm, um dem zarten Jungen, den man gerade erst so viel Krankheit entrissen hatte, etwas Gutes zu tun. Die Mutter mit den Kindern Sophie, Otto und Erwin (d. i. Max) und einem blutjungen tschechischen Dienstmädchen fuhr voraus; der in der Bank nicht für viele Wochen abkömmliche Vater (man blieb bis zum Herbst an der Ostsee) reiste später hinterher. Für die Kinder war diese Reise in den Norden, dessen Menschen und Bräuche ihnen fremd, bedrohlich oder komisch oder beides in einem erschienen, ein großes Abenteuer. Für die Mutter wird es mehr eine Last als ein Vergnügen gewesen sein, denn sie wirtschaftete in gemieteten Räumen selbst, kochte, führte den Haushalt nach demselben Reglement wie in Prag. Deshalb nahm sie auch das Dienstmädchen mit, das sie noch vor Ende der Ferien hinauswarf, nach Prag zurückschickte, ein von den Kindern gefürchtetes Ereignis, das sich jeden Sommer wiederholte. Das neurotische Verhältnis der Mutter zu ihren Dienstmädchen hat Brod schon 1908 in dem kleinen Roman Ein tschechisches Dienstmädchen beschrieben.
Die junge, schöne, blonde, wilde, unbeherrschte und herrschsüchtige Mutter, die, wie man heute deutlich sieht, krank und ihren Launen selbst hilflos ausgeliefert war, ist eine ständige Bedrohung seiner Phantasie, seiner musischen Leidenschaften, seines Spieleifers, seines Gerechtigkeitssinns. Mit solchem Hunger, solcher Lebenslust, solchem Nachholbedarf stürzt er sich auf alles, was das Leben bietet, auf Spiel und Sport, Musik und Bücher, dass die Mutter für seine Gesundheit fürchtet und Verbote ausspricht, strenge Verbote, die durch keine Bitte aufzuheben sind, »denn die Mutter gibt niemals nach«! Die strenge Mutter, die unerbittliche, grausame, harte Mutter, die jedoch nur aus Liebe so handelt. Sie bewahrte ihm die Anmut seiner äußeren Erscheinung, weil sie als einzige den aussichtslos scheinenden Kampf gegen die Kyphose aufgenommen hatte. Der Vater ist weich, liebt den Frieden, ist gerecht, während die Mutter, ohne es zu wissen, von einer rasenden Ungerechtigkeit ist. Der Vater tut, was die Mutter sagt. Und sie sagt ihm, dass für die Heilung des Kindes Geld, viel Geld nötig ist. Sie nehmen bei einem Verwandten einen Kredit auf, den der Vater abarbeiten muss, abends nach seinem Tagewerk in der Bank. Das war in einer Zeit, in der es keine freien Sonnabende gab, in der man erst spät abends und nicht um vier oder fünf Büroschluss hatte. Diese jahrelange Arbeit erschöpfte den Vater, »er las keine Bücher mehr«, »er hatte seine jugendliche Fröhlichkeit verloren«.
»Und Erwin erinnerte sich, dass er noch einige Jahre später an Winterabenden, wenn er spazierengehend am großen Geschäft des Onkels vorbeiging, den guten Vater zu besuchen pflegte, der in einem von spärlichem Gaslicht beleuchteten Raum hinter dem strahlenden Verkaufsladen über die riesigen Bücher und Ziffernreihen gebeugt saß, nachdem er in der Bank sein nicht geringes Tagespensum absolviert hatte. Nur für einen Augenblick hielt der Vater in seiner Arbeit an, küsste Erwin und wandte die rotgeränderten Augen rasch wieder den endlosen Kolonnen zu.«
Als Max die Zusammenhänge erkennt, beginnt er sich schuldig zu fühlen, obwohl er ja an seiner Krankheit unschuldig ist. Er liebt die Eltern sehr, und er leidet an ihnen. In seinem jüngeren Bruder Otto, der schön, gesund und gelassen ist, hat er einen echten Freund. In der Synagoge auf dem alten Judenfriedhof Prags, deren Wände über und über mit den Namen ermordeter Bürger der Stadt bedeckt sind, findet man auch, klein, weil es so unendlich viele sind, den Namen Ota Brod. Ihm ist Der Sommer den man zurückwünscht vom Bruder gewidmet worden, mit diesen Worten des Catull:
»Fern durch viele Völker und viele Meere gefahren Komm ich zu diesem Dienst, Bruder, zum Totenfest, Trostlos mit letzter Begräbnisgabe dich zu beschenken. Anzusprechen den Staub …«
In dem Erinnerungsbuch Beinahe ein Vorzugsschüler, das einem ermordeten Schulkameraden gewidmet ist, einem aus dem »lebensfrohen Volk der Stephanesen«, stellt er die Frage: »Was ist das für ein traumhaft vorbeigehendes Leben, in dem ich sogar die Tatsache, dass es so etwas wie Nebel gibt, gänzlich vergessen konnte?«
Ja, was ist das für ein traumhaft vorbeigehendes Leben, das nun plötzlich, erfüllt, aber immer noch zu kurz, zu Ende ist«: »Traumhaft«. Einmal nennt er sich einen Träumer. Aber es war ein harter Traum. Die Grazie, die wir in seinen Büchern finden und an ihm selbst wahrnehmen konnten, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Mut dazu gehörte, dieses Leben zu »träumen«, die Augen nicht zu verschließen, dem Schmerz nicht auszuweichen. Es gehörte ein ungeheurer Mut dazu, dem zarten Körper diese enorme Arbeitsleistung abzuringen, die vielen Bücher.
Sigrid Brunk
Der Sommerden manzurückwünscht
Romanaus jungen Jahren
Seltsam ist Prophetenlied,Doppelt seltsam, was geschieht
GOETHE
Der Vater hatte die Familie zum Staatsbahnhof begleitet. Nun verabschiedete er sich von ihr auf dem Perron. – »Staatsbahnhof«, ohne näheren Zusatz, hieß damals das alte, massige Gebäude aus dem Prager Vormärz, das später, viel später den Namen Masaryk-Bahnhof erhielt.
Von dieser revolutionären Zeit sind wir hier aber noch weit entfernt. Wir leben noch ganz tief im alten, auswattierten Österreich drinnen, ganz tief im Frieden, der ein ewiger Frieden schien; wir halten vor der Wende ins unselige zwanzigste Jahrhundert – wir mögen wohl das Jahr 1899 schreiben. Altösterreichisch ist die blaßblaue, seidene Luft der Kinderjahre über der sommerlichen Stadt, altösterreichisch sind die Einspänner und die Fiaker, die auf hohen, mit Gummi bekleideten Rädern (weshalb sie auch »Gummiradler« heißen) fast geräuschlos durch die Straßen schlüpfen. Die sanftgeschwungenen Linien dieser leichten Fahrzeuge finden sich wieder in den wallenden, nur knapp fußfreien Röcken der Damen und in ihren vielleicht allzu hohen, nach vorn gewellten Frisuren, den sorgfältig gebauten Toupets unter den großen Hüten. – Altösterreichisch ist schon die ausgeblaßte Farbe des großen Bahnhofs, die zwischen Hellbraun und Orange eine zarte, schwer bestimmbare (weil etwas verschmutzte) Mitte hält. Es ist dies eine ganz besondere Farbe, an der man damals sowohl in Wien wie in Prag, wahrscheinlich auch in anderen Städten der kaiserlich-königlichen Österreichisch-Ungarischen Monarchie, die »ärarischen«, das sind: die amtlichen Gebäude und auch manche Villa in den Vororten, manches Wohnhaus besonders loyaler Familien erkannte; denn offenbar stellte dieses spezielle Hellorange oder Dunkelgelb gleichsam die zivile Variante jenes anderen, strahlenderen, kriegerischen Gelb dar, das in den Wappenfarben Schwarz-Gelb seine vielen verhaßten, vielen mit Fug verhaßten Eroberungsgelüste durch die Geschichte trug. Doch davon wußten die Kinder nichts. Man hatte sie gelehrt, in den Farben Schwarz-Gelb das Gute, das Schöne, die Heimat und vor allem ihre eigene Jugendseligkeit zu empfinden. Daher kommt es denn wohl auch, daß ihnen in späteren Lebensjahren diese besondere Farbe, dieses besondere Gelb nie mehr zu Gesicht gekommen ist.
Die Kassenräume und Korridore des Bahnhofs waren eng, übelriechend und dunkel. Die Aufgabe des großen Reisegepäcks verursachte Schwierigkeiten, die der Vater mit überlegener Ruhe erledigte, indes die aufgeregte Mutter die ebenso aufgeregten, aber verschüchtert stillen Kinder überflüssigerweise zur Ordnung und Disziplin verwies. Endlich wurde man aus dem Wartesaal dritter Klasse, den eine breite Glastüre abschloß, in dichtem Gedränge zu den Zügen hinausgelassen oder vielmehr hinausgestoßen, nachdem ein Kondukteur überlaut, aber undeutlich die Stationen ausgerufen hatte. »Kondukteur« hieß es bei uns, und man betrat den »Perron«; nur in Deutschland gab es »Schaffner« und »Bahnsteige«. Wir Kinder wußten das schon; es war ja nicht unsere erste Sommerreise nach Deutschland, an die Ostsee. Aber es hatte immer noch einen exotischen Reiz für uns, wie so vieles Ungewohnte »draußen«, auf das wir uns freuten, wiewohl wir es zugleich auch mißbilligten und von oben herab kritisierten, ja ein wenig komisch fanden.
Man überschritt die Bahngeleise; denn hier auf dem guten alten Prager Staatsbahnhof prunkte man noch nicht mit Unterführungen wie in Dresden und Berlin. Die riesigen Räder der Lokomotive drehten sich dicht an uns vorbei, mit scharfem Zischen lärmend ausgestoßener Rauch stieg zu der hoch oben gewölbten Decke empor, die von Eisen und schmutzigem Mattglas starrte. Die Mutter schrie mehrmals auf, als wäre eines der Kinder bereits überfahren worden. Der Vater führte umsichtig die kleine Schwester Sophie an der Hand.
Man war eingestiegen, hatte die Plätze belegt, eine endlose Reihe von kleineren Koffern und Handgepäck (viele Butterbrote darin) über die zwei Sitzbänke ausgebreitet. Der Vater küßte die Mutter, stürmisch warf sie sich in seine Arme, dann stieg sie in den Waggon, trat gleich ans Fenster und begann von da aus, ihrem Manne eine Unmenge von Ratschlägen zu geben, mit einem Eifer, als hätte sie nie zuvor dieses Thema berührt, als sei es ihr erst jetzt eingefallen. Die beiden Jungens, Erwin und Otto, hatten die Fensterplätze besetzt, die Mutter stand zwischen ihnen. »Gib acht auf das Geld, Fantsch«, sagte der Vater, gewissermaßen scherzend; aber es war ihm doch ein wenig ernst damit; denn in Geldsachen war er ungemein ängstlich; nicht ängstlicher freilich als die Mutter, die jetzt ihr Handtäschchen in beide Hände nahm und gleichsam symbolisch an ihre Hüfte preßte. – Sie hieß Franziska, die Verwandten nannten sie Fanny; doch der Vater mit stereotyper Zärtlichkeit, die sich vielleicht noch aus der Liebes- und Bräutigamszeit herschrieb, seither aber recht verblaßt war, rief sie »Fantsch«. Bei festlichen und seltenen Anlässen wie solch einem Abschied für einige Wochen klang überdies die in dem Wort aufgespeicherte Zärtlichkeit echter als sonst. Es war aber doch etwas Gespieltes, Aufgemachtes oder vielleicht auch nur, genauer gesagt, etwas Steifes darin, steif nicht im Grunde des Herzens allerdings; denn der Vater liebte ja die Mutter innigst, trotz allen Zwistigkeiten und manchmal recht heftigen Auftritten – wohl aber steif im Ausdruck, der einen falschen Ton miteinfließen ließ, während die Mutter einfach und natürlich ihren Besorgnissen, ihrem überströmenden Gefühl Ausdruck gab. »Bleib gesund, Dolf, gib acht auf dich – die Marschka soll auf das Fleisch aufpassen; es soll immer ganz frisch sein und weich und das Schnitzel ganz dünn.« Sie hatte Tränen in den Augen; sie sah ihren zärtlich umhegten Mann tausend Gefahren preisgegeben; nur der Kinder wegen, die es für ihre Gesundheit so nötig hatten, namentlich Erwins wegen, hatte sie, wie jedes Jahr, die Mühen dieser beschwerlichen Expedition ans Meer auf sich genommen. Und wie alle Jahre, hatte es auch heuer viele lange Auseinandersetzungen zwischen den Ehegatten gegeben, ehe sie sich entschloß. Der Vater sollte gleich mitfahren, er hatte aber noch keine Ferien in der Bank. Sein Urlaub begann erst an »Kaisers Geburtstag«, also am 18. August. Die Schulferien dagegen fingen in der ersten Hälfte des Juli an und dauerten bis weit in den September hinein. Wie alljährlich, hatte man schließlich auch diesmal beschlossen, daß der Vater nachkommen solle – die Mutter würde ihm dann von Misdroy aus (dies das Ziel der Reise: Misdroy, eines der billigen Ostseebäder, auf der Insel Wollin östlich von Swinemünde gelegen) bis zur »Laatziger Ablage«, vielleicht bis Stettin entgegenfahren. Für die Kinder, die beiden Brüder vor allem, die schon etwas vom Leben verstanden, hatten diese Worte einen magischen Klang. Namentlich die seltsame, für die Einwohner Wollins vermutlich völlig prosaische Bezeichnung »Laatziger Ablage« tönte ihnen wie etwas von Urzeiten her Bestimmtes, etwas Großartiges, Sagenhaftes ins Ohr, etwas, was zu ihrer größten Freude die Liebe zwischen ihren Eltern und den Frieden des Hauses auf geheimnisvolle Art zu verbürgen schien, diesen durch häufige Streitigkeiten in Frage gestellten Frieden. Worin lag der Zauber? Worin die Bürgschaft? Zur Rede gestellt, hätte keiner der beiden Brüder eine Antwort gewußt – sie sprachen auch nie über diesen Gegenstand, sie dachten ihn nicht einmal deutlich zu Ende –, aber so war es, so fühlten sie; es bedurfte zwischen ihnen durchaus keiner Worte, um über so grundlegende, das ganze Dasein bestimmende Dinge einig zu sein, wiewohl ja der ungeheure, eigentlich kaum überbrückbare Altersunterschied zwischen ihnen eine Verständigung außerordentlich erschwerte. Es handelte sich um volle drei Jahre – man denke: drei Jahre, eine ganze Welt in jener zarten Abstufung der ersten dämmerhaften Lebensperioden. Erwin war im Mai fünfzehn Jahre alt geworden, und obwohl er sogar noch wesentlich kindlicher oder sogar kindischer war, als es seinem Alter entsprach, lag doch eine kaum absehbare Lebensstrecke, reich an Erfahrungen, zwischen ihm und dem erst zwölfjährigen Otto.
In diesem Augenblick war Erwin übrigens sehr weit davon entfernt, an »Laatziger Ablage« und irgendwelche sonstigen, harmonisch schönen Licht- und Höhepunkte des Familiendaseins, der Elternwelt zu denken. Die selten genug auftauchende »Laatziger« Freude in den Augen der jungen Mutter, die doch meist verdrießlich, verärgert, zornig waren, ihr hochzeitlich festliches Ausnahmegesicht – das war ihm in dieser recht eigentlich bitteren Abschiedsstunde ganz fern. Aufrichtig gesagt: er hatte Angst vor der Mutter, vor der unbeschränkten Herrschaft, die sie in Misdroy, so weit entfernt von Prag, vom Vater, über alles ausüben würde, was die Familie betraf.
Denn es läßt sich nun nicht länger aufschieben, es muß gesagt sein, daß Erwin, der doch eigentlich der Mutter zu besonderem Dank verpflichtet war – wir werden darüber später einiges erfahren –, daß Erwin die Mutter für irgendwie mit einem Fehler behaftet hielt, für das, was er (eingestandenermaßen durchaus nicht zutreffend) »ungerecht« nannte, und daß hieraus in den letzten zwei oder drei Jahren ein beinahe feindseliges Verhältnis zwischen ihr und ihm entstanden war, wenn man es sich getraut, ein so grobes Wort wie »feindselig« auf eine zarte und im Grunde doch eigentlich liebevolle, nur seltsam schmerzliche Beziehung anzuwenden, die überdies immer halb im Dunkeln und jedenfalls unausgesprochen blieb. Es regierte ja vor allem eine tiefe, gegenseitige Liebe zwischen Mutter und Kind, wenn diese Liebe auch im Alltag wie durch trübe Brechung verhüllt und nie mehr, seit früher Kindheit nicht, an die es kaum eine Erinnerung gab, durch eine innige Bewegung, ein Streicheln etwa, ausgedrückt wurde. Doch nicht etwa diese Sparsamkeit des Gefühlsausdrucks störte den Sohn. Nein, es war etwas ganz anderes. Erwin hätte gern gesehen, daß die Mutter in jeder Hinsicht so vollendet gewesen wäre, wie sie ihm äußerlich schön erschien. Aber er konnte es sich nicht verhehlen, daß sie seinem seelischen Ideal durchaus nicht entsprach, daß sie äußerst unbeherrscht war, daß sie ihrem Temperament die Zügel schießen ließ – gegen jedermann, gegen einige Verwandte, mit denen sie in dauerndem Zwist lag, gegen den Vater, den sie manchmal ganz despektierlich anschrie, vor allem aber gegen die Dienstmädchen, die schutzlos ihrem strengen Regiment preisgegeben waren. An sich selbst dachte er dabei nicht. Er war ja in früher Kindheit, seines lang anhaltenden Krankendaseins wegen (das jetzt überwunden war), das Sorgenkind der Mutter gewesen – in gewissem Sinn war er es geblieben, obwohl er sich über die Gründe nicht ganz klar war, obwohl sich die Mutter (wohl auch aus Liebe) alle Mühe gab, ihn nicht merken zu lassen, daß sie ihn wachsamer behütete als die andern, obwohl sie ihre Sorge gelegentlich hinter Rauheit und verdoppelter Autorität verbarg. Aber gegen diese Rauheit hätte er nichts einzuwenden gehabt, sie war ihm manchmal sogar lieber als die stets diplomatische, höfliche Gewandtheit, Ausgewogenheit und Friedensliebe des Vaters – nein, mochte die Mutter grob und kurzangebunden ihm gegenüber sein, soviel sie wollte, nur Unrecht tun sollte sie niemandem! Nicht den beiden jüngeren Geschwistern, die er auch schon manchmal gegen die Mutter in Schutz zu nehmen hatte – vor allem aber den Dienstmädchen nicht, mit denen es in diesem Hause eine geradezu krankhafte, völlig abnormale Bewandtnis hatte. Nun, damals in den Jahren der Sommerreisen nach Misdroy, war diese Krankheit freilich erst angedeutet, die später das ganze Leben der Eltern beherrschen und das der Mutter schließlich zerstören sollte; aber daß es nicht mit rechten Dingen zuging, wenn die Mutter kein Dienstmädchen länger als drei Wochen oder einen Monat behalten konnte, meist nicht einmal so lange, nicht bis zum Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist von vierzehn Tagen; das merkte der Junge wohl, und es war die erste dunkle Wolke, die seine Kinderjahre verdüsterte. – Seine vielen Krankheiten hatten ihm innerlich wenig zu schaffen gemacht; mit der ungebrochenen Energie der ersten Lebenszeit hatte er sie abgetan, hatte sich sie (worüber er später staunte) kaum zu Bewußtsein gebracht, jedenfalls seelisch nicht im geringsten an ihnen gelitten. Das, woran er litt, was seine erste bittere Lebenserfahrung darstellte: das war der ewig tobende Krieg im Haus, die Reizbarkeit der Mutter, die in der immer aktuellen, ja sich ständig verschärfenden Dienstmädchenfrage einen grotesken Gipfel erreichte.
Diese Frage war ebenso rätselhaft, wie sie sich als dauernd vorhanden, raumfüllend, zimmerfüllend erwies. Erwin, der viel Zeit daran wandte, sich über das ihn so unmittelbar betreffende Unglück – denn es umschattete ihn zuweilen völlig – den Kopf zu zerbrechen, hatte sich die Sache ungefähr folgendermaßen zurechtgelegt: Mama hat ein besonderes System, ihr Hauswesen zu führen – nicht etwa, daß sie es ersonnen, erfunden hätte, es war ihr vielmehr gleichsam angeboren, war mit ihr gewachsen, hatte sich mit ihr entwickelt, gab sich kund als ihre zweite Natur, sobald sich die Gelegenheit bot, ein immerhin nicht ganz kleines Hauswesen zu leiten. Erstaunlich genug, dieses zur rechten Zeit präsente System – denn gelernt hatte sie es nie, es kam also wirklich offenbar aus ihrer innersten Seele hervor. Keineswegs war ihr ja an der Wiege gesungen worden, daß sie einmal die Frau eines Bankprokuristen sein werde, eines Mannes also, der sogar Aussicht auf den Titel eines Direktors hatte, wenn auch leider nicht auf dessen Tantiemen – hier stießen, wie Erwin erst später verstehen lernte, zwei entgegengesetzte Welten aneinander, durch unübersteigliche Mauern getrennt. Die Mutter aber stammte aus einer dritten Welt, den Lebensumständen und der sozialen Schichtung nach, soll sagen: aus einer armen dörflichen Familie. Und sie hatte in ihrer Jugend oft genug mit Elend, mit nacktem Hunger zu kämpfen gehabt. Doch das war nun lange vorbei. Sie beherrschte das Haus als Sachverständige. Alles, was sie tat, war, als könne es gar nicht anders sein, als sei es die selbstverständlichste, unbezweifelbarste Sache der Welt; als habe sie es an einer autoritativ unbestrittenen Hochschule gelernt. – Übrigens war auch des Vaters Jugendzeit durchaus nicht sorglos gewesen. Auch sein Ursprung führte in eine Familie, dessen Oberhaupt einst schwer genug, als schlichter Handwerker, das Brot für seine vier Kinder heranzuschaffen hatte. Aber es war immerhin ein Handwerker in Prag, also im Zentrum der Welt gewesen. Er hatte, wiewohl zu den Frommen gehörig, die großstädtische Bildung sich anzueignen gewußt und vor allem das Theater gern und oft besucht, mit besonderer Vorliebe für die Oper; eine Neigung, die er auf Kinder und Kindeskinder vererbte. Auch die Mutter war ja musikalisch; aber sie hatte in der Not ihrer Kinderjahre nie Zeit gehabt, diese Anlage auszubilden. Mit reiner, schöner Stimme sang sie manchmal ein Lied – in den seltenen Momenten einer guten Stimmung, die in letzter Zeit kaum mehr eintrat. Sie sang aber (so glaubte der Sohn feststellen zu müssen) mit geradezu vollkommener Richtigkeit; und das Herz tat ihm weh, wenn er bedachte, daß nur äußere Umstände die Mutter gehindert hatten, ihre Begabung in dieser Hinsicht, wie auch in anderen Punkten, gehörig zu entwickeln. Namentlich eines dieser Lieder fiel ihm manchmal ein; es gab Stunden, in denen er es nicht glauben konnte, in denen er es für eine Erinnerungstäuschung hielt – und doch war es nicht zu bezweifeln, daß ihm einst, in einer durch Jahrhunderte abgetrennten Vorzeit, die Mutter öfters ein altes Wiegenlied mit bezaubernder Freundlichkeit vorgesungen hatte: »Schlaf, Herzensbübchen, mein Liebling bist du.« – Doch das war nun vorbei, und es hatte keinen Sinn, diese lieblichen Träume heraufzurufen. – Klüger war es, sich an das Vorbild des tüchtigen und bescheidenen Großvaters zu halten. Diese Erinnerung war ein wahrer Fels inmitten all der anbrandenden, den kindlichen Kopf bedrohenden Unsicherheiten. Der Großvater, der tüchtige Handwerker, wie er mit würdiger Miene, die Rechte zwischen zwei Rockknöpfe geschoben, auf einem alten Familienporträt zu sehen war. Einmal in seinem kargen Dasein, das er aber zufrieden trug, hatte denn auch dem stillen Arbeiter das Glück gelächelt: er hatte im »Kleinen Lotto«, das unter dem Schutz der Regierung stand, also ein durchaus erlaubtes Spiel war, einen nicht unbeträchtlichen Treffer gemacht, ein Terno vielleicht, oder ein Ambo solo – man dachte bei diesem seltsamen Namen, wenn man wie Erwin historischen Unterricht genoß und liebte, an die einstigen italienischen Provinzen der Großmacht Österreich. – In grauer Vorzeit also hatte der lebenskluge Großvater mit seinem Lotteriegewinn ein Haus im damaligen Prager Ghetto gekauft, in der »Judenstadt«, die seit Kaiser Josefs II. aufgeklärten Tagen und Taten nicht mehr von Gesetzes wegen, sondern aus freier Wahl vielen Judenfamilien der natürliche Mittelpunkt ihres Lebens geblieben war. Ein Haus – das ist nun freilich übertrieben gesagt. Es war ein sogenanntes »Teilhaus«; denn in diesem Stadtviertel, nur hier, gab es noch die Besonderheit, die später den Grundbüchern und den Juristen einige Kopfschmerzen machte: man konnte auch einzelne Stockwerke erwerben, ohne den Boden selbst in Eigentum zu bekommen. Man lebte also eigentlich im wahren Sinn der Worte in der Luft, in einem Luftschloß – ein Ausdruck, der Erwin allerdings nie in den Sinn kam, wenn er, schon in einem der vornehmen neuen Stadtteile geboren und aufwachsend, die Großeltern in ihren engen, kaum von der Sonne erreichten Stuben besuchte. Von Luftschlössern konnte in diesem stickig lebhaften Stadtviertel mit seinen vielen Trödelläden wirklich nicht geredet werden. Schon daß die schmutzige Gasse, in der die Großeltern lebten, geradezu »Goldene Gasse« hieß, wirkte wie bösartige Ironie. Indes war die Wohnung der Großeltern sehr ordentlich gehalten. Und doch machte alles, auch die Möbel, einen höchst baufälligen Eindruck, der vielleicht weniger architektonisch, als durch die stockende Luft innerhalb des alten Gemäuers begründet war. Und die ganze Pracht ist ja auch längst eingerissen, vom Erdboden verschwunden, nebst allen Gassen rund um dieses großelterliche Haus, so daß niemand auch nur den Fleck finden könnte, auf dem es gestanden oder vielmehr über dem es als Teilhaus wie ein Ballon geschwebt hatte.
Denn nicht das Parterre, nur der erste und zweite Stock, alles in allem vier Zimmer und zwei Küchen, gehörten dem Großvater; er teilte sie mit der zahlreichen Familie eines Verwandten – und das Auffallendste in der ganzen Wohnung war eine schöne Pendeluhr aus dunklem Holz, die auf einem Tischchen beim Fenster stand und eine Erwin sonst unbekannte Form aufwies; mit ihren kleinen weißen Alabastersäulen stellte sie einen Tempel vor, in dem als einzige Gottheit der flink hin- und hergehende glitzernde Messingpendel waltete, immer tickend und in einem spiegelnden Hintergrund gleichsam vor sich selbst weglaufend. Die Kargheit der ganzen übrigen Umgebung, sauber, aber verwittert, verlieh diesem einzigen Prunkstück etwas geradezu Mythologisches, Sagenhaftes, das Bewunderung einflößte. – Ja, es gab frühe Zeiten, in denen diese Pendeluhr dem Kinde wie der Inbegriff aller Schönheit auf Erden erschienen war. Soweit sein Gedächtnis in die Anfänge seines Erdendaseins zurückreichte: am fernsten Ursprung dort stand zusammen mit seinen ersten Erinnerungen diese Uhr. Zuzeiten war sie ihm, ihrer Goldverzierungen wegen, als ein verwunschener Prinz erschienen, der unerkannt im Haus eines Armen aufwächst. Eines Tages wird er seine Flügel ausbreiten und wegfliegen, das zierliche Tischchen als Triumphwagen mit ihm.
Gesichert durch seinen, sei es auch zwerghaften Hausbesitz, hatte der Großvater alles, was er fleißig erwarb, der guten Erziehung seiner Kinder gewidmet. So war Erwins Vater von einer Handelsmittelschule aus in die damals gerade neugegründete Böhmische Unionbank aufgestiegen – der Mutter gegenüber aber tat sich ein Abgrund auf, den freilich nur sie selbst zu sehen schien und dessen Schwärze sie gelegentlich auch mißbrauchte, im Kampf gegen alle, die etwa nicht ganz einverstanden mit ihr waren. »Nun ja, ich verstehe das eben nicht, ich bin eben ungebildet!« rief sie mit bitterer Ironie, vom Sturm heiliger Entrüstung gepackt – und wer hätte ihr dann zu widersprechen gewagt, wenn sie sich solcherart auf ihre arme, mißhandelte Jugend berief. Sie hatte nur die Dorfschule in Morchenstern, einem kleinen Flecken am Fuße des Riesengebirges, besucht. Das also, ihr Leute, ist es, was ihr an mir verachtet, das ist es, was euch zum Angriff gegen mich ermuntert – einem ungebildeten Menschen gegenüber kann man sich eben alles erlauben. – Erwin senkte die Augen. Jede Waffe war ihm aus der Hand geschlagen, wenn die Mutter, der er etwa eine sanfte Vorhaltung irgendeiner Anna wegen gemacht hatte, sich in einer derartigen Erniedrigung blicken ließ, die nichts an Wirksamkeit verlor, mochte man auch wissen, daß sie im Grunde nur ein Advokatenkniff war. Denn gleichzeitig fühlte man, daß diese Selbstbloßstellung in einem noch tieferen Grunde doch auch mehr als ein Advokatenkniff war. Erwin erschauerte und wurde rot; er konnte nach solch einem Gespräch tagelang der Mutter nicht ins Gesicht sehen, als hätte er eine große, geheimnisvolle Schuld auf sich geladen. – Noch ärger war es freilich, wenn die Mutter dann aus der Defensive zum Gegenangriff überging. Da gab es einen Onkel, der mit einem Taugenichts von Sohn gesegnet war, einem Sohn, der nicht wie Erwin die Schulklassen immer als Erster, sondern als der Letzte, als »Ultimus«, zu erledigen pflegte, wenn er nicht gar »sitzenblieb«, der überdies auch sonst seinen Eltern durch einige Streiche Kummer verursachte, die in jener Atmosphäre der Kindertage ein drohendes, geradezu verbrecherisches Aussehen annahmen, obwohl sie vielleicht nichts als harmlos waren. Dieser aufgeweckte, frühreife Bursche von einigermaßen grobschlächtiger Gemütsart hieß Arthur. Wollte nun die Mutter ihren Sohn förmlich brandmarken, so daß er sich in seinen eigenen Augen als der verächtlichste und böseste aller Menschen erschien, so brauchte sie ihm nur diesen Namen zu geben. Ironisch, unter wildem Funkeln ihrer blauen Augen, rief sie ihm ein »Arthur!« zu. Es war zu viel. Er fühlte sich angeklagt, aber auch schon überführt, verurteilt und hingerichtet, und zwar all dies in einem Verfahren, in dem es keine Beweise, also auch keine Einwände gab. In dem einen Wort »Arthur« lag die Summe aller nur möglichen Vorwürfe, die Eltern seit je, seit Adams nicht überlieferten und auch nicht überlieferbaren Worten an Kain, gegen ihre sündhaften Kinder gerichtet hatten. Einen Augenblick schwebte dies Gewitter von Anschuldigung in der trüben Luft, schon schlug der Blitz ein; der, den man »Arthur« nannte, durfte sich nie mehr unter anständigen Menschen sehen lassen.
Und nun also würde es in Misdroy trotz all seiner guten Vorsätze, sich zurückzuhalten und nie mehr der »ungerechten« Mutter zu widersprechen, doch einmal (ungewiß, wann, aber dem Wesen nach gewiß) zu einem jener offenbar unvermeidlichen Auftritte kommen, in dem man ihn mit dem Satz von der »Unbildung« knicken und dann mit dem hohnvoll hingeschleuderten Wort »Arthur« vollends zu Boden werfen würde. Und das Einzige, was gegen diesen argen Schaden irgendwie schützen konnte, würde dort fehlen: der milde Vater, zu dem man flüchten konnte. Nicht wirklich flüchten allerdings, in der handfesten Verflechtung des Tatsächlichen, aber in Gedanken wohl, die man nicht, wie in Misdroy, in weite Ferne zu richten hatte, die vielmehr durch den deutlichen Anblick des gegenwärtigen, leibhaftig anwesenden Helfers gestärkt wurden. Mehr als solche Gedanken hätte sich Erwin nie erlaubt, nicht einmal einen Blick des Einverständnisses wagte er vom Vater zu fordern, oh, nicht die leiseste Andeutung eines solchen Blickes, der ja fast Verrat an der Mutter gewesen wäre. War es denn nicht genug, daß Vater und Mutter miteinander in Unfrieden lebten, einander oft genug geradezu zu quälen schienen; sollte er, der Sohn, den Übelstand noch vermehren, die Erbitterung steigern? Nein, er war entschlossen, zu leiden und zu schweigen. In Prag, in der heimatlichen Wohnung gelang es ihm denn auch, mit Aufgebot aller Kräfte. Dort aber, an der Ostsee, würde er keinen Ausweg aus seinem unheimlichen Mißgeschick wissen. Seltsam, der Vater war ihm die oberste Instanz, wiewohl diese Instanz nie eingriff, obwohl es geradezu verboten war, einen solchen Eingriff auch nur zu wünschen. Und dennoch war der Vater nicht wirkungslos, wenn es auch in Worten nicht ausdrückbar schien, worin seine milde, besänftigende, tröstende Wirkung lag. Genug, es gab diese Wirkung – und im Moment des Abschieds, da diese Kraft auf einige Wochen, ja auf mehr als sechs lange Wochen unerbittlich ausgeschaltet sein würde, machte sie sich im vorausgenommenen Gefühl der Entbehrung mit großer Deutlichkeit stärker geltend als je.
Und alles Ungemach hing mit Mamas System zusammen – das war leider nicht zu verkennen. Dieses System (so sagte sich Erwin manchmal mit einem gewissen Galgenhumor), dieses System wäre geradezu ideal gewesen, wenn es nur je geklappt hätte. Aber es klappte niemals. – Trat ein neues Dienstmädchen ein (in diesem Haushalt unglücklicherweise die häufigste aller Konstellationen), so wurde es von der Mutter mit einer Freundwilligkeit empfangen, die auf alle (mit Ausnahme des Mädchens selbst) beängstigend wirkte; denn alle außer dem Mädchen wußten ja schon im voraus, wie bald diese so liebenswürdig in Szene gesetzten Flitterwochen oder, besser gesagt, Flittertage eine traurige Wendung und ein zerzanktes Ende nehmen würden. Von Seite der Mutter war übrigens, das braucht wohl kaum mehr besonders bemerkt zu werden, nicht die geringste Spur von Schauspielerei an ihrem Betragen. Sie glaubte durchaus ehrlich, mit der ganzen Leidenschaft ihres immerdar naiven Herzens, daß sie jetzt, gerade jetzt endlich, ja, daß sie diesmal ganz sicher die vollkommene Hausgehilfin, die Perle aller Perlen, ins Haus geliefert erhalten hatte – daß es also jetzt nur an ihr, der Mutter, lag, durch möglichst genaue und geduldige Erklärung des Gewünschten den Dienst glatt und vollständig, für alle Zeit bis ans Lebensende einzurichten. An Geduld und Genauigkeit wurde denn auch nicht gespart. In allen Details zeigte die Mutter unermüdlich vor, was und wie es zu machen sei. Vom ersten Abend an war der Schulunterricht eröffnet; der erste und teilweise noch der zweite Tag galt der nicht rastenden Belehrung des Mädchens, die schwierigeren Prozesse wurden mehrmals vorgeführt. Dabei lag ein beständiges Lächeln auf den Lippen der Mutter, das Lächeln der Wohlerzogenheit, des höflichen Entgegenkommens, wie einem geehrten Gast gegenüber, aber wohl auch das Lächeln der Hoffnung, daß von nun an die Epochen der hassenswerten Unordnung im Haushalt zu Ende seien, daß all die Qual und das Herzeleid dem Vergessen anheimfallen würden, daß das Mädchen selbst, dankbar und einsichtig, die vielen Erleichterungen und Beschleunigungen, die die Hausordnung der Mutter vorsah, als einen wahren Schatz des praktischen Lebens anerkennen werde, den man auszunützen habe, ja, daß das Mädchen diese Unterweisung als echte Bereicherung empfinden und in ihr eigenes Selbst als neuen herrlichen Bestandteil miteinbeziehen würde. – Schrecklich war der Augenblick, in dem die Mutter die Lehrzeit für abgeschlossen anzusehen sich bewogen fand und zur Bewährung in der Wirklichkeit des Alltags überging. »Aber das habe ich Ihnen doch ganz anders gezeigt«, hörten die erschrockenen Familienmitglieder aus dem Nebenzimmer; es klang schon gar nicht mehr freundlich, es pfiff wie der erste Stoß des Wirbelwinds, der plötzlich das Segel knattern läßt – ein Sturmzeichen. Und nun folgte Schlag auf Schlag. Das Mädchen wußte nichts, es hatte nichts gelernt, es hatte sich nichts gemerkt. Es war dumm, ein Trampel ganz einfach – oder es war bösartig, es machte alles zum Trotz. Tatsächlich gerieten die Mädchen sehr rasch in Verwirrung. Sie waren gewohnt, selbständig zu arbeiten, sie hatten ja schon bei hochansehnlichen Hausfrauen gedient, sie wünschten nicht bei jedem Handgriff überwacht zu werden. Das machte sie nur irre. Und die intelligenteren äußerten denn auch sehr bald ihr Mißvergnügen. »Was, frech bist du auch noch!« – »Ich bin nicht ›du‹ – Sie haben mich mit ›Sie‹ anzureden. Oder ich sage dir auch du, wenn du das vorziehst.« Nun waren alle Furien los. Der Vater sollte zur Polizei gehen, den Wachmann holen. »Ach, von Ihnen haben wir schon gehört, gnädige Frau«, rief eines oder das andere der Mädchen, es war eine der regelmäßigen Phasen dieses Geschehens, »man hat uns gewarnt, bei Ihnen einzutreten.« Gewarnt! Das war das richtige Stichwort. »Du hörst es, Dolf, man hat sie gewarnt. Und du schweigst? Man hat also das Mädchen im Haus gegen mich aufgehetzt. Der Hausmeister hat es getan. Ja, Sie Unverschämte, Sie sind gestern mit ihm beisammengestanden, vor seiner Türe, ich habe es wohl gesehen. Oder hat das Mädchen von der Nachbarin mit Ihnen geklatscht? Gestehen Sie! Sie gehen jetzt sofort mit mir aufs Kommissariat. Ich werde mir schon Ruhe zu verschaffen wissen. Ein für allemal werde ich mir Ruhe verschaffen!«
Die arme Mutter! Denn sie war mehr zu bedauern als die gleichfalls unglücklichen Mädchen. Die Mädchen entflohen ja nach kurzer Zeit diesem Unglück, während die Mutter ständig in seinem Herd und Zentrum verblieb. Nie wäre es ihr eingefallen, die Schuld bei ihrem eigenen System zu suchen. Es war doch so köstlich, ein Muster an Zweckdienlichkeit, ein klassisches Beispiel vernünftiger Menschenordnung. Wie war es denn möglich, dies nicht einzusehen! – Aber die Mädchen hatten eben gar nicht den guten Willen, der, nach Ansicht der Mutter, mit zum Beruf der Hausgehilfin gehörte. War es denn nicht ausdrücklich auf die Schonung der Kräfte des arbeitenden Menschen angelegt, wenn die Mutter eine bestimmte Reihenfolge der Handgriffe beim Aufbetten, beim Geschirrwaschen, beim Auftragen der Mahlzeiten nahelegte, oder wenn sie darauf bestand und an vielen Beispielen erläuterte, wie man bei jedem Gang aus einem Zimmer ins andere oder aus der Küche ins Zimmer immer »etwas mitnehmen« könne, womit man auf nützliche Art Zeit und Mühe ersparte. Dieses »etwas mitnehmen« wurde geradezu in der Art einer hohen Kunst, einer Virtuosität gelehrt (freilich gleichzeitig auch als Selbstverständlichkeit, auf die jeder vernünftige Kopf von selbst verfallen müsse). »Immer etwas mitnehmen«, war gleichsam das Losungswort, die Verschwörerparole unseres Hauswesens – oder sollte es doch sein! Denn in Wirklichkeit wurde diese Parole von den unbelehrbaren Kreaturen schnöde zur Seite gesetzt. »Schon wieder geht sie mit leeren Händen hinaus!« rief die Mutter, in schrill fanatischer, äußerster Verzweiflung. Das Mädchen wurde nochmals in das Zimmer, in dem wir aßen, zurückgerufen. – »Da stehen zwei, sogar drei Teller leer auf dem Tisch und eine Schüssel dazu, die können Sie doch auf dem Servierbrett schon jetzt hinaustragen. Bitte!« Das erstemal klang es nur drohend, später hörte jenes Geschrei gar nicht mehr auf, das als einförmiges Zanken, als eine eigentlich inhaltlose, aber gefühlsmäßig ganz besondere Verwendung der Sprache zur Entspannung und doch auch ständigen Neuerzeugung einer Dauererregung vielen unserer Stunden das Gepräge gab. – In der Küche brach das Mädchen fassungslos in Tränen aus. Erwin suchte der Mutter den Tatbestand zu erklären, auf ihre Vernunft einzuwirken: »Die Mädchen können sich all die vielen Anweisungen nicht merken. Du beirrst sie. Es ist zu viel auf einmal. Vielleicht solltest du in der ersten Woche nur auf eine Tätigkeit Gewicht legen, zum Beispiel das Aufräumen, später auf das Einholen, das Kochen. Die Erziehung muß schrittweise vorgehen. Und du vergißt eines, Mama: Dich interessiert der Haushalt; aber die Mädchen kann er doch nicht in gleichem Maße interessieren.« – »Was erlaubst du dir!« fuhr ihn die Mutter in höchstem Zorn an – und schon brannte ihm eine Ohrfeige auf der Wange. Er konnte froh sein, wenn die Exekution nicht durch den Fluch »Arthur!« ins Unerträgliche verschärft wurde.
Ein derartiger Zusammenstoß, mit Tätlichkeit gesalzen, kam natürlich nur äußerst selten vor, vielleicht einmal im Jahre oder noch seltener. Aber daß so etwas immer möglich war – das lag wie Gifthauch über dem Leben. Ängstlich ging Erwin der Mutter aus dem Wege, fraß den Groll in sich hinein, suchte nur, durch einen freundlichen Blick, ein Wort, das Schicksal der armen Helotinnen zu erleichtern, die meist gar nicht verstehen konnten, in was für eine Hölle sie geraten waren. Auch die Mutter suchte er zu besänftigen; denn er verstand bald, daß es sich um eine Art von Krankheit handelte, freilich eine Krankheit ohne Namen und von rätselhafter Art, und daß man durch Nachsicht, nicht durch offenes Entgegentreten, das doch nur eine Konzession an das eigene Temperament war, dem Übel steuern konnte. Ja, einmal entschloß er sich zu einem großangelegten Versuch. Die Mutter braucht Ablenkung, sagte er sich, es muß verhindert werden, daß sie ihre ganze Energie in die Hauswirtschaft wirft … Und er weckte ihren musikalischen Ehrgeiz, er lobte absichtsvoll (dabei aber ohne von der Wahrheit abzuweichen) die Korrektheit und Leichtigkeit, mit der sie Opernmelodien vom ersten Hören behielt; so brachte er sie allmählich dazu, bei ihm Klavierstunden zu nehmen. Mit Hingabe unterrichtete er sie. Die raschen Fortschritte am Anfang machten ihr auch wirklich sehr viel Freude. Und Erwin hatte Mühe, seinen Jubel hinter einer Fassung zu verbergen, die, wie er meinte, dem Lehrer ziemte. Mit jedem neuen Fingersatz, den er der Mutter beibrachte, glaubte er sich dem ersehnten Ziele näher. Es ging einen Monat, zwei Monate lang. Schon ließ sich ein innerer Wandel erhoffen … Da machte ein besonders obstinates Dienstmädchen alle seine Bemühungen mit einem Schlag zunichte. Plötzlich hatte die Mutter keine Zeit »zu solchen Dummheiten«. Sie hatte überhaupt keine Zeit! Ihr war ja bestimmt, zu schuften über alles Maß hinaus, selbst mit Hand anzulegen, da die Mädchen sie im Stich ließen, selbst auf dem Boden im Spülwasser umherzukriechen und unter den Schränken sauber zu machen, vor allem aber dem dringlichen Geschäft des Zankens, des Zankens zu obliegen, das ihr offenbar wie eine heilige, durch nichts belohnte, nur um ihrer selbst willen zu erfüllende und niemals ausreichend zu erfüllende Pflicht erschien. »Dem strebe nach!« Für nichts anderes gab es Zeit und Lust. Daß aber das Hauswesen sie »interessierte« (wie Erwin ihr einst darzulegen versucht hatte, einen psychologischen Fehler ersten Ranges begehend, zu dessen Erfassung ihm freilich damals alle Voraussetzungen fehlten): das war schlechthin die ärgste Beleidigung, die man ihr sagen konnte. Sie wollte ja wegen der Qual, die ihr die Wirtschaft verursachte, wegen der Mühe, die sie auf sich nahm, wegen des ewigen Feuers, in dem sie brannte, durchaus bedauert, bemitleidet sein. – Erst viel später, in seinen Mannesjahren, fand Erwin bei einem Dichter der Zeit die richtige Formel für die Krankheit, die so viele alternde, vielleicht nicht mehr durch die Liebe ihres Mannes verwöhnte Frauen befällt, eine Formel, die freilich auch nur Formel ist und keinen Weg zur Heilung zeigt. »Die Hausordnung über die Weltordnung«, das ist, nach Ansicht jenes Dichters, die böse Einflüsterung, der solche verwundete Frauen unterliegen. Ja wahrlich, die Hausordnung über die Weltordnung, darin liegt eine arge Verfehlung, vielleicht der Keim zu allem anderen, und es scheint, daß nicht nur Frauen, daß auch Männer, ja ganze Völker und Staaten von diesem Fluch, ihr eigenes Haus über das Ganze des Weltalls und Gottes zu erheben, heute heftiger befallen sind als in früheren Jahrhunderten. Das würde auch ahnen lassen, warum sich dem kleinen Erwin die Wirrnis seiner Mutter bedrückender auf die Brust legte, als es dieser kleinen Welt der Familie nüchternerweise entsprochen hätte, warum er in beinahe abergläubischem Schreck, als hätte er einen Weltdämon erblickt, vor ihr zurückzuckte. Vielleicht spürte er in der aufgelösten Seele seiner Mutter zum erstenmal einen Beisatz jenes Wahnsinns, der später das ganze Zeitalter so grausam durchschüttern sollte. Doch davon hier nichts! Es liegt weitab von jenen altösterreichischen Tagen in ihrem besinnlichen hellorangen Glanz.
Die Bahnhofsuhr machte gerade wieder einen Minutensprung und ließ dann ihren zitternden Zeiger liegen. Bald werde ich mit dieser gefürchteten Mutter allein sein – dort – in Misdroy – niemand kann mich retten …, und er sah zärtlich den Vater an, ließ aber gleich ein Lächeln in seinen Blick miteinfließen, damit der Vater seine Gedanken nicht errate. Und dieses Lächeln, zu dem er sich ein wenig (nicht gerade mit großer Anstrengung) zwang, wirkte auf ihn zurück – er begann sich im Augenblick wieder auf die weite Reise zu freuen, auf die fremde Welt, die vor ihm offen lag. So ist ja nicht immer nur das Gefühl die Ursache einer Gebärde, sondern umgekehrt kann gelegentlich einmal auch die Gebärde das ihr entsprechende Gefühl auf ehrliche Art, wiewohl das nicht recht begreiflich ist, in uns auslösen. Man weint, weil man traurig ist. Aber manchmal ist man auch traurig, weil man weint. Bei großen Schauspielern und bei Kindern ist das gar nicht so selten. Und Erwins Kinderherz war eben elastisch genug, alle Angst wie im raschen Zucken eines Pulsschlags von sich zu werfen.
»Sind Sie noch immer nicht fertig? Steigen Sie doch endlich ein, Zdenka!« rief die Mutter dem Dienstmädchen zu, das vom Perron aus ihr immer noch einige kleine Gepäckstücke ins Fenster reichte. Zdenka, das unscheinbare, ganz junge Dienstmädchen – so unscheinbar, daß wir im Gang unserer Darstellung bis zu diesem Augenblick ihre Anwesenheit noch gar nicht bemerkt haben (aber in Hinkunft sollte sie trotz ihrer äußeren Unscheinbarkeit zu einer Wirkung gelangen, wie sie nur im Leben eines solchen Knaben wie Erwin möglich war, der, wie es schien, alles »übertrieb«, alles viel zu ernst nahm) –, Zdenka stieg dienstfertig in den Waggon ein; sie hatte ihre Arbeit eben beendet. »Rasch, rasch«, schrie die Mutter hastig, »der Zug fährt ja schon!« Sie sprach mit dem Mädchen, das vor wenigen Tagen aus dem Dorf in die Stadt gekommen war, in tschechischer Sprache. »Aber, Fantsch«, wendete der Vater in deutscher Sprache und überdies sehr leise ein, »wir haben noch reichlich fünf Minuten Zeit.« – Diese Zdenka, rotbackig, klein und von ziemlich voller Statur, mit kohlschwarzem Haar, kohlschwarzen Augen, wie sie in gewissen Gegenden Böhmens häufig sind – ein gesunder Typus –, war erst gestern aufgenommen worden. Es hatte sich genau dasselbe abgespielt wie in den Jahren zuvor: die Mutter hatte alle Anstrengungen gemacht, ein Mädchen für Misdroy »zu erziehen«, was gar nicht leicht war; denn man beabsichtigte, auch in Misdroy eigene Wirtschaft und Küche zu führen. Im Restaurant zu essen, wie die meisten Kurgäste: das wäre der Mutter zu teuer erschienen (worin der Vater mit ihr übereinstimmte, wenn auch nicht ohne Vorbehalt); aber außerdem hielt sie Wirtshauskost nicht nur für unzweckmäßig, sondern aus Gründen, die ihr Geheimnis blieben, geradezu für unmoralisch, für schlechthin verabscheuenswert und korrupt. Vom Essen im Gasthaus sprach sie ebenso bitter und stolz wie ein Satiriker von der Verderbnis seiner Zeitgenossenschaft. – Unabgeschreckt also von ihren zahllosen Mißerfolgen im Lenken des Haushaltes, war es ihr selbstverständlich, daß sie den Bereich ihrer Künste und wohldurchdachten Planungen bis an die Küsten der Ostsee auszudehnen habe. Es galt nur, das Mädchen dazu »abzurichten«. Welch eine Mühe, welch ein Seufzen in Voraussicht der vielen erforderlichen Reden des Unterrichts, welch feierlich erwartungsvolles und durchaus beherrschtes Lächeln beim Empfang der neuen »Donna«, wie sie manchmal ironischerweise genannt wurde, mit gespieltem, aber nicht ganz unernst gemeintem Respekt (denn wie viel hing von ihr ab!), ein Lächeln, das, wie wir wissen, am ersten, zweiten Tag der Schulung anhielt. Das Ergebnis, das Erwin gar nicht mehr anders erwartet hatte, war: daß das Mädchen, nachdem es zwei Wochen lang mit allen Feinheiten des durch höhere Mächte vorgezeichneten Lehrkurses vertraut gemacht worden war, das Haus knapp vor der Abreise »auf die Minute« verließ. Nach ihrer eigenen Ansicht lief sie weg, nach Mamas Auffassung »flog sie hinaus« – es war immer wieder so, daß sich der gleiche Tatbestand auf diese beiden stereotypen Arten gleich treffend beschreiben ließ. – Was sollte nun aber geschehen? Mit drei Kindern wegfahren, in der Fremde den Haushalt führen – dafür glaubte sich selbst die stahlharte Energie der Mutter nicht gewappnet.
Man sah sich also gezwungen, ein Mädchen aufzunehmen, das »gar nichts wußte, nichts konnte«, einen unpolierten Diamanten sozusagen, ein Landkind, ein »klein’s Idioterl« rundheraus. Es fiel der Mutter keineswegs auf, daß sie Jahr um Jahr dasselbe Experiment wiederholen mußte, mit solch einem Nichts an »Stütze der Hausfrau« in die Welt zu reisen. Ja, ihren Augen blieb selbst die Tatsache verborgen, daß sich in letzter Zeit viele der besseren Vermittlungsbüros unter allerlei höflichen Vorwänden und Ausreden weigerten, ihr Dienstmädchen nachzuweisen (so verschrien war sie schon in weiten Kreisen), daß sie mehr und mehr auf Anstalten minderen Ranges angewiesen war, die denn auch keineswegs bewährte, mit erstklassiger Konduite ausgestattete Kräfte, sondern meist nur solche noch gar nicht oder wenig erprobte Geschöpfe von der Art unserer kleinen Zdenka, frisch vom Feld und Misthaufen, zu »liefern« imstande waren. – Ein Glück, daß wenigstens Marschka da war, um für den Vater zu kochen. Denn selbstverständlich war gar nicht daran zu denken, daß etwa der Vater in der Zeit unserer Abwesenheit regelmäßig in ein Gasthaus gehen würde – das wäre in den Augen der Mutter gewissermaßen noch unmöglicher und noch schändlicher gewesen als ein Gasthausregime für die Familie in Misdroy (zu dem es ja ohnehin im Laufe der sommerlichen Begebenheiten alljährlich auf eine katastrophale Art zu kommen pflegte, die uns noch in Atem halten wird). – Marschka aber, die ausgezeichnete Köchin, war von warmfühlenden Verwandten geliehen, die die bizarren Nöte des Hauses kannten und die überdies auf diese Art ersparten, dem alten Mädchen für die Zeit der eigenen Sommerfrische den Lohn zu zahlen; diese Auslagen übernahm selbstverständlich der Vater. Marschka hatte freilich, so schien es der Mutter, einen gewissen Makel an sich; sie war ja nicht durch ihren speziellen Lehrgang hindurchgegangen, hatte sich sozusagen auf eigene Faust entwickelt. Und die guten »Zeugnisse«, die sie sich während ihrer langen Laufbahn in »ersten« Häusern erworben hatte, galten meiner Mutter wenig oder gar nichts; sie hatte oft genug erlebt, was es mit solch schwindelhaftem Lob auf sich habe, das manche Frau gern erteilt, wenn sie ihre »Fee« loswird. Die Mutter allerdings machte diesen Mißstand nicht mit. Sie war äußerstenfalls dazuzubringen, in das kleine Dienstbotenbuch mit dem schäbigen violetten Pappendeckeleinband die ohnedies schon lügnerischen Worte »Auf eigenen Wunsch entlassen« einzutragen, keinesfalls eine Empfehlung. Marschka aber stellte doch einen Sonderfall vor. Sie gehörte gar nicht unter Mamas Gerichtsbarkeit. Da sie mithin, genau genommen, ein »fremdes« Mädchen war, mit dem man das Jahr über nichts zu tun hatte, da der Vater stets mit ihr zufrieden zu sein erklärte (mit welchem Dienstmädchen wäre er wohl nicht zufrieden gewesen, der stille, gute, genügsame, vernünftige Mensch!), so nahm die Mutter dieses Provisorium heuer, wie auch schon in früheren Jahren, mit einem leichten Achselzucken genehmigend hin. – Übrigens ließ man vorsichtigerweise Marschka ihren Interimsposten erst eine Stunde nach unserer Abreise antreten.
Nun mußte der Zug bald fahren. Da geschah etwas ganz Unerwartetes. Der Vater rief Erwin nochmals auf den Perron hinunter. Erstaunt kam der Knabe auf das Trittbrett. Der Vater machte einen Schritt ihm entgegen. Hier, wo die Wand des Waggons zurücksprang, konnten sie vom Coupéfenster aus kaum gesehen, jedenfalls nicht gehört werden.
»Erwin«, sagte der Vater mit einem Stirnrunzeln, das ihn sofort unendlich ehrwürdig erscheinen ließ, »du weißt, die Mama ist sehr nervös. Ihr dürft die Mama nicht ärgern. Versprich es mir! Du bist der Älteste.« Es war mit Strenge gesagt, doch auch mit dem leisen Unterton einer Bitte, die sich verschämt nur halb entschleierte. – Plötzlich fühlte Erwin einen durchdringenden Stich im Herzen. Der Vater tat ihm in diesem Augenblick unendlich leid. Erwin nickte. Er glaubte plötzlich alles zu verstehen. Er wußte auch, warum sich der Vater gerade so und nicht anders ausdrücken mußte. Stolz erfüllte sein Herz. Freilich war auch einige Bitternis beigemischt, die diesem Stolz alles Kindische nahm, den Knaben plötzlich in den Rang der Erwachsenen erhob. – »Ich verspreche es dir, Papa«, erwiderte er ernst. – »Gut, sei brav!« sagte der Vater knapp, mit plötzlicher Kühle. Er winkte mit der Hand, erklärte damit das Gespräch für beendet. Erwin ergriff diese Hand, die sehr weiß und seltsam warm war – er ergriff die Hand noch in ihrer Bewegung und drückte einen langen Kuß auf sie. – Während er durch den engen Gang zum Coupé zurückging, in dem die Mutter am Fenster stand, schnürte ihm der Gedanke die Kehle zu, daß der Vater doch wissen müsse, daß nicht die Mutter im Recht sei, sondern er, der Sohn, der für die Gerechtigkeit stritt und der, wenn er sich dies versagte, wenn er sich schweigend verhielt, dies doch auch nur um einer höheren Gerechtigkeit willen tat, die man Liebe nennt. Hätte dies nicht eine gewisse Anerkennung – nicht etwa als Lob, nur als Konstatierung eines Sachverhalts – verdient? Wäre nicht gerade jetzt die unvergleichlich günstige, vielleicht nie wiederkehrende Gelegenheit gewesen, so etwas zumindest anzudeuten? Trotzdem hatte der Vater es nicht für nötig gehalten, mit einem einzigen Wort zu erwähnen, daß er die ganze Sachlage durchschaue und eigentlich auf Seite seines Sohnes stand. »Ihr dürft die Mama nicht ärgern!« Taten wir denn das? Unternahm man nicht alles, um Ärger zu vermeiden? – Doch diese Zurückhaltung des Vaters, seine absichtliche Undeutlichkeit mochte in der höheren Weisheit der Erwachsenen begründet sein, vor der Erwin viel Hochachtung hatte. Es tat dennoch weh. Aufrichtiger wäre es gewesen, wenn der Vater die Worte der Mahnung an die Mutter, nicht an ihn gerichtet hätte. – Offenbar aber war das mehr, als man vom Schicksal verlangen konnte. Dem Knaben kam in diesem Augenblick die deutliche Vorstellung, daß das Leben noch viel Schweres, ja Grauenhaftes für ihn in Bereitschaft halte. Ich habe noch lange nicht gewonnen – das fühlte er. Daß aber doch auch eine gewisse Art von unterirdischer Anerkennung darin lag, wenn sich der Vater an seine Einsicht wandte (sei es auch ohne Würdigung seines besseren Rechts): das gab ihm eine gewisse Zuversicht, einen festen Mut, für die nächste Zukunft zumindest.
Der Zug, der wie eingewurzelt schien, riß sich nun von seiner Unterlage los. Die Bahnhofshalle kam ins Gleiten. Und ein langes Nachwinken begann, das aber rasch den Charakter eines mechanischen Spiels annahm, ohne das tiefere Gefühl der drei Kinder zu erregen.
II
Ordensritter?« sagte Erwin zu Otto, nachdem sich die beiden auf den einander gegenüberliegenden Eckplätzen der Holzbänke am Fenster solid eingerichtet und das Winken eingestellt hatten.
Das im fragenden Ton, absichtlich nur lässig hingeworfene Wort bedeutete, ob Otto es nicht für angebracht halte, daß sie nun beide »Ordensritter« miteinander spielen sollten.