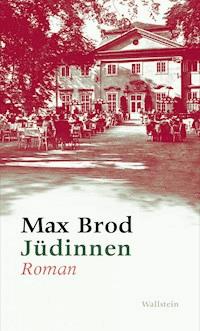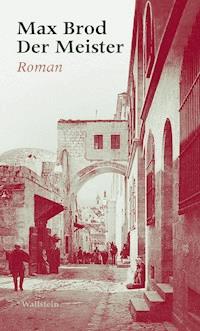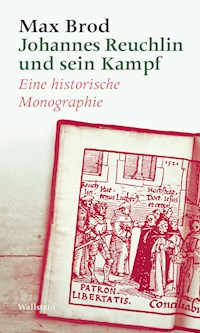Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Max Brod - Ausgewählte Werke
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Dieser Roman wurde oft als Max Brods »Zauberberg" bezeichnet, spielt er doch 1914, in den letzten Monaten vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, welcher das alte Europa zum Einsturz brachte. Aber nicht ein entlegenes Sanatorium, sondern die kleine deutsche Gemeinde in Prag ist bei Brod das Modell der bürgerlichen Gesellschaft vor dem Kriege. Im Mittelpunkt steht der Gymnasiast Stefan Rott, ein junger Mann aus guter Familie, der sich die Welt zu erklären sucht und seine erste Liebe erlebt - er verehrt Phyllis, die Mutter eines Klassenkameraden und wird schließlich sogar von ihr erhört. Hinter der gutbürgerlichen Fassade aber verbergen sich Lüge und Korruption, wie Stefan nach und nach erkennen muss. Die schöne Phyllis ist dem reichen Advokaten Urban zugetan, und Geld spielt dabei durchaus eine Rolle. Mit dem Attentat von Sarajevo stürzt auch diese kleine Prager deutsche Welt in den Abgrund: Frau Phyllis schießt auf ihren Ehemann, der Anarchist Dlouhy, Stefans Klassenkamerad, wird zum Tode verurteilt. Private und politische Entwicklung sind am selben Punkt angelangt: es wird nicht mehr geredet, es wird geschossen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 763
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max BrodAusgewählte Werke
Herausgegeben von Hans-Gerd Kochund Hans Dieter Zimmermannin Zusammenarbeit mit Barbora Šramkováund Norbert Miller
Max BrodStefan RottoderDas Jahr der EntscheidungRoman
Mit einem Vorwort vonDževad Karahasan
Gefördert von der Fritz Thyssen Stiftung Köln und unterstützt vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds sowie dem deutschen Auswärtigen Amt
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2014
www.wallstein-verlag.de
Vom Verlag gesetzt aus Aldus Roman
Umschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf
Druck und Verarbeitung: Hubert & Co, Göttingen
ISBN (Print) 978-3-8353-1337-8
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-2534-0
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-2535-7
Inhalt
Vorwort(Dževad Karahasan)
Erstes Kapitel
Freundschaft, Jugend
Zweites Kapitel
Kampf mit einem erhabenen Menschen
Drittes Kapitel
Das Gespräch über Frau Phyllis und die Güter des Lebens
Viertes Kapitel
Die Karyatiden
Fünftes Kapitel
Die Philosophie der schönen Stellen
Sechstes Kapitel
In welchem die Einweihung des Knaben vorbereitet wird
Siebentes Kapitel
Der Österreicher hat ein Vaterland –
Achtes Kapitel
Homoiosis Theó
Neuntes Kapitel
Zweierlei Spazierengehen
Zehntes Kapitel
Von Bestechung, Einbruch, Anarchismus, Organisation und einer Badewanne
Elftes Kapitel
Himmelswein in irdischem Becher
Zwölftes Kapitel
Das Gartenfest
Dreizehntes Kapitel
Doch ihr, die echten Göttersöhne
Vierzehntes Kapitel
Querkopf (Tag der Entscheidung)
Fünfzehntes Kapitel
Das Leben – ein Platokommentar
Sechzehntes Kapitel
In welchem dieser Kommentar eine unvorhergesehene Fußnote erhält
Anmerkung zum XI. und XII. Kapitel
Nachwort(Norbert Miller)
Editorische Notiz
Über den Autor
Vorwort
Lang ist die Reihe der Schriftsteller, die in ihre Werke, hauptsächlich Dramen und Romane, poetologische Reflexionen, manchmal sogar systematisch formulierte Poetiken integriert haben. Am Anfang dieser Reihe steht, soviel mir bekannt ist, Aristophanes, der in seiner Komödie Die Frösche eine Art immanenter Poetik formuliert hat. Er hat es indirekt getan, indem er Tragödien von Aischylos und Euripides verglich, die Mittel und Verfahren formulierte, mit denen sie bei den Zuschauern Mitleid und Mitgefühl auslösen, sowie die Auswahl und Darstellungsweise der Gestalten und Schicksale in diesen Tragödien. Es ist indessen klar, daß die Äußerungen über die Dramentechnik von Euripides und Aischylos gleichzeitig Autoreflexionen über Aristophanes’ eigenes Werk sind, spezifische »Hinweise«, wie die Komödie, in die sie integriert sind, gelesen werden sollte. Ich glaube, daran hat sich seit jener Zeit bis heute, seit Aristophanes bis, sagen wir, Milan Kundera, nichts Wesentliches geändert: Immer sind in ein fiktionales Werk eingeschriebene poetologische Reflexionen gleichzeitig Autoreflexionen über das Werk selbst, sozusagen das »Bewußtsein seiner selbst« des betreffenden literarischen Werkes, Hinweise oder zumindest Vorschläge für seine Lektüre. Das ist im übrigen notwendig, schon Empedokles hat uns darauf aufmerksam gemacht, daß der Mensch in der Welt nur das sieht und wiedererkennt, was er in sich trägt, daher ist der Blick ein Symbol des Selbstverständnisses, das darauf verweist, daß der Betrachtende sich selbst deutet.
Lang ist die Reihe der literarischen Werke, die sich mittels einer eingeschriebenen Poetik oder poetologischer Fragmente selbst reflektieren und deuten, und sie erstreckt sich von der Antike bis in unsere Tage, von Aristophanes bis Somerset Maugham und Milan Kundera. Und wie könnte es auch anders sein, wenn Literatur Kunst und Kunst ein sich seiner selbst bewußtes Gewerbe, eine professionelle Tätigkeit mit Technik und Theoriekompetenz ist, fähig, sich selbst zu reflektieren und einigermaßen zu erklären? Nicht so lang, aber beeindruckend ist die Reihe von Formen, in denen diese poetologischen, autoreflexiven Fragmente in den verschiedenen Werken vorkommen. Sie reicht von einer indirekt formulierten Poetik über beiläufige Bemerkungen zum Schreiben und zur Kunst überhaupt bis hin zu einer systematisch dargelegten und philosophisch begründeten Poetik, zum Beispiel in Ein Porträt des Künstlers als junger Mann von James Joyce. In meiner Erfahrung als Leser ist jedoch das Beispiel, das der Roman Stefan Rott oder Das Jahr der Entscheidung von Max Brod bietet, einzigartig.
Die Autoreflexion in diesem Roman ist äußerst fokussiert, konzentriert auf ein Bild bzw. einen Begriff, ausgedrückt in einem Wort. Ich erinnere mich nicht, in welchem Essay T. S. Eliot den Begriff des objektiven Korrelats verwendet und gesagt hat, daß das literarische Werk ein Bild erschaffen muß, das die Erfahrung, auf der das Werk basiert, objektiviert, so daß sich in diesem Bild, als objektivem Korrelat, das Werk und der Leser treffen, weil es, dieses Bild, indem es die Erfahrung, auf der das Werk basiert, objektiviert, dem Leser ermöglicht, in seiner Erinnerung eine ähnliche Erfahrung zu finden oder diese im Werk geäußerte zu erleben. Ohne das ist die Kommunikation des Lesers mit dem Werk nicht ästhetisch, Kunst setzt eine Kommunikation voraus, die Verstand und Emotion, körperliche Empfindung und Intuition einschließt, weil das künstlerische Erleben alle Elemente des menschlichen Wesens einschließt, wie es die unmittelbare Erfahrung tut. Und ein solches Erleben, schrieb Eliot, wird gerade durch das objektive Korrelat ermöglicht. Eliots Begriff kam mir schon beim Lesen dieses Romans von Brod in den Sinn, weil der ganze Roman mit einer wahrhaftigen technischen Meisterschaft auf einen Begriff fokussiert ist, der gerade als objektives Korrelat funktioniert, als Bild, in dem sich der Leser mit dem Werk treffen und es erleben kann. Gemeint ist der Begriff »Atopon«. Er taucht im fünften Kapitel, »Die Philosophie der schönen Stellen«, auf, das in Gänze dem Innenleben des zentralen Helden gewidmet ist. In diesem Kapitel treffen und verflechten sich Erinnerungen und Fragen, Erfahrungen mit der Musik und philosophische Interessen, das emotionale und intellektuelle Erwachsenwerden von Stefan Rott. Gerade in diesem Kapitel wird, keineswegs zufällig, seine verstorbene Mutter in den Erzählgang eingeführt, werden ihr Charakter und Schicksal skizziert, werden die Erinnerungen des Helden an sie relativ erschöpfend evoziert, besonders die Erinnerung an ihr Musizieren, das natürlich durch seine Überlegungen über Wagner und seine eigenen Erfahrungen mit der Musik kommentiert wird. In diesem Kapitel, sage ich, das ganz dem Innenleben des Helden gewidmet ist, taucht in unmittelbarer Verbindung mit seiner Mutter, seinem Vater und der Musik das Wort »Atopon« auf: »Nun sprühen bürstende Klänge des kleinen Instruments, Ariston genannt. Das ist die Gestalt der Mutter. Sie tritt dem lieben sanften Vater entgegen, dessen Nietzsche-Ähnlichkeit den Griechen wie des Sokrates Silenen-Äußeres als ein ›Atopon‹ erschienen wäre, ein seltsam peinliches ›Fehl-am-Ort‹. Die Mutter aber kam vielleicht wirklich aus Nietzsches Sturmwindzone. Alles, was Stefan von ihr wußte, war, daß sie in ewiger Aufregung gelebt hatte.«
Atopia ist im altgriechischen Wörterbuch Ungewöhnlichkeit, Sonderbarkeit, Widersprüchlichkeit und dann als Ableitung daraus Häßlichkeit, Verunstaltung. Atopos ist »nicht an seinem Platz«, daher auch »ungewöhnlich, seltsam, unpassend«. Der Roman lehrt uns, daß Sokrates ein Atopon war, ich denke, in Platons Gastmahl wird er auch so genannt, weil sein Silenen-Äußeres in keiner Weise mit seinem inneren Wesen, dem eines weisen und zurückhaltenden Menschen, übereinstimmt, der geradezu asketisch lebt. In einem Atemzug bezeichnet Brods Erzähler Sokrates und den Vater von Stefan Rott, der die Sanftheit selbst ist, aber aussieht wie Nietzsche, als ein Atopon. Die totale Unstimmigkeit von Äußerem und Innerem, die äußerste Widersprüchlichkeit zwischen dem Sichtbaren und Phänomenalen einerseits und dem Unsichtbaren und Wesentlichen andererseits, determiniert auch den Vater des Helden, der erscheint (aussieht) wie die Auflehnung selbst, aber im Kern im vorhinein allem zugestimmt hat.
Im Roman wird nicht gesagt, aber gezeigt, daß buchstäblich alles ein Atopon ist, was in seiner Welt überhaupt auftaucht. Ein Atopon ist die erste Liebe von Stefan Rott, Frau Phyllis, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Das gesellschaftliche Bild ihrer Person, also alles, was man in der besseren Prager Gesellschaft über sie hören und erfahren kann, stimmt überhaupt nicht mit den Tatsachen ihrer Biographie und dem, was man von ihr selbst hören kann, überein. Ganz ähnlich steht das Bild von ihrem Wesen, das auf der Sicht von außen und aus der Ferne basiert, in totalem Gegensatz zu dem Bild, das man gewinnt, wenn man Frau Phyllis etwas näher kennenlernt. Die Phyllis, die der verliebte Stefan Rott am Anfang ihrer Beziehung kennengelernt hat, ähnelt der Phyllis, die er im Kapitel »Gartenfest« kennenlernen konnte, wenig oder gar nicht. Wie eine Figur in einem Kaleidoskop verändert sich diese Gestalt unaufhörlich, eine Reihe von Informationen stellt sich als falsch heraus und muß durch eine andere Reihe von Informationen ersetzt werden, die sich in der Zukunft womöglich als genauso falsch erweisen wird, so wie ein Eindruck von ihrem Charakter fast bei jeder neuen Begegnung durch einen anderen Eindruck ersetzt werden muß, der sich als genauso vorübergehend erweisen wird. Als wäre sie nur ein Spiegel, in dem sich der, vor dem sie steht, oder das, worauf ihr Blick gerade ruht, spiegelt.
Ein Atopon ist auch Stefan Rott selbst, der zentrale Held des Romans, der sich in ein Liebesabenteuer mit der Mutter seines besten Freundes einläßt, obwohl er die Ethik, die Moral, die Ehrlichkeit, die Treue und andere Tugenden, die er annehmen und in sich entwickeln möchte, ernst nimmt. Und auch der Freund Anton sowie die Revolutionäre und Anarchisten, mit denen er Stefan bekannt macht, stellen sich als Leute heraus, die »fehl-am-Ort« sind. Sie exekutieren einen Verräter, den sie entlarvt haben, auf eine Weise, die nicht im geringsten im Einklang mit den Idealen, für die sie sich einsetzen, und den proklamierten Zielen ihres Kampfes steht. (Die Freunde des anekdotischen Erzählens könnten sich an den Seiten erbauen, die von den geheimen und halbgeheimen Zirkeln im damaligen Prag handeln. In diesen Kreisen tauchen, unter anderen, Franz Kafka und Jaroslav Hašek auf, ersterer natürlich schweigsam und sehr bemüht, unsichtbar zu sein, und Hašek natürlich laut und bereit, sich in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu drängen.)
An Stefans Erwachsenwerden hat der Religionslehrer Professor Werder viel aktiver mitgewirkt als Stefans Vater, dessen Rolle sich im Roman fast darauf reduziert, daß er gutmütig alles billigt und akzeptiert. Und auch der Professor ist, wie sich zeigen wird, fehl am Platz, sich selbst nicht ähnlich, ebenso wie die philosophischen Konstruktionen, die er auf Grund der Lektüre von Platon und Thomas von Aquin baut. Die Wahl Platons und des Aristotelikers Thomas, der Aristoteles über Ibn Ruschd kennengelernt hat, ist geistreich und sicher nicht zufällig: Die beiden bzw. ihre Weltanschauungen zu versöhnen, würde bedeuten, das logische Paradox, auf dem alle Existenz gründet, zu überwinden und das undurchsichtige, logisch unmögliche Geheimnis der Existenz zu erhellen. Natürlich gelingt es auch Professor Werder nicht, so belesen er ist. Nicht nur, daß seine philosophischen Konstrukte als Versuche, die Welt zu erklären, »fehl-am-Ort« sind, sie sind auch sich selbst unähnlich, weil sie als Verknüpfung des Unverknüpfbaren unhaltbar sind.
Von den Gestalten und ihren Versuchen, zu leben oder wenigstens die Welt zu verstehen, wird die »Unähnlichkeit mit sich selbst« auf die Außenwelt übertragen, von der man zuverlässig nur sagen kann, daß sie sich nicht einmal im Detail gleicht. So zum Beispiel in einer beiläufigen Bemerkung, die Frau Phyllis charakterisieren soll: »Frau Phyllis war in all dem holden, koketten, unbewußt grausamen und doch wieder schlechthin natürlichen Überschwang ihres Wesens ein Abbild des alten Österreich. War der Genius jenes Schwarz-Gelb der alten Schildtafeln, auf denen das Gelb immer ein wenig eingedunkelt, manchmal fast orange oder braun war, – still! In dieser Abweichung von der korrekten Farbenskala liegt für den, der es versteht, alles enthalten, was darüber gesagt werden kann.«
Alles ist so in diesem Roman. Die Gestalten, die Ereignisse und Dinge, die Gedanken, Gefühle und Erinnerungen, alles ist »verschoben«, »fehl am Ort« oder »nicht an seinem Ort«, alle sind und alles ist ein Atopon. Dieser Begriff ist das Prinzip, nach dem der Roman aufgebaut ist, er ist das Grundmodell und Prinzip der Romankonstruktion. Alles ist so gemacht und aufgebaut, daß es sich als unähnlich mit sich selbst erweist. Der Begriff »Atopon« ist der Schlüssel des Romans, der äußerst präzise Ausdruck seines Bewußtseins von sich selbst, die Anleitung zu seiner Lektüre und die Formel seiner Konstruktion.
Nur der Konstruktion? Wahrhaftige Metaphysik in der Kunst schafft sich immer eine adäquate Technik, so wie eine gute Technik immer Metaphysik schafft. Ich würde sagen, so könnte es auch im Fall dieses Romans sein, daß »Atopon« auch der Schlüssel, der fokussierte Ausdruck ist für das Erleben der Welt, für die Erfahrung der Existenz, auf der der Roman gründet. Wie die Welt erkennen und verstehen, wenn man mit Sicherheit nur eins über sie sagen kann: Auf der Basis des Phänomenalen und Sichtbaren kann man nicht über das Wesentliche und Unsichtbare urteilen, weil sie einander nicht gleichen? Wie soll ich mich auf mein Urteil über irgend etwas, über einen Menschen oder Gegenstand, ein Ereignis oder mein eigenes Gefühl verlassen, wenn es so ist? Was kann ich über die Welt und über mich wissen, wenn zwischen dem, was sich mir offenbart, und dem Verborgenen, Inneren keine Ähnlichkeit besteht? Wie kann ich über meine Begegnung mit der Welt sprechen, wenn es so ist? Ich fürchte, nur so, wie man über etwas spricht, was »fehl am Ort« ist.
Im übrigen ist Stefan Rott oder Das Jahr der Entscheidung ebensosehr ein Roman über das Erwachsenwerden wie ein Roman über die Zeit unmittelbar vor dem Krieg. Ich glaube, daß er dem Korpus der europäischen Romane, die die Welt unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg darstellen, in Wirklichkeit näher ist als dem Korpus der Romane über das Erwachsenwerden. Oder ist zumindest mir diese Dimension näher und wichtiger, so daß mir scheint, daß das Erwachsenwerden des zentralen Helden hier nur ein Mittel ist, mit dem seine Reise durch die verschiedenen Segmente der Gesellschaft, die auseinanderzufallen begonnen hat, motiviert wird? Hat das irgend etwas mit meiner eigenen Kriegserfahrung zu tun, die jetzt frischer ist als das Erwachsenwerden? Das kann ich nicht wissen, aber ich bezeuge, auch meine Erfahrung sagt, daß der Krieg beginnt, wenn die Welt und die Menschen, die sie bewohnen, aufhören, sich selbst ähnlich zu sein.
Dževad Karahasan
Aus dem Bosnischen von Katharina Wolf-Grießhaber
Indicabit hic tractatulus velut jacta tessera, quid Dominus de meis laboribus statuerit.
Helmont, »Febrium doctrina inaudita«
Erstes Kapitel
Freundschaft, Jugend
Der Tennisplatz lag im Glanz der Jugend und eines milden Frühlingsspätnachmittags. Im lauen Wind, der von der großen grünen Fußballfläche kam und wohlig nach Gras roch, tummelten sich weißgekleidete Jünglinge und Mädchen wie freiheitsdurstige Dämonen. Im Klubhaus unter der Dusche wurden sie vollends zu Göttern. Noch erhitzt vom Kampf, nackt, schön, von klingenden Tropfen umsprungen, zusammenschauernd und wieder aufgereckt – so standen in zwei benachbarten Einzelzellen die beiden Freunde Anton und Stefan, zwei große siebzehnjährige Burschen, Schüler der Septima, der vorletzten Gymnasialklasse. Sie konnten einander nicht sehen, sie hörten nur das Brausen der Wassergüsse, in den Pausen riefen sie einander lustig zu: »Mindestens zwanzig Service-Bälle hast du heute verschlagen« und »Wenn du mir lieber nicht jedes Game am Netz verpatzt hättest«. Der Sturm des Spiels war in ihnen noch so heftig, daß sie beide, wie auf Kommando, sinnlose, schwingend ruckartige Armbewegungen ausführten, manchmal auch beide den rechten Arm quer über die Brust nach links streckten und mit kurzem Zucken vorschnellten, – Backhand-Drives, Tennisschläge ohne Schläger. Einem Beobachter, der beide zugleich hätte sehen können, wären sie verrückt erschienen.
Nun waren sie angekleidet, trafen einander vor der Tür des Klubs. »Nein, im Ernst« sagte Stefan Rott, der Größere und Stärkere von den beiden, im Spiel aber um eine Klasse schwächer, denn Anton war an Geschicklichkeit, Schnelligkeit geradezu ein Genie »im Ernst, ich nehme es dir sehr übel, daß du nicht mit mir trainierst. Ich könnte viel von dir lernen.«
Anton beachtete diese Klage nicht. Er war sie seit langem gewohnt. Sein Interesse wandte sich dem Oblatengebäck zu, das in traditioneller Form (schmale Rechteck-Stangen mit Chokoladecremeschichten) am Buffet erhältlich war. Seit einer der britischen Gast-Champions in einer Spielpause eine Probe dieses Leckerbissens zusammen mit einem Glas Mineralwasser für die bestmögliche Erfrischung erklärt hatte, waren die jungen Leute wie wild auf das vorher wenig beachtete heimische Erzeugnis.
»Du hast doch auch wieder beim vierhändigen Klavierspiel einiges von mir gelernt? – Oder in Latein« setzte Stefan beharrlich fort; beharrlich, doch nicht ohne Schüchternheit – und die Frage ganz aufrichtig gemeint.
Anton kaute.
Längere Pause, dann sagte Stefan »Servus«, gab ihm die Hand. Nicht gerade beleidigt, aber das Thema »gegenseitige Hilfe« als aussichtsarm kurzerhand abbrechend.
»Wohin?«
»In die Stadt hinunter.«
Die Spielplätze waren auf dem heiteren Plateau gelegen, unten lag die Stadt im Dunst, nur die vorderste Häuserreihe am Moldauquai deutlich, – es sah geradezu übertrieben nach Rauch und schlechter Luft aus. So schlecht konnte die Luft gar nicht sein, man atmete ja in ihr, schließlich lebte man ja in diesem Prag.
»Gehst du stucken? Was machst du jetzt schon zuhause? Es ist kaum sechs.«
Nicht ganz fest setzte Stefan an: »Ich gehe nicht nach Hause.«
»Also doch zu diesem verdammten Pfaffen!« Anton Liesegang stellte jetzt das Kauen ein. »Hab ich dich nicht gebeten … hab ich dirs nicht verboten?«
»Ich möchte wissen, was du mir zu verbieten hast.«
Das war nun allerdings recht kindisch geredet, wie man es bei einem so großen Kerl, der sich überdies ausdrücklich über die letzten und höchsten Dinge Gedanken macht, gar nicht vermutet hätte. Denn handelte es sich etwa um ein wirkliches »Verbieten«, hatte Anton vielleicht eine diktatorische Maßnahme gemeint? Nein, er hatte ihn nur gewarnt, auf dem ganzen Weg von der Villa Liesegang (Stefan hatte ihn abgeholt) war von nichts anderem die Rede gewesen. Antons hübsches schlankes Gesicht unter dem hellblonden Haar färbte sich nun rot vor Zorn. So wenig fruchtete also seine ganze Argumentation, in der er unter Zuhilfenahme vieler Zitate aus den Schriften von Marx, auf den er schwor, die klerikale Gefahr und die ganze Reaktion in Österreich, die »Rückkehr des Staats zu seiner ältesten Form, zur unverschämt einfachen Herrschaft von Säbel und Kutte« aufgefahren hatte!
Seine Wut staute sich, explodierte aber sofort in Gelächter, das reizvoll, zivilisiert, zierlich und doch zugleich behaglich war. Hemmungen kannte er nicht, er entlud jedes Gespanntsein im Augenblick – und deshalb ging ein steter Strom von Lustigkeit und Wärme von ihm aus, zumindest mochte es bei oberflächlicher Betrachtung diesen Anschein haben. Stefan freilich kannte den Freund tiefer, fühlte ahnungsweise das Unglück in seinem Wesen – ein Unglück, für das es in jenen Jahren der Jugend noch keinen Namen gab.
»Von mir aus« sagte Anton verächtlich. »Ich brauch dich zum Krenreiben.«
Stefan blieb nachdenklich stehen. Er war dunkel, schön, groß. War auch sehr kräftig – und pflegte mit Boxhieben zu antworten, wenn einer in der Klasse ihm seine besondere Liebe für Professor Werder, den Katecheten (»Katechet« hieß der katholische Religionslehrer im alten Österreich) vorzuwerfen wagte. Daß dieses Verfahren, lästige Frager einfach auf körperlichstem Wege zurückzuweisen, ihm keine Feinde gemacht hatte, war eines der vielen Zeichen seiner besonderen Beliebtheit in der Klasse, eines Respektiertseins, das natürlich nur zum Teil auf seiner Leibeskraft, im Wesentlichen auf Eigentümlichkeiten geistiger Art beruhte, über die sich keiner der Mitschüler Gedanken machte, die aber im Stummen und Geheimen desto merklicher für jedermann wirkten. Auch Anton war unter den Kameraden beliebt, aber auf ganz andere Weise. Man lachte über ihn, man billigte seine Ungezogenheiten und freien Reden, aber ein wenig Verachtung mischte sich halb unbewußt bei – Anton gab der Klasse das »Kasperl« ab, Stefan wurde geehrt. Übrigens fand gerade Stefan diese unterschiedliche Behandlung ganz unrichtig, war fest überzeugt, daß man seinen Freund durchaus unterschätzte.
»Was soll ich dir darauf antworten« sagte er jetzt mit einer gewissen Traurigkeit »soll ich dir erst erklären, daß Werder der Gescheiteste von unsern Profen ist und daß ich deshalb gern zu ihm hingehe.«
»Halt die Pappen. Oder erklär mir lieber, daß er es dir heute aufgetragen hat – und daß du deshalb gehorsam hinhatschen mußt.«
»Weißt du, was das ist? Das ist eine Schweinerei von dir.« Stefan zwang sich sichtlich zu der ordinären Ausdrucksweise Antons, die ihm nicht lag, und in diesem Sich-Zwingen zeigte sich ja eigentlich schon der Sieg Antons – eine Tatsache, die überdies Stefan sofort und gern anerkannt hätte, – denn daß Anton ihm durchaus überlegen sei, gehörte zu den Fundamenten seiner jungen Lebenserfahrung. Ja, er bewunderte den Freund, nur war die äußere Form dieser Verbundenheit in all den Gymnasialjahren Gleichgiltigkeit der Verkehrsformen, wo nicht Feindschaft gewesen, wie dies eben unter ganz jungen Leuten Sitte und Brauch ist. In einer gewissen Art fürchteten sie sich wohl auch vor einander; der gewandte, aber schmächtige Anton nicht zuletzt vor Stefans Faust, die jetzt auf ihn losging. »Eine Schweinerei von dir – du weißt doch ganz gut, daß mich Professor Werder längst interessiert, daß ich auch ohne den Zwischenfall zu ihm hingegangen wäre.«
Aber Anton trotzte. »Einen Dreck weiß ich.« Vielleicht war auch eine gewisse Eifersucht an seiner Erbitterung mitbeteiligt. Fühlte Anton seine Herrschaft über Stefan bedroht? Wußte er denn überhaupt, daß er Stefan beherrschte und lag ihm irgendetwas daran? Derartiges ließ sich nicht feststellen, denn Anton pflegte, wenn die Rede auf Persönliches kam, nur Witze zu machen. Konfidenzen lagen ihm nun einmal von allem Anfang an nicht.
Stefan trat nahe auf ihn zu. Gleich werden sie raufen. (Aber der Glanz der Jugend liegt auf dem Weg, der längs der Tennisplätze führt. Weiße Sommerhemden, Sporthemden, es huscht an die Netze, schlägt und springt. Solange die Welt diesen hellen Schein und die Freude glücklicher junger Körper behält, kann es nicht ganz schlimm werden – und so ist auch der Streit der beiden Burschen nur ein vergleichsweise harmloses Geplänkel und Vorspiel zu all dem Ernsthaften, das zwischen ihnen an Streit- und Erregungsstoff in die Zukunft hinauswachsen mag.)
»Sag einmal aufrichtig, was hast du gegen Professor Werder?«
»Aber gar nichts« heuchelt Anton. Und in der ganzen Tonart liegt ein scharfer gewollter Hinweis darauf, daß er heuchelt, nichts als heucheln will.
Anton bleibt stehen. »Es ist doch überhaupt lächerlich, darüber noch ein Wort zu verlieren. Mir ist es pipe, lauf ihm nur nach. Nur bist du selbstverständlich, wenn du ihm heut auf die Bude rückst, – leider für mich erledigt.« Das »leider« sehr herausgehoben, sehr ironisch gesagt.
Jetzt muß ich ihm doch eine hineinlangen – denkt Stefan gesammelt, und während er das blasse Gesicht des Freundes betrachtet, wie um sich die Stelle auszusuchen, an der er die Ohrfeige ablagern wird, fällt ihm auf, wie hübsch und ebenmäßig dieses Gesicht im Ganzen ist, trotz der großen Nüstern, der abstehenden Ohren, – ein keckes und doch edles Gesicht; frech-edel, wenn man so sagen kann.
»Du gibst also nicht zu, daß er ein Denker ist, ein Gelehrter –«
»Gelehrt in Dingen, die uns gar nichts angehen, die unnütz, also schädlich sind, – Dinge, die mich …« Er sprach es zu Ende, es war seine Lieblingsredensart, so kräftig und schmutzig, wie er zierlich, hübsch und sauber war. Seltsamer Gegensatz; und er gebrauchte das klassische Zitat so gern, mit so überzeugender, zumindest ihn selbst überzeugender Abschlußkraft, daß er es (wie soeben) auch in Fällen anwandte, in denen sein Sinn weit hergeholt und nur mit einiger grammatischer Gezwungenheit zur Geltung kam.
»Das ist noch die Frage, ob diese Dinge uns nichts angehen.«
»So – so – du bist also ein Schwarzer? Am Ende wirst du noch Pfarrer werden. Nimmst Privatstunden bei ihm. Aber bitte sehr –« Anton war jetzt ganz ruhig geworden. Seine Wut pflegte meist sehr rasch zu verrauchen und einem durchschnittlichen, immer von sich selbst herzlich amüsierten Gemütszustand Platz zu machen. »Zu deiner ersten Predigt kannst du mich einladen. Ich komme ganz bestimmt nicht.«
Diese Kühle wirkte quälend, beleidigend. Stefan seufzte. »Ich weiß nicht, warum du mich so gar nicht verstehen willst.«
Der Blonde hob sich auf die Zehenspitzen, sah ihm scharf ins Auge. »Daß er ein Schwerpathetiker ist, dein Professor Werder, das ist dir wohl noch gar nicht aufgefallen?« »Pathos« war in Antons Ausdrucksweise die ärgste Schmähung. Er gebrauchte das Wort nicht ganz in dem üblichen Sinn, legte es mehr als schreienden Gegensatz zur stillen Macht der Tatsachen an, die er als einzige legitime Gegebenheit der Zeit anerkannte; zumindest hatte er sich das als strenge, überdies durch einen Teil seiner Veranlagung vorgeformte Aufgabe gestellt.
»Pathetiker? Man denke –« und nun spielte Stefan seine stärkste Karte aus, ein in der Klasse vieldiskutiertes und ziemlich allgemein als ebenso achtbar wie rätselhaft anerkanntes Geschehnis – »man denke an unsern Kondolenzbesuch. Ich finde, daß Werder damals und immer sehr aufrichtig war.«
»Aufrichtig wie du, wenn du das sagst.«
»Du hältst mich also für einen Lügner.«
»Was ist der Unterschied zwischen Romantik und Lüge?«
Und nun wurde also doch gerauft. Es mutet ja einigermaßen komisch an, daß eine Frage wie die der Romantik und ihrer Illusion (eine Frage, lebensentscheidend in der Folge für Stefan und wohl auch in Antons Dasein späterhin wichtig genug) – daß eine solche die Welt seit Jahrtausenden in Atem haltende Frage durch eine schlichte Prügelei zwischen zwei Gymnasiasten und gerade am Rande des Belvedereplateaus um sechs Uhr nachmittag am 3. April 1914 zur Austragung und endgiltigen Lösung gebracht werden sollte. Aber Jugend macht sich solche Skrupel nicht, in ihrem Gold- und Frühlingsglanz liegt selbst ein illusionierendes Element, durch das auf den Grund der Wirklichkeit durchzustoßen nicht leicht ist und merkwürdigerweise auch bei Anwendung des heftigen Willens gerade der Jugend, die Wahrheit und Wirklichkeit zu erfahren, nicht im Mindesten leicht wird. – Nun, so wurde eben gerauft! Erst geboxt und dann gerungen, in ganz freiem Stil. Die beiden Burschen, temperamentvoll alle beide, gerieten wider ihren Willen in den Ernst des Kampfes, die gegenseitigen Schläge machten sie immer wütender, plötzlich waren sie – Stefan fühlte es mit Erschauern – wirklich Feinde. Sie taten einander weh, die Sache wurde gefährlich. Das Entsetzen über diese Wendung hinderte indes Stefan (in der jugendlichen Unlädiertheit seiner Nerven) durchaus nicht, seinen Vorteil wahrzunehmen, jetzt hatte er den leichteren Anton um die Hüfte gepackt, hob ihn und wollte ihn eben hinschmeißen, – da schien er sich eines Besseren zu besinnen. Er stellte ihn auf die Erde hin, säuberlich auf beide Füße, nahm bei dieser Prozedur noch selbst ein paar verirrte Hiebe mit in den Kauf, – und trabte dann rasch, wie auf der Flucht, den von Hecken umsäumten schrägen Weg längs des Abhangs hinunter. Anton verfolgte ihn nicht. Aber Stefan glaubte im Rücken seine feindseligen Blicke zu spüren.
Ich hätte ihn doch züchtigen sollen, – dachte er dann und straffte sich. Ausdrücklich dieses Wort »züchtigen« dachte er. Seltsam, er erkannte die glänzendere Begabung Antons an, – trotzdem nahm er unwillkürlich eine Art von Kontrollstellung ihm gegenüber in Anspruch. Übrigens nicht nur ihm, nein, in Ausnahmeminuten allen Menschen gegenüber, – halbverrückte Stimmungen waren das, die er gewissermaßen mißbilligte, demütig vor sich selbst abzuleugnen suchte, – aber sie waren doch unzweifelhaft da und mochten ihren verborgenen Sinn haben. Dabei erkannte er ebenso wie seinem Mitschüler den Menschen in ihrer Gesamtheit bereitwillig ihre hohe Überlegenheit zu, hoch über seine Person hinaus. Und trotzdem dieser rätselhafte Ruf zur Führerschaft, zu einer Art von Oberaufsicht, von Verantwortung für alle! Hirnverbrannt. Und still, nie und niemandem von diesem »Geheimnis« etwas gesagt! Ja, sein persönlichstes Geheimnis war es, ging niemanden etwas an, niemanden auf der ganzen Welt. Es hing mit ein paar Dingen zusammen, von denen gleichfalls niemand wußte, mit der plumpen, häßlichlieben Klavierbank in seinem Zimmer, mit diesem Zimmer selbst, in dem es trotz der hohen Fenster niemals ganz und grell licht wurde, mit den sechs Quadraten dieser Fenster, so verschieden von den bloß dreiteiligen Fenstern in neueren Häusern, mit den protzigen und in mehr als einer Hinsicht unheimlichen Karyatiden rechts und links vom Mittelfenster draußen an der schmutziggrünen Fassade; es hing mit manchem zusammen, was beunruhigte und beglückte. Aber wie es auch sein mochte, es war und blieb sein »Geheimnis«. Nie würde er sich so lächerlich machen wollen, irgendwem auch nur eine Andeutung davon zu verraten.
Anton aber – wie stand es mit dem, wie mit der »Züchtigung«? Die hatte der Lauser reichlich verdient. Einen wirklich »erhabenen« Menschen so gemein anzufallen, meinen Professor Werder, – das Gefühl für geistigen Rang todsündlich zu verraten! – Stefans Gedanken wandten sich dem Verehrten zu, die einfache ruhige Gelehrtenwohnung tauchte auf, die er ein einzigesmal gesehen hatte, damals, bei dem merkwürdigen Kondolenzbesuch. – Professor Werder, unter dem Einfluß der modernen französischen Katholiken stehend, unter dem Fernlicht Pascals. Er arbeitet seit Jahren und ohne je ein Ende zu erreichen an einer zusammenfassenden Darstellung der thomistischen Theologie. – Nun bin ich also zu Professor Werder unterwegs. Anton Liesegang, verschwinde! Ich brauch dich zum Krenreiben, – wie du zu sagen pflegst.
Noch rasch, im Weiterschreiten, zum vorläufigen Abschied gleichsam umschrieb er im Geist das liebe blasse Gesicht. Kleine graue Augen, lange Nase, jede Einzelheit unhübsch, das Ganze bezaubernd in seiner Frechheit, seinem Elan. – Stefan erschrak. Da war »jenes andere«, das er lieber im Dunkel ließ. Hing es etwa mit Antons Mutter zusammen, Frau Phyllis Liesegang? Einen so hübschen eigenartigen lebensstarken Burschen zum Sohn zu haben – auch das eine Lockung? Eine von vielen. Immerhin bin ich froh, daß es wenigstens mit Anton nichts zu tun hat. Da liest man solch eine Menge von Büchern (um eine Lücke zu füllen, endlich, man war ja bis vor kurzem ganz dumm und »unaufgeklärt«) – eine solche Menge also, und alle bemühen sich, in höchst geschwätziger Weise, das ganze schlüpfrige Thema erschöpfend abzuhandeln, nur ja um Gottes willen nicht die absurdeste Einzelheit auszulassen. Absurd, das ist das richtige Wort. Knabenliebe, Männerliebe, – das gab es also auch, auf diesem peinlichen Gebiete sollte ja offenbar auch das Undenkbarste und Unmöglichste möglich sein! Oft hatte er sich gefragt, ob er etwa eine Spur dieses Gefühls, auch nur ein Analogon dazu, dem Freund gegenüber verspürte. – Daß vielleicht schon diese Frage verdächtig war, das war ihm freilich nicht eingefallen. Er war ja jung. Und bei aller Komplikation und Gewissenhaftigkeit, bei aller scheinbaren Selbstzerfaserung, die eben durchaus scheinbar bleibt (eine der vielen Goldfarben der Jugend, dem Sonnenschimmer auf der Moldau ähnlich, im Glitzern ihrer ruhig kleingewellten Stromfläche), bei aller Intensität also, die in späteren Lebensjahren als das verlorene Paradies der ersten Geisteserregungen erscheint, fehlt dem jugendlichen Denken doch jenes Mißtrauen gegen sich selbst, das in der Folge jede gerade Linie, jedes Vorwärtsschreiten beirrt – vielleicht rechtmäßigerweise beirrt – jedenfalls beirrt. – Nein, nichts von Verdächtigungen, noch denkt Stefan völlig geradeaus und rein. Er sagt sich: ich habe ihn ja gerade deshalb losgelassen und nicht »gezüchtigt«, weil es mir unangenehm war, ihn körperlich anzupacken. Wie sich seine warmen Hüften mir unter den Händen drehten, – einfach unangenehm. Sogar im Eiswasser habe ich leise etwas Abstoßendes verspürt, damals als ich ihm nachsprang und ihn herauszog, – jetzt wird am Ende so einer kommen und mir weismachen wollen, daß ich ihm »deshalb«, um dieser Art von Freundschaft willen nachgesprungen bin. Das wäre aber denn doch der Gipfel der Lächerlichkeit! Es war mir ja im Gegenteil äußerst peinlich, daß ich ihn damals »umarmen« mußte, nach allen Regeln der Kunst, sonst hätte ich ihn eben nicht herausziehen können. – Wild blickte Stefan um sich. Er empfand förmlich Wut gegen den gar nicht vorhandenen »so einen«, der dies oder ähnliches behauptet hätte.
Zweites Kapitel
Kampf mit einem erhabenen Menschen
Professor Werder wohnte in Podol, einem kleinen billigen alten Vorort am rechten, von der Neuzeit vernachlässigten Moldauufer. Längs des linken führen einige Bahnstrecken, auch die Hauptstrecke über Pilsen nach München, – das rechte lag damals verlassen, träumerisch kleinbürgerlich da, mit seinen Kähnen, friedlichen Anglern, winzigen Badehütten. Die Häuser in Podol waren niedrig, eine Kleinstadt unmittelbar vor den Toren Prags, die sogar noch einen deutlich dörflichen Einschlag hatte.
Der erste richtige Besuch – und doch hatte die nähere Beziehung zu Professor Werder schon vor vielen Monaten eingesetzt. Zu Beginn des Schuljahrs, in einer Griechischstunde, die der Religionslehrer supplieren mußte.
Bewunderung von ferne, ohne persönliche Beziehung auch nur der leichtesten Art, war allerdings von jeher, schon Jahre lang da gewesen. Denn das wußten ja alle: Professor Werder überragte die Lehrpersonen der Schule um ein Beträchtliches – nur blieb man ihm eben fern, man liebte ihn nicht. Er hielt alle in Schrecken, obwohl er nicht »gemein« war wie die andern, obwohl er niemals aus Gründen eines persönlichen privaten Ärgers die Schüler peinigte, nie einen geheimen Zorn an ihnen ausließ oder irgendeinen einzelnen, der sich bemerkbar gemacht hätte, aus der Herde herausgriff und gegen alle Gerechtigkeit »zweierte«. (Ein »Zweier« war die von älteren Generationen übernommene, einem vergessenen Klassifikationsschema angehörige Bezeichnung für »nicht genügend«.) O, Professor Werder war gerecht, vielleicht allzu gerecht, – er hatte einen Kreis glazialer Unnahbarkeit um sich gezogen, den er im Guten wie im Bösen nie überschritt. Auch Stefan mußte später, selbst in der Zeit des dichtesten Umgangs, oft genug diese Eisgrenze spüren. Im Ganzen hatte die gleichmäßige Freundlichkeit des Professors, die er nie aufgab, doch auch nie steigerte, etwas Gekünsteltes und nur gleichsam Pflichtschuldiges – auch wenn er einen Schüler bestrafte oder ihn durchfallen ließ, geschah es in Freundlichkeit. Ein imponierendes Benehmen; man wehrte sich dagegen, redete sich ein, daß es ein aufgeblasenes leeres Unwesen sei; vergebens, es packte doch und in irgendeinem innersten Winkel der Seele mußte man es ehrlich anstaunen. »Unmenschlich, herzlos« nannte es die Schülerschaft, nannten es wohl auch die Lehrkollegen, denen der Mann nie ganz geheuer war. In ihrem Kreis brachte man denn auch seine Härte, fremdartige Gelassenheit mit seiner niedrig kleinbäuerlichen Herkunft zusammen. Stimmte das? War es richtig, was einer zu erzählen wußte: daß Werder damals als er noch gar nicht Professor, nur einfacher Kooperator auf dem Dorf war, mit Vorliebe den Bauern beim Einbringen der Ernte geholfen habe und damals überhaupt ganz anders gewesen sei als jetzt, ja sogar – was man sich kaum vorstellen konnte – ein ehrlich froher und unbeschwerter Mensch? Das mochte vielleicht nur Gerede sein. Gesehen, bei der Ernte gesehen hatte ihn niemand, – wenn man näher zufragte, auch der Erzählende nicht, – er hatte es nur wieder von einem andern gehört. Was man mit Sicherheit in Erfahrung bringen konnte, beschränkte sich schließlich auf die Tatsache, daß Werder wirklich von Bauern stammte, und zwar von deutschungarischen Eltern aus der Umgebung Preßburgs. Mehr wußte man nicht, sein Lebensschicksal kam nie auch nur in der geringsten Kleinigkeit an die Oberfläche. Nur Stefan und sein Kreis bekam einiges Wichtige zu hören, das geschah allerdings erst viel später. –
Die erste nähere Beziehung war ein Zusammenstoß gewesen. In jener Griechischstunde, die Professor Werder ersatzweise gab, – es zeigte sich aber, daß er das Griechische weit besser beherrschte als der Ordinarius, und seine Auslegung der Verteidigungsrede des Sokrates (im Wortlaut Platos) eröffnete holde Bilder und dann wieder eine ganz schroffe, auf die unmittelbarste Gegenwart bezogene Ironie, deren sich die Klasse im regulären Griechisch-Unterricht nie versehen hatte. So verglich er den Meletos, den Ankläger des Sokrates, mit einem bestimmten Dichter von heute, der in der Stadt eine etwas weinerliche und sentimentale Lokalberühmtheit genoß – und des Sokrates »Atopon«, das Ungereimte seiner äußeren Häßlichkeit bei feurigstem Seelenadel, wurde als eines jener Paradoxe erkannt, in die man sich, obwohl sie sich sperren, wagend hineinstürzen muß, um zum Glauben und tiefsten Wissen zu kommen, indes die betont lyrische Haartracht jenes Prager Meletos einladender war, Unbürgerlichkeit und Tiefe vortäuschte, damit aber nur die Leichtgläubigen irreführte. Denn Meletos war, trotz seines »Dichterberufs«, nichts als banal – und eben aus diesem Grund des Sokrates Feind. – Nicht alle verstanden, daß mit solcher Übersetzung der Antike ins nahe und nächste Erlebnis etwas Ungewöhnliches vorging; doch der größere Teil der Schülerschaft, im Ganzen noch von jener frischen Eindrucksfähigkeit des Gemüts, die das schöne Vorrecht der Jugend ist und eine weise Ahnungskraft in sich birgt, merkte schon irgendetwas Besonderes – und vor allem war Stefan entzückt, der den Unterricht immer sehr ernst nahm, ohne jede Spur von innerlicher Obstruktion und »Schüler-Problematik«, der wirklich lernen – nein, das war es doch nicht – der im Lernen etwas Neues, Weites, Herrliches »genießen« wollte. »Genießen« war das Lieblingswort seiner Jugendjahre, er verwendete es in seiner innerlichen Dialektik sehr oft, zur Selbstbeurteilung, jedoch immer auf eine besondere, gleichsam geistig veredelte Art. Warum sprach er also überhaupt (zu sich selbst) von »Genießen«? Hätte er denn keine bessere Bezeichnung für das, was er meinte, finden können? O gewiß – und er wußte ja auch ganz genau, daß im Wort und Begriff »Genießen« etwas Degradierendes liegt, – aber gerade das nahm er gern mit in den Kauf, ja, es schien ihm eine gewisse, sehr schwer definierbare, eigensinnige Freude zu bereiten, daß er gleichsam schief, von einer nicht sehr in Ansehen stehenden, ja suspekten Seite her an dieses Grundelement der höheren Welt herankam. Er erschien sich im Verborgenen allein, unbeachtet – und das war (so fühlte er) der rechte Weg des unerbittlich Wahren und des Erhabenen. Es liegt nicht auf der Straße, es kann nicht allgemein verständlich gemacht werden, nicht allgemein anerkannt sein, es muß aus innerer Notwendigkeit bescheiden sein, stolz-bescheiden und Mißdeutungen ausgesetzt. Aufrichtigkeit führt zwangsläufig zu wenig verstandener Formulierung; die glanzvollen und allgemein gelobten Worte, die großen Anlässe und Märkte, die Berühmtheiten gehören auf ein anderes Blatt. Daß er sich mit solcher Hinneigung allen Gefahren der Eitelkeit aussetzte: auch das war ihm klar. Dieser Gefahr mußte eben immer wieder begegnet werden, aber da er sie sah, würde er ihr schon nicht verfallen, – und selbstverständlich änderte die Gefahr nichts daran, daß der richtige Weg richtig blieb und zu gehen war.
Ja, den will ich »genießen« – träumte Stefan in seiner Schulbank – schon wenn er Religionslehre vortrug, habe ich es geahnt, aber jetzt, bei Platon, wird es mir ganz klar, was für ein »erhabener« Mensch das ist. – Und sein Herz weitete sich in lustvollem Schmerz, das Gefühl menschlicher Größe strömte wieder einmal ein – wie nur je bei einem Wagner-Akkord, bei jenem Akkord mit dem geheimnisvollen Nonen-E.
Und so geschah es denn wirklich nur aus Gewohnheit, daß Stefan unter der Bank den »Pasch« geöffnet hielt (so nannte man die »von einem Schulmann« herausgegebene Übersetzung, die als Denkersparnis und Eselsbrücke streng verboten war).
»Rott Stefan, was haben Sie da?«
Mit Luchsblick hatte Werder, den Gang zwischen den Bankreihen abschreitend, von hinten her das winzige Büchlein bemerkt.
Stefan, stolz aufspringend: »Ich brauche den Pasch wirklich nicht, ich verwende ihn gar nicht.«
Zu seiner Beschämung duckte ihn, wiewohl er tatsächlich nichts als die pure Wahrheit gesagt hatte, das Wort des Lehrers rasch nieder, das lächelnde, in Werders langsamer näselnder Sprechart hervorgedrehte Wort, – gesprochen, während der »Pasch« weggenommen wurde und in Werders Rocktasche verschwand: »Ich weiß ja, das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler ist ein Kampf, in dem beiderseits jedes Mittel erlaubt ist.«
Die Klasse staunte. Solch eine Rede hatte man noch nie gehört. Welch ein Zynismus – mit einem ganz seltsamen Unterton von Langweile und Verdrossenheit dabei – das strafte ärger, als ein Karzer es getan hätte. Es griff ans Innerste. Unklar fühlten alle, daß durch solch eine Ansicht die Grundlagen der Schule, ja des Lebens selbst erschüttert wurden – und daß sie dabei durchaus die richtige, nur immer wieder versteckte Ansicht war.
Nach der Stunde trat Stefan auf der Straße mit entschlossenem kühnen Schritt an den Professor heran.
Die kleine Diskussion blieb ihm zeitlebens in Erinnerung. Sie lief darauf hinaus, daß Werder erklärte, immer mit seiner liebenswürdigen, leicht in singende Töne umkippenden Stimme: Stefan möge sich mit seiner Auseinandersetzung nicht aufregen – außerhalb der Kirche gebe es ja ohnehin keine volle Wahrheit – daß in der Schule geschwindelt werde, gehöre eben auch mit dazu.
»Ich schwindle aber wirklich nicht.«
Der Professor sagte nichts, machte nur eine kleine zweideutige Bewegung, als blättre er in dem verbotenen Büchlein. Heute nicht, aber bei Bedarf, wer weiß – das etwa sagte die Bewegung. Oder: Ist vielleicht gerade das ein Grund zu Hochmut, daß man erwischt worden ist?
Aber der Professor schwieg ja. Machte keinen Vorwurf. Stefan fühlte das Schiefe seiner Situation, fühlte sich lächerlich gemacht. Er hatte den Eindruck, daß Werder ihm ganz absichtlich und provokativ seine normale, sozusagen menschlich-durchschnittliche Anständigkeit abstreite. Diese Betrachtungsweise, die ihm schon während der Schulszene schwach aufgedämmert war, kam ihm in ihrer Deutlichkeit doch so brüsk und unerwartet, daß er erbost und ohne Gruß wegging.
»Auf Wiedersehen, Rott« rief ihm der Professor nach, – ein milder, durchaus temperamentloser Gruß, der aber den Schüler doch aufhorchen machte, zurückdrehte. Da sah er seinen nicht mehr jungen Lehrer, einen Fünfzigjährigen wohl, mit entblößtem Haupt, um das rostrotes und graues Haar in spärlichen Strähnen, vom Straßenwind gezaust, sich aus der Ordnung löste. Werder hatte den Hut gezogen – gewiß nur eine mechanische Geste. Aber dieser kalte Wind! Und der mächtige breite Schädel! Stefan hätte weinen mögen; er wußte nicht recht, warum.
Bald darauf traf in der Klasse die Nachricht ein, Werders Mutter sei gestorben. Mit jener Geschäftigkeit und Sensationsgier, die den Schüler in die privaten Bezirke des Lehrers wie in ein verbotenes und lüstern umkreistes Heiligtum treibt, beschloß man, eine dreigliedrige Deputation in Werders Wohnung zu senden, um ihm das Beileid seiner dankbaren Gymnasiasten auszudrücken. Es war selbstverständlich (aber Stefan wäre vor keinem Mittel zurückgeschreckt, es auch gegen den allgemeinen Willen durchzusetzen), daß Stefan die Deputation führte. Sie traten ins Haus. Zum erstenmal erklomm Stefan die winklige, steile, nach Zimt und Nüssen riechende Holzstiege. Es schepperte die alte Glocke an der weißlackierten Holzgittertüre, die die »Pawlatsche« – eine längs des Hofes laufende Galerie – abgrenzte. Ein verrunzeltes Dienstmädchen öffnete mit devot altmodischem Knix. Man mußte über die ganze Galerie weg, ehe man die Wohnungstür mit dem Messingschild erreichte. Dann fand man den Professor in seinem halbhellen Wohn- und Studierzimmer, das auffallend wenig Bücher enthielt, nur zwei kurze Regale mit ein paar alten, vieldurchblätterten Bänden. Der hochgeschlossene, schwarze Rock, den er zuhause trug, war aus einem dürftigeren Stoff als sein Schulanzug. Übrigens zeigte da wie dort nur der schmale weiße Streif des lückenlos geschlossenen Halskragens den Unterschied geistlicher Tracht von der weltlichen an. Und seltsamerweise war doch der Eindruck des Nicht-Weltlichen durchaus nicht auf dieses Krägelchen beschränkt, sondern erfaßte den ganzen Mann von oben bis unten und die Luft rings um ihn. Woran das lag – ein dauerndes Problem, mit dem sich späterhin Stefans Beobachtungsgabe abplagen sollte, die dann auch zu verschiedenen Zeiten verschiedene Antworten gab.
Durch Aufstehen begrüßte der Lehrer die drei Ängstlichen, es war ihm keinerlei Aufregung, keine Tränenspur anzumerken, überhaupt nichts, worüber man später der Klasse hätte Bericht erstatten können. Stefan hatte sich einige ganz knappe Sätze zurechtgelegt, nach taciteischem Muster prägnant, hatte die kleine Rede gut memoriert – er brachte nur den Anfang richtig, dann wurde er weitschweifig, unklar. Werder schaute ihn fest an, mit seinen blaßgrauen scharfen Augen, die einen durch und durch zu spießen schienen und dabei doch ganz freundlich blieben. »Nur nicht sich schämen« dachte Stefan. »Ich tu ja nichts Schlechtes, nichts Unehrenhaftes.« Er stand dem Lehrer so nah, daß er die winzigen Fältchen um die Augen bemerkte, die er bisher nie gesehen hatte; die Fältchen erschienen ihm listig, – gleichzeitig erregte das übermäßig große Holzkruzifix an der weißgetünchten Wand seine Aufmerksamkeit – und bildete einen in Worten nicht ausdrückbaren Kontrast zu diesen Augenfältchen. Dabei sollte man ein Sprüchlein aufsagen! – Endlich war er zu Ende. Werder schwieg ein Weilchen, dann hob er den Zeigefinger, wackelte mit ihm hin und her – sein Blick wurde traurig und schwer. »Davon versteht ihr gar nichts« sagte er ganz langsam und still. Es wirkte bedrückend in seiner Aufrichtigkeit, zu der auch die zwischen Lehrer und Schüler sonst ganz ungewohnte Du-Ansprache gehörte. Eine gespenstische Vertraulichkeit gerade im Moment, da unüberbrückbare Distanz der Jahre, der Erfahrung und wohl auch noch anderer, ganz dunkler Dinge sich auftat. Kein Wort mehr. Die Schüler waren entlassen. Wie geprügelte Hunde zogen sie ab. Vergebens fragten sie sich nachher, ob der Professor sie ganz unfreundlich oder (so daß sie es nur mißverstanden hätten) gerade besonders freundlich behandelt habe. Offenbar entzog sich vieles, was der rätselhafte Mann tat, den üblichen Kategorien.
Unter den dreien bildete es dann noch lange Zeit einen Diskussionsgegenstand, ob es in dem Zimmer (einer sagte gar: in der »Mönchszelle«) des Katecheten nach Weihrauch gerochen habe oder nicht.
Jedenfalls schien er der Klasse seit jenem mißglückten Besuch noch entrückter und unzugänglicher als vorher.
Umso erstaunlicher, daß er kurze Zeit darauf Stefan eine Art Gegenbesuch machte. Die Veranlassung dazu war freilich keine alltägliche. Stefan hatte beim Schlittschuhlaufen auf dem einbrechenden Eis der Moldau seinen Mitschüler Anton Liesegang unter eigener Lebensgefahr vor dem sicheren Tod gerettet. Mit verstauchtem Bein lag Stefan zu Bett. Alle Professoren, auch der Direktor des Gymnasiums kamen ihn besuchen, nicht feierlich offiziell (ein offizielles Anerkennungsschreiben der Anstalt war natürlich nicht ausgeblieben), sondern jeder einzelne als Privatmann, in offenbar verabredeten Stunden, um jeder für sich dem Mutigen Bewunderung auszudrücken, – wobei sich selbst verschrobene und wenig beliebte Lehrer in ihrer echten Ergriffenheit erstaunlich einfach und gut benahmen. Dann kam auch Professor Werder. Obwohl er sich nur der allgemeinen Reihe einfügte, hatte Stefan seinen Besuch durchaus nicht erwartet, – es stellte sich später heraus, daß auch keiner in der Klasse nur im Entferntesten an die Möglichkeit einer solchen Annäherung gedacht hatte, daß alle, denen Stefan das Ereignis erzählte, überrascht, ja erschrocken waren. Auch Stefan erschrak, als der Religionslehrer eintrat. Erschrak aus dem unklaren Gefühl hervor, daß Werder den schönen Rausch der Heldentat, in dem sein Knabenherz sich erging und den die Umgebung schmeichlerisch nährte, durch irgendeine seiner sarkastischen und unheimlich überlegenen Bemerkungen stören würde. Doch – zweites Erstaunen – Professor Werder sprach mit zartester Freundlichkeit, ließ nicht im Geringsten die ablehnende Reserve fühlen, die er sonst wie ein unsichtbares Drahtnetz um sich gespannt hielt, er hatte sogar ein Jugendbuch mitgebracht, wie es einem Siebzehnjährigen Freude machen konnte – ja Professor Werder brachte ihm, Stefan, ein Geschenk.
Stefan schlug das Buch auf – nicht etwa eine Erbauungsschrift, sondern ein populäres physikalisch-praktisches Lehrbuch mit vielen Bildern. »Im Wunderland der Technik« von Hans Dominik, Bongs Jugendbücherei. Schön. Aber keine Widmung. Er war nun etwas enttäuscht. »Und wenn ich Sie nun bäte, Herr Professor, Ihren Namen einzuschreiben –« Das Wort blieb ihm fast in der Kehle.
»Bitte, gern.« Mit geheimnisvoller Bereitwilligkeit (was war das nur? Hatte er sich denn ganz verwandelt?) zog der Geistliche eine Füllfeder, trug »Melchior Werder« ein. Dann schien er eine Weile zu überlegen, aber nur ganz kurz, und setzte sofort hinzu: »Für Stefan Rott – zur Erinnerung an ein gutes Werk«.
»Ich möchte etwas fragen …« stockte der Junge. »Damals, als Sie mir den Pasch wegnahmen …«
»Es ist jetzt an mir, um Entschuldigung zu bitten« sagte Werder, mit leichter Neigung des Kopfes.
Wie, der Lehrer errötete vor ihm, dem ertappten Schwindler! Das durfte nicht sein! Da stürzte ja die ganze Welt zusammen. »Ich war zu hart …« fuhr Werder fort.
Für Stefan ging es aber nicht um Härte oder Milde. Es ging um die höchste Logik. Nochmals betrachtete er die Widmung. Zur Erinnerung – an ein »gutes Werk«? Daß es nichts Gutes außerhalb des Glaubens gebe –, so oder ähnlich schwirrte noch die Verurteilung, die er damals aus dem Mund des Verehrten erfahren hatte, um seine Ohren, hatte sich tief eingegraben und war seinem ganzen Denken, ohne daß er es im Einzelnen beachten mochte, seiner »Philosophie der schönen Stellen« gefährlich geworden. Sollte das ein Spiel gewesen sein? Ein Mißverständnis vielleicht? Er wagte eine Frage. »Gewiß, ein Mißverständnis« sagte der Katechet, indem er für einen Moment zu seiner gewohnten Härte zurückfand. Wie ein Verweis klang es fast und wurde sogar wiederholt, als habe Stefan bei einer Prüfung nicht entsprochen: »Ein klares Mißverständnis!« Dann aber schien sich Werder darauf zu besinnen, daß die Fassungskraft des Knaben derartigen Unterscheidungen, an denen die Erinnerung jahrhundertelanger Theologenfehden hing, denn doch nicht gewachsen sei. Er stieß mehrmals mit dem Daumen an seine Oberzähne – eine Gebärde, die Stefan später oft an Professor Werder bemerken sollte, die so etwas wie eine Selbst-Zurechtweisung bedeutete. Gütig (doch nicht mehr so ungekünstelt wie beim Eintritt) explizierte Werder: Die Lehre gehe durchaus nicht dahin, daß es nicht auch vereinzelte Taten gebe, die naturaliter gut – allerdings nur unvollkommen gut seien – sogar unter den Heiden! Diese Taten kämen freilich äußerst selten vor – daher sei im praktischen Leben Mißtrauen aufs Äußerste geboten, Mißtrauen gegen die universa generis humani massa damnata, wie Augustin in seinem »Gottesstaat« die Menschheit als der Verdammnis anheimgegebene Gesamtmasse ebenso traurig wie richtig bezeichnet habe … »Wenn Sie wollen, Rott, können wir einmal mehr darüber reden. Aber nicht jetzt. Erst lassen Sie Ihr Fieber vorübergehen.« Nun war wieder Güte da und erreichte die höchste Wärme in den beglückenden Schlußworten, die tausendmal mehr Geschenk waren als das mitgebrachte Buch: »Werden Sie gesund, Rott, und dann können Sie zu mir kommen, so oft es Ihnen paßt.«
Glaubt er, daß ich mich bei ihm einschmeicheln will? – Das wäre schändlich – von ihm, von mir! Vielleicht weil er jetzt Griechisch definitiv übernommen hat, nicht bloß provisorisch, – weil er jetzt über zwei Klassifikationen im Zeugnis verfügt? – Wie merkwürdig erfreut er war! Glaubt mich jetzt wirklich bei einer Gemeinheit erwischt zu haben. Man sagt ja: wenn er einen Schüler bei einer Schlechtigkeit des Charakters ertappt, dann lächelt er immer so beglückt wie Siegfried, wenn er das Waldvöglein singen hört. Infam ist er … mit seiner ewigen Überlegenheit!
Wenige Wochen nachdem er wieder in die Schule gehen konnte, – seine Krankheit nach dem Eisbad hatte bis fast an den Frühlingsanfang hin gedauert – machte er sich eifrig wie an ein heiliges Werk an eine der Lausbübereien, an denen es auch sonst in seiner Schülerlaufbahn nicht mangelte. Protest gegen die Verhimmlung als »Tugendchef« sprach mit, die Lebensrettungsgeschichte wuchs ihm schon zum Hals heraus. Aber außerdem wollte er diesem Professor Werder zeigen, daß ihm gar nichts daran lag, sich als Schüler mit ihm gutzustellen. Deshalb war er auch seiner Einladung nicht gefolgt; deshalb und wohl auch aus Schüchternheit. Er wollte ihn als erhabenen Menschen »genießen«, sonst gar nichts. – Es war damals eine glückliche Zeit für Stefan, er hatte Recht mit seiner Lebensformel des »Genusses«, er durfte sie anwenden, denn wahrhaftig, er genoß in vollen Zügen, er strahlte vor Dankbarkeit, sehr vieles im Leben erschien ihm zauberhaft, kraftvoll, förderlich, beladen mit geheimnisvollen Hinweisen auf einen großen Sinn des Ganzen, den er wohl noch nicht faßte, der sich aber schon irgendeinmal (dessen war er sicher) deutlicher entschleiern würde. Dabei machte er keine Unterschiede in den Sphären dieser »Genüsse«, gab sich der Jugendwonne hin, die seinen starken Körper wie seinen unverbrauchten aufnahmebereiten Geist durchströmte. Platons Dialoge oder Sport, ein guter Lehrer, der einem neue Ausblicke zeigte, oder ein Spaziergang oder das Über-die-Stränge-Schlagen zusammen mit den Kollegen – alles lag auf derselben Linie, alles, auch das scheinbar Sinnlose, Zuchtlose hatte einen Schimmer begeisternder »Erhabenheit« an sich (womit eben jener Hinweis auf den Sinn der Welt gemeint war). Es war herrlich, lateinische Verse mit ihren kunstvollen Wortumstellungen, Satzglied-Verschraubungen aufzusagen – und es war ebenso herrlich, auf der Promenade Zigaretten zu rauchen, was der Disziplinarordnung strikt widersprach (in der überdies rätselhafterweise auch das Tragen eines Spazierstockes verboten war, wiewohl der Spazierstock wirklich nur ein Minimum an Genuß bedeuten konnte. Welcher Sadist hatte das wohl ausgeklügelt, der schon im Versagen eines so minimalen Genusses Genuß fand?). Aber widersprach etwa irgendein Genuß den Ovidschen und Horazischen Versen, die man auswendig lernte und von denen man aus Begeisterung und nicht bloß, weil es verboten war, auch diejenigen las, die in den gesiebten Schulausgaben ausgelassen waren? Hätte Ovid vielleicht nicht geraucht, falls es damals schon Zigaretten gegeben hätte, und hätte er nicht gerade auf der Promenade geraucht? Und hätte nicht er, gerade er, verbotene Verse mit Elan gelesen? Welch ein Unsinn im Schulschema, das die antiken Klassiker als Leisetreter und Vorzugsknaben vorführt – mit gelegentlichen »Unbesonnenheiten« und »Fehltritten«! Waren sie denn nicht durch und durch großartige Ungetüme, mühsam gezähmte Raufbolde und Abenteurer? – Für Stefan war in dem gewaltigen und nicht sehr detaillierten Überblick jener ersten Erwachensjahre die ganze Erde mit allem, was sich je auf ihr abgespielt hatte, wie ein großer Trichter, in dem regellos brüllende Leidenschaften einander stießen. Man konnte verzagen, wenn man das alles sah, – man konnte sich aber auch mutig hineinstürzen (wie in jenes »Atopon« des Sokrates, das gefährliche Paradox seines Silenengesichts) und dann ging plötzlich alles gut aus, dem Mutigen geschah gar nichts, der Höllentrichter war nur Blendwerk für die Feiglinge und Duckmäuser, die gefoppt werden sollten, während die Helden den Preis davontrugen. Mit solchen Anschauungen war Stefan kraft seiner Talente zwar in allen Fächern der erste, galt auch inoffiziell als »Primus«, offiziell konnte er es nie werden, denn seine Note aus »Sittlichem Betragen« war immer eine recht schlechte. Im Grunde war ihm gerade das recht. Er vereinigte zwei Extreme, die sonst wohl schwerlich vereint gefunden wurden (von Anfang an zeigte sich, was als »Zweigeleisigkeit« Schicksal seines Lebens werden sollte): einerseits Rädelsführer der Klasse bei allen bösen Streichen, die auf eine gewisse Regellosigkeit und Zerrüttung und daher auf einen tiefern, dunklern »Genuß« im Schul-Leben hinzielten, – andererseits an Kenntnissen und billigenswertem Fleiß den Professoren beinahe unheimlich.
Da ist das Bild Werders an die Tafel gemalt, eine Karikatur mit übergroßem Schädel, zerzausten Haarsträhnen – aus den Augen schießen lange Pfeile, durchdringen wie Röntgenstrahlen ein Schülerherz. Das Porträt ist fertig, unverkennbar – rasch mit der roten Kreide, die für die Mathematikstunde bereit liegt, die Haare hervorgehoben. Wenn Herr Werder hereintritt – er kann das nicht dulden, er muß fragen: Wer hat das gemacht? Stefan wird sich melden und mitteilen, daß der Zeichenprofessor zu Studien nach der Natur aufgefordert hat. (Natürlich nicht auf der Schultafel.) Die weiteren Komplikationen nimmt er mit Vergnügen auf sich.
Werder tritt ein, seine Miene ist traurig, ja verdrießlich wie immer. Erwartungskühle Stille. Werder sieht das Bild – er lächelt nicht (ein verlegenes Lächeln, das rasch in Wut übergehen müßte) – er zeigt auch keine Wut. Ruhig beginnt er seinen Vortrag, nimmt die Zeichnung gar nicht zur Kenntnis, und die Klasse ist dazu verurteilt, ihn und neben ihm die gehässige Verzerrung gleichzeitig im Gesichtsfeld zu haben, in einer Vortragspause sagt er dann mit melancholischer Stimme: »Rott Stefan, kommen Sie heraus, nehmen Sie den Schwamm, – so, löschen Sie das weg, – so, ich danke.« Und es wird kein Wort mehr über den Vorfall geredet. Der Angriff ist abgeschlagen; es gibt keinen in der Klasse, der nicht fühlte, daß Stefan besiegt ist. »Christliche Demut« zischt er. Es hilft nichts.
Nach der Stunde spricht er den Professor an, wie damals, nach der Affäre mit dem Pasch. Das heißt: er tritt aus der Bankreihe, will nur etwas sagen, aber Werder läßt ihn gar nicht zu Wort kommen. Ein freundliches Nicken: »Rott Stefan – ich erwarte Sie heute gegen Abend.«
Nun ist es keine Einladung mehr, ist ein Befehl.
Und das war nun jene Zusammenkunft, zu der Stefan von den Tennisplätzen nach Podol unterwegs war. Er stand vor dem kleinstädtischen gelben, da und dort mit schlecht gedeihenden Weinranken bezogenen Haus. Die Straße ungepflastert, staubig. Oben im ersten Stock schepperte die alte Glocke an der weißlackierten Holzgittertür.
Drittes Kapitel
Das Gespräch über Frau Phyllisund die Güter des Lebens
Ich verstehe Sie ja sehr gut« sagt Werder, als die beiden, Lehrer und Schüler, im halbhellen Hofzimmer einander gegenübersitzen. »Sie wollten mir Ihre Unabhängigkeit beweisen. Nicht eigentlich Verachtung, zu der ja kaum ein Anlaß vorhanden ist, – zu der ein Anlaß erst dann vorhanden wäre, wenn Sie mich näher kennen würden …«
Was für ein Ton! Auf alles war Stefan vorbereitet, auf diese plötzlich hervorbrechende, mit schwarzer Leidenschaft ausgestoßene Selbstanklage nicht.
»Ich bitte um Vergebung –« beeilt er sich.
»Darum handelt es sich wirklich nicht. Ich habe Ihnen nichts zu vergeben. Ich gestehe, daß ich dem Kampf nur deshalb ausgewichen bin, weil ich ihn in diesem Moment – gegen den ruhmvollen Helden des Tages – nicht erfolgreich führen könnte.« Schon wieder diese zynische Aufrichtigkeit, die sich selbst, aber damit auch alles andere entwertet. »Oder nur dann erfolgreich, wenn er mich mehr interessierte. Ich habe keine Lust, mich lächerlich zu machen; obwohl mir im Grunde auch daran nichts liegt. Dabei wäre gerade das – vielleicht – das von mir so lang gesuchte, richtige Martyrium: mich auch noch lächerlich zu machen, indem ich eure kleinen Bosheiten ernst nehme. Es ist ein Zufall, daß meine Absichten auf ein anderes Gebiet zielen. Eine Schwäche vielleicht, denn man weiß ja nie genau, wo unsere wahrhaftige Bestimmung liegt. Wir haben nur das winzige Lichtlein unserer Vernunft. Dieses Lichtlein zu gebrauchen sind wir allerdings verpflichtet, bei aller Einschränkung, mit der wir seine Wirksamkeit abmessen mögen. Und das ist auch der eigentliche Grund, weshalb ich Sie hergebeten habe. Ich wollte Sie warnen, Rott, – warnen vor Ihrem Hochmut – ja, Sie sind sehr hochmütig, ebenso hochmütig wie begabt – vor Ihrem Hochmut wollte ich Sie warnen und noch vor etwas anderem: Ihrer bösen Begierde. Sie verstehen schon, was ich meine. Bleiben Sie ruhig sitzen, Rott. Wir sprechen ganz privat. Es geht niemanden etwas an als Sie und mich. Ich rede nicht als Ihr Lehrer, ich spreche als Ihr Freund, Ihr älterer und einigermaßen erfahrener Freund.«
»Ich wüßte nicht, wodurch ich mich hochmütig erwiesen hätte« erwiderte Stefan leise, nicht ganz sicher.
»Das kann ich Ihnen sehr genau sagen, lieber Stefan. Sie glauben nur an sich – an nichts anderes als an sich selbst. Sie sind kein böser, auch kein materiell gesinnter Mensch. Aber Ihnen sind im Grunde nur Ihre eigenen, persönlichen Empfindungen wichtig. Und das ist schlimm. Auf solche Art machen Sie sich Illusionen und verschließen sich der Wahrheit, – ich meine: der einzig richtigen, objektiven, christlichen Wahrheit – Sie entziehen sich den Ausstrahlungen der absoluten Welt Gottes, und die sind wahrlich doch etwas ganz anderes als die lüsternen Spiele Ihres Ich.«
In diesem Augenblick wußte Stefan nicht, daß zum erstenmal in seinem Leben der Grundakkord angeschlagen war, der dann manchmal wie unter Wasser verhallend, manchmal mit stählerner Orchester-Kraft, immer aber deutlich hörbar, sein Leben lang weiterschwingen sollte. Wußte nicht, daß ihm zum erstenmal die Entscheidung vorgelegt wurde, ob er sein innerstes Wesen für bloße private Genußsucht, wenn auch noch so verfeinert, oder für ein wirkliches Erfassen der allgemeinen Wahrheit, allerdings eben im begrenzten Gefäß seines Ich (wie sollte es anders sein) halten durfte und sollte. Dennoch packte den Knaben, wiewohl ein eigentliches Wissen um sein zukünftiges Schicksal sich nicht ankündigte, eine dumpfe Ahnung von der Größe des Moments, eine Ahnung, die sich etwa darin ausdrückte, daß ihm wie mit einem Schlag, wie mit plötzlicher Grelle aus dem Unbestimmten hervortretend, jede Einzelheit des Zimmers, in dem das Gespräch stattfand, unendlich bedeutsam erschien. Schon daß es ein Hofzimmer war, – Ausblick aus den hohen Fenstern nur auf die eisernen Gitterstäbe des Hofbalkons und eine sehr nahe gegenüberliegende schmutziggelbe Hauswand, also kein freier Ausblick auf Straße und »wirkliches« Leben, wie Stefan es liebte, – schon dies Abgesperrte, diese trübe stehende Luft hatte einen besonderen Sinn. Und dazu der ruhige, aber quälende Pendelschlag einer Uhr, das schwarze Kreuz an der kalkweißen Wand, die bescheidenen zwei Bücherreihen, einige Familienbilder in ovalen Rahmen, das mit grünem Rips überzogene schmale Sofa, – alles war schwer und alt und unheimlich ernst wie das zerfurchte Gesicht des Lehrers, sonst durch Gleichgiltigkeit wie mit unsichtbarem Reifenwerk zusammengehalten, jetzt aber staubig zerfallend und fast formlos in seiner tiefen Nachdenklichkeit.
»Wenn zwei Menschen zusammenkommen« sagte Werder mit kalter Bestimmtheit »auf irdische Art zusammenkommen und nicht im Zeichen des Erlösers, kurz also: wenn sie so zusammenkommen, wie wir beide hier zusammensitzen, – dann ist es gut, wenn sie sich von vornherein klar machen, was sie von einander erwarten. Nicht wahr? Damit dann später keine Verwirrung und kein Vorwurf entsteht, – soweit derlei Traurigkeit in unserer bösen Welt sub luna überhaupt auszuschalten ist. Was wollen Sie von mir, Stefan? Was will ich von Ihnen? – In aller Aufrichtigkeit! – Ich bin kein Seelenfänger. Ich gebe Religionsunterricht. Warum ich das tue, tun muß, gehört auf ein anderes Blatt. Aber vielleicht ist es besser, wenn wir auch das gleich besprechen. Ich komme sofort dazu. Nur das eine vorweg: Auf Seelenfang bin ich in meinem Unterricht niemals ausgegangen, das können Sie mir doch bezeugen, nicht wahr, Stefan?«
Stefan senkte zustimmend den Kopf.
»Ich kenne den Durchschnitt der mir anvertrauten Mittelschüler. Kein schlechter Durchschnitt, gewiß. Aber im allgemeinen nicht empfänglich für die Beängstigungen und Nöte eines wahren Christen, für die nur das schreckliche Leiden der Erkenntnis den Geist öffnet. Oft mache ich mir Vorwürfe, daß ich den jungen Menschen, die vor mir sitzen, nichts von dem Wesentlichen des Christentums, nicht das entfernteste Bewußtsein der Dinge, um die es sich handelt, beibringen kann und daß ich trotzdem, dieses Unvermögens ungeachtet, weiterunterrichte – wie ein Pfuscher, der eben nur auf irgendeine beliebige Art seinen Broterwerb sucht. Dabei gehöre ich doch wohl nicht zu denen, die ihre Aufgabe leicht nehmen. Im Gegenteil, ich habe von der Aufgabe ›Religionsunterricht‹ eine so hohe Idee, daß ich sie vielleicht gerade deshalb nicht realisieren kann, ja an ihrer Realisierung verzweifle. Oder glauben Sie, daß es mit einigen historischen Kenntnissen, die ich vermittle, mit einigen ernsten Worten gegen die leichtsinnige sogenannte ›Textkritik‹ getan ist? Das alles berührt ja nicht den Kern. Oder finden Sie etwa, daß es eine persönliche Unfähigkeit von mir ist? Halten Sie mich für einen unbegabten Lehrer? Mache ich meine Sache schlecht?«