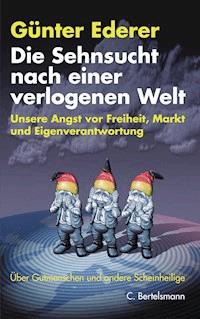9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Berlin Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Brücken werden gesperrt, die Staus immer länger. 53 Milliarden Euro zahlen wir für Mineralöl-, Kfz- und Versicherungssteuer. Trotzdem jammern alle Verkehrsminister, dass sie zu wenig Geld haben. In einer gekonnten Mischung aus Reportage, Fakten und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen geben die Autoren einen Überblick über den Zustand des Verkehrsbetriebs in unserem Land und ziehen eine niederschmetternde Bilanz. Neben bitterbösen Enthüllungen über ein eingefahrenes System der Selbstbedienung und politischer Korruption erzählen sie auch zahlreiche Anekdoten, wie zum Beispiel über die fehlenden Toiletten an neuen Bahnhöfen, oder räumen mit Gerüchten auf wie dem, das Elektroauto sei umweltfreundlich. Das Buch zeigt Lösungen auf, wie der Stillstand beendet werden kann, darunter auch Alternativen aus dem Ausland. Ein leidenschaftliches Plädoyer für mehr Markt und Wettbewerb in der Verkehrspolitik und damit auch für mehr Transparenz und Wirtschaftlichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Berlin Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2014
ISBN 978-3-8270-7742-4
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin 2014
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Karten und Grafik: Jennifer Martin
Typografie: Birgit Thiel, Berlin
Datenkonvertierung: Greiner & Reichel, Köln
»Wir brauchen den effizientesten Verkehr, um uns den umweltschonendsten leisten zu können.«
Prof. Hans-Jürgen Ewers, ehemaliger Präsident
der TU Berlin, Prof. für Infrastrukturpolitik
VORBEMERKUNG
Wir sind zwei Autoren mit sehr unterschiedlichem Hintergrund, was zu unterschiedlichen Schwerpunkten führt. So wurden alle Berechnungen in diesem Buch von Gottfried Ilgmann überprüft oder selbst vorgenommen. Wenn von »wir« die Rede ist, dann handelt es sich um Bewertungen und Recherchen, die wir gemeinsam vorgenommen haben. Bei »ich« geht es um persönliche Erlebnisse von Günter Ederer bei seinen Fernsehproduktionen.
Gottfried Ilgmann hat sich für dieses Buch hauptsächlich um die Themen öffentlicher Nahverkehr, Schienenverkehr und Binnenschifffahrt gekümmert. Für diese Verkehrsbereiche war er jahrelang als Gutachter und wissenschaftlicher Autor tätig.
Günter Ederer hat sich mit dem Straßenverkehr und der Luftfahrt beschäftigt. Bedingt durch seine Arbeit als Wirtschaftspublizist und TV-Produzent, hat er vier Jahrzehnte lang pro Jahr etwa 70000 Kilometer im Auto zurückgelegt und über 1500 Flüge absolviert.
Günter Ederer, Gottfried Ilgmann,
im Juli 2014
VORWORT
Deutschland im Stau – auf der Straße,
der Schiene, zu Wasser und in der Luft
1990 zurück in Deutschland, nach sechs Jahren in Japan, hatte ich völlig verlernt, wie ich mich im Straßenverkehr zu verhalten habe. Ganz einfach, werden Sie sagen: Halte dich an die Regeln, beachte die Schilder und konzentriere dich auf den Verkehr. Wenn es so einfach wäre! In Japan hatte ich mich an die dortigen strengen Vorschriften gewöhnt: auf der Autobahn 80 Stundenkilometer mit wenigen Ausnahmen. Auf gut ausgebauten Nationalstraßen 60 Stundenkilometer und kilometerlanges Überholverbot. Sonst 40 Stundenkilometer. Dazu überall Polizisten oder Radarfallen mit horrenden Gebühren.
Dagegen in Deutschland: mit 100 Stundenkilometern auf der Autobahn ein Verkehrshindernis, auf der Überholspur mit 120 Stundenkilometern Hassobjekt für angehende Formel-1-Fahrer, auf Bundesstraßen ständig wechselnde Gebots- und Verbotsschilder. Bei dem Versuch, mich der deutschen Autofahrkultur wieder anzupassen, hatte ich schnell 14 Punkte in Flensburg, und mein Führerschein war ernsthaft in Gefahr. Alle Punkte stammten von zu schnellem Fahren auf Autobahnen. Ich hatte am Anfang einfach den Bogen nicht raus, wann, wo und warum mal freie Fahrt herrscht und mal nicht. So bei etwa zehn Punkten auf dem Verkehrssünderkonto machte ich dann eine entscheidende Entdeckung: Es ist wichtig zu wissen, welche Parteien in welchen Bundesländern regieren. Bei Rotgrün gibt es mehr Geschwindigkeitsbegrenzungen als bei Schwarzgelb.
Mit 14 Punkten musste ich dann mit zwanzig anderen Sündern an einer Verkehrserziehung von fünfmal vier Stunden teilnehmen, ansonsten hätte ich den Führerschein für eine Zeit lang abgeben müssen. Als Erstes bekamen wir einen schriftlichen Test vorgelegt, der zeigen sollte, auf welchem Stand sich unser theoretisches Wissen befand. Eine Frage lautete: »Worauf muss ich bei den Geschwindigkeitsanzeigen auf der Autobahn achten?« Meine Antwort: »Auf die jeweilige politische Zusammensetzung der Landesregierung.« – »Falsch«, sagte der Fahrlehrer. »Richtig«, sagte ich, »aber vielleicht wollen Sie etwas anderes hören.«
Es entspann sich ein Disput, der die erste vierstündige Sitzung andauerte. Am Ende gab mir der Fahrlehrer recht. Fast mit jedem Regierungswechsel ändern sich die Geschwindigkeitsschilder, so als änderte sich das Gefahrenpotenzial auf einer Straße, nur weil eine andere Partei regiert, was sich in den Unfallstatistiken jedoch noch nicht bemerkbar gemacht hat. Eigentlich eine irrwitzige Vorstellung. Dazu nur ein Beispiel: Unter Rotgrün war die A66 zwischen Wiesbaden und Frankfurt auf 100 Stundenkilometer beschränkt, als die CDU allein regierte, wurde sie freigegeben. Übrigens: Ich habe mich wieder an die deutschen Verhältnisse gewöhnt und bleibe jetzt weitgehend punktefrei.
Das könnte eine launige Geschichte sein, wenn sich dahinter nicht das ganze Dilemma der deutschen Verkehrspolitik verbergen würde. Sie wird von ideologischen und machtpolitischen Entscheidungen geprägt und nicht von sachlichen, volks- und betriebswirtschaftlichen Gegebenheiten. Der subtil ausgetragene Streit um die Geschwindigkeitsbegrenzungen ist fast noch harmlos. Da geht es einerseits um die Vorstellung, mit der der ehemalige hessische Verkehrsminister Florian Rentsch kurz vor seiner Ablösung im Januar 2014 die Freigabe einiger Autobahnabschnitte begründete – er wolle den Autofahrer nicht erziehen, sondern mit Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Gefahrenschwerpunkte aufmerksam machen –, und anderseits um die Fürsorge des Staates für die Umwelt und ein bisschen auch um die Gesundheit des Verkehrsteilnehmers. Diese Sicht setzen meistens die Grünen in Koalitionen durch, an denen sie beteiligt sind. CDU und SPD sind da nicht so festgelegt, eine eigenständige Verkehrspolitik haben sie schon lange nicht mehr.
Viel grundsätzlicher aber ist die Auseinandersetzung »Schiene« gegen »Straße«. Die wird mit harten Bandagen geführt, so wie dies bei Glaubenskriegen immer der Fall ist. Für die Schienenfreunde steht der Umweltschutz im Mittelpunkt – so wie sie ihn definieren: Schiene steht für sie für weniger Energieverbrauch und dadurch mehr Klimaschutz, weniger Landverbrauch und dadurch mehr Artenschutz, mehr öffentlicher Personennahverkehr und dadurch bessere Luft. Vor allem der Slogan »Mehr Güterverkehr auf die Schiene« wird als Alternative zu Lkw-Schlangen, Straßenverschleiß und Staus propagiert.
Vordergründig hört sich das alles sehr gut an, deshalb werden diese Thesen weitgehend von den Massenmedien übernommen. Aber warum funktionieren diese Konzepte nicht, werden sie nicht umgesetzt? Mehr Güterverkehr auf der Schiene bedeutet noch mehr Lärm, der ganze Landstriche Deutschlands fast unbewohnbar macht. Die Kapazität des Schienennetzes ist weitgehend ausgeschöpft. Es gibt da die Berechnung: Zehn Prozent mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene müsste eine Verdopplung des Schienennetzes auf den Hauptverkehrsstrecken nach sich ziehen. Was das bedeutet, ist augenblicklich zwischen Basel und Karlsruhe zu besichtigen, wo sich die Bevölkerung gegen die Ausbaupläne der Deutschen Bahn AG in Dutzenden Bürgerinitiativen wehrt. Das Thema Lärm haben die Schienenfreunde weitgehend ausgeblendet. Und damit die Kosten der Trassen transparent werden, die den Umweltanforderungen entsprechen, haben wir in mehreren Kapiteln nachgerechnet, was die Schienenmobilität wirklich kostet und wer sie zurzeit bezahlt.
Doch auch die Verteidiger des Individualverkehrs haben kein Interesse an transparenten Nutzen-Kosten-Rechnungen. Der ADAC, Jahrzehnte der Repräsentant – andere sagen Lobbyist – der Autofahrer, lehnt vehement eine Mautgebühr ab. Zwar ist der ADAC infolge seiner eigenen intransparenten Machenschaften vorerst keine gute Adresse mehr, wenn es um die Interessenvertretung der Autofans geht, doch reflektiert seine Ablehnung von Straßenbenutzungsgebühren dennoch die Mehrheit der deutschen Autofahrer. Mit der schon an Peinlichkeit kaum zu überbietenden Selbstüberschätzung »Wir Deutsche haben das beste Straßennetz der Welt« übertünchen die jeweiligen Verkehrsminister eine zunehmend marode Infrastruktur und eine bürokratische Misswirtschaft, die Milliarden Euro verschwendet. Wir nennen es Straßenbau nach Gutsherrenart, wobei die feudalen Gutsherren durch sich überschätzende Länderfürsten ersetzt wurden.
Dieser parteipolitisch motivierte Zank auf Kosten der Steuerzahler könnte durch ein transparentes kostendeckendes Verkehrskonzept beendet werden. Ob »Schiene« oder »Straße«, beide Mobilitätsalternativen werden direkt aus Haushalten finanziert, für die zwar theoretisch die strengen Regeln der deutschen Etatvorschriften gelten, die aber im Sumpf aus Bürokratie, Parteiinteressen und Inkompetenz verwischt werden. Mahnungen des Bundes- und der Länderrechnungshöfe und Verschwendungslisten des Bundes der Steuerzahler zeigen regelmäßig, wie mit unseren Steuern umgegangen wird. In diesem Buch rechnen wir vor, wie die Milliarden mal mehr und mal weniger offensichtlich versenkt werden – und das liest sich oft wie eine Satire.
Eines aber wird für die Benutzer von Schiene und Straße deutlich: Mobilität kostet Geld, mehr jedenfalls, als wir bisher bereit sind zu zahlen. Eine zeitgemäße und funktionierende Infrastruktur gibt es nicht zum Nulltarif, auch wenn die Politik diesen Eindruck gern vermittelt. Die generelle Entscheidung, ob die Infrastruktur aus den Haushalten, also durch Steuern bezahlt oder ob sie transparent von den Betreibern durch Gebühren finanziert werden soll, trifft der Wähler, also Sie, die Leser dieses Buches.
Auf einem CDU-Parteitag hörte ich einem Gespräch zu, in dem der Berlin-Korrespondent einer Zeitung einem prominenten Landespolitiker versicherte, dass er gern Steuern zahle, weil er dafür ja auch die S- und U-Bahn preiswert nutzen könne. Das, fand der Politiker, sei eine lobenswerte Einstellung. Mein Einwurf: Wäre es nicht preiswerter, wenn er den kostendeckenden Preis des Tickets zahlte und dafür weniger Steuern? Damit könnte die Durchschleusung seiner Abgaben durch den Apparat eingespart werden. Da antworteten beide wie aus einem Mund: Aber das wäre sozial ungerecht. Schließlich würden ja die Besserverdienenden mehr Steuern zahlen und so die Fahrkarte auch mit subventionieren. Ich versuchte es noch einmal mit dem Status des Hauptstadtkorrespondenten. Er gehöre ja wohl zu den Besserverdienenden und würde so von dem verbilligten Nahverkehr profitieren. Für verbilligte Tickets sei das Sozialamt zuständig, aber nicht die S- und U-Bahn. Doch da die ja auch dem Staat und der Stadt gehörten, sei dies ja egal, stellte der Politiker fest. Ende der Unterhaltung.
Ja, es ist egal, ob die Brücken bröseln, wir im Stau stehen, die Bahnen verspätet sind, die Klimaanlage in den ICE-Zügen im Sommer nicht kühlt, im Winter die Heizung nicht funktioniert, es vierzig Jahre dauert, bis eine Autobahnlücke geschlossen wird, der Güterzuglärm ganze Täler entvölkert. In Deutschland ist immer der Staat der verantwortliche Unternehmer, und deshalb lassen sich die chaotischen Verhältnisse in der Verkehrspolitik auch auf einen kurzen Nenner bringen: Sie dokumentieren das große Staatsversagen.
Zurzeit regen sich die Deutschen über zwei Projekte besonders auf, die das große Staatsversagen, den eigentlichen Systemfehler der deutschen Verkehrspolitik, auch für den ansonsten nicht so informierten Bürger deutlich machen. Das ist das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 und der neue Flughafen Berlin Brandenburg. So unterschiedlich sie auch sein mögen, eines haben sie gemeinsam: Sie werden ohne eine transparente Nutzen-Kosten-Bewertung geplant und dann mit unwahren politischen Versprechungen durchgezogen, und sie werden von Staatsbediensteten gemanagt, die für die Milliardenverluste nicht aufkommen müssen.
Während wir dieses Kapitel schreiben, überschlägt sich die Posse um den Berliner Flughafen gerade wieder in einer weiteren Volte, die keinem noch so verwirrten Drehbuchautor einfallen würde. Der neue brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke wünscht, dass der Aufsichtsrat über seinen Vorstoß entscheidet, dass der Flughafen freiwillig auf den Flugbetrieb zwischen 5 und 6 Uhr morgens verzichtet. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende ist der Vertreter des Landes Brandenburg, Staatssekretär Rainer Bretschneider, der am 13. August 2004 in Potsdam den Planfeststellungsbeschluss verkündete – der unter seiner Verantwortung erstellt worden war. Darin ist alles detailliert geregelt, vom Lärmschutz über die Zahl der Flugbewegungen, das Passagieraufkommen und die Ausbaubegrenzung. Und daraus geht auch hervor, dass eine weitere Verkürzung der Nutzungsmöglichkeit des Flughafens seine Rentabilität gefährdet.
Also: Das Land Brandenburg erlaubt einen Flughafenbau, der den Bürgern aus Lärmgründen nicht zumutbar ist, und will das korrigieren, wodurch dauerhafte Zuschusskosten produziert werden. Die Verantwortlichen sind mal für und mal gegen dasselbe Projekt. Bei der Bekanntgabe des Planfeststellungsbeschlusses reagierte der damalige Ministerpräsident Matthias Platzeck auf die Frage eines Journalisten nach den Kosten noch patzig: Über Geld rede er bei dem Projekt nicht – sagte es und verließ die Pressekonferenz. Heute redet die ganze Republik über die Kosten des peinlichsten Flughafens der Welt in Berlin-Schönefeld. Auch wir werden darüber schreiben. Dabei ist es unvermeidlich, das Hickhack der Länder im deutschen Luftverkehr mit zu beleuchten. Diese Wachstumsbranche droht bei uns zwischen Prestigeprojekten von Kassel bis Zweibrücken im provinziellen Sumpf zu versacken.
Die zweite deprimierende Meldung während des Schreibens dieses Buches im April 2014 kam aus dem Norden. Dort leidet die meistbefahrene Wasserstraße der Welt, der Nord-Ostsee-Kanal, darunter, dass er in Deutschland liegt und deshalb, wie alle unsere Verkehrsadern, vor sich hin vergammelt. Als er 1895 nach nur achtjähriger Bauzeit eingeweiht wurde, zeugte er von der Fähigkeit deutscher Ingenieursleistung. 156 Millionen Goldmark hat er gekostet und blieb damit genau im vorkalkulierten Rahmen. Heute ist ein Besuch der Schleusen in Brunsbüttelkoog ein Erlebnis, vor allem für die Liebhaber von Industriemuseen. Die Schleusenkammern aus der Kaiserzeit sind noch immer im Dienst, wenn auch zunehmend mit Auszeiten für Reparaturen, die dann Vollsperrungen nach sich ziehen, wenn beide Kammern gesperrt werden müssen. Dann fahren die Schiffe wieder um Dänemark herum.
Um die bestehenden Museumsstücke erneuern zu können, muss eine weitere Schleuse gebaut werden. 2007 wurden die Kosten dafür auf 220 Millionen Euro beziffert, aber nicht mit dem Bau begonnen. 2012 dann die Meldung: Es gibt grünes Licht für den Bau der fünften Schleusenkammer. Dies verkündete der CDU-Abgeordnete im Haushaltsausschuss, Norbert Brackmann, der dem Fraktionschef Volker Kauder dankte, weil er seine Hilfe zugesichert hatte. Also: Nicht die wirtschaftliche Notwendigkeit war der Anlass, den Kanal zu sanieren, sondern das Beziehungsgeflecht der CDU. 300 Millionen Euro sollte die Schleuse kosten, aber nichts geschah.
April 2014: Der Bundesrechnungshof stoppt die Genehmigung für den Bau der fünften Schleuse. Zu teuer, zu unwirtschaftlich, sagen die Prüfer, denn mittlerweile haben die 540 Millionen Euro errechnet. Darüber hinaus fühlen sie sich hintergangen: Das Verkehrsressort habe den Nutzen des Bauvorhabens überschätzt, weil das Ministerium davon ausgeht, der Kanal sei bis Kiel schon ausgebaut und würde deshalb mehr Schiffe anziehen. Doch damit wurde noch nicht einmal begonnen, und er würde frühestens 2024 fertig sein. Wir reiben uns ungläubig die Augen: Ist es denn nicht mehr möglich, in Deutschland ein Verkehrsprojekt von überragender internationaler Bedeutung so zu planen und zu kalkulieren, dass es in einem überschaubaren Zeitraum zu realistischen Kosten auch umgesetzt werden kann?
Und was ist die Alternative zu einer Reparatur der Schleusen: die Aufgabe des Nord-Ostsee-Kanals? Wenn die Politik es nicht kann, dann sollte der Kanal vielleicht an ein internationales Konsortium verkauft werden, der die meistbefahrene Wasserstraße der Welt unterhält, betreibt und die Gebühren einkassiert. Da ist nämlich noch Luft. Die knapp 100 Kilometer lange Durchfahrt von Kiel nach Brunsbüttel kostete 2009 im Durchschnitt nur 5437 Euro, die etwa gleich lange Durchfahrt durch den Panamakanal 80550 Euro.
Ähnlich wie der Berliner Flughafen der Anlass war, sich mit dem Luftverkehr in Deutschland zu beschäftigen, ist die peinliche Teilsperrung des Nord-Ostsee-Kanals Aufhänger, sich mit den Bundeswasserstraßen zu beschäftigen. Und Sie werden sicher nicht überrascht sein, wenn wir dabei feststellen, dass es auf dem Wasser nicht viel anders zugeht als auf der Straße, der Schiene und in der Luft.
»Deutschland im Stau« – damit sind nicht nur die 830000 Kilometer gemeint, die die Autofahrer jährlich im Stau stehen, sondern auch der Zeitverlust an Arbeits- und Kapitalproduktivität, der uns alle belastet. Deutschland befindet sich in einem mentalen Stau, lähmt sich durch seine eigenen gesetzlichen Vorgaben, seine eigenen ideologischen Vorstellungen. Und eine Überzeugung ist dabei besonders gefährlich und schädlich: Wir halten uns auch noch für die Größten, machen uns gern zum Maßstab für die Welt. Doch wie lange können wir uns noch eine Verkehrspolitik leisten, die Jahr für Jahr Milliarden verschluckt? Dieses Buch will zeigen, dass es auch anders geht.
I. STRASSE
Straßen: Adern des Wohlstands
Wenn es um die Verkehrspolitik geht, werden die hitzigsten Debatten in Deutschland zwar seit einigen Jahren über den Bahnhof Stuttgart 21 und den neuen Berliner Flughafen geführt – also um ein Schienen- und ein Luftfahrtprojekt. Wir beginnen trotzdem mit dem Verkehr auf der Straße. Denn, wie sehr sich die offizielle Politik auch bemüht, mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene und mehr Autofahrer in den öffentlichen Nahverkehr umzuleiten, es hat alles nichts gebracht: Deutschlands Straßenverkehrsinfrastruktur bestimmt die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft und erfüllt die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen, und das ist sicher eine ärgerliche Botschaft für alle Straßen- und Autogegner. Daran wird sich auch noch in einigen Generationen nichts ändern.
Wer nicht durch ideologische Scheuklappen behindert ist, kann dies an wenigen Zahlen ablesen: In Deutschland haben wir 413000 Kilometer Gemeindestraßen, 91000 Kilometer Kreisstraßen, 86600 Kilometer Landstraßen, 39700 Kilometer Bundesstraßen und 12800 Kilometer Autobahnen. Denen steht ein Schienennetz von 37700 Kilometern entgegen. Das Straßennetz ermöglicht es vielen Bürgern unseres Staates, direkt von ihrem Standort abzufahren und bis zu ihrem Ziel ohne Umsteigen die Straße zu nutzen. Natürlich kann der Bürger kleine Entfernungen zu Fuß und mittlere Distanzen mit dem Fahrrad erledigen. Aber die Unabhängigkeit vom Wetter, die Zeitersparnis durch die Geschwindigkeit haben Vorteile, die dazu führen, dass sich die Zahl der Pkw vom Jahr 2000 bis 2012 um 12 Prozent erhöht und sich der Anteil des motorisierten Verkehrs mit 85 Prozent an der gesamten Verkehrsleistung seit 1994 nicht verändert hat.
Bei den vielen beruflich bedingten Reisen in allen Kontinenten ist uns nirgendwo so eine Anti-Straßen-Haltung aufgefallen wie in Deutschland. Überall, sowohl in armen Entwicklungsländern wie Indonesien als auch in hochindustrialisierten Staaten wie Japan, wird der Ausbau von Straßen gefördert, um Regionen für den Handel zu erschließen oder die unproduktiven Stauzeiten zu verringern. Beide Aspekte spielen bei uns nur eine untergeordnete Rolle. Dafür haben wir Projekte kennengelernt, die den Verkehr behindern und den Lästigkeitswert der Straße erhöhen. Es geht nicht etwa darum, den Lärm zu vermindern, den Verkehr flüssiger zu organisieren, um die Abgaswerte zu senken, nein, der Straßenbenutzer soll vergrault werden. Irgendetwas stimmt bei uns nicht.
Sicher kennen Sie auch die Schlagzeilen von der Betonierung und Versiegelung des Landes durch die Straßen, wobei dieses Argument vor allem beim Bau von Autobahnen strapaziert wird. Um gleich noch mit ein paar Zahlen die Irrationalität des Anti-Straßen-Kampfes zu unterstreichen, hier die offiziellen Statistiken der Bundesrepublik Deutschland (Zahlen von 2010): 0,08 Prozent der Fläche werden für Autobahnen genutzt, 0,10 Prozent für Bundes- und Landesstraßen, und wenn alle Straßen, also auch die Gemeinde- und Stadtstraßen, dazuaddiert werden, kommen wir auf 1,23 Prozent. Alle Autobahnergänzungen und zusätzlichen Umgehungsstraßen zusammen benötigen noch einmal 0,01 bis 0,02 Prozent der 35167,94 Quadratkilometer. Deshalb noch einmal: Die angebliche Versiegelung Deutschlands durch den Autobahnbau betrifft 0,08 Prozent der Fläche. Verblüffend ist höchstens, wie sich Propagandasprüche im öffentlichen Bewusstsein festsetzen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!