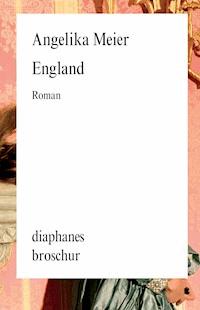19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diaphanes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Literatur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Lässt es sich in einem Totenhaus nicht vielleicht noch am besten leben? Nur ein paar Wochen hatte Odra Decker im Haus ihrer Kindheit bleiben wollen, um es aufzulösen. Doch nun ist seit dem Tod des Vaters schon der zweite herrliche Sommer ins Land gegangen, und noch immer ist nichts geschehen. Völlig bewegungsunfähig holt sie den ihr gänzlich unbekannten Josef von Házy ins Haus, der als ihr Sekretär an ihrer Stelle handeln soll. Der lernt jedoch schnell, der dritte im Bunde zu sein, sich ebenso mit der erstarrten Tochter wie mit dem Geist des toten Vaters – einem Kunsthistoriker, der an der deutschen Vergangenheit verzweifelt war – zu arrangieren. Statt es aufzulösen, nisten sich die beiden ein im Hause Decker, in dem doch eigentlich nicht länger gelebt werden kann. Und so droht das listige Haus, seine neuen Bewohner selbst aufs Angenehmste aufzulösen.
Eine Geschichte von Niedergang und Neuanfang, und von der tragikomischen Unmöglichkeit, der Vergangenheit zu entfliehen. Leicht und sanft delirierend wie ein Sommertag im Liegestuhl, irreal und schwermütig, getragen von einem hintergründigen, aber unerbittlichen Humor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Ähnliche
Die Auflösung des Hauses Decker
Angelika Meier
Die Auflösung des Hauses Decker
Roman
DIAPHANES
Die Arbeit an diesem Buch wurde gefördert
durch ein Stipendium der Stiftung Preußische Seehandlung
1. Auflage 2021
© DIAPHANES, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-0358-0453-9
Umschlagzeichnung: Johannes Pilz
Satz und Layout: 2edit, Zürich
Druck: Steinmeier, Deiningen
www.diaphanes.net
Jede Beschmutzung kann ich ertragen, nur die bürgerliche nicht.
Ist das nicht seltsam?
Ludwig Wittgenstein
Inhalt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
„Gleich morgen, wenn Sie wollen.“
Nun wird ja großer Eifer häufig als Übereifer und damit als unfreiwillige Anzeige einer ausgewachsenen Verzweiflung gedeutet, und daher biss ich mir sogleich auf die Zunge, doch zum Glück willigte sie verhalten lächelnd ein:
„Schön, dann kommen Sie gleich morgen um dieselbe Zeit.“
Ansonsten keine Geste des Entgegenkommens, unbewegt blieb sie, noch immer mit verschränkten Armen, in diesem ihr anscheinend unbedingt gebührenden weiten Abstand zu mir vor ihrem großen, chaotisch überhäuften und obendrein ziemlich verdreckt wirkenden Metallschreibtisch stehen und nickte bloß abschließend. Meine Anstellung war ihr wohl nicht oder zumindest noch nicht der Besiegelung durch einen Handschlag wert, und so erhob ich mich zögernd und zog mich mit einem diskreten Gruß zurück, um nicht diese meine neue Sekretärsstellung, kaum in den Vorstellungskreis des Möglichen getreten, durch lästige Nachfragen gleich wieder zu gefährden. Doch auf der knarzenden Türschwelle angelangt, wurde ich noch einmal zurückgerufen.
„Ach, und… ähm, Herr von Házy“, auf einmal saß sie nun an ihrem Schreibtisch und blätterte ohne aufzublicken in einem Stapel Papier herum, „versuchen Sie, Ihr Drogenproblem oder was immer es ist in den Griff zu kriegen. Wir werden es sonst nicht weit bringen zusammen, und das wäre doch schade, nicht wahr?“
Ich weiß nicht mehr wie, ja ob ich darauf überhaupt reagiert habe, erinnere mich nur, wie ich den kurzen Fußweg zurückhetzte in die Domstuben, ein freundliches, aber nach fleischigem Schankraum stinkendes kleines Hotel, das einzige am Ort und an eben diesem gänzlich deplatziert, handelte es sich doch hier um eine gehobene Kleinstadt, genauer einen recht wohlhabenden, außerhalb und hübsch im Grünen gelegenen Teil einer ansonsten ausgesprochen hässlichen Ruhrgebietsstadt. Dem hinter seiner Theke Gläser polierenden Wirt teilte ich mit, ich bliebe noch eine Nacht länger, was dieser mit einem gleichgültigen Nicken quittierte, als sei ihm das ohnehin klar gewesen.
Auf meinem Zimmer pflanzte ich mich als unschöne Mulde in die Mitte der viel zu dicken Bettdecke und verbarg eilig meine Ohren unter dem voluminösen Noise-Cancelling-Kopfhörer, der freilich nur so heißt, denn tatsächlich gecancellt wird der Noise leider nicht, aber immerhin doch gedämpft. Die Frage meiner Unterbringung hatte sie gar nicht angeschnitten, nur mit einem desinteressierten Ach so zur Kenntnis genommen, dass ich für das Vorstellungsgespräch extra aus München angereist gekommen war. Noch eine Nacht konnte ich bezahlen, aber dann würde es eng werden, und ich wusste nicht, wie schnell sich hier ein bezahlbares Zimmer finden ließ, in jedem Fall müsste ich sie wohl unangenehmerweise gleich morgen um einen Vorschuss bitten.
Den Rest des Tages verbrachte ich, wenn auch in meinem grauen Flanellanzug etwas zu warm gekleidet, als Urlauber in der Nachsommerfrische, spazierte an der silbern schimmernden Ruhr entlang, die hier eigentlich gar kein Fluss, sondern ein riesiger Stausee war, blinzelte auf der Wehrbrücke verweilend ins schon etwas diesige Spätseptemberlicht, ließ mich vom Rauschen des künstlich fallenden Wassers einlullen und wunderte mich unterschwellig ein wenig über den arg fischigen Gestank des Wassers. Erst als ich auf der anderen Uferseite weiterlief, vorbei an einem ein Segel nachbildenden Regattatürmchen aus den Sechzigerjahren, an welchem seltsamerweise ein Dutzend große, runde Uhren angebracht waren, deren Zeiger alle in unterschiedlichem Tempo mal vorwärts mal rückwärts kreisten, was vermutlich einem künstlerischen Zweck diente, stellte ich fest, dass der silbrige Schleier auf der Oberfläche des Wassers von lauter kleinen toten Fischen herrührte.
Lange blieb ich auf den gräulichen Holzbohlen am Segelbootanleger stehen, in die Anschauung der unzähligen Fischleichen versunken, bis eine alte Frau neben mich trat und mir unvermittelt erklärte, dass die Fische alle tot seien wegen der ungewöhnlichen Hitze des vergangenen, im Grunde noch immer nicht vergangenen, ja vielleicht sogar endlosen Sommers. Das Wasser hätte sich so sehr erwärmt, dass es die Fische quasi gekocht hätte, oder nein, das wohl nicht, eher einen Hitzschlag hätten sie erlitten, sowas habe sie noch nie erlebt, und ich nickte betroffen, denn sowas hatte ich auch noch nie erlebt. Traurig fände sie vor allem, dass dies nicht der See Genezareth war, wo Jesus mit einer großen, aber doch wahrscheinlich deutlich geringeren Menge von Fischen fünftausend Menschen genährt hatte, während diese Fische hier niemanden sättigten, sondern vollkommen sinnlos verrotteten. Wieder nickte ich betroffen, doch dann lachte sie plötzlich aufheiternd:
„Kommen Sie, junger Mann, zur Entschuldigung für diese düsteren Betrachtungen lade ich Sie zum Essen ein, das Restaurant da drüben serviert einen passablen Zander.“
Nach einigem höflichen Ablehnen willigte ich dankbar ein, und während ich mich noch fragte, ob die alte Frau mir wohl angesehen haben konnte, dass ich hungrig war, mir aber ungeachtet meiner tadellos feinen Kleidung kein Essen leisten konnte, hatten wir trotz des langsamen, leicht hinkenden Gangs der Frau den Weg zurück über das Wehr und in das Gasthaus bereits absolviert, und ich ließ mir das gute Zanderfilet und obendrein ein Glas Riesling, große Lage, schmecken.
Ihr ganzes Leben hatte die alte Frau hier verbracht, jeden hiesigen Stock und jeden Stein kannte sie, aber die Leute seien wie überall und daher gäb’s darüber nichts groß zu erzählen, sie lebten alle so dahin, selbst das Verschwinden der Kohle habe für die Menschen keinen wirklichen Einschnitt bedeutet, in den Gruben gearbeitet habe ohnehin so gut wie niemand von hier, aber sie sei als junges Mädchen noch dort oben in der Villa auf dem Hügel, mit ausgestrecktem Zeigefinger machte sie eine unbestimmte Geste schräg hinter ihren Kopf, ein- und ausgegangen, damals sei sie mit den Kindern der hohen Familie befreundet gewesen. Aber das zähle nicht mehr. Interessant sei jedoch, was jetzt mit der Gegend geschähe, wo alle Welt nach draußen wolle in die Freizeit, keinen halte es mehr daheim, jeder wolle in jeder freien Minute auf das Fahrrad oder auf das Boot, und dass all diese Menschen nun sichtbar würden, statt an ihren heimischen Herden und ihren Stammtischen hocken zu bleiben, das sei ein großes, kaum zu bewältigendes Problem.
Mein zufriedener Magen hörte ihr gerne zu, und auch der Blick wollte ausruhen in dem runden, freundlich geknitterten, an keiner Stelle bitteren Gesicht mit den kornblumenblauen Augen darin. Dankbar, dass sie mich auf meine Auskunft hin, ab heute sei ich der Sekretär von Odra Decker, nicht weiter ausgehorcht, nur mit einem angedeuteten Schulterzucken gemurmelt hatte, ach ja, die Tochter vom alten Decker, verabschiedete ich mich von ihr, und beide drückten wir die Hoffnung aus, uns bald wieder an diesem Ufer oder dem andern zu begegnen. Abends bloß ein paar Tropfen Tramadol, und zum Einschlafen trotz des Lärms aus dem Speiseraum nur ganz leise die Diabelli-Variationen.
Am nächsten Morgen trat ich kräftig meine neue Stelle an, lediglich kurz gekränkt, dass mich meine Arbeitgeberin nicht wie gestern elegant gekleidet, sondern in einer schwarzen Adidas-Hose, einem verwaschenen grünen Pullover, speckigen Wildlederstiefeln, und, der leichten Filzigkeit ihrer hellbraunen Locken nach zu urteilen, ungeduscht empfing. Doch ich ließ mir meine Verstimmung nicht anmerken, nahm stattdessen den Kaffeebecher, den sie mir gähnend aus der Küche nach unten in die Bibliothek brachte, freundlich lächelnd entgegen.
Da sie nichts sagte, mir keine Aufgabe gab, was ich als Prüfung meiner Eigeninitiative deutete, nahm ich hastig ein, zwei große Schlucke Kaffee, um ihr dann beherzt vorzuschlagen:
„Und, soll ich mich vielleicht als Erstes an die Ordnung der Bibliothek machen? Denn gut geordnet ist ja halb verkauft, oder? All das inventarisier ich Ihnen im Handumdrehen.“
Schon stürzte ich an eins der himmelhohen Eichenregale, rupfte ein erstbestes Buch aus seinem verstaubten Schuber, den es sich mit drei Geschwistern teilte. Na, wer sagt’s denn, damit ließe sich doch ein Anfang machen, Eugène Sues Mystères de Paris, hübsch illustrierte Ausgabe von 1848, schöne braune Halbledereinbände, die Intarsien auf den Rücken vollkommen unbeschädigt, und auch das Innere in erstaunlich gutem Zustand, kaum vergilbt, ungelesen, dafür ließe sich einiges verlangen.
Doch sie schüttelte bloß abschätzig den Kopf, ließ den Blick missmutig an den Regalen auf und ab wandern und murmelte, dass der Sue, da es sich nun mal nicht um die 1843er-Ausgabe handele, praktisch wertlos sei, und dass ihr Vater diese Unsinnsbücher auch lediglich aus der Bibliothek wiederum seines Vaters in die eigene übernommen habe, weil ein paar der Illustrationen darin von Honoré Daumier seien, wobei sie dazu sagen müsse, dass ihr Vater diese Holzschnitte eigentlich nie sonderlich interessant gefunden habe, sondern Daumier, wie wohl die meisten der an Daumier Interessierten, weniger wegen seines graphischen Werks als für seine im besten Sinne anachronistische Malerei geschätzt habe. Eigentlich nur wegen Daumiers Don-Quijote-Bildern habe ihr Vater diese Sue-Bände aufgehoben, was bei Lichte und damit bei reichlich Staub betrachtet kein guter Grund sei. Und überhaupt: Vergessen Sie die Bibliothek, darum kümmert sich ein Antiquar. Dieser habe ihr bereits schonungslos beigebracht, dass er ihr nur einen Bruchteil der Bücher abkaufen könne, den großen Rest dafür aber für sie in den Papiercontainer entsorgen werde, eine Aussicht, die sie ein paar Wochen lang gequält, dann aber außerordentlich erleichtert habe. Ich wollte protestieren, wenigstens die Großen vor dem Verderben retten, doch sie lächelte ungerührt:
„Ist doch halb so schlimm, immerhin ist der Müllhaufen der Geschichte heutzutage ein Recyclinghof.“
Bevor ich mich weiter für Daumier oder Don Quijote verwenden konnte, wechselte sie mit einem Fingerzeig auf meine Reisetasche, die ich unbeholfen oder vielleicht eher etwas demonstrativ hatte im Weg herumstehen lassen, das Thema:
„Ach ja, wir haben Ihre Unterbringung noch gar nicht geklärt. Sie werden selbstverständlich hier wohnen, oben unterm Dach, kommen Sie, ich zeig’s Ihnen.“
Jetzt erst nahm ich das imposant großzügige Treppenhaus wahr. Auf dem Weg die zweieinhalb Stockwerke nach oben über eine hübsch geschwungene, kunstvoll gedrechselte, rücksichtsloserweise aber vor langer Zeit grau lackierte und obendrein nikotingelb verfärbte Treppe erklärte sie mir, hin und wieder vage über ihre Schulter herabschauend, dass die drei kleinen Räume mit Bad und Küche dort oben eine eigene Einliegerwohnung bildeten, in der früher Studenten gewohnt hätten, im Moment aber leider nur noch einer der drei Räume bewohnbar sei, da die beiden anderen mit Kartons, Möbeln und allem möglichen anderen Zeug vollgestopft seien.
Die Küche war ein offener, behaglich verwinkelter Raum, karg eingerichtet entlang dreier freistehender Balken des Dachgestühls. Das gelblich gekachelte Duschbad war etwas angejahrt, aber hell, und auch das eigentliche Zimmer genügte vollkommen meinen Ansprüchen. Ein schmales Bett mit Nachttischchen und einem grellorangenen Lämpchen darauf, ein bescheidener Schreibtisch und ein Kleiderschrank, alles hässliche, aber ordentliche Möbel, und vor allem gab es ein großes Kippfenster in der Dachschräge. Eine kleine sonnige Welt.
„Ist das in Ordnung? Ganz hübsch eigentlich, oder? Etwas staubig, aber ich werd der Putzfrau Bescheid geben, dass sie das gleich morgen hier auf Vordermann bringt. Die Küche und das Bad mal ordentlich schrubben. Neuen Duschkopf, was? Ganz verkalkt. Und neue Bettdecke und neues Kissen soll sie auch kaufen gehen, Bettwäsche und Handtücher leg ich Ihnen nachher hin, ich hoffe, bis morgen geht das so?“
Ich beeilte mich, ihr zu sagen, dass alles perfekt sei, doch sie wanderte unruhig durch die Räume, ihre Stiefeltritte hallten laut auf dem Dielenboden, und dabei nickte sie unentschieden vor sich hin, als sei sie unzufrieden, unklar, ob mit dem Zustand der Wohnung oder meiner Zufriedenheit mit dieser.
Dann ging es wieder hinab, trottete ich erneut hinter ihr her. Die Treppenstufen zwischen erstem Stock und Dachgeschoss waren deutlich steiler als die, die in das Zwischengeschoss und in den ersten Stock führten. Dort, auf den beiden Geschossen, wurde die Treppe durch so großzügige Absätze unterbrochen, dass man auf ihnen verweilen mochte wie auf einem freien Plateau. Auf dem Podest des Zwischengeschosses, das aus nur einem Zimmer bestand, gab zudem ein riesiges Flügelfenster den Blick nach draußen frei, bezaubernd eingerahmt von der die ganze Rückseite des Hauses umrankenden uralten Glyzinie, und von diesem Absatz führten wie in einem englischen neogotischen Landhaus drei eigene, breite Treppenstufen hinauf zu dem separierten Zimmer, das, wie ich später erfuhr, Odra Decker als Schlafraum diente.
Doch hier oben glitt der Fuß von dem winzigen Treppenabsatz nahezu ankündigungslos auf die steile Treppe hinab, und Odra Decker murmelte, über ihre Schulter diesmal unbestimmt zu mir hinaufschauend:
„Allzu betrunken oder was auch immer sollte man hier lieber nicht sein.“
Wobei sie selbst, wie sie sogleich, vielleicht um die möglicherweise sogar unbeabsichtigte Spitze gegen mich zu mildern, hinzufügte, diese Treppe freilich in jedem Zustand meistern könne, blind, ohne jemals auch nur zu stolpern, denn wenn man eine solche Treppe von der frühesten Kindheit an immerzu hinauf- und hinabgerannt, gehopst oder müde geschlurft sei, bewege man sich traumwandlerisch auf ihr, ja traumwandelte man tatsächlich, sobald man auf ihr liefe, da der Körper von den Fußsohlen aus jede dieser Stufen auswendig kenne, sich die Windungen der Treppe in die noch weichen Hirnwindungen hineinverwachsen hätten. Auf einer solchen Treppe könne man nicht mehr fallen. Aber das sei natürlich banal, ginge es doch jedem Menschen mit den Treppen in seinem Geburtshaus so.
Ich wollte sie fragen, ob es ihr nicht schwerfalle, das Haus aufzugeben, aber dies erschien mir, obgleich es doch der ganz natürliche Gesprächsanschluss gewesen wäre, als ungebührliche Frage, vielleicht ahnte ich da schon, dass es hier ein wenig problematischer sein könnte, das Elternhaus auszuräumen als normalerweise, und sie möglicherweise nicht einfach mit dem üblichen sentimentalen Seufzer darauf reagieren könnte, Ja, es hängen ja auch so viele Erinnerungen daran, was man eben so sagt, wenn es einem in Wirklichkeit gar nicht sonderlich schwerfällt, sofern der Verkaufspreis stimmt. Daher schwieg ich lieber, auf die Gefahr hin, für verstockt oder ignorant befunden zu werden. Doch als erahnte sie meine Skrupel, sagte sie, wieder unten in der Bibliothek angelangt, mit Blick auf den überhäuften, verdreckten Schreibtisch:
„Mein Vater war ein guter Mensch.“
Was soll man da sagen? Eine solche Aussage ist von einem Sekretär nicht zu kommentieren, er hat hier nicht einmal beipflichtend zu nicken. Nichts kann man da sagen und auch nichts tun, wenn die Dinge so liegen. Aber wie sie da lagen, unbewältigt haufenweise auf diesem Schreibtisch, und zu allem Überfluss nun übergossen von schönstem Vormittagssonnenlicht, wodurch der um all die blassen Papiere, vergilbten Zeitungen und ausgeblichen bunten Pappaktenordner herumtanzende Staub an etwas außerirdisch Kosmisches im eigenen Augenlicht gemahnte, das erschien mir plötzlich so unerträglich, dass ich anstelle des angemessen mitfühlenden Nickens fragte:
„Sollte ich nicht als allererstes den Schreibtisch aufräumen? Jetzt gleich, würde ich vorschlagen.“
Empört starrte sie mich an, die dunkelgrünen, im Sonnenlicht auf einmal durchscheinend hellen Augen weit aufgerissen, doch umso unerschrockener schickte ich mich an, ihr die Sache auseinanderzusetzen: Da ich schließlich, anders als sie selbst, die Ordnung der Unordnung auf diesem Schreibtisch nicht im Mindesten verstünde, wäre es für mich ein Leichtes und daher geradezu eine Menschenpflicht, in dieses Chaos das zu bringen, was man gemeinhin Ordnung nennt, etwas, das in ihren Augen wahrscheinlich nichts anderes sein könne als eine grauenhafte Zerstörung, ja Vernichtung dieser im Laufe der Jahrzehnte ganz organisch gewordenen Papiergebilde, aber wie sie sicherlich wisse, sei die völlige Vernichtung nun einmal der einzige Weg, die Sache überhaupt anzurühren. Natürlich aber bestünde, so beeilte ich mich einzuräumen, immer auch die Möglichkeit, alles zu lassen, wie es ist, im Zweifel sollte man sich wohl daran halten, genau so, für immer, und dabei zog ich mein Telefon aus der Tasche und begann den Schreibtisch zu fotografieren, trat mit jedem Foto ein wenig näher an ihn heran, mit Ausfallschritten nach links und rechts, nahm verschiedenste Blickwinkel auf diese Landschaft aus Papier, Pappe, Plastikordnern, Zigarettenasche, Bleistiftstummeln, Kugelschreibern ein, welche mir sämtlich den Eindruck vermittelten, der ganze Berg sei von der Handschrift des Besitzers, die sich auf unzähligen Zetteln fand, überschrieben, und als ich schließlich jede Ansicht dieser Welt erfasst zu haben glaubte, wiederholte ich aufmunternd:
„Ja, also, wir können auch alles lassen, wie es ist.“
Wortlos verließ sie den Raum, kam aber kurz darauf mit einer Rolle blauer Müllsäcke zurück, die sie mir mit ausgestrecktem Arm wie ein Staffelholz übergab:
„Ich… bin dann oben…, wenn Sie fertig sind…“
Ein pietätloserer Mensch hätte wohl schleunigst von seinem Unterarm Gebrauch gemacht, alles flugs vom Schreibtisch hinuntergeschoben, unbesehen in die Säcke hineinfallen lassen. Ich hingegen griff die Papiere in einzelnen Häufchen, so wie sie sich mir darboten, schob und klopfte sie ineinander zu kleinen, wenn auch durch die vielen verschiedenen Formate sehr unregelmäßigen Stapeln, beglaubigte also ihr vollkommen sinnloses Aufeinandertreffen als vernünftige Ordnung, blies und wischte von ihnen, darüber schon bald kräftig hustend, den gröbsten grauveraschten Staub ab und legte diese halbwegs geputzten Bündel dann vorsichtig übereinander in ihre neue blaue Heimstatt hinein, bis die Säcke jeweils zu voll waren für diesen euphemistischen Unsinn und alles ebenso durcheinanderfiel, wie wenn ein ehrlich gefühlloser Unterarm von vornherein kurzen Prozess gemacht hätte. Ich zwang mich, nichts von dem zu entziffern, was auf all die Bögen und Zettelchen, auf Karteikarten in allen verblichenen Pastelltönen und obendrein auf Körbe voll Bierdeckel in dieser kleinen, vorwärtsdrängenden, sich nicht mit kunstvollen Ausreißern nach oben oder unten aufhaltenden, für einen Mann aber, wie ich fand, erstaunlich runden, fast kugeligen Handschrift notiert worden war, deren Buchstaben sich nicht einfach aneinanderreihten, sondern vielmehr einer dem anderen wie einem Bauch entsprangen. Aber das ein oder andere Wort, der ein oder andere Satz in dieser mal blassblauen, mal kugelschreiberroten, dann wieder filzstiftschwarzen Girlande, die scheints die ganze Welt hatte kreuz und quer überfahren wollen wie eine endlose Ameisenstraße, verfing sich doch in meinem Blick und sollte später in schlaflosen Nächten vor mir wieder auftauchen.
Endlich war die böse Tat vollbracht, sieben Müllsäcke mit den geistigen Überresten eines guten Menschen standen aufrecht nebeneinander an einer der Bibliotheksregalwände, und eine hinterhältige Stille legte sich auf meine Ohren. Ein paar Tropfen Valoron landeten von der Pipette auf meiner staubigen Zunge, und augenblicklich kräftiger stieg ich die Treppen hoch.
Zaghaft klopfte ich an, trat aber ohne eine Antwort abzuwarten ein und fand mich in einer schönen, großen, vollkommen quadratischen Wohnküche wieder. Odra Decker stand, mir den Rücken zugekehrt, am offenen Fenster und blickte in den Garten hinab.
„Und? Geschafft?“, fragte sie müde.
„Ja…“, entgegnete ich, irritiert, dass sie den Kopf nicht wenigstens andeutungsweise in meine Richtung drehte, und in kindischem Stolz auf mein Aufräumwerk setzte ich hinzu: „Wollen Sie’s sich anschauen?“
„Nein“, noch immer sah sie nach draußen, „warum sollte ich das wollen?“
Ja, warum, wie dumm. Unschlüssig stand ich herum, besah mir den korkbeschichteten, quadratischen Esstisch, auf dem eine dicke Klarlackschicht, in die das Nikotin tief eingesunken war, im Sonnenlicht bernsteinfarben schimmerte, bis Odra Decker sich endlich doch umdrehte und plötzlich heiter fragte:
„Können Sie kochen?“
„Äh… ja, einigermaßen, also leidlich… vielleicht.“
Sie lachte:
„Na kommen Sie, gehen wir was essen.“
Vorher, teilte sie mir die Treppe hinabrasend mit, müssten wir nur noch schnell zur Bank, und kurz darauf ließ sie den Geldautomaten tausend Euro ausspucken, mit einer routinierten Beiläufigkeit, mit der ich bestenfalls hundert aus dem Ding rausholen könnte, und ebenso beiläufig gab sie mir davon fünfhundert, die ich für einen Vorschuss hielt, und den ich, wie ich fürchte mit angedeutetem Diener, dankend entgegennahm, aber nein, nein, kein Vorschuss, bloß für Ihre Auslagen, Fahrtkosten, Hotel, ich liebe Bargeld, Sie nicht?, und damit stopfte sie die anderen fünfhundert nachlässig in die Außentasche ihres ausgeblichenen Trenchs, den sie im Hinauslaufen über ihr Jogginghosen-Pullover-Kostüm geworfen hatte.
Von der Hauptstraße bloß einmal um die Ecke gebogen, fanden wir uns am Rand der puppenstubenartigen, altstädtischen Fußgängerzone bei einem Mittagstisch-Italiener ein, wo die Chefin, eine hübsch dickliche Frau, die aussah wie eine dunkelhaarig attraktive Version von Bugs Bunny, inklusive des charmant hasenhaften Silberblicks, uns geschäftig liebenswürdig Brot und Öl hinstellte und unaufgefordert auch gleich zwei Rotweingläser, woraufhin Odra Decker, kaum, dass sie sich auch nur hingesetzt hatte, fragte, Anna, hast du grad eine Flasche offen von diesem mallorquinischen Rotwein von letzter Woche? Nein, habe sie nicht, aber freilich könne sie davon eine aufmachen, gern, Odra, für dich, und schon brachte sie eine Flasche an unseren Tisch, auf deren rotem Etikett übergroß und in schmucklosen Lettern die seltsam aktenähnlichen Zeichen AN/2 standen, und Anna, meinen stirnrunzelnden Blick auf das Etikett aufnehmend, erklärte mir beim Einschenken lächelnd, dass AN die Kurzform für Ànima Negra sei, schön weich, nicht?, einfach der beste mallorquinische Rotwein, und ich dachte noch, dass ich wegen der Wechselwirkung lieber keinen Rotwein trinken sollte, und keinesfalls schon mittags, aber da ließen wir bereits, noch bevor die Antipasti auf dem Tisch standen, die in der Tat köstliche schwarze Seele in uns hineinfließen. Augenblicklich durchströmte mich wieder das gute Gefühl, wie es ist, ist es gut, und der Herr hat dich auf einen Platz gestellt, und nun sieh du zu, wie du ihn zu dem deinen machst.
An den Nebentischen spielte sich das für eine Mittagstischrestauration übliche Kommen und Gehen ab, der Kleinstadt gemäß allerdings ein wenig verlangsamt, und diese leichte Verlangsamung einer doch gestisch und verbal, du, ich muss los, gleichwohl als größte Eile und Geschäftigkeit ausgewiesenen Weltläufigkeit verstärkte zusätzlich die behaglich entrückende Wirkung des Rotweins: Mitten im Leben stehen wir staunend davor. Vorrangig Frauen mittleren Alters ließen sich in Zweier- oder Dreiergruppen an den Tischchen nieder und flogen bald wieder davon. Wahrscheinlich waren sie kaum älter als Odra Decker, einige vielleicht sogar deutlich jünger als sie, aber unter ihren gleichförmig diskreten Blondierungen und Puderungen und ihrem angeregt ziellosen Gerede wirkten sie zeitlos alt und frisch. Arglos saßen sie in ihren pastellfarbenen Freizeitdaunenjäckchen da, genau so wie die gleichen Frauen in Schwabing dasaßen und überall, wo ihnen nichts zustoßen konnte, oder fast nichts, wo das Schlimmste, was ihnen passieren konnte, war, vorübergehend alleinstehend zu sein und genau dann einem Mann wie mir zu begegnen.
Einvernehmlich schweigend nahmen meine neue Chefin und ich unsere recht ausgiebige Mahlzeit ein, was mir damals gar nicht als doch angesichts unserer Unvertrautheit durchaus bemerkenswert auffiel, und ebenso einvernehmlich betrachteten wir, noch als wir gemütlich in unseren Espressi herumrührten, mit zoologischem Interesse die Damenwelt an den Nebentischen, bloß dass Odra Decker hin und wieder eine der Daunenjäckchenträgerinnen mit freundlichem Nicken grüßte.
Den Weg nachhause legten wir hintenrum zurück, einen Uferweg entlang, links die Ruhr, rechts die noch immer riesig erscheinenden Villen der Stahl- und Kohlebarone und Barönchen, die von weit oberhalb einer hübsch verwitterten und mit wilden Bohnen bewachsenen Mauer gleichgültig auf den Spaziergänger am Flussweg hinabsahen. In der Ruhr lag hier ein langgestrecktes Inselchen, warum auch immer benannt nach Alfred Brehm, auf der ein Park angelegt war, in dem an diesem Nachmittag vereinzelte Spaziergänger herumschlichen und ihren Hunden Stöckchen warfen. Nach etwa zehn Minuten Weges endeten Insel und Mauer, und wir waren am Ende der Straße angelangt, in der das Decker’sche Haus stand. Doch bevor wir in diese stille Straße wieder einbogen, blieb Odra Decker auf dem Weg stehen, zeigte auf die Inselspitze, an der sich der Fluss teilte und ein wenig staute, wies auf die hohen Sträucher und kleinen Bäume dort drüben und erklärte mir in verhaltenem Ernst, dass sich dort früher ein verwunschener Ort befunden habe: der Tamponwald. Bei Hochwasser hatten sich hier immer unzählige, aus der Kanalisation angeschwemmte Tampons und Damenbinden verfangen, blieben in den Sträuchern und Bäumen hängen, und nach dem Hochwasser sah es aus, als wüchsen sie daran. Als Kinder seien sie staunend durch diesen Fabelwald auf der Brehminsel gestreift und hätten in fröhlicher Ekellust gar nicht genug bekommen können von der Betrachtung und manchmal sogar Berührung dieser seltsamen weißen Wattefrüchte mit den rotbraunverwaschenen Flecken darin.
„Damals hat man das noch alles ins Klo geschmissen. Ich glaube, nicht bloß aus vorökologischer Ignoranz, sondern vor allem aus Scham. Spült man das Ding einfach runter, existiert es nicht mehr, ganz anders als wenn man es mühsam in Klopapier einwickelt und in den Mülleimer wirft und dabei jedes Mal riskiert, dass ein Familienmitglied oder der Müllmann die Sache entdeckt. Denn leicht kann das Blut wieder durchsickern und einen verraten.“
Ich musste lachen, und auch sie lachte, fuhr dann aber ernst fort:
„Wissen Sie, man sollte diese dummen Frauen da an den Tischen vorhin nicht unterschätzen, nicht weil sie weniger dumm wären als man glaubt, sondern weil ihre Dummheit ein unwägbarer Faktor für das Böse wie für das Gute sein kann.“
Dann blickte sie wieder hinüber auf die Bäume und Sträucher, als hingen an ihnen noch immer die angespülten Tampons und Binden, und weil mich Odra Deckers Schweigen plötzlich verlegen machte, fragte ich sie:
„Wie alt waren Sie damals?“
„Damals? Wann? Als die Frauen das letzte Mal für das Böse gestimmt haben?“
„Was? … Nein, ich meine damals, als Sie im Tamponwald umhergestreift sind. Sie sagten, als Kinder…“
„Elf, zwölf?“
Erst jetzt kehrte ihre Aufmerksamkeit wieder ganz zu mir zurück, und wir betrachteten einander ohne Scheu. Noch immer, so dachte ich, sah sie aus wie ein zwölfjähriges, vorpubertäres und sehr ernstes Mädchen. Nun lenkten schon ihre großen Augen, die weichen, feinen Locken und ihre schmale Gestalt den Blick unweigerlich ins Kindchenschema hinein, doch weil sie so kindlich aussah, sah sie zugleich auch unangemessen alt aus, viel zu erschöpft und seltsam ausgezehrt für ein zwölfjähriges Kind. Dunkelbläuliche, fast schwarze Augenringe waren eingezeichnet in ihre dünne Haut, die je nach Licht fein silbrig hell aufstrahlen und plötzliche Heiterkeit in die Welt zurückwerfen konnte oder rötlich blass den dauerverfrorenen, anämisch kränklichen Eindruck ihrer ganzen traurigen Gestalt verstärkte. Vor allem irritierte mich ihr aufmerksamer, für alles offener Gesichtsausdruck, denn ich wurde das Gefühl nicht los, dass sie sich über die Wirkung dieser vollkommenen Offenheit auf ihr Gegenüber nicht allein vollkommen im Klaren war, sondern sich darüber ebenso zu amüsieren wie auch zu grämen schien wie über etwas, das zu kontrollieren nicht in ihrer Macht lag. Während ich ihr Gesicht studierte wie ein Porträt, gleichsam um es mir näherzubringen und doch auch auf Distanz zu halten, wandelte sich ihr Bild unablässig derart hin und her, dass in den Gesichtszügen eines Mädchens immer wieder plötzlich die eines merkwürdigen alten Wichts erschienen. Ich musste an das Männlein im Walde denken, ganz still und stumm, und zugleich, wohl auch, um die leichte Unheimlichkeit zu verscheuchen, die mir wahrscheinlich weniger von ihrem wirklichen Aussehen eingegeben wurde als vom langen, unverstellten Blick auf einen anderen lebendigen Menschen, fragte ich mich, wie alt sie wohl nun tatsächlich war, doch lächelnd kam sie mir zuvor:
„Fünfzig. In diesem Frühjahr bin ich fünfzig geworden. Und Sie, auch kein Frischling mehr, oder? Ich meine, der Lack ist noch nicht ab, aber man kann schon langsam ahnen, wie er mal abblättern wird.“
„Ich bin letzte Woche vierzig geworden.“
Zu meinem Ärger war meine Gekränktheit wohl unüberhörbar, denn sie klopfte mir freundlich neckend auf den Arm:
„Verzeihung, ich hab bloß Spaß gemacht, wollte Sie nur aufziehen, weil Sie so ein Getue ums Alter zu machen scheinen. Keine Sorge, Sie sehen gut aus, wirklich gut.“ Zur Bekräftigung des doppelten gut nickte sie zweimal. „Von Ihnen wird der Lack niemals abgehen.“
Das klang mehr wie eine Drohung, und so ging ich nicht weiter darauf ein, sondern lächelte nur versöhnlich. Unser Verhältnis schien nun irgendwie geklärt, und daher wunderte es mich nicht, dass sie sich vertraulich bei mir einhakte, als sie unsere Schritte zurück auf die kleine Straße lenkte. Einträchtig kehrten wir ins Haus zurück.
2.
Eines Nachmittags Anfang November rief mich eine Frau vom Auktionshaus an, der ich bereits drei Wochen zuvor eine Anfrage wegen des Verkaufs der Decker’schen Kunstsammlung geschickt hatte. Sie hatte nicht reagiert, was mich durchaus gewundert hatte. Aber nun sei man doch sehr interessiert. Ob des späten Rückrufs gab ich mich ein Weilchen reserviert, doch nachdem sie routiniert ihr Entschuldigungsprogramm für den komplexbeladen stolzen Mittelmaßbürger oder, noch schlimmer, den von jeher verarmten und bedeutungslosen Adligen abgespult hatte, sehen Sie, Herr von Házy, in einem großen, renommierten Haus wie dem ihrigen komme es leider immer mal zu Verzögerungen, zudem sei sie zwecks Kundengesprächen in Paris gewesen, und selbstverständlich habe sie die Decker’sche Angelegenheit nicht delegieren, sondern persönlich und so weiter, beendete ich, einen winzigen Moment, bevor sie ihren Tonfall auf herablassend umgestellt hätte, mein verschnupftes Getue, denn, meine Güte, so eine tolle Sache sind ein paar zweitrangige Corinth-Kreidezeichnungen und ein zwar hübsches, großes, aber unrettbar nikotinvergilbtes Heckel-Aquarell, das eine mit höchst filigranen oder eher spirligen Blumen widersinnig üppig gefüllte Vase vorstellte, nun auch wieder nicht. Das war natürlich nicht alles, aber doch das pekuniäre Herzstück der Sammlung, so schien es mir wenigstens. Es gab noch haufenweise Ölbilder, Grafiken, Zeichnungen, Aquarelle wohl eher von Nebenkünstlern und Nebennebenkünstlern der klassischen Moderne und ihrer Ausläufer bis in die sechziger Jahre hinein, lauter Bilder, über deren Wert ich mir trotz großer, wenn auch freilich nicht übermäßig professioneller Recherchebemühungen nicht recht klar hatte werden können.
Bei der Inventur der Kunstsammlung ihres Vaters war Odra Decker mir, wenig überraschend, keine Hilfe gewesen. Sie hatte mir bloß achselzuckend den Schlüssel für ein beeindruckendes Monstrum von einem alten, graumetallenen Grafikschrank ausgehändigt. Schulterhoch, zweimeterfünfzig breit und annähernd zwei Meter tief, okkupierte er fast die Hälfte des hintersten und kleinsten der drei ineinander übergehenden Bibliotheksräume. In zwölf wunderbar leichtgängigen Schubfächern beherbergte er all diese kleinen und größeren Kunstwerke, einige wenige von ihnen waren gerahmt, die meisten hingegen ohne Rahmen und augenscheinlich schon vor Jahrzehnten in Seidenpapiere erstaunlich schlampig verpackt, so lagerten sie friedlich in ihren verblasst bunten Schachteln und Mappen neben- und übereinander wie die unterschiedlichsten Bewohner eines zwölfstöckigen Hauses, oder sagen wir eines nie gebauten utopischen Entwurfs eines solchen.
Es hatte mich die ersten beiden Oktoberwochen, meine ersten beiden Arbeitswochen, gekostet, all diese Bilder zu sichten, ihre Signaturen, so vorhanden, mit der Lupe zu inspizieren und gegebenenfalls zu entschlüsseln, die Bilder zu fotografieren und schließlich in einer provisorischen Inventarliste zu erfassen. Darauf folgte dann die Anfertigung einer ordentlichen Liste, wozu es freilich erforderlich gewesen war, diejenigen Künstler, deren Namen mir nichts sagten, zu recherchieren, nach Preislisten, in denen die Künstler auftauchten, zu suchen, nach Auktionsergebnissen, die vergleichbare Bilder erzielt hatten, was mir leider nicht immer gelang.
Darüber war es plötzlich doch noch Herbst geworden, ich weiß, es war der zehnte Oktober, an dem ich zur Mittagszeit noch einmal mit meinem Laptop auf der Terrasse unterhalb der Bibliothek, die eigentlich keine richtige Terrasse war, sondern bloß ein mit vermoosten Verbundsteinen gefliester kleiner Hof, kaffeetrinkend an einem Klapptischchen saß und dort die Lebensdaten einiger Künstler heraussuchte. Gerade war ich bei einer Schweizer Malerin namens Alice Bailly angelangt, die Sonne hatte noch eine erstaunliche Kraft, als Odra Decker mir leichthin aus dem offenen Bibliothekszimmer zurief, sie ginge kurz in die Stadt, um zu schauen, ob sie nicht noch schnell für diesen möglicherweise letzten gnädigen Nachsommertag irgendwo einen Bikini erstehen könne.
Kaum eine halbe Stunde später kam sie wieder, angetan mit einem sogar sehr gut sitzenden schwarz-orange-vanillefarben gemusterten Bikini, an dem hinten an der Hose noch ein dreieckiges Herstellerschild baumelte, und schleppte einen spinnwebverdreckten Liegestuhl herbei, platzierte ihn auf dem einzigen, nicht eben großen Fleck des Rasens, der nicht von einem der für den kleinen Garten viel zu hohen und obendrein mit ihren schwarzgrünlich wie lackiert glänzenden Blättern äußerst hässlichen Ilex-Bäume verschattet war, und streckte sich laut aufseufzend darauf aus.
Ich hatte wohl meinen Blick, der von meinem Plätzchen auf der Hofterrasse durch zwei hohe, blassrosa Rosenstöcke in den Garten gewandert war, ein wenig zu lang auf Odra Deckers wie tot hingestreckter Gestalt ruhen lassen, denn etwas missmutig erklärte sie, während sie das Schild an der Bikinihose, den Po kurz seitlich in die Luft gehoben, mit einem wütenden Griff abriss, dass sie es in diesem Sommer dummerweise wieder kein einziges Mal in den Garten hinaus geschafft habe, und man müsse doch wohl zumindest einmal im Jahr ein bisschen die Sonne genießen. Dies gelang ihr etwa eine halbe Stunde lang, dann fing sie an, nervös auf dem Liegestuhl hin und her zu rutschen, die große Sonnenbrille ins Haar hochzuschieben und wieder auf die Augen hinabfallen zu lassen, bis sie sich kurz darauf ruckartig erhob und mit einem gemurmelten Ich mach mal was zu essen wieder ins Haus verschwand.
Tags darauf war die Kälte, mit der eigentlich gar nicht mehr zu rechnen gewesen war, hereingebrochen, und so hatte ich meine Arbeit dann in der Bibliothek abgeschlossen. Wobei das Wort abgeschlossen nicht ganz zutrifft, da ich umständehalber mit der Inventarisierung nicht ganz durchgekommen war, eigentlich lediglich knapp die Hälfte der Bilder erfasst hatte. Aber ich hatte es für das Vernünftigste gehalten, dem Auktionshaus möglichst schnell erst einmal ein wenn auch vorläufiges, so doch möglichst attraktives Portfolio zu übersenden, zuoberst die Fotos des Heckel-Aquarells und der Corinth-Zeichnungen und außerdem einiger anderer Bilder, die wie der Heckel und die Corinths nicht im Grafikschrank weggeschlossen, sondern im Wohnzimmer und der Bibliothek aufgehängt waren.
Als nun die Dame vom Auktionshaus, Frau Dr. Diane Westhoff-Setz, ein paar konkrete Bemerkungen zu der Sammlung fallen ließ, den Heckel aber nicht einmal erwähnte, wurde mir etwas unbehaglich bei dem Gedanken, dass ich eigentlich keinen vollumfänglichen Überblick über die Sache besaß. Aber je nun, dachte ich, dafür waren schließlich diese Leute da, sie hatten die Werte, auf denen Odra Decker saß, einzuschätzen. Meine Aufgabe war doch lediglich, diese Einschätzung der Fachleute möglichst sachdienlich vorzubereiten. Vorsichtig brachte ich die Heckel-Blumenvase ins Spiel, doch Frau Dr. Westhoff-Setz reagierte nicht wie gewünscht:
„Mhm, der Heckel, ja natürlich. Was uns ja unter anderem durchaus auch besonders interessiert, sind die beiden kleinen Baumeister.“
„Ja…, sehr schön, nicht?“
Baumeister, Willi Baumeister, was waren die noch mal…? Ach du je, die beiden kleinen Gemälde, die übereinander in einer Ecke der Bibliothek hingen, halb verhangen von einem groben dunkelbraunen Vorhang, der anstelle einer ausgehängten Flügeltür als Raumteiler diente. Diese Gemälde waren in meinen Augen wenig reizvoll gewesen, ein unentschiedenes Gemisch aus halbherzig kubisierten Körpern in scheußlich verblasstem fleischfarbenem Rosa und kompositorisch völlig unmotiviertem graphischem Dekor drum herum. Ein Halbkreis hier, ein Dreieck da. Ich fing ein wenig an zu schwitzen, aber glücklicherweise wollte die Frau nun nicht weiter plaudern.
„So, heute haben wir den fünften, richtig? Ja, ich könnte gleich übermorgen, also Mittwoch, zu Ihnen kommen, sodass wir eine erste Sichtung gemeinsam machen könnten.“
Dummerweise hatte ich nicht damit gerechnet, dass diese Leute derart unverzüglich hier auftauchen könnten, klarerweise war ich nicht ausreichend auf eine persönliche Präsentation der Sammlung vorbereitet und musste also Zeit gewinnen.
„Oh…, das geht nun leider gar nicht…“
„Nicht?“
„Nein…, leider verreisen Frau Decker und ich morgen und werden voraussichtlich erst um den…, lassen Sie mich sehen, zwanzigsten November herum wieder hier sein. Wenn es dann ginge…?“
„Gut… ja, natürlich, das ginge auch.“ Sie schien ein wenig verdutzt, aber ich glaube nicht, dass sie ahnte, dass die Reise eine Notlüge war. „Wollen wir dann gleich den Einundzwanzigsten nehmen, das wäre auch ein Mittwoch? Sagen wir elf Uhr?“
„Gern, sehr gern.“
Um das Gespräch abzuschließen, wollte ich ihr noch einmal die Adresse geben, doch sie rief fröhlich:
„Danke, hab ich, hab ich! Herr Dr. Brandstetten, der Leiter unseres Hauses in Berlin, hatte ja damals mit Herrn Professor Decker persönlich gesprochen und die Angelegenheit dann hierher an unsere Düsseldorfer Repräsentanz weitergeleitet.“
„Ach! So…?“
„Ja, vor gut zwei Jahren. Professor Decker hatte ja alles schon sehr gut vorbereitet für den Verkauf seiner Sammlung. Doch dann wurde er…, kam die… Krankheit, und er musste uns mitteilen, dass er nun nicht mehr die Kraft habe, uns zu empfangen, was er, wie er betonte, außerordentlich bedauerte, denn es war ihm doch ein großes Anliegen gewesen, diese Aufgabe nicht seiner Tochter überlassen zu müssen. Da haben wir freilich nicht weiter insistiert, uns auch diskret zurückgehalten, als wir von seinem Tod erfuhren.“ Sie hüstelte pietätvoll. „Aber nun… immerhin erleichtert es die Sache für Frau Decker doch sehr, dass ihr Vater uns damals eine in jeder Hinsicht vorbildliche Inventarliste übermittelt hat.“
Im letzten Halbsatz hatte sie einen leicht mokanten Ton angeschlagen, vielleicht schien es mir auch bloß so, ich war so verdattert, dass es mir schon wieder leichtfiel, vollkommen natürlich zu reagieren, selbstverständlich war ich darüber im Bilde, hatte mit meinem improvisierten Portfolio ja auch lediglich einen kleinen Reminder an sie versenden wollen, und nach ein paar heiter hingeworfenen Höflichkeiten beendete ich das Gespräch souverän oder eher als ausgemachter Vollidiot.
Odra Decker war noch nicht wieder zurück. Sie hatte mir, als ich zum Frühstück in die Küche runterkam und mich wunderte, dass sie bereits geduscht und vollständig angezogen war, gutgelaunt verkündet, dass sie mit dem Zug nach Wuppertal fahren wolle und voraussichtlich am frühen Abend wieder da sei. Wie immer, wenn sie sich etwas zu eilig geföhnt hatte, standen ihre obersten, feinen Deckhaare noch elektrisiert zu Berge, bewegten sich in der wegen der schlimmen Zugigkeit des Hauses wie stets überheizten Luft seltsam zackig schlängelnd wie Zitteraale in die Höhe. Sie hatte hastig im Stehen eine Tasse Kaffee getrunken, dann war sie pfeifend die Treppe hinabgerast und hatte die Haustür krachend ins Schloss geworfen.
Vier Uhr, vor sechs würde sie wohl nicht zurück sein, ich hatte also noch etwas Zeit, mir den Kopf darüber zu zerbrechen, wie ich sie mit der Frage konfrontieren sollte, ob sie von den Verkaufsgesprächen und der Inventarliste ihres Vaters gewusst hatte. Sie musste davon gewusst haben, auch wenn es keinen Sinn ergab. Um mir allerdings den Kopf auch nicht allzu sehr zu zerbrechen, stieg ich erst einmal nach oben in meine Räume unterm Dach.
Diese Kämmerchen waren mir schon sehr ans Herz gewachsen, ja direkt von der ersten Nacht an hatte ich mich hier heimisch gefühlt, mich sogleich mit einem solchen Wohlbehagen in dem schmalen Bett ausgestreckt und in so tiefer Erleichterung laut aufgeseufzt, hier will ich bleiben, für immer, dass ich mir erschrocken die Hand auf den Mund gepresst hatte, in der Furcht, Odra Decker, eineinhalb Stockwerke tiefer in ihrem Schlafzimmer im Zwischengeschoss liegend, könnte mich gehört haben. Nachsichtig in mich hineinlächelnd hatte ich dann freilich sofort den Kopf geschüttelt über meine Unsinnigkeit, zugleich jedoch hatten mir mein Seufzer und das Glücksgefühl, in diesem Bett zu liegen, die Augen geöffnet, in welch jämmerlichem Zustand ich mich wohl befinden musste. Ein leichtes Nervenzittern hatte meinen linken Mundwinkel umlaufen, und als spräche ich über einen beklagenswerten Verwandten, hatte ich vor mich hin gemurmelt soso, unters Dach hat er sich gerettet.
Und so betrat ich auch jetzt, nach dem verwirrenden Gespräch mit Frau Dr. Westhoff-Setz, aufatmend mein kleines Reich, wo es, Vorteil der hässlichen, alles abdichtenden Plastikfenster, anders als unten immer schön gleichmäßig warm war, und kochte mir in meiner hübschen Dachbalken-Küche einen Kaffee. Ich nutzte die Küche eigentlich fast niemals zum Kochen oder Essen, denn ohne dass wir darüber gesprochen hatten, hatte es sich sehr schnell eingebürgert, dass ich meine Mahlzeiten gemeinsam mit Odra Decker ein Stockwerk tiefer in ihrer großen Küche einnahm, so wir nicht ohnehin auswärts aßen. So kochte ich mir hier oben fast immer nur meinen Kaffee oder saß abends am Küchentisch im warmen Licht einer verrosteten Stehlampe, hin und wieder trank ich auch nachts noch ein Glas Wein, im Dunkeln ganz nah an dem offenen Dachfenster stehend und in die hier doch meist erstaunlich klaren Nächte hinaus- oder eher hinaufschauend. Dass ich diese Küche kaum zu ihrem angestammten Zweck nutzte, machte sie mir noch lieber – sie war meine Küche und legte doch kein Zeugnis ab von meiner vollkommenen Unfähigkeit, ein Leben zu führen.
Nach dem Kaffee legte ich mich kurz hin, nicht unter die Bettdecke, nur auf dem Rücken schnell einmal ausstrecken, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, um nicht zu tief wegzusacken, bloß ein viertelstündiges Nachdenkschläfchen halten.
Als ich wieder aufwachte, war es stockdunkel. Traumverkatert schaute ich auf die Uhr, kurz vor zehn. Das ist das Lästige an Haldol in kleinen Dosen, man weiß nie genau, ob und wann die Wirkung doch noch einsetzt, manchmal eben erst zwei Tage später, wenn man schon fast vergessen hat, dass man es genommen hat und man jedenfalls jetzt gerade nicht um Schlafförderung gebeten hat. Es ist, als verabschiede man um zwei Uhr morgens nach einem genüsslich zerdehnten Abendessen, nach Dessert, Käse und Whiskey, seine Gäste, und plötzlich stünde der Diener neben einem, auf der Hand das Tablett mit den Martinis, die er vor sechs Stunden vergessen hat. Eilig strich ich Hemd und Frisur glatt, versorgte die verquollenen Augen mit reichlich kaltem Wasser und stieg schwindelnd die steile Treppe hinunter, trat in die Küche und von dort mit drei langgestreckten Schritten ins angrenzende Wohnzimmer, dabei rhetorisch an die ohnehin immer offen stehende Tür klopfend.
In einer Ecke des riesigen Raums, am Ende der dem Eintretenden gegenüberliegenden langen Fensterfront, saß Odra Decker unter dem Heckel-Aquarell in ihrer verstellbaren Fernsehliege, die Rückenlehne wie immer vollkommen gerade hochgestellt, die Beine lang ausgestreckt, die Knöchel übereinandergelegt und die Hände locker im Schoß gefaltet. Direkt auf der Schwelle machte ich Halt und zwitscherte wie ein Vogel auf dem Gartenzaun in die Tiefe des Raums zu Odra Decker hinüber:
„Oh, hallo. Sind Sie schon lange wieder da?“
„Seit sechs oder so“, von ihrer morgendlichen guten Laune war anscheinend nichts mehr übrig, „gucken Sie mit mir?“
„Gibt’s ’nen Tatort?“
„Ja, hat grad erst angefangen. Noch kaum was passiert, bloß die Leiche. Junge Frau, erstochen, und vorher vergewaltigt, selbstverständlich.“
Anfangs hatte ich mir immer einen der Sessel vom runden Wohnzimmertisch herbeitragen und nach jedem Fernsehabend anstandshalber wieder an seinen Platz zurückgestellt. Einmal hatte ich ihn dann bloß aus Müdigkeit neben Odra Deckers Liege stehen lassen, und ab da blieb er dort, ein Verzicht aufs Dekorum, der lediglich unserem wirklichen Alltag Rechnung trug und obendrein eben diesen Alltag deutlich erleichterte, denn standen die beiden Sitze schon tagsüber friedlich für unsere allabendlichen gemeinsamen Fernsehsitzungen bereit, nahmen sie den Ausklang des Tages trostreich vorweg.
Obwohl der Gerichtsmediziner gerade seine albernen Scherzchen machte, die uns immer so gut gefielen, und Odra Decker sich mit einem gemurmelten Bierchen? erhob und in die Küche hinüberging, musste ich, als sie, in der Linken die beiden Biere, in der Rechten eine Schale mit Pistazien, wiederkam und sich wie ein alter Mann ächzend auf ihre Liege zurücksortierte, leider unseren schönen Hausfrieden brechen:
„Haben Sie gewusst, dass Ihr Vater, bevor er krank wurde, noch den Verkauf der Sammlung mit dem Auktionshaus angeleiert hat?“
„Äh… was?“
„Dass er eine komplette Inventarliste all seiner Bilder erstellt und diesen Leuten geschickt hat?“
„Ich versteh nicht… Wie kommen Sie…?“
„Die haben mich angerufen, heute. Die Frau, der ich meine kleine Inventur geschickt habe, hat es mir gesagt. Also, haben Sie’s gewusst oder nicht?“
„Keine Ahnung…“, defensiv unwillig schüttelte sie den Kopf, „wie oft soll ich Ihnen noch sagen, ich hab keinen Überblick? Dafür sind Sie ja schließlich da! Um Licht in dieses Dunkel hier zu bringen, richtig? Ihr Job, nicht meiner!“
„Schon, aber ein wenig Kooperation wäre eine große Erleichterung dieser Aufgabe, und ich sage das nicht meinetwegen, sondern Ihretwegen, denn es ist Ihr Geld und Ihre Zeit, die dabei unnötig draufgehen. Wenn Sie mir gesagt hätten, dass Ihr Vater bereits…“
„Herrgott, ich weiß nichts von einer Inventarliste!“
„Wie kommt’s, dass ich Ihnen nicht glaube?“
„Jetzt werden Sie mal nicht unverschämt, Josef!“
Es war das erste Mal, dass sie mich beim Vornamen nannte, und sie schien darüber, und wohl auch darüber, dass sie mich angeschrien hatte, erschrockener als ich, der ich, nachdem ich kurz den Griff eines kühlen Händchens an mein Herz gefühlt hatte, ahnte, dass mir diese Übertretung einen Vorteil verschaffen würde. Sie war aufgesprungen, hatte die Fernbedienung, die wie so oft nicht gleich auf den Druck des roten Ausschaltknopfes reagierte, wütend zu Boden geschleudert, sodass der Kommissar weiter mit seiner Assistentin frotzeln konnte, derweil Odra Decker nun wie das Bild eines Patriarchen ohnmächtig aggressiv im Zimmer hin und her lief.
„Diese scheiß Kunstsammlung! Ist mir doch vollkommen egal. Ich hab Ihnen ja gleich gesagt, vergessen Sie die scheiß Bilder und kümmern Sie sich erstmal um die scheiß Plastiken hier!“
Mit unfreiwillig komödiantischem Schwung malte ihr ganzer Arm über ihrem Kopf einen großen Kreis in die Luft, eine verächtliche, vor allem aber wohl ängstliche Rundumgeste, wie ein hilfloser Bann gegen all die dunklen Holzplastiken, die den ganzen Raum beherrschten, Menschenfiguren, Totems und seltsame Kreuzungen aus beidem. Einige von ihnen standen eng beieinander oben auf den hohen Eichenregalen entlang der gegenüberliegenden Wand, andere auf einem scheußlichen Trumm von einem brusthohen Aktenschrank aus dem neunzehnten Jahrhundert. Außerdem hingen ringsherum, auch zwischen den Fenstern, Masken verschiedenster Größen, Formen und Bemalungen an den Wänden, und schließlich thronte in der Zimmerecke zwei Meter neben dem Fernsehplatz, auf einem eigens für ihn gefertigten Podest und umringt von drei weißen, dünnen, wunderbar glatt polierten Stockplastiken, die man aus der Ferne für aufgestellte Birkenzweige hätte halten können, breitbeinig ein anderthalb Meter großer Krieger mit langem, dickem Hals und kleinem, spitz zulaufendem Kopf, die zu lockeren Fäusten eingebogenen Hände hatte er wie Sandkastenförmchen auf den außerordentlich breiten Hüften abgelegt. Im spärlichen, nervösen Fernsehlicht konnte man von all diesen Figuren und Masken nur bläuliche Umrisse erkennen, und ob sie uns ansahen, uns freundlich oder feindlich gesonnen waren oder aber, was wohl das Wahrscheinlichste und Unheimlichste war, gar keine Notiz von uns nahmen, war nicht zu erkennen.
Odra Decker hatte ja recht, sie hatte mich tatsächlich, und zwar direkt noch am Abend meines ersten Arbeitstags, angewiesen, mich statt um die Bücher oder die Bilder erst einmal um die afrikanische Sammlung zu kümmern, sie wolle diese so schnell wie möglich aus dem Hause haben. Gleich morgen hätte ich damit anzufangen, all diese Kunstwerke oder Kultgegenstände, was auch immer sie für wen auch immer seien, abzufotografieren und dann ein auf dieses Zeug spezialisiertes Auktionshaus in Würzburg zu kontaktieren.
Am nächsten Morgen hatte ich auch wirklich mit der Angelegenheit beginnen wollen, war frischen Muts auf die Leiter gestiegen und hatte die erstbeste Plastik vom Regal heruntergeholt, eine männliche Figur, deren kleiner, recht naturalistisch gebildeter Körper anstelle des Kopfes eine riesige Maske in Form eines abgerundeten Rechtecks trug, viel größer als der Körper selbst. Die Figur stellte wohl, so dachte ich, einen Mann dar, der angelegentlich einer rituellen Handlung eine überdimensionale Maske trug. Doch dann fragte ich mich, welche rituelle Bedeutung die Darstellung einer rituellen Handlung überhaupt haben könnte oder sagen wir, welchen rituellen Gebrauch man von der Darstellung einer rituellen Handlung machen könnte, vermutlich doch wohl keinen, denn es ist doch recht unwahrscheinlich, dass ein Mann mit einer riesigen Maske die kleine Figur mit der riesigen Maske, die dann also ihn selbst en miniature darstellte, bei einer rituellen Handlung vor sich hergetragen hat. Oder war womöglich das Doppelwesen aus kleinem Körper und riesigem Fremdkopf als Ganzes selbst wiederum eine Maske? Der große, echte Mensch hält sie sich als Maske vors Gesicht, indem er den kleinen Körper, Nachbildung seines eigenen Körpers, als Griff nutzt.