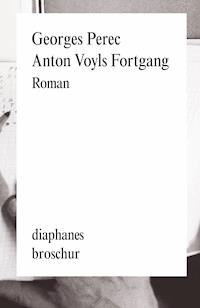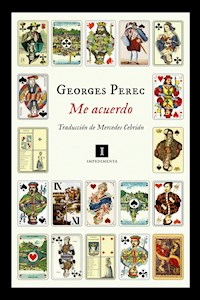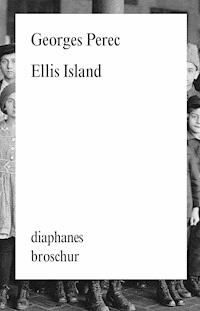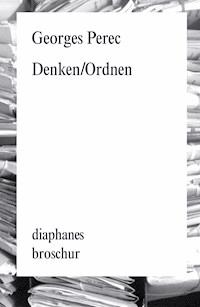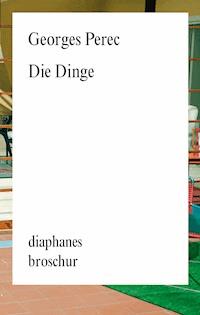
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diaphanes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: diaphanes Broschur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Quasi über Nacht berühmt wurde Georges Perec mit diesem 1965 erschienenen Werk, für das er den renommierten Prix Renaudot erhielt und das sich 50 Jahre nach der Erstausgabe als aktueller denn je erweist.
Perec beschreibt in diesem schmalen Buch das Leben des jungen Paares Jérôme und Sylvie als ganz und gar von Dingen bestimmt, die sie besitzen oder besitzen wollen und denen sie alle ihre menschlichen Beziehungen unterordnen. Beide haben ihr Studium aufgegeben und betreiben nun mit Versatzstücken aus Psychologie und Soziologie Marktanalysen für eben jene Konsumindustrie, deren exemplarische Zielgruppe sie bilden. Getrieben von der Frage, auf welche Art jenes den anderen offenbar so reichlich zur Verfügung stehende Geld zu beschaffen sei, verlieren sie sich immer tiefer in den »Gefängnissen des Überflusses«, nicht ohne jedoch einen Ausbruch zu wagen…
Perecs Erzählung verbindet literarischen Formwillen mit wacher Gesellschaftsanalyse, schonungslose Beschreibung mit großer Empathie: Literatur als Utopie jenseits aller Tristesse konformer und kristalliner Warenwelten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Ähnliche
Georges Perec Die Dinge
Eine Geschichte der sechziger Jahre
Aus dem Französischen von
Inhalt
Unschätzbar sind die Wohltaten, die die Zivilisation uns gebracht hat, unermesslich ist die Produktivkraft, die alle Arten von Reichtümern hervorbringt und ihren Ursprung in den Erfindungen und Entdeckungen der Wissenschaft hat. Unbegreiflich sind die wunderbaren Schöpfungen des menschlichen Geschlechts, um die Menschen glücklicher, freier und vollkommener zu machen; ohnegleichen die kristallenen und fruchtbaren Quellen des neuen Lebens, das sich noch immer den durstigen Lippen derer verschließt, die ihren bedrückenden und unwürdigen Aufgaben nachgehen.
Malcolm Lowry
ERSTER TEIL
I
Zuerst würde der Blick über den grauen Teppichboden eines langen, hohen und schmalen Korridors gleiten. Die Wände wären Einbauschränke aus hellem Holz, deren Messingbeschläge glänzten. Drei Stiche – der eine stellt Thunderbird dar, Sieger in Epsom, der andere einen Schaufelraddampfer, dieVille-de-Montereau, und der dritte eine Lokomotive von Stephenson – würden zu einem von großen, schwarz gemaserten Holzringen gehaltenen Ledervorhang führen, der sich durch eine einfache Handbewegung zurückschieben ließe. Nun würde der Teppichboden einem fast gelben Parkett weichen, das drei Teppiche in gedämpften Farben teilweise bedeckten.
Es wäre ein Wohnraum, etwa sieben Meter lang, drei breit. Links, in einer Art Nische, stünde ein großes schwarzes, abgewetztes Ledersofa zwischen zwei Bücherschränken aus heller Kirsche, in denen die Bände sich kunterbunt übereinanderstapelten. Über dem Sofa nähme eine alte Seekarte die ganze Länge der Wand ein. Hinter einem kleinen niedrigen Tisch, unter einem seidenen, mit drei breitköpfigen Messingnägeln an der Wand befestigten Gebetsteppich, einem Gegenstück zum Ledervorhang, würde ein anderes, mit hellbraunem Samt bezogenes, rechtwinklig zum ersten aufgestelltes Sofa zu einem kleinen hochbeinigen, dunkelrot lackierten Möbelstück mit drei Fächern führen, in dem sich Nippes befände: Achate und Steineier, Schnupftabakdosen, Bonbonnieren, Jadeaschenbecher, eine Perlmuschel, eine silberne Taschenuhr, ein geschliffenes Glas, eine Kristallpyramide, eine Miniatur in ovalem Rahmen. Etwas weiter, nach einer gepolsterten Tür, enthielte ein in die Ecke eingepasstes Wandregal Kästchen und Schallplatten sowie einen geschlossenen Plattenspieler, von dem man nur vier ziselierte Metallknöpfe sähe und über dem ein Stich des Grand Défilé de la fête du Carrousel hinge. Vom Fenster aus, dessen weiße und braune Vorhänge die Farben des Gemäldes von Jouy aufgreifen würde, entdeckte man ein paar Bäume, einen winzigen Park, ein Stück Straße. Zu einem mit Papieren und Schreibstiften überhäuften Sekretär mit Rollläden würde ein kleiner Rohrsessel gehören. Ein Figurenständer trüge ein Telefon, ein ledernes Notizbuch, einen Abreißblock. Hinter einer anderen Tür und nach einem drehbaren, niedrigen und quadratischen Bücherschrank, auf dem eine große zylindrische, mit gelben Rosen gefüllte blau verzierte Vase thronte, über der wiederum ein länglicher, in einem Mahagonirahmen gefasster Spiegel hinge, würden ein schmaler Tisch und zwei dazugehörige, mit Schottenkaro bezogene Polsterbänke zu dem Ledervorhang zurückführen.
Alles wäre braun, ocker, fahlrot, gelb: eine Welt leicht altmodischer Farben, die Töne sorgfältig, fast pedantisch dosiert, zwischen denen ein paar hellere Flecke, das fast schreiende Orange eines Kissens, ein paar knallbunte zwischen den Ledereinbänden verlorene Bücher überraschen würden. Am hellen Tag würde das in Strömen eindringende Licht diesen Raum trotz der Rosen ein wenig traurig machen. Es wäre ein Raum für den Abend. Im Winter jedoch, bei zugezogenen Vorhängen, einigen Lichtpunkten – die Ecke mit den Bücherregalen, die Schallplattenspieler, der Sekretär, der niedrige Tisch zwischen den beiden Sofas, die undeutlichen Reflexe im Spiegel – und den großen Schattenzonen, in denen alle Dinge aufleuchten würden, das polierte Holz, die schwere, kostbare Seide, das geschliffene Kristall, das weiche Leder, wäre er ein Hafen des Friedens, eine Stätte des Glücks.
Die erste Tür öffnete ein Zimmer, das mit hellem Teppichboden ausgelegt wäre. Ein großes englisches Bett nähme den Hintergrund ein. Rechts, zu beiden Seiten des Fensters, enthielten schmale, hohe Regale Bücher, zu denen man immer wieder greifen würde, Alben, Spielkarten, Keramikschalen, Halsketten, Krimskrams. Links ständen ein alter Eichenschrank und zwei stumme Diener aus Holz und Messing einem kleinen, mit grauer, fein gestreifter Seide bezogenen Sessel und einem Frisiertisch gegenüber. Durch eine halb geöffnete, ins Badezimmer führende Tür sähe man dicke Bademäntel, Messinghähne in Form von Schwanenhälsen, einen großen verstellbaren Spiegel, ein Paar englische Rasiermesser und ihr grünes Lederetui, Flakons, Bürsten mit Horngriffen, Schwämme. Die Wände des Schlafzimmers wären mit bedrucktem Kattun bespannt; über das Bett wäre ein Schottenplaid gebreitet. Ein Nachttisch, an drei Seiten von einem niedrigen Messinggitter eingefasst, trüge einen Silberleuchter mit einem Lampenschirm aus blassgrauer Seide, eine viereckige Stutzuhr, eine Rose in einem Stielglas und, in dem unteren Fach, zusammengefaltete Zeitungen, ein paar Illustrierte. Etwas weiter, am Bettende, läge ein großes Sitzkissen aus Naturleder. An den Fenstern glitten die Tüllgardinen über Messingstangen; die grauen Vorhänge aus dichtem Wollstoff wären halb zugezogen. In der Dämmerung wäre das Zimmer noch hell. An der Wand, über dem schon für die Nacht aufgedeckten Bett, würde zwischen zwei kleinen elsässischen Lampen die verblüffende, schmale und lange Schwarz-Weiß-Fotografie eines am Himmel dahinfliegenden Vogels durch ihre etwas allzu formale Perfektion überraschen.
Die zweite Tür führte in ein Arbeitszimmer. Die Wände wären von oben bis unten mit Büchern und Zeitschriften tapeziert, nur hier und da, um das Einerlei der Buchrücken und Broschüren zu unterbrechen, ein paar Stiche, Zeichnungen, Fotografien – der Heilige Hieronymus von Antonello da Messina, ein Ausschnitt aus dem Triumph des Heiligen Georg, ein Blatt aus den Carceri von Piranesi, ein Porträt von Ingres, eine kleine, mit der Feder gezeichnete Landschaft von Klee, eine vergilbte Fotografie von Renan an seinem Arbeitsplatz im Collège de France, ein Warenhaus von Steinberg, Cranachs Melanchthon – auf Holztafeln befestigt und in die Gefache eingelassen. Etwas links vom Fenster und leicht schräg stünde ein langer lothringischer, mit einem großen, roten Löschblatt bedeckter Tisch. Holzschalen, lange Federkästen, Behältnisse verschiedenster Art enthielten Bleistifte, Heftklammern, Karteikartenreiter. Ein Glasbaustein würde als Aschenbecher dienen. Eine runde Dose aus schwarzem Leder, mit feinen Goldarabesken verziert, wäre mit Zigaretten gefüllt. Das Licht käme von einer alten, schlecht verstellbaren Tischlampe mit einem Schirm in der Form eines Visiers aus grünem Opalglas. Zu beiden Seiten des Tisches, einander fast genau gegenüber, stünden zwei Sessel aus Holz und Leder mit hoher Rückenlehne. Noch weiter links, direkt an der Wand, würde ein schmaler Tisch von Büchern überquellen. Ein Klubsessel aus flaschengrünem Leder führte weiter zu graumetallenen Ablagekästen, zu Karteikästen aus hellem Holz. Auf einem dritten, noch kleineren Tisch ständen eine schwedische Lampe und eine mit einer Wachstuchhülle bedeckte Schreibmaschine. Ganz im Hintergrund gäbe es ein schmales, mit marineblauem Samt bezogenes Bett zu sehen, darauf Kissen in allen Farben. Ein Dreifuß aus bemaltem Holz trüge, fast in der Mitte des Zimmers, einen Globus aus Neusilber und Papiermachee, naiv bemalt, auf antik gemacht. Hinter dem Schreibtisch, halb verdeckt von dem roten Vorhang des Fensters, könnte auf einer Messingschiene eine Trittleiter aus gewachstem Holz, die rund um das Zimmer geführt werden würde, entlanggleiten.
Hier wäre das Leben leicht, wäre einfach. Alle Verpflichtungen und Probleme des Alltags fänden eine natürliche Lösung. Jeden Morgen wäre eine Zugehfrau da. Alle vierzehn Tage würden Wein, Öl, Zucker ins Haus geliefert. Es gäbe eine große, helle Küche mit wappengeschmückten, blauen Kacheln, drei arabeskenverzierten Wandtellern, überall metallisch glänzende Einbauschränke, einen schönen, weißen Holztisch in der Mitte, Hocker, Bänke. Es wäre angenehm, sich hier jeden Morgen nach dem Duschen leicht bekleidet hinzusetzen. Auf dem Tisch ständen eine Butterdose aus Steingut, Marmeladengläser, es gäbe Honig, Toast, halbierte Pampelmusen. Es wäre früh. Es wäre der Beginn eines langen Maitages.
Sie würden ihre Post öffnen, sie würden die Zeitungen aufschlagen, sie würden die erste Zigarette anzünden. Sie würden das Haus verlassen. Ihre Arbeit nähme sie nur ein paar Stunden am Vormittag in Anspruch. Zum Mittagessen träfen sie sich wieder, um, je nach Laune, ein Sandwich oder ein Stück gegrilltes Fleisch zu verzehren; auf einer Caféterrasse würden sie eine Tasse Kaffee trinken, danach würden sie zu Fuß langsam nach Hause gehen.
Ihre Wohnung wäre selten aufgeräumt, aber gerade die Unordnung wäre ihr größter Charme. Sie würden sich kaum um die Wohnung kümmern: Sie würden darin leben. Der Komfort, der sie umgäbe, würde ihnen selbstverständlich erscheinen, als eine feststehende Tatsache, als eine zu ihnen gehörende Gabe, als ein Zustand ihrer Natur. Ihre Aufmerksamkeit wäre anderen Dingen zugewandt: dem Buch, das sie aufschlügen, dem Text, den sie schrieben, der Schallplatte, die sie hörten, ihrem jeden Tag wieder neu begonnenen Dialog. Sie würden lange arbeiten, ohne Erregung, ohne Hast, ohne Groll. Dann würden sie zu Abend essen oder zum Abendessen ein Lokal aufsuchen; sie träfen ihre Freunde, sie gingen zusammen spazieren.
Manchmal würde es ihnen vorkommen, als könne ein ganzes Leben harmonisch ablaufen zwischen diesen mit Büchern bedeckten Wänden, zwischen diesen so perfekt angepassten Gegenständen, von denen sie schließlich glaubten, sie seien von jeher nur zu ihrem Gebrauch geschaffen worden, zwischen diesen schönen, einfachen, sanften, leuchtenden Dingen. Aber sie würden sich nicht an sie gekettet fühlen: An manchen Tagen würden sie auf Abenteuer ausgehen. Kein Plan wäre für sie unmöglich. Sie würden weder Hader, Bitterkeit und Neid kennen. Denn ihre Möglichkeiten würden in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit mit ihren Wünschen übereinstimmen. Diese Ausgeglichenheit würden sie Glück nennen, und durch ihre Freiheit, ihre Klugheit, ihre Kultur würden sie es in jedem Augenblick ihres Zusammenlebens zu bewahren und zu entdecken wissen.
II
Sie wären gern reich gewesen. Sie hätten, so glaubten sie, ihren Reichtum nutzen können. Sie hätten zu schauen, zu lächeln, sich zu kleiden gewusst wie reiche Leute. Sie hätten den notwendigen Takt, die nötige Zurückhaltung besessen. Sie hätten ihren Reichtum vergessen, hätten es verstanden, ihn nicht zu zeigen. Sie hätten sich seiner nicht gerühmt. Sie hätten ihn gelebt. Ihr Vergnügen wäre intensiv gewesen. Herumzulaufen, zu flanieren, auszuwählen, zu begutachten hätte ihnen Freude gemacht. Zu leben hätte ihnen Freude gemacht. Ihr Leben wäre Kunst zu leben gewesen.
All diese Dinge sind nicht leicht, im Gegenteil. Für dieses junge Paar, das nicht reich war, es aber zu sein wünschte, gab es, weil es auch nicht wirklich arm war, keine unbequemere Lage. Sie hatten nur, was sie zu haben verdienten. Während sie schon von Raum, Licht und Stille träumten, mussten sie mit der, wenn auch nicht trostlosen, aber – und das war vielleicht schlimmer – einfach beengten Wirklichkeit ihrer zu kleinen Wohnung, ihrer täglichen Mahlzeiten, ihrer armseligen Ferien zurechtkommen. Nur das entsprach ihrer finanziellen Situation, ihrer sozialen Stellung. Nur das war ihre Wirklichkeit, und sie hatten keine andere. Aber neben ihnen, um sie herum, in den Straßen, durch die sie gehen mussten, gab es die trügerischen und zugleich so verlockenden Angebote der Antiquitätenläden, der Delikatessgeschäfte, der Schreibwarenhandlungen. Vom Palais-Royal zum Quartier Saint-Germain, vom Champ-de-Mars zum Étoile, vom Luxembourg zum Montparnasse, von derÎle Saint-Louis zum Marais, von den Ternes zur Opéra, von der Madeleine zum Parc Monceau war ganz Paris eine fortwährende Versuchung. Sie brannten darauf, ihr berauscht zu erliegen, sofort und für immer. Aber der Horizont ihrer Sehnsüchte war hoffnungslos verstellt; ihre großen, fantastischen Träume waren bloße Utopie.
Sie lebten in einer winzigen, bezaubernden Wohnung mit niedrigen Decken, die auf einen Garten ging. Und wenn sie sich an ihre Dachkammer erinnerten – einen engen, düsteren, überheizten Schlauch mit hartnäckigen Gerüchen –, dann lebten sie hier anfangs in einer Art Trunkenheit, die jeden Morgen vom Gezwitscher der Vögel erneuert wurde. Sie öffneten die Fenster und blickten minutenlang vollkommen glückselig auf ihren Hof hinunter. Das Haus war alt, zwar noch nicht baufällig, aber verwittert, voller Risse. Flure und Treppen waren eng und schmutzig, feucht und von fettigem Rauch durchtränkt. Aber zwischen zwei großen Bäumen und fünf Gärtchen von unregelmäßiger Form, die zumeist verwahrlost, aber reich an kleinen Rasenstücken, Blumen in Töpfen, Sträuchern und sogar naiven Statuen waren, verlief ein unregelmäßig, grob gepflasterter Weg, der dem Ganzen ein ländliches Aussehen gab. Es war einer der in Paris seltenen Orte, wo an bestimmten Herbsttagen, nach einem Regen, vom Boden ein fast überwältigender Geruch nach Wald, Humus, faulenden Blättern emporstieg.
Nie wurden sie dieses Zaubers überdrüssig, und noch immer ließen sie sich genauso spontan davon einnehmen wie in den ersten Tagen, aber nach einigen Monaten allzu sorgloser Heiterkeit stellte sich heraus, dass dieser Zauber nicht stark genug war, sie die Mängel ihrer Wohnung vergessen zu lassen. Daran gewöhnt, in ungesunden Zimmern zu hausen, wo sie nur schliefen, während sie ihre Tage in Cafés verbrachten, verging eine Weile, ehe sie bemerkten, dass die banalsten Funktionen des Alltagslebens – Schlafen, Essen, Lesen, Plaudern, Sich Waschen – einen bestimmten Platz erforderten, dessen offenkundiges Fehlen sich nun bemerkbar machte. Sie trösteten sich, so gut sie konnten, priesen die vortreffliche Lage des Stadtviertels, die Nähe der Rue Mouffetard und des Jardin des Plantes, die Ruhe der Straße, den Charme der niedrigen Häuser und die Pracht der Bäume, den Hof während jeder Jahreszeit; aber im Innern begann alles unter der Anhäufung von Gegenständen, Möbeln, Büchern, Tellern, Altpapier, von leeren Flaschen zusammenzubrechen. Ein Abnutzungskrieg begann, aus dem sie nie als Sieger hervorgehen würden.
Bei einer Gesamtfläche von fünfunddreißig Quadratmetern, die sie nie nachzuprüfen wagten, bestand ihre Wohnung aus einer winzigen Diele, einer engen Küche, die zur Hälfte als Bad eingerichtet war, und einem Zimmer bescheidenen Ausmaßes, einem Raum für alles – Bibliothek, Wohn- und Arbeitszimmer, Gästezimmer – sowie aus einem undefinierbaren Winkel, einem Mittelding zwischen Käfig und Korridor, wo gerade ein kleiner Kühlschrank, eine Kochplatte, eine notdürftige Kleiderablage, ein Tisch, an dem sie aßen, und eine Wäschetruhe, die ihnen auch als Bank diente, Platz hatten. An manchen Tagen machte sich diese Enge äußerst unangenehm bemerkbar. Sie erstickten. Sie mochten die Grenzen ihrer zwei Zimmer noch so weit zurückstecken, die Wände einreißen, sich Flure, Einbauschränke, Nebenräume herbeiwünschen, im Traum die Nachbarwohnung annektieren, sie fanden sich am Ende immer in ihrer Parzelle, ihrer einzigen Parzelle wieder: in ihren fünfunddreißig Quadratmetern.
Vernünftige Veränderungen wären zweifellos möglich gewesen: Eine Zwischenwand konnte herausgenommen und dadurch eine große, schlecht genutzte Ecke freigemacht werden, ein zu großes Möbelstück konnte vorteilhaft ersetzt werden, eine Reihe Einbauschränke konnte den Blick auf sich ziehen. Frisch gestrichen, blank geputzt und mit etwas Liebe eingerichtet, wäre ihre Wohnung zweifellos bezaubernd gewesen: das Fenster mit den roten Vorhängen und das mit den grünen Vorhängen, der lange, etwas wacklige, auf dem Flohmarkt erstandene Eichentisch, der unter der sehr schönen Reproduktion einer Seekarte die ganze Länge einer Wand einnahm, ein kleiner Schreibsekretär mit Rollverschluss im Second-Empire-Stil aus Mahagoni mit eingearbeiteten schmalen Messingstäben, von denen mehrere fehlten, teilte das Zimmer in zwei Arbeitsflächen, links für Sylvie, rechts für Jérôme, jede markiert von dem gleichen roten Löschblatt, dem gleichen Glasbaustein, dem gleichem Bleistifttopf; das alte zinneingefasste Glasgefäß, das zu einer Lampe umgearbeitet worden war, der Zehnliterkornscheffel aus metallverstärkten Holzdauben, der als Papierkorb diente, die beiden verschiedenartigen Sessel, die Flechtstühle, der Melkschemel. Und von diesem sauberen, gepflegten, geschickt arrangierten Ensemble wäre eine freundschaftliche Wärme ausgegangen, eine sympathische Atmosphäre von Arbeit, von gemeinsamem Leben.
Aber allein schon der Gedanke an diese Aufwendungen erschreckte sie. Sie hätten sich Geld leihen, sparen, investieren müssen. Sie konnten sich damit nicht anfreunden. Das Herz war unbeteiligt: Sie dachten nur in den Kategorien des Alles oder Nichts. Der Bücherschrank müsste aus hellem Holz sein, oder es gäbe ihn überhaupt nicht. Es gab ihn nicht. Die Bücher stapelten sich auf zwei verschmutzten Regalen und in den Fächern der Wandschränke, die nie dafür vorgesehen waren. Drei Jahre lang blieb eine Steckdose defekt, ohne dass sie sich entschließen konnten, einen Elektriker kommen zu lassen, während an fast allen Wänden grob gespleißte Kabel und unschöne Verlängerungsschnüre entlangliefen. Sie hatten sechs Monate gebraucht, um eine Vorhangschnur zu erneuern. Und die geringste Nachlässigkeit bei der täglichen Instandhaltung hatte innerhalb von vierundzwanzig Stunden eine Unordnung zur Folge, welche die wohltuende Nähe der Bäume und Gärten nur noch unerträglicher machte.
Das Provisorium, der Status quo herrschten unumschränkt. Sie warteten nur noch auf ein Wunder. Sie würden Architekten kommen lassen, Bauunternehmer, Maurer, Klempner, Tapezierer, Maler. Sie wären zu einer Kreuzfahrt aufgebrochen und hätten bei ihrer Rückkehr eine umgebaute, instand gesetzte, neu eingerichtete Wohnung vorgefunden, eine Musterwohnung, wundersam vergrößert, voller Besonderheiten, die zu ihr passten, verstellbare Zwischenwände, Schiebetüren, eine wirksame und unauffällige Heizung, unsichtbare Elektroinstallationen, gediegenes Mobiliar.