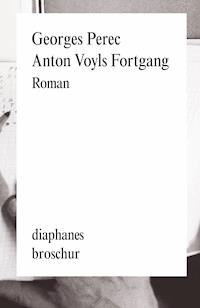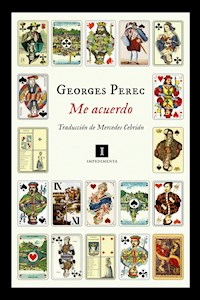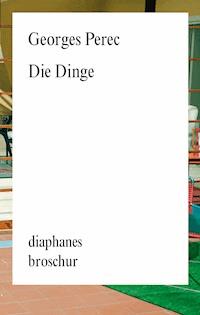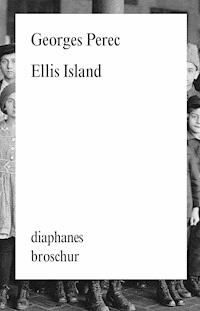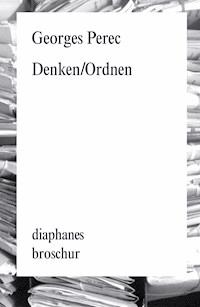12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diaphanes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: diaphanes Broschur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Mit der Neuauflage dieses lange vergriffenen Werks wird eine der »faszinierendsten Autobiographien des 20. Jahrhunderts« (DIE ZEIT) endlich wieder der deutschsprachigen Leserschaft zugänglich. In einer meisterlichen und verstörenden Erzählung verdichten sich Perecs Kindheitsphantasien von der utopischen Insel W, auf der das ganze Leben dem Sport gewidmet ist, mit den Erinnerungen an den Holocaust und den frühen Verlust der Eltern zu einer alptraumhaften Vision, die niemanden unberührt lässt.
Zwei Erzählungen, die sich überkreuzen, verschränken und schließlich in einem fulminanten Crescendo ineinander übergehen, prägen den Aufbau des Buches: die Phantasiewelt, die sich Perec als 13-jähriger Junge erfand, und ein autobiographischer Bericht, der eine chronologische Familiengeschichte nachzuzeichnen versucht. Das Ringen um eigene, intime Erinnerungen im Nebel einer unerträglichen Vergangenheit findet eine unerhört kühne formale Darstellung, die es in der sorgsamen Übersetzung von Eugen Helmlé wiederzuentdecken gilt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Ähnliche
Georges Perec W
oder
die Kindheitserinnerung
Aus dem Französischen
Inhalt
Für E
Erster Teil
Dieser sinnlose Nebel,
in dem sich Schatten bewegen,
wie könnte ich ihn lichten?
Raymond Queneau
I
Ich habe lange gezögert, bevor ich den Bericht über meine Reise nach W in Angriff nahm. Ich entschließe mich heute dazu, von einer zwingenden Notwendigkeit getrieben, weil ich überzeugt bin, dass die Ereignisse, deren Zeuge ich gewesen bin, enthüllt und ans Licht gebracht werden müssen. Ich habe mir die Skrupel – und fast möchte ich sagen, ich weiß nicht warum, die Vorwände – nicht verhehlt, die sich einer Veröffentlichung entgegenzustellen schienen. Lange habe ich das Geheimnis dessen, was ich gesehen hatte, für mich behalten wollen; es stand mir nicht zu, über den Auftrag, den man mir anvertraut hatte, auch nur das mindeste zu verbreiten, zum einen, weil dieser Auftrag vielleicht nicht ausgeführt worden ist – aber wer hätte ihn wohl zu einem guten Ende führen können? –, zum andern, weil der, der ihn mir anvertraut hatte, ebenfalls verschwunden ist.
Lange war ich unentschlossen. Langsam vergaß ich die zweifelhaften Zwischenfälle dieser Reise. Doch meine Träume wurden heimgesucht von den Gespensterstädten, von den blutigen Wettläufen, deren tausendfaches Geschrei ich noch zu hören glaubte, von den wehenden Wimpeln, die der Wind des Meeres peitschte. Verständnislosigkeit, Entsetzen und Faszination verschwammen in eins in diesen Erinnerungen ohne Boden.
Lange habe ich nach den Spuren meiner Geschichte gesucht, mich durch Karten und Jahrbücher, Berge von Archivmaterial gewühlt. Ich habe nichts gefunden und manchmal war mir, als hätte ich geträumt, als wäre alles nur ein unvergesslicher Alptraum gewesen.
Vor … Jahren habe ich in Venedig in einem billigen Restaurant in der Giudecca einen Mann hereinkommen sehen, den ich zu erkennen glaubte. Ich bin auf ihn zugestürzt, aber bereits zwei oder drei Worte der Entschuldigung stammelnd. Es konnte keinen Überlebenden geben. Was meine Augen gesehen hatten, war wirklich geschehen: die Lianen hatten die Verfugungen gelockert, der Wald hatte die Häuser verschlungen; der Sand wehte die Stadien zu, die Kormorane ließen sich zu Tausenden nieder und dann Stille, plötzlich eisige Stille. Was auch geschieht, was ich auch tue, ich war der einzige Mitwisser, das einzige lebende Gedächtnis, das einzige Überbleibsel jener Welt. Dies, mehr noch als jede andere Überlegung, hat mich zu schreiben veranlasst.
Einem aufmerksamen Leser wird aus dem oben Dargelegten sicherlich klar, dass ich bei dem, worüber Zeugnis abzulegen ich mich anschicke, Zeuge war und nicht Beteiligter. Ich bin nicht der Held meiner Geschichte.Ich bin eigentlich auch nicht ihr Dichter. Selbst wenn die Ereignisse, die ich erlebt habe, den bis dahin unbedeutenden Lauf meines Daseins grundlegend verändert haben, selbst wenn sie noch mit ihrem ganzen Gewicht auf meinem Verhalten lasten, der Art und Weise, die Dinge zu sehen, möchte ich mich, um von ihnen zu berichten, doch des kühlen, gelassenen Tons des Ethnologen bedienen: ich habe diese versunkene Welt besichtigt, und folgendes habe ich gesehen. Nicht die hitzige Leidenschaft Achabs erfüllt mich, sondern die freischweifende Träumerei Ishmaels, die Geduld Bartlebys. Sie bitte ich nun noch einmal, wie schon so oft, meine schützenden Schatten zu sein.
Dennoch werde ich jetzt, um einer quasi allgemeinen Regel Genüge zu tun, die ich übrigens auch gar nicht anzweifele, so kurz wie möglich einige Angaben über mein Leben machen und, genauer, über die Umstände, die für meine Reise bestimmend waren.
Ich wurde am 25. Juni 19 … gegen vier Uhr in R., einem kleinen, aus drei Anwesen bestehenden Weiler unweit von A. geboren. Mein Vater besaß eine kleine Landwirtschaft. Er starb kurz vor meinem sechsten Geburtstag an den Folgen einer Verletzung. Er hinterließ eigentlich nur Schulden, und meine ganze Erbschaft bestand aus einigen Kleidungsstücken, etwas Wäsche und drei oder vier Geschirrteilen. Einer der beiden Nachbarn meines Vaters erbot sich, mich an Kindes statt anzunehmen; ich wuchs unter den Seinen auf, halb als Sohn, halb als Knecht.
Mit sechzehn Jahren verließ ich R. und ging in die Stadt; dort übte ich einige Zeit verschiedene Berufe aus, da ich jedoch keinen fand, der mir gefiel, meldete ich mich schließlich freiwillig zum Militär. Ans Gehorchen gewöhnt und mit einer ungewöhnlichen körperlichen Widerstandskraft ausgestattet, hätte ich einen guten Soldaten abgeben können, doch wurde mir bald schon klar, dass ich mich nie wirklich mit dem Soldatenleben anfreunden würde. Nachdem ich ein Jahr in Frankreich im Ausbildungslager T. zugebracht hatte, kam ich zum Kriegseinsatz; ich blieb dort über fünfzehn Monate. In V. desertierte ich während eines Urlaubs. Ich wurde von einer Organisation für Kriegsdienstverweigerer in Obhut genommen, und es gelang mir, mich nach Deutschland abzusetzen, wo ich lange ohne Arbeit war. Ich ließ mich schließlich in H., ganz nahe der luxemburgischen Grenze, nieder. Ich hatte in der größten Autoreparaturwerkstätte der Stadt eine Stelle als Abschmierer gefunden. Ich wohnte in einer kleinen Familienpension und verbrachte die meisten Abende in einer Wirtschaft, wo ich mir das Fernsehprogramm ansah oder manchmal mit dem einen oder andern meiner Arbeitskollegen Skat spielte.
II
Ich habe keine Kindheitserinnerungen. Bis zu meinem zwölften Lebensjahr etwa lässt sich meine Geschichte in wenigen Zeilen zusammenfassen: mit vier Jahren habe ich meinen Vater, mit sechs meine Mutter verloren; ich habe den Krieg in verschiedenen Internaten in Villard-de-Lans verbracht. 1945 adoptierten mich die Schwester meines Vaters und ihr Mann.
Diese Geschichtslosigkeit hat mich lange beruhigt: ihre objektive Dürre, ihre offensichtliche Gewissheit, ihre Unschuld beschützten mich, wovor aber beschützten sie mich, wenn nicht gerade vor meiner Geschichte, meiner erlebten Geschichte, meiner wirklichen Geschichte, meiner eigenen Geschichte, die, wie man vermuten darf, weder dürr noch objektiv, weder offensichtlich gewiss noch gewiss unschuldig war.
»Ich habe keine Kindheitserinnerung«: ich habe diese Behauptung selbstsicher aufgestellt, fast etwas herausfordernd. In dieser Angelegenheit brauchte man mir keine Fragen zu stellen. Sie stand nicht auf meinem Programm. Ich war davon befreit: eine andere Geschichte, die Große, die Geschichte mit der großen Streitaxt, hatte an meiner Stelle die Antwort gegeben: der Krieg, die Lager.
Mit dreizehn Jahren erfand, erzählte und zeichnete ich eine Geschichte. Später vergaß ich sie. Vor sieben Jahren erinnerte ich mich eines Abends in Venedig ganz plötzlich, dass diese Geschichte »W« hieß und dass sie in gewisser Hinsicht wenn nicht die, so doch wenigstens eine Geschichte meiner Kindheit war.
Außer dem plötzlich wiederentdeckten Titel hatte ich praktisch keine Erinnerung an W. Alles, was ich darüber wusste, lässt sich in weniger als zwei Zeilen sagen: das Leben einer ausschließlich mit Sport beschäftigten Gesellschaft auf einer kleinen Insel des Feuerlandes.
Wieder einmal wurden die Fallen des Schreibens aufgestellt. Wieder einmal war ich wie ein Kind, das Versteck spielt und nicht weiß, was es am meisten fürchtet oder wünscht: versteckt bleiben, entdeckt werden.
Ich fand später einige der Zeichnungen wieder, die ich mit dreizehn Jahren gemacht hatte. Mit ihrer Hilfe erfand ich W neu, schrieb es nieder und veröffentlichte das jeweils Fertige zwischen September 1969 und August 1970 als Fortsetzungsroman in der Zeitschrift La Quinzaine littéraire.
Heute, vier Jahre später, versuche ich, dieser langsamen Entschlüsselung ein Ende zu setzen – und damit will ich zweierlei sagen, sowohl ihr »Grenzen zu ziehen« als auch ihr »einen Namen zu geben«. W gleicht meiner olympischen Wahnvorstellung so wenig wie diese olympische Wahnvorstellung meiner Kindheit glich. Doch ich weiß, dass in dem Netz, das sie bilden wie in dem Lesestück, das ich daraus mache, der Weg verzeichnet und beschrieben ist, den ich zurückgelegt habe, die Entwicklung meiner Geschichte und die Geschichte meiner Entwicklung.
III
Ich war seit drei Jahren in H., als meine Wirtin mir am Morgen des 26. Juli einen Brief übergab. Er war tags zuvor in K., einer etwa fünfzig Kilometer von H. entfernt gelegenen größeren Stadt aufgegeben worden. Ich öffnete ihn; er war französisch geschrieben. Das Papier von ausgezeichneter Qualität trug als Briefkopf den Namen
OttoAPFELSTAHL,MD
über einem komplizierten, hervorragend gestochenen Wappen, das zu identifizieren oder auch nur zu entziffern meine Unkenntnis in heraldischen Dingen mir jedoch untersagte; tatsächlich vermochte ich nur zwei von den fünf Symbolen, aus denen es sich zusammensetzte, eindeutig zu erkennen: in der Mitte über die ganze Höhe des Wappens ein zinnenbewehrter Turm, und unten rechts ein aufgeschlagenes Buch mit leeren Seiten; die drei andern blieben trotz der Anstrengungen, die ich unternahm, um sie zu verstehen, dunkel für mich; dabei handelte es sich nicht um abstrakte Symbole, es waren zum Beispiel keine Sparren, auch keine Balken oder Rauten, sondern gewissermaßen doppelte Figuren einer zugleich genauen und zweideutigen Zeichnung, die sich anscheinend auf mehrere Arten deuten ließ, ohne dass man sich je auf eine zufriedenstellende Wahl hätte festlegen können: die eine hätte allenfalls für eine sich windende Schlange gelten können, deren Schuppen Lorbeerblätter gewesen wären, die andere für eine Hand, die gleichzeitig eine Wurzel gewesen wäre; die dritte war ebenso gut ein Nest wie ein glühendes Kohlenbecken oder sogar ein durchbohrtes Herz.
Es gab weder eine Adresse noch eine Telefonnummer. In dem Brief stand lediglich dies:
»Sehr geehrter Herr,
Wir wären Ihnen zu größtem Dank verpflichtet, wenn Sie die Freundlichkeit hätten, uns eine Unterhaltung in einer Sie betreffenden Angelegenheit zu gewähren.
Wir werden am kommenden Freitag, den 27. Juli, im Hotel Berghof in der Nürnbergstraße 18 sein und Sie ab 18 Uhr in der Bar erwarten.
Ihnen im Voraus bestens dankend und uns dafür entschuldigend, dass wir Ihnen im Augenblick keine weitergehenden Erklärungen geben können, verbleiben wir mit vorzüglicher Hochachtung.«
Es folgte eine fast unleserliche Unterschrift, und nur der Name auf dem Briefkopf erlaubte mir die Feststellung, dass sie »O. Apfelstahl« heißen musste.
Es ist leicht zu verstehen, dass dieser Brief mir zunächst einmal Angst machte. Mein erster Gedanke war Flucht: ich war erkannt worden, es konnte sich nur um eine Erpressung handeln. Später gelang es mir, meiner Furcht Herr zu werden: die Tatsache, dass der Brief französisch geschrieben war, bedeutete nicht, dass er an mich, an den, der ich gewesen war, an den Deserteur gerichtet war; mein gegenwärtiger Ausweis machte aus mir einen Welschschweizer, und dass ich französisch sprach, verwunderte niemanden. Die Leute, die mir geholfen hatten, kannten meinen früheren Namen nicht, und es hätte eines unwahrscheinlichen, eines unerklärlichen Zusammentreffens von Umständen bedurft, damit ein Mensch, der mir in meinem früheren Leben begegnet war, mich wiederfand und erkannte. H. ist nur ein kleines Nest, abseits der Hauptverbindungsstraßen, von dem die Touristen nichts wissen, und ich saß am helllichten Tag in der Abschmiergrube oder lag unter den Motoren.Und überhaupt, was hätte derjenige von mir wollen können, der durch einen unbegreiflichen Zufall meine Spur gefunden hätte? Ich hatte kein Geld und auch keine Möglichkeit, mir welches zu beschaffen. Der Krieg, an dem ich teilgenommen hatte, war seit über fünf Jahren beendet, es war mehr als wahrscheinlich, dass ich sogar unter die Amnestie gefallen war.
Ich versuchte, so ruhig wie möglich alle Hypothesen in Betracht zu ziehen, die dieser Brief nahelegte. War er das Ergebnis einer langen, geduldigen Nachforschung, einer Untersuchung, die langsam ihre Schlingen um mich zog? Glaubte man einem Mann zu schreiben, dessen Namen ich vielleicht trug oder dessen Namensvetter ich möglicherweise war? Meinte ein Notar, in mir den Erben eines unermesslichen Vermögens gefunden zu haben?
Ich las den Brief immer wieder, ich versuchte jedes Mal, einen zusätzlichen Anhaltspunkt darin zu entdecken, aber ich fand nur Gründe, noch stärker beunruhigt zu sein. War dieses »wir«, das mir schrieb, eine reine Briefformel, wie sie in fast allen Geschäftsbriefen üblich ist, wo der Unterzeichner im Namen der Gesellschaft spricht, bei der er beschäftigt ist, oder hatte ich es mit zwei, mit mehreren Briefschreibern zu tun? Und was bedeutete das »MD«, das auf dem Briefkopf hinter dem Namen Otto Apfelstahl stand? Im Prinzip konnte es sich nur, wie ich dem Nachschlagewerk entnahm, das ich mir für einige Augenblicke bei der Sekretärin der Autoreparaturwerkstatt ausgeliehen hatte, um die amerikanische Abkürzung von »Medical Doctor« handeln. Aber dieses in den Vereinigten Staaten gebräuchliche Kürzel hatte auf dem Briefkopf eines Deutschen, auch wenn er Arzt war, nichts zu suchen. Oder aber ich musste annehmen, dass dieser Otto Apfelstahl, obgleich er mir aus K. schrieb, kein Deutscher, sondern Amerikaner war; das wäre an sich nichts Erstaunliches: es gibt viele in die Vereinigten Staaten ausgewanderte Deutsche, zahlreiche amerikanische Ärzte sind deutscher oder österreichischer Abstammung; aber was konnte ein amerikanischer Arzt von mir wollen und wozu war er nach K. gekommen? Konnte man sich überhaupt einen Arzt gleich welcher Nationalität vorstellen, der auf seinem Briefpapier zwar auf seinen Beruf hinweist, jedoch alle Referenzen, die man mit Fug und Recht von einem Doktor der Medizin erwarten dürfte – seine Adresse oder die Adresse seiner Praxis, seine Telefonnummer, die Angabe seiner Sprechstunde, sein Aufgabenbereich im Krankenhaus usw. –, durch ein ebenso veraltetes wie sibyllinisches Wappen ersetzt?
Den ganzen Tag über fragte ich mich, was ratsamerweise zu tun sei. Sollte ich zu diesem Treffen gehen? Musste ich unverzüglich fliehen und anderswo, in Australien oder Argentinien, wieder im Untergrund leben, mir von neuem das zerbrechliche Alibi einer neuen Vergangenheit, einer neuen Identität zurechtzimmern? Im Laufe der Zeit wich meine Angst der Ungeduld, der Neugierde; fieberhaft stellte ich mir vor, dass diese Begegnung mein Leben ändern würde.
Ich verbrachte einen Teil des Abends in der Stadtbücherei, blätterte in Wörterbüchern, Enzyklopädien, Fernsprechverzeichnissen, in der Hoffnung, darin Auskünfte über Otto Apfelstahl zu entdecken, eventuelle Angaben über andere Auslegungen der Kürzel »MD« oder über die Bedeutung des Wappens. Aber ich fand nichts.
Von einer hartnäckigen Ahnung befallen, stopfte ich am andern Morgen etwas Wäsche in meine Reisetasche und das, was ich, wäre es nicht derart lächerlich gewesen, meine wertvollsten Besitztümer hätte nennen können: meinen Radioapparat, eine silberne Taschenuhr, die ich sehr gut von meinem Urgroßvater hätte geerbt haben können, eine kleine Perlmuttstatuette, die ich in V. gekauft hatte, und eine seltsame und seltene Muschel, die mir meine Kriegspatin eines Tages geschickt hatte. Wollte ich fliehen? Ich glaube nicht: aber gegen alle Eventualitäten gewappnet sein. Ich sagte meiner Wirtin Bescheid, dass ich vielleicht für einige Tage verreisen würde, und zahlte die Miete, die ich ihr schuldete. Ich ging zu meinem Arbeitgeber; ich sagte ihm, meine Mutter sei gestorben und ich müsse zu ihrer Beerdigung nach Bayern fahren. Er gab mir eine Woche frei und zahlte mir einige Tage im Voraus meinen Monatslohn.
Ich ging zum Bahnhof und stellte meine Tasche in ein Schließfach. Dann saß ich im Wartesaal zweiter Klasse, fast mitten unter einer Gruppe portugiesischer Arbeiter, die nach Hamburg wollten, und wartete bis sechs Uhr abends.
IV
Ich weiß nicht, wo die Bande zerrissen sind, die mich an meine Kindheit fesseln. Wie jeder oder fast jeder habe ich einen Vater und eine Mutter gehabt, einen Topf, ein Gitterbettchen, eine Kinderklapper und später ein Fahrrad, das ich jedoch allem Anschein nach nie bestieg, ohne ein Gebrüll des Entsetzens auszustoßen bei dem bloßen Gedanken, man würde die beiden kleinen Zusatzräder, die mir meine Stabilität sicherten, hochklappen oder gar entfernen wollen. Wie jeder habe ich alles aus meinen ersten Lebensjahren vergessen.
Meine Kindheit gehört zu jenen Dingen, von denen ich weiß, dass ich nicht viel darüber weiß. Sie liegt hinter mir, und doch ist sie der Boden, auf dem ich groß geworden bin, sie hat mir gehört, wie hartnäckig auch immer ich behaupten mag, dass sie mir nicht mehr gehört. Lange Zeit habe ich versucht, diese unbestreitbaren Tatsachen zu umgehen oder zu verschleiern, mich in den harmlosen Status des Waisenkindes, des Ungezeugten, des Kindes von niemand einzukapseln. Doch die Kindheit ist weder Sehnsucht noch Schrecken, noch verlorenes Paradies, noch Goldenes Vlies, sondern Horizont vielleicht, Ausgangspunkt, Koordinaten, von denen aus die Achsen meines Lebens ihren Sinn bekommen können. Selbst wenn ich, um meine unwahrscheinlichen Erinnerungen abzustützen, nichts anderes habe als die Hilfe vergilbter Fotos, spärlicher Zeugnisse und lächerlicher Dokumente, bleibt mir doch keine andere Wahl, als das zu beschwören, was ich allzu lange das Unwiderrufliche genannt habe: das, was einst war, was stehenblieb, was eingezäunt wurde: das, was einst war, sicherlich, weil es heute nicht mehr ist, aber auch das, was einst war, damit ich heute noch bin.
*
Meine beiden ersten Erinnerungen sind nicht völlig unwahrscheinlich, wenn sich auch nicht leugnen lässt, dass die zahlreichen Varianten oder Schein-Einzelheiten, die ich in meine – gesprochenen oder geschriebenen – Berichte eingebracht habe, sie zutiefst verändert, wenn nicht gar vollständig entstellt haben.
Die erste Erinnerung würde sich in dem Raum hinter dem Laden meiner Großmutter abspielen. Ich bin drei Jahre alt. Ich sitze in der Mitte des Zimmers, um mich herum sind jiddische Zeitungen verstreut. Der Kreis der Familie umgibt mich vollständig: diese Empfindung der Einkreisung ist für mich in keiner Weise von dem Gefühl des Erdrücktwerdens oder der Drohung begleitet; im Gegenteil, sie ist herzliche Obhut, Liebe: die ganze Familie, die Familie in ihrer Gesamtheit, ihrer Vollständigkeit ist um das Kind herum versammelt, das gerade geboren wurde (habe ich nicht vor einem Augenblick gesagt, dass ich drei Jahre alt war?), wie ein unüberwindlicher Wall.
Alle sind in Verzückung geraten angesichts der Tatsache, dass ich auf einen hebräischen Buchstaben gezeigt und ihn richtig benannt habe: das Zeichen soll die Form eines im linken unteren Winkel geöffneten Quadrats gehabt haben, so etwas wie
und sein Name soll Gammeth oder Gammel1 gewesen sein. Die ganze Szene gleicht für mich wegen ihres Themas, ihrer Anmut, ihres Lichtes einem Bild, vielleicht von Rembrandt oder vielleicht frei erfunden, das den Titel trüge »Jesus vor den Schriftgelehrten«.2
Die zweite Erinnerung ist kürzer; sie gleicht eher einem Traum; sie scheint mir noch eindeutiger märchenhaft zu sein als die erste; es gibt mehrere Varianten davon, die sich überlagern und sie dadurch immer illusorischer zu machen bestrebt sind. Die einfachste Aussage darüber wäre diese: mein Vater kommt von der Arbeit zurück; er gibt mir einen Schlüssel. In einer Variante ist der Schlüssel aus Gold; in einer anderen ist es kein goldener Schlüssel, sondern ein Goldstück; in wieder einer anderen sitze ich auf dem Topf, als mein Vater von der Arbeit kommt; in einer anderen schließlich gibt mir mein Vater ein Geldstück, ich verschlucke das Geldstück, alle regen sich wahnsinnig auf, am nächsten Tag findet man es in meinem Stuhl.
1. Dieses Übermaß an Genauigkeit genügt, die Erinnerung zunichte zu machen, oder es belastet sie auf jeden Fall mit einem Buchstaben, den sie nicht hatte. Es gibt in der Tat einen Buchstaben namens »Gimmel«, von dem ich gern glauben möchte, er könnte das Initial meines Vornamens sein; er gleicht in keiner Weise dem Zeichen, das ich gemalt habe und das bestenfalls für ein »mem« oder »M« angesehen werden könnte. Esther, meine Tante, hat mir kürzlich erzählt, dass mich meine Tante Fanny, die jüngste Schwester meiner Mutter, 1939 – ich war damals drei Jahre alt – manchmal von Belleville zu ihr nach Hause gebracht habe. Esther wohnte damals in der Rue des Eaux, ganz in der Nähe der Avenue de Versailles. Wir gingen an die Seine zum Spielen, ganz in die Nähe der großen Sandhaufen; eines meiner Spiele bestand darin, zusammen mit Fanny Buchstaben in den Zeitungen zu entziffern, keinen jiddischen Zeitungen, sondern französischen.
2. In dieser Erinnerung oder Schein-Erinnerung ist Jesus ein von wohlwollenden Greisen umgebenes Neugeborenes. Alle Gemälde mit dem Titel »Jesus unter den Schriftgelehrten« stellen ihn als Erwachsenen dar. Das Gemälde, auf das ich mich beziehe, ist, falls es überhaupt existiert, viel wahrscheinlicher eine »Darstellung Jesu im Tempel«.
V
Es war genau sechs Uhr, als ich durch die Drehtür des Hotels Berghof ging. Die große Hotelhalle war so gut wie leer; nachlässig an einen Pfeiler gelehnt, die Arme verschränkt, schwatzten drei junge Pagen in roten Westen mit Goldknöpfen leise miteinander. Der Portier, an seinem weiten flaschengrünen Überwurf und seinem Kutscherhut mit Federbusch erkennbar, durchquerte die Halle in der Diagonalen. Er trug zwei große Koffer und schritt einem weiblichen Hotelgast mit einem kleinen Hund im Arm voran.
Die Bar war am hinteren Ende der Halle und durch eine mit hohen Grünpflanzen bewachsene Staketenwand kaum von ihr getrennt. Zu meiner großen Überraschung saß kein einziger Gast dort; in der Luft schwebte nicht der Rauch der Zigarren, der die Atmosphäre fast undurchsichtig, ein wenig schwül und erstickend macht; dort, wo ich gedämpfte Unordnung erwartete, das Geräusch von zwanzig Gesprächen mit einer seichten Hintergrundmusik, waren nur saubere Tische, ordentlich aufgelegte Zierdecken, Aschenbecher aus funkelndem Kupfer. Die Klimaanlage machte den Raum fast kühl. Hinter einer Theke aus dunklem Holz und Edelstahl saß ein Kellner in einer etwas zerknautschten Jacke und las die Frankfurter Zeitung.
Ich setzte mich ganz hinten an einen Tisch. Der Kellner sah einen Augenblick von seiner Zeitung auf und schaute mich fragend an; ich bestellte ein Bier. Er brachte es mir, wobei er die Füße nachzog; ich bemerkte, dass er ein sehr alter Mann war, seine stark gerunzelte Hand zitterte ein wenig.
»Nicht viel Betrieb«, sagte ich, um etwas zu sagen und weil mir das doch erstaunlich vorkam. Er nickte, ohne zu antworten, dann fragte er plötzlich:
»Möchten Sie Brezeln?«
»Wie bitte?«, machte ich, ohne zu verstehen.
»Brezeln. Brezeln, die Sie zu Ihrem Bier essen können.«
»Nein danke. Ich esse nie Brezeln. Geben Sie mir lieber eine Zeitung.«
Er drehte sich auf dem Absatz um, aber wahrscheinlich hatte ich mich schlecht ausgedrückt oder er hatte überhört, worum ich ihn gebeten hatte, denn anstatt zu den Zeitungshaltern hinüberzugehen, die an der Wand hingen, kehrte er zu seiner Theke zurück, stellte sein Tablett ab und ging durch eine kleine Tür hinaus, die wohl zu den Küchenräumen führte.
Ich sah auf meine Uhr. Sie zeigte erst fünf Minuten nach sechs. Ich stand auf, ging mir eine Zeitung holen. Es war die wöchentlich erscheinende Wirtschaftsbeilage einer Luxemburger Tageszeitung, Das Luxemburger Wort, schon über zwei Monate alt. Ich durchflog sie gut zehn Minuten lang, während ich mein Bier trank, völlig allein in der Bar.
Man konnte nicht sagen, dass sich Otto Apfelstahl verspätet hatte; man konnte auch nicht sagen, dass er pünktlich war. Alles, was man sagen konnte, alles, was man sich sagen konnte, alles, was ich mir sagen konnte, war, dass man bei jeder Verabredung immer einen Spielraum von einer Viertelstunde einkalkulieren muss. Ich hätte es gar nicht nötig haben sollen, mich zu beruhigen, ich hatte überhaupt keinen Grund, beunruhigt zu sein, und dennoch fühlte ich mich durch das Fernbleiben Otto Apfelstahls unbehaglich. Es war über sechs Uhr, ich war in der Bar, ich erwartete ihn, während eigentlich er in der Bar hätte sein müssen, um mich zu erwarten.
Gegen zwanzig nach sechs – ich hatte die Zeitung weggelegt und mein Bier schon lange ausgetrunken – beschloss ich aufzubrechen. Vielleicht lag an der Hotelrezeption eine Botschaft von Otto Apfelstahl für mich, vielleicht erwartete er mich in einem der Leseräume oder in der Halle oder in seinem Zimmer, vielleicht entschuldigte er sich und machte mir den Vorschlag, diese Unterredung auf später zu verschieben. Plötzlich herrschte in der Hotelhalle großer Trubel: fünf oder sechs Personen tauchten in der Bar auf, setzten sich geräuschvoll an einen Tisch. Fast zur gleichen Zeit kamen zwei Kellner hinter der Theke hervor. Sie waren jung und ich stellte unwillkürlich fest, dass sie beide zusammen wohl knapp das Alter desjenigen erreichen mochten, der mich bedient hatte.
In dem Moment, als ich einen der Kellner herbeirief, um mein Bier zu bezahlen – aber er schien zu sehr damit beschäftigt, die Bestellungen der Gäste entgegenzunehmen, die sich gerade niedergelassen hatten, als dass er mir Aufmerksamkeit geschenkt hätte –, erschien Otto Apfelstahl: ein Mann, der, kaum dass er einen öffentlichen Ort betreten hat, stehenbleibt und mit besonderer Sorgfalt um sich blickt, mit einem Gefühl neugieriger Aufmerksamkeit, und, sobald sein Blick dem Ihren begegnet ist, unverzüglich weitergeht, kann niemand anderes sein als Ihr Gesprächspartner.
Er war ein Mann von etwa vierzig Jahren, eher klein, sehr mager, mit schmalem, hagerem Gesicht und sehr kurzem, schon angegrautem Haar im Bürstenschnitt. Er trug einen dunkelgrauen Zweireiher. Falls man einem Menschen überhaupt seinen Beruf vom Gesicht ablesen kann, machte er jedenfalls nicht den Eindruck eines Arztes, sondern eher eines Geschäftsmannes, eines Prokuristen einer großen Bank oder eines Rechtsanwalts.
Er blieb einige Zentimeter vor mir stehen.
»Sie sind Gaspard Winckler?«, fragte er mich, aber der Satz war kaum eine Frage, eher eine Feststellung.
»Äh … ja«, antwortete ich stupide und wollte gleichzeitig aufstehen, doch er hielt mich mit einer Gebärde zurück.
»Nein, nein, bleiben Sie sitzen, setzen wir uns, so lässt es sich besser plaudern.«
Er setzte sich. Er betrachtete einen Augenblick mein leeres Glas.
»Wie ich sehe, trinken Sie gern Bier.«
»Es kommt schon mal vor«, sagte ich, ohne so recht zu wissen, was ich antworten sollte.
»Ich trinke lieber Tee.«
Er wandte sich leicht der Theke zu und hob zwei Finger. Der Kellner kam sofort.
»Für mich einen Tee. Trinken Sie noch ein Bier?«, fragte er mich.
Ich stimmte zu.
»Und ein Bier für den Herrn.«
Ich fühlte mich immer unbehaglicher.
Sollte ich ihn fragen, ob er Otto Apfelstahl hieß?Sollte ich ihn ganz unvermittelt und geradeheraus fragen, was er von mir wollte? Ich holte mein Zigarettenpäckchen aus der Tasche und bot ihm eine Zigarette an, doch er lehnte ab.
»Ich rauche nur Zigarren, und auch die nur nach dem Abendessen.«
»Sind Sie Arzt?«
Meine Frage schien ihn – ganz im Gegensatz zu dem, was ich naiverweise angenommen hatte – nicht zu überraschen. Er lächelte kaum.
»Inwiefern führt Sie die Tatsache, dass ich meine Zigarre nur nach dem Abendessen rauche, zu der Annahme, ich könne Arzt sein?«
»Weil das eine der Fragen ist, die ich mir über Ihre Person stelle, seit ich Ihren Brief bekommen habe.«
»Stellen Sie sich noch viele andere?«
»Einige schon, ja.«
»Welche?«
»Nun, zum Beispiel, was Sie von mir wollen.«
»Das ist in der Tat eine Frage, die sich aufdrängt. Möchten Sie, dass ich sofort darauf antworte?«
»Ich wäre Ihnen dafür sehr dankbar.«
»Darf ich zuvor Ihnen eine Frage stellen?«
»Bitte sehr.«