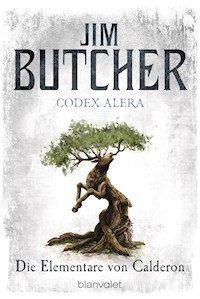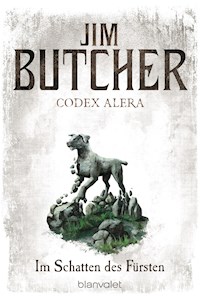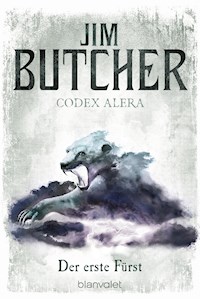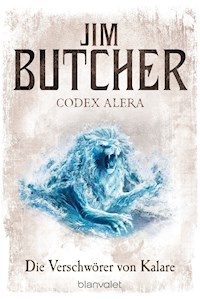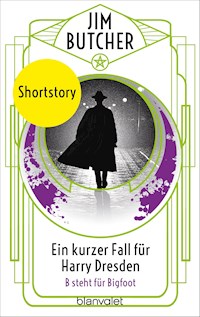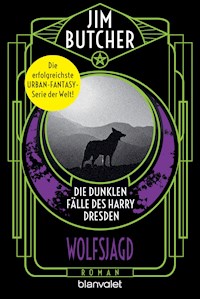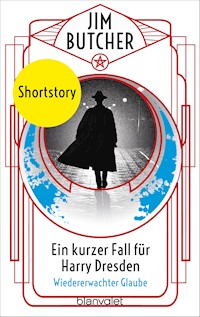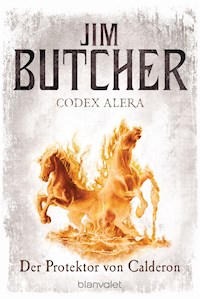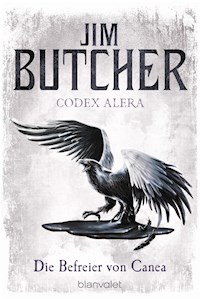9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Harry-Dresden-Serie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Manche Kämpfe kann man nicht gewinnen. Doch der sichere Tod wird Harry Dresden nicht davon abhalten, dem Bösen entgegenzutreten … Der fünfte dunkle Fall für Harry Dresden.
Mein Name ist Harry Blackstone Copperfield Dresden, und die vielleicht schrecklichsten Gegner, denen ich je entgegentreten musste, sind die Denarier. Ihre kämpferischen Fähigkeiten sind schrecklich, und die Listigkeit ihres Anführers wird vermutlich nur vom Höllenfürsten selbst übertroffen. Während ich versuchte, eine christliche Reliquie aufzuspüren, reichte nur ein Denarier, um mich fertig zu machen – und dabei gibt es dreißig von ihnen! Einen für jeden silbernen Denar, den Judas für den Verrat an Jesus erhalten hat. Zum Glück retteten mich drei leibhaftige Kreuzritter. Sie verlangten, dass ich mich aus ihrem Kampf heraushielt, denn es war prophezeit, dass ich sonst sterben würde. Doch sie kannten nicht die ganze Vorhersagung! Ohne mich würden die drei Ritter sterben, und Chicago würde vernichtet werden …
Die dunklen Fälle des Harry Dresden:
1. Sturmnacht
2. Wolfsjagd
3. Grabesruhe
4. Feenzorn
5. Silberlinge
6. Bluthunger
weitere Titel in Vorbereitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Ähnliche
Buch
Mein Name ist Harry Blackstone Copperfield Dresden, und die vielleicht schrecklichsten Gegner, denen ich je entgegentreten musste, sind die Denarier. Ihre kämpferischen Fähigkeiten sind schrecklich, und die Listigkeit ihres Anführers wird vermutlich nur vom Höllenfürsten selbst übertroffen. Während ich versuchte, eine christliche Reliquie aufzuspüren, reichte nur ein Denarier, um mich fertigzumachen – und dabei gibt es dreißig von ihnen! Einen für jeden silbernen Denar, den Judas für den Verrat an Jesus erhalten hat. Zum Glück retteten mich drei leibhaftige Kreuzritter. Sie verlangten, dass ich mich aus ihrem Kampf heraushielt, denn es war prophezeit, dass ich sonst sterben würde. Doch sie kannten nicht die ganze Vorhersagung! Ohne mich würden die drei Ritter sterben, und Chicago würde vernichtet werden …
Autor
Jim Butcher ist der Autor der Dresden Files, des Codex Alera und der Cinder-Spires-Serie. Sein Lebenslauf enthält eine lange Liste von Fähigkeiten, die vor ein paar Jahrhunderten nützlich waren – wie zum Beispiel Kampfsport –, und er spielt ziemlich schlecht Gitarre. Als begeisterter Gamer beschäftigt er sich mit Tabletop-Spielen in verschiedenen Systemen, einer Vielzahl von Videospielen auf PC und Konsole und LARPs, wann immer er Zeit dafür findet. Zurzeit lebt Jim in den Bergen außerhalb von Denver, Colorado.
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Jim Butcher
SILBERLINGE
DIE DUNKLEN FÄLLE DES HARRY DRESDEN
Roman
Deutsch von Jürgen Langowski
Die Originalausgabe erschien 2000 unter dem Titel »Summer Knight (The Dresden Files 5)« bei Penguin RoC, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2002 by Jim ButcherPublished by Arrangement with IMAGINARY EMPIRE LLC
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Peter Thannisch
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
Illustrationen: © www.buerosued.de
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-29105-1V001
www.blanvalet.de
In Erinnerung an Plumicon und Ersha, die gefallenen Helden
1. Kapitel
Manche Dinge passen einfach nicht zusammen, etwa Öl und Wasser oder Orangensaft und Zahnpasta.
Das gilt auch für Magier und das Fernsehen.
Die Scheinwerfer blendeten mich, ihre Hitze ließ mir Bäche von Schweiß übers Gesicht laufen, die das pfannkuchendicke Make-up, das mir ein gestresster Handlanger ein paar Minuten vorher im Gesicht verteilt hatte, wegzuspülen drohten. Auf den Kameras blinkten Lichter, die Erkennungsmelodie der Talkshow lief, und das Studiopublikum skandierte: »Lar-ry, Lar-ry, Lar-ry!«
Larry Fowler, ein kleiner Mann mit einem makellosen Anzug, trat durch die Doppeltür im Hintergrund des Studios und marschierte zur Bühne. Er setzte sein Kukident-Lächeln auf und schüttelte einem Dutzend Zuschauern, die an den Enden der einzelnen Reihen saßen, im Vorbeigehen die Hände. Die Zuschauer pfiffen und jubelten. Ich zuckte in dem Lärm zusammen, unter meinem weißen Anzughemd und der Jacke lief mir der Schweiß über die Rippen. Vorübergehend spielte ich mit dem Gedanken, schreiend hinauszulaufen.
Glauben Sie aber bitte nicht, ich hätte Lampenfieber gehabt. Ganz und gar nicht. Es war einfach nur ziemlich heiß auf der Bühne. Nervös leckte ich mir über die Lippen und vergewisserte mich für alle Fälle, wo die Notausgänge waren. So was ist gut zu wissen, falls man schleunigst das Weite suchen muss. Die Lichter und der Lärm machten es mir schwer, meine Konzentration zu halten, und der Spruch, den ich um mich gewirkt hatte, ließ ein wenig nach. Ich schloss einen Moment die Augen, bis er sich wieder stabilisiert hatte.
Neben mir saß ein dicker Mann mit einem Kahlkopf, etwa Ende vierzig und in einem Anzug, der erheblich besser war als meiner. Mortimer Lindquist wartete gelassen und mit höflichem Lächeln, murmelte aber, ohne die Lippen zu bewegen: »Geht’s Ihnen nicht gut?«
»Ich habe Wohnungsbrände erlebt, die angenehmer waren als das hier.«
»Sie haben um dieses Treffen gebeten, nicht ich«, erwiderte Mortimer. Mit gerunzelter Stirn beobachtete er Fowler, der gerade einer jungen Frau die Hand schüttelte. »So ist das Showgeschäft.«
»Wird es lange dauern?«, fragte ich Morty.
Er blickte zum freien Stuhl neben ihm und einem weiteren neben mir. »Zwei Überraschungsgäste. Es könnte wohl eine Weile dauern. Sie zeichnen alles auf und schneiden später die besten Stücke zusammen.«
Ich seufzte. Direkt nachdem ich meine Arbeit als Privatdetektiv aufgenommen hatte, war ich schon einmal in der Larry-Fowler-Show gewesen, und das hatte sich als kapitaler Fehler erwiesen. Ich hatte danach gegen eine ganze Woge von Beschimpfungen ankämpfen müssen.
»Was haben Sie denn herausgefunden?«, fragte ich.
Mort warf mir einen nervösen Blick zu. »Nicht sehr viel.«
»Nun machen Sie schon, Mort.«
Er öffnete den Mund, aber dann bemerkte er, dass Larry Fowler bereits die Treppe herauflief und die Bühne betrat. »Zu spät. Warten wir auf die Werbeunterbrechung.«
Larry Fowler tänzelte auf uns zu und schüttelte erst mir und dann Mort ausgiebig und mit maßlos übertriebener Begeisterung die Hand. »Willkommen in der Show«, sagte er in ein Handmikrofon. Dann wandte er sich zur nächsten Kamera um. »Hexerei und Zauberei – Fake oder fabelhaft? Als ersten Studiogast begrüße ich das Chicagoer Medium und den medialen Berater Mortimer Lindquist, der bereit ist, uns in sein geheimes Wissen einzuweihen.«
Die Zuschauer applaudierten höflich.
»Neben ihm sitzt Harry Dresden, Chicagos einziger professioneller Magier.«
Diesmal kicherten die Leute, während sie klatschten.
Ich kann nicht behaupten, dass ich schockiert war. Die Menschen glauben heutzutage nicht mehr an das Übernatürliche, denn was in dieses Reich gehört, macht ihnen Angst. Es ist viel bequemer, sich einzureden, niemand könnte mit magischen Mitteln zuschlagen und einen töten und dass Vampire nur in Filmen vorkämen und Dämonen nichts als psychische Fehlfunktionen seien.
Das trifft ganz und gar nicht zu, aber man kann mit dieser Einstellung ruhiger schlafen.
Obwohl ich an derartige Verleugnungen gewöhnt bin, wurde mein Gesicht heiß. Ich mag es nicht, wenn man mich auslacht. Alte, halb vergessen geglaubte Verletzungen mischten sich mit meiner Nervosität, und ich bemühte mich erneut, den Dämpfungsspruch zu erhalten.
Ja, ich meine einen Zauberspruch. Ich bin nämlich tatsächlich ein Magier, ich arbeite mit Magie. Mir sind Vampire, Dämonen und viele andere Wesen begegnet. Ich habe noch die Narben und kann es beweisen. Das Problem ist allerdings, dass die moderne Technik versagt, sobald ein Magier in der Nähe ist. Computer stürzen ab, Glühbirnen brennen durch, Autoalarmanlagen spielen aus keinem erkennbaren Grund verrückt. Ich hatte mir einen Spruch zurechtgelegt, mit dem ich die Ausstrahlung meiner Magie wenigstens vorübergehend unterdrücken konnte, um nicht gleich die komplette Studiobeleuchtung und alle Kameras in die Luft zu jagen oder den Feueralarm auszulösen.
Das war auch so schon eine komplizierte Angelegenheit und ein schwieriger Spruch dazu. Bisher war es einigermaßen gut gegangen, aber dann zuckte gleich neben mir ein Kameramann zusammen und riss sich den Kopfhörer herunter, der eine pfeifende Rückkopplung von sich gab.
Ich schloss die Augen, schob mein Unbehagen und meine Verlegenheit beiseite und konzentrierte mich auf den Spruch. Die Rückkopplung hörte auf.
»Nun gut«, sagte Larry nach einer halben Minute Vorgeplänkel. »Morty, Sie waren schon mehrmals als Gast in dieser Show. Würden Sie unseren Zuschauern bitte noch einmal erklären, was Sie tun?«
Mortimer riss die Augen weit auf und flüsterte: »Ich treffe mich mit Toten.«
Die Zuschauer lachten.
»Etwas ernsthafter ausgedrückt, ich führe Seancen durch«, fuhr Mortimer fort. »Ich bemühe mich, Menschen zu helfen, die einen nahen Angehörigen verloren haben, wenn sie mit den Verstorbenen im Jenseits Kontakt aufnehmen möchten, um irgendetwas zu klären, das hier auf der Erde ungeklärt blieb. Außerdem biete ich Weissagungen an, die meinen Klienten bei wichtigen Entscheidungen helfen. So kann ich sie vor möglichen Gefahren warnen.«
»Wirklich?«, sagte Larry. »Könnten Sie uns dies einmal demonstrieren?«
Mortimer schloss die Augen und legte die Fingerspitzen der rechten Hand auf den Nasenrücken. Dann tönte er mit Grabesstimme: »Die Geister sagen mir … dass bald noch zwei weitere Gäste eintreffen werden.«
Die Zuschauer lachten, und Mortimer nickte grinsend. Er wusste, wie man mit einem großen Publikum umgehen muss.
Larry lächelte nachsichtig. »Und warum sind Sie heute hier?«
»Ich will einfach nur die Menschen auf die übersinnliche und paranormale Ebene aufmerksam machen. In einer neueren Umfrage erklärten fast achtzig Prozent der erwachsenen Amerikaner, dass sie an die Existenz von Geistern der Toten, von Gespenstern, glauben. Ich will den Menschen nur helfen zu erkennen, dass Geister tatsächlich existieren und dass es gar nicht wenige Leute gibt, die eigenartige, unerklärliche Begegnungen mit ihnen hatten.«
»Vielen Dank. Harry … Ich darf Sie doch Harry nennen?«
»Aber klar, Sie sind der Boss«, erwiderte ich.
Larrys Lächeln gefror ein wenig. »Können Sie uns etwas über Ihre Arbeit erzählen?«
»Ich bin Magier«, sagte ich. »Ich finde verlorene Gegenstände, untersuche paranormale Vorfälle und bilde Menschen aus, die Schwierigkeiten damit haben, wenn sich ihre Fähigkeiten auf einmal zeigen.«
»Trifft es nicht auch zu, dass Sie für eine Sondereinheit der Chicagoer Polizei arbeiten?«
»Gelegentlich«, räumte ich ein. Ich wollte nach Möglichkeit nicht über die Polizei reden, denn die Verantwortlichen dort wären sicher nicht begeistert, wenn sie in der Larry-Fowler-Show zum Gespött gemacht würden. »Viele Polizeibehörden im ganzen Land beauftragen freie Berater, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.«
»Warum sind Sie hier?«
»Weil ich pleite bin und Ihr Produzent mir das doppelte Honorar zahlt.«
Wieder lachten die Zuschauer, dieses Mal etwas freundlicher.
Larry Fowlers Augen blitzten hinter der Brille ein wenig ungehalten, und sein Lächeln ähnelte eher einem Zähneknirschen. »Jetzt mal im Ernst, Harry. Was haben Sie uns mitzuteilen?«
»Meine Gründe sind die gleichen, die auch Mort … äh … Mortimer hier genannt hat«, erwiderte ich. Das entsprach der Wahrheit. Ich war gekommen, um Mort zu treffen und einige Informationen von ihm zu erhalten. Er war gekommen, um mich zu treffen, weil er ansonsten nicht in meiner Nähe gesehen werden wollte. Man könnte sagen, dass ich nicht bei allen Zeitgenossen den besten Ruf genieße.
»Sie behaupten also, Sie könnten magische Dinge tun«, sagte Larry.
»Ja.«
»Könnten Sie uns das vielleicht vorführen?«, drängte Larry.
»Das könnte ich, aber ich halte das für keine gute Idee.«
Larry nickte und warf einen vielsagenden Blick in Richtung Publikum. »Warum?«
»Das würde wahrscheinlich Ihrer Studioeinrichtung schaden.«
»Aber natürlich«, sagte Larry. Er zwinkerte dem Publikum zu. »Das wollen wir nach Möglichkeit vermeiden, nicht wahr?«
Einige Leute lachten, ein paar andere johlten. Mir kamen Szenen aus »Carrie« und »Der Feuerteufel« in den Sinn, doch ich beherrschte mich und erhielt den Dämpfungsspruch aufrecht. Schließlich bin ich ein Meister der Selbstbeherrschung. Dennoch blickte ich einmal mehr sehnsüchtig zum Notausgang hinter der Bühne.
Larry absolvierte den Gesprächsteil der Talkshow und redete über Kristalle, ESP und Tarotkarten. Meist antwortete Mort. Ich steuerte hin und wieder etwas Einsilbiges bei.
Nach einigen Minuten sagte Larry: »Wir sind gleich wieder da, bleiben Sie dran.« Bühnenhelfer hoben Schilder mit der Aufschrift APPLAUS, und die Kameras hielten auf die pfeifenden, johlenden Zuschauer.
Larry warf mir einen genervten Blick zu und stakste hinter die Bühne, wo er eine Maskenbildnerin wegen seiner Frisur zur Schnecke machte.
Das war die Gelegenheit, mich zu Mort hinüberzubeugen und ihn zu fragen: »Also, was haben Sie herausgefunden?«
Der pummelige Ektomant schüttelte den Kopf. »Nichts Konkretes. Ich muss erst wieder mit den Toten Kontakt aufnehmen.«
»Trotzdem, Sie haben in dieser Hinsicht mehr Informanten als ich«, antwortete ich. »Meine Quellen verfolgen nicht sehr aufmerksam, wer in der letzten Zeit gestorben ist, deshalb erfahre ich nicht viel. Lebt sie denn wenigstens noch?«
Er nickte. »Ja, sie lebt noch. So viel weiß ich sicher. Sie ist derzeit in Peru.«
»In Peru?« Einerseits war ich sehr erleichtert, dass Susan noch lebte, andererseits fragte ich mich, was sie dort zu suchen hatte. »Das ist doch das Revier des Roten Hofs.«
»In gewisser Weise«, bestätigte Mort. »Allerdings sind die meisten in Brasilien und Yucatán. Ich habe zwar versucht, ihren genauen Aufenthaltsort herauszufinden, wurde aber abgeblockt.«
»Von wem?«
Mort zuckte mit den Achseln. »Das kann ich nicht sagen, tut mir leid.«
»Nein, schon gut. Vielen Dank, Mort.«
Dann lehnte ich mich zurück und dachte über die Neuigkeiten nach.
Susan Rodriguez arbeitete als Reporterin für eine Illustrierte namens Arcane. Schon kurz nachdem ich mein Büro eröffnet hatte, war ihr Interesse an mir erwacht. Sie hatte mich erbarmungslos verfolgt, um mehr über jene Wesen herauszufinden, auf die ich in der Nacht traf. Wir hatten uns näher kennengelernt, und unser erstes Date endete mit mir mitten in einem Gewitter nackt auf der Straße, während Blitze ein Krötenmonster in klebrige Stücke zerhackt hatten. Danach hatte sie über einige Begegnungen mit Wesen berichtet, die mit meinen Fällen zu tun gehabt hatten.
Zwei Jahre später war sie mir trotz meiner Warnungen heimlich in ein Vampirnest zu einem großen Fest gefolgt. Eine Edle des Roten Hofs der Vampire hatte sie geschnappt und die Verwandlung von einer Sterblichen in eine Vampirin in Gang gesetzt. Das war die Rache für etwas gewesen, das ich ihr angetan hatte. Die adlige Vampirin hatte sich aufgrund ihrer Stellung am Roten Hof für unantastbar gehalten und gehofft, dass ich davor zurückschrecken würde, mich mit dem ganzen Hof anzulegen. Sie hatte gedroht, zwischen dem Weißen Rat der Magier und dem Roten Hof der Vampire würde ein weltweiter Krieg ausbrechen, würde ich Susan gewaltsam befreien.
Ich hatte mich für den Kampf entschieden.
Die Vampire konnten mir nicht verzeihen, dass ich ihnen Susan entrissen hatte, wahrscheinlich nicht zuletzt, weil eine ganze Reihe von ihnen, darunter mehrere Adlige, im Laufe der Auseinandersetzung verbrannt waren. Deshalb wollte Mort sich auch nicht mit mir blicken lassen. Er hatte mit dem Krieg nichts zu tun, und so sollte es auch bleiben.
Jedenfalls war Susans Transformation noch nicht vollendet, doch sie spürte bereits den Blutdurst der Vampire, und wenn sie dem jemals nachgab, würde sie unwiderruflich zum Roten Hof gehören. Ich hatte ihr einen Heiratsantrag gemacht und ihr versprochen, einen Weg zu finden, ihr die Menschlichkeit zurückzugeben. Sie hatte abgelehnt und die Stadt verlassen, um allein damit zurechtzukommen. Ich wollte sie immer noch aus ihrer Lage befreien, hatte aber seit ihrem Verschwinden nur ein paar Postkarten von ihr bekommen.
Vor zwei Wochen hatte die Redakteurin des Arcane mich angerufen, weil Susan ihre Kolumne noch nicht geschickt hatte, und mich gefragt, wie man sie erreichen könne. Das wusste ich nicht, doch ich hatte mich daraufhin ein wenig umgehört und mich schließlich an Mort Lindquist gewandt, der mit seinen Kontakten in der Geisterwelt möglicherweise mehr Erfolg hatte als ich.
Auch er hatte nicht viel anzubieten, aber immerhin hatte ich nun erfahren, dass sie noch lebte, und war halbwegs beruhigt.
Inzwischen lief wieder die Erkennungsmelodie, und Larry kehrte auf die Bühne zurück. Die Lautsprecher quietschten und kreischten, als er zu sprechen begann. Meine Kontrolle ließ mit jeder Minute weiter nach, denn der Dämpfungsspruch war erheblich schwieriger zu halten, als ich es mir vorgestellt hätte. Ich konzentrierte mich mühsam, und die Lautsprecher beruhigten sich und knackten nur noch gelegentlich.
»Willkommen zur Fortsetzung der Show«, sagte Larry in eine Kamera. »Heute unterhalten wir uns mit den Meistern des Paranormalen, die hierhergekommen sind, um unserem Studiopublikum und Ihnen zu Hause ihre Geheimnisse zu offenbaren. Zur Vertiefung der Diskussion habe ich zwei Experten mit gegensätzlichen Standpunkten hinzugebeten. Hier sind sie.«
Das Publikum applaudierte, als von entgegengesetzten Seiten zwei Männer die Bühne betraten.
Der erste setzte sich auf den Stuhl neben Morty. Er war ein wenig größer als der Durchschnitt und schmal, seine Haut war von der Sonne dunkel und ledrig. Sein Alter war schwer zu schätzen, vermutlich war er zwischen vierzig und sechzig. Seine grauen Haare waren akkurat geschnitten, und er trug einen schwarzen Anzug mit einem weißen Stehkragen, der ihn als Pfarrer auswies, dazu einen Rosenkranz und ein Kruzifix um den Hals. Lächelnd nickte er Mort und mir zu und gab Larry die Hand.
»Ich möchte Ihnen nun Father Vincent vorstellen, der den weiten Weg vom Vatikan hierhergekommen ist. Er gilt in der katholischen Kirche als führender Gelehrter und Forscher auf dem Gebiet der Hexerei und der Magie und beschäftigt sich sowohl mit der historischen als auch mit der psychologischen Perspektive. Father, willkommen in unserer Show.«
Vincents Stimme klang ein wenig heiser, doch er sprach Englisch mit jenem kultivierten Akzent, der als Kennzeichen einer teuren Ausbildung gilt. »Danke, Larry. Ich freue mich, hier zu sein.«
Dann fiel mein Blick auf den zweiten Mann, der sich neben mir niedergelassen hatte. »Von der Universität von Brasilien in Rio de Janeiro begrüßen wir Doktor Paolo Ortega, den weltberühmten Forscher, der schon viele übernatürliche Legenden widerlegt hat.«
Larry wollte noch etwas anderes sagen, doch ich hörte es nicht mehr, sondern starrte nur den Mann neben mir an, während die Erinnerungen wach wurden. Er war von mittlerer Größe und recht kräftig gebaut, mit breiten Schultern und einem voluminösen Oberkörper. Seine Haut war dunkel, die schwarzen Haare ordentlich gekämmt, und der grau und silbern schimmernde Anzug war modisch und geschmackvoll.
Er war ein Herzog vom Roten Hof – ein alter, äußerst gefährlicher Vampir, der mich nun aus weniger als einem Meter Entfernung anlächelte. Mein Puls stieg von sechzig auf hundertfünfzig Millionen, und die nackte Angst durchzuckte mich mit silbernen Blitzen.
Gefühle haben große Kraft. Sie sind der Brennstoff für einen großen Teil meiner Magie. Als mich die Angst packte, verdoppelte sich schlagartig der Druck, den mein Dämpfungsspruch eindämmen musste. In der nächsten Kamera blitzte es, eine Rauchwolke stieg auf, und der Kameramann taumelte zurück und riss sich mit einem Fluch, den sie auf jeden Fall herausschneiden mussten, den Kopfhörer herunter. Es roch nach verbranntem Gummi, die Rauchwolke über der Kamera verdichtete sich, und in den Studiolautsprechern kreischten Rückkopplungen.
»Tja«, sagte Ortega halblaut, »wie schön, Sie mal wieder zu sehen, Mister Dresden.«
Ich schluckte und durchwühlte hektisch meine Hosentaschen, in denen ich ein paar magische Hilfsmittel zur Selbstverteidigung verstaut hatte. Ortega legte mir eine Hand auf den Arm. Es sah überhaupt nicht so aus, als strengte er sich dabei an, doch es fühlte sich an wie ein Schraubstock. Die Schmerzen schossen durch meinen Ellenbogen bis zur Schulter hinauf. Ich sah mich um, aber im Augenblick starrten alle die ausgefallene Kamera an.
»Immer mit der Ruhe«, sagte Ortega mit starkem südamerikanischem Akzent. »Ich bin nicht gekommen, um Sie vor laufender Kamera zu töten. Ich will mit Ihnen reden.«
»Lassen Sie mich sofort los.« Meine Stimme klang dünn und bebend.
Er ließ los, und ich zog abrupt den Arm zurück. Die Mitarbeiter rollten die rauchende Kamera hinaus, und ein Regisseur mit einem Kopfhörer machte mit einer Hand eine Geste, dass es weitergehen sollte.
Larry nickte und wandte sich an Ortega. »Tut mir leid, das schneiden wir später heraus.«
»Kein Problem«, versicherte Ortega.
Larry hielt einen Moment inne, dann fuhr er fort: »Doktor Ortega, herzlich willkommen in der Show. Sie sind berühmt für Ihre Analysen paranormaler Phänomene auf der ganzen Welt, und Sie haben bewiesen, dass eine große Zahl sogenannter übernatürlicher Vorfälle im Grunde nur raffinierte Tricks waren. Können Sie uns etwas mehr darüber erzählen?«
»Aber gern. Ich untersuche diese Phänomene schon seit einer ganzen Reihe von Jahren und bin noch nie auf ein Ereignis gestoßen, das sich nicht auf ganz natürliche Weise hätte erklären lassen. Die angeblichen Kornkreise etwa waren nichts anderes als die Freizeitbeschäftigung einer kleinen Gruppe britischer Bauern. Andere Ereignisse waren gewiss sehr ungewöhnlich und dennoch beileibe nicht übernatürlich. Hier in Chicago gab es beispielsweise einen Krötenregen, den Dutzende, wenn nicht Hunderte Menschen in einem Stadtpark beobachtet haben. Später stellte sich heraus, dass ein ungewöhnlich starker Sturm die Kröten an einem anderen Ort ausgehoben und herbeibefördert hatte.«
Larry nickte ernst. »Dann glauben Sie also nicht an übernatürliche Ereignisse.«
Ortega lächelte selbstgefällig. »Ich würde gern glauben, dass diese Dinge wahr sind, Larry. Es gibt viel zu wenig Magie in der Welt. Aber Tatsache ist, dass es sich stets um einfachen, primitiven Aberglauben handelt, auch wenn wir alle irgendwo tief in unserem Herzen gern an Wunderwesen und fantastische Kräfte glauben würden.«
»Dann sind also die Anwender der übernatürlichen Disziplinen in Ihren Augen …«
»Scharlatane«, erwiderte Ortega, wie aus der Pistole geschossen. »Damit will ich natürlich nicht Ihre Gäste beleidigen. Alle sogenannten Medien, vorausgesetzt, sie machen sich nicht selbst etwas vor, sind in Wirklichkeit nur geschickte Schauspieler, die etwas von der menschlichen Psychologie verstehen und dies auszunutzen wissen. Sie täuschen die Gutgläubigen und spiegeln ihnen vor, sie könnten mit Toten Kontakt aufnehmen oder Gedanken lesen oder sie seien gar selbst übernatürliche Wesen. Wenn ich mir ein wenig Mühe gebe und die richtige Umgebung schaffe, könnte ich sicherlich jeden in diesem Raum davon überzeugen, dass ich ein Vampir bin.«
Die Zuschauer lachten, ich dagegen starrte Ortega finster an, während die Frustration in mir wuchs und den Dämpfungsspruch erneut unter Druck setzte. Die Luft rings um mich wurde merklich wärmer.
Ein zweiter Kameramann schrie erschrocken auf und riss sich die quietschenden Kopfhörer herunter, während seine Kamera sich langsam um sich selbst drehte und die Stromkabel um das Gestell wickelte, auf dem sie stand.
Die Schilder mit der Aufschrift »AUFNAHME« erloschen. Larry marschierte zum Rand der Bühne und brüllte den armen Kameramann an. Von der Seite erschien der Regisseur mit verlegener Miene, auf den Larry gleich danach seine Aufmerksamkeit richtete. Der Mann ließ die Beschimpfungen mit stoischer Geduld über sich ergehen und untersuchte die Kamera. Er murmelte etwas in sein Headset, dann rollte er zusammen mit dem erschütterten Kameramann das kaputte Gerät hinaus.
Larry verschränkte unterdessen ungeduldig die Arme vor der Brust und wandte sich an seine Gäste. »Es tut mir leid. Geben Sie uns ein paar Minuten Zeit, damit wir eine Reservekamera holen können. Es wird nicht lange dauern.«
»Kein Problem«, versicherte Ortega. »Wir können uns ja einstweilen unterhalten.«
Larry fasste mich ins Auge. »Geht es Ihnen nicht gut, Mister Dresden? Sie wirken ein wenig bleich. Möchten Sie vielleicht etwas trinken?«
»Ich ganz sicher«, sagte Ortega, der mich keinen Moment aus den Augen ließ.
»Ich lasse Ihnen etwas bringen.« Damit ging Larry von der Bühne ab, um seine Frisur nachzubessern.
Mort hatte Father Vincent bereits in eine leise Unterhaltung verwickelt und mir unmissverständlich den Rücken gekehrt. So wandte ich mich wieder vorsichtig und nicht ohne Befürchtungen an Ortega und kämpfte meine Wut und die Angst nieder. Normalerweise ist es nützlich, wenn ich ungeheure Angst habe, denn Magie entsteht aus Gefühlen, und Todesangst ist ein starker Brennstoff. Hier im Studio konnte ich jedoch unmöglich Stürme oder Blitze heraufbeschwören. Es waren zu viele Unschuldige in der Nähe, und allzu leicht hätte ich versehentlich jemanden verletzen oder gar töten können.
Außerdem hatte Ortega recht. Dies war nicht der richtige Ort, um zu kämpfen. Es traf wohl zu, dass er mit mir reden wollte, denn sonst hätte er mich einfach im Parkhaus überfallen können.
»Na gut«, willigte ich ein, »was haben Sie zu sagen?«
Er beugte sich ein wenig zu mir herüber, um leise sprechen zu können. Innerlich zuckte ich zusammen, ließ mir jedoch nichts anmerken. »Ich bin nach Chicago gekommen, um Sie zu töten. Allerdings habe ich einen Vorschlag, den Sie sich vielleicht vorher anhören möchten.«
»Sie müssen dringend an Ihrer Verhandlungstechnik feilen«, gab ich zurück. »Ich habe ein Buch darüber gelesen, das Sie gern mal ausleihen können.«
Sein Lächeln war völlig humorlos. »Der Krieg, Dresden. Der Krieg zwischen Ihrem und meinem Volk ist für uns beide viel zu kostspielig.«
»Krieg ist, ganz allgemein gesagt, ein ziemlich dummer Weg«, antwortete ich. »Ich wollte ihn jedenfalls nicht.«
»Aber Sie haben ihn begonnen«, widersprach Ortega. »Sie haben ihn aus prinzipiellen Erwägungen begonnen.«
»Weil ein Menschenleben auf dem Spiel stand.«
»Wie viele weitere könnten Sie jetzt retten, wenn Sie dem ein Ende setzen?«, fragte Ortega. »Nicht nur Magier leiden darunter. Da wir uns auf den Krieg konzentrieren müssen, fällt es uns schwerer als sonst, die wilderen Angehörigen unseres Hofs unter Kontrolle zu halten. Wir missbilligen sinnlose Tötungen, doch verletzte oder führerlose Angehörige unserer Höfe töten mitunter, auch wenn es nicht wirklich nötig ist. Es würde Hunderten, wenn nicht Tausenden Menschen das Leben retten, wenn der Krieg jetzt beendet würde.«
»Jeden Vampir auf dem Planeten zu töten, würde zum gleichen Ergebnis führen. Was wollen Sie nun eigentlich?«
Er zeigte mir lächelnd die Zähne. Es waren ganz normale Zähne, keine langen Reißzähne oder so was. Ein Vampir des Roten Hofs sieht durchaus menschlich aus – bis er sich in ein Wesen verwandelt, das aus einem schrecklichen Albtraum stammen könnte. »Ich will darauf hinaus, dass der Krieg nachteilig und wenig wünschenswert ist. Sie sind für mein Volk der symbolische Auslöser, Sie sind der Streitpunkt zwischen uns und Ihrem Weißen Rat. Sobald Sie tot sind, werden beide Seiten Friedensverhandlungen aufnehmen.«
»Wollen Sie mich bitten, mich hinzulegen und zu sterben? Das ist kein besonders freundliches Angebot. Sie sollten wirklich mal dieses Buch lesen.«
»Ich mache Ihnen folgendes Angebot: Stellen Sie sich mir in einem Kampf Mann gegen Mann.«
Beinahe hätte ich ihn ausgelacht. »Warum sollte ich das tun?«
Seine Augen verrieten nicht, was in ihm vorging. »Wenn Sie zustimmen, werden die Krieger, die ich in die Stadt mitgebracht habe, nicht gezwungen sein, Ihre Freunde und Verbündeten anzugreifen. Die sterblichen Mörder, die wir rekrutiert haben, werden ihr letztes Stichwort nicht bekommen und darauf verzichten, eine Reihe von Klienten zu töten, die in den letzten fünf Jahren Ihre Dienste in Anspruch genommen haben. Ich denke, ich muss keine Namen nennen.«
Meine Furcht und mein Zorn hatten sich schon fast gelegt, aber jetzt waren sie mit voller Wucht wieder präsent. »Es gibt keinen Grund dafür«, sagte ich. »Wenn Sie gegen mich Krieg führen wollen, tun Sie es.«
»Mit Freuden«, sagte Ortega. »Ich billige solche Taktiken nicht. Stellen Sie sich mir nach den Bedingungen des Abkommens zum Duell.«
»Was passiert, nachdem ich Sie getötet habe?« Ich war nicht sicher, ob ich ihn töten konnte, aber es gab keinen Grund, ihn das wissen zu lassen. »Dann fängt der nächste heißblütige Rote Herzog wieder von vorne an, oder wie?«
»Wenn Sie mich besiegen, willigt der Hof ein, dass diese Stadt zum neutralen Gebiet erklärt wird. Alle, die hier leben, darunter Sie selbst, ebenso Ihre Freunde und Partner, werden von der Bedrohung eines Angriffs befreit, solange sie hier sind.«
Ein Bühnenhelfer kam mit zwei Flaschen Wasser und reichte sie Ortega und mir. Ich trank einen Schluck. Der Spruch stand inzwischen so stark unter Druck, dass farbige Pünktchen vor meinen Augen tanzten.
»Sie müssen dumm sein, mich zum Duell zu fordern«, sagte ich. »Selbst wenn Sie mich töten, würde Sie mein Todesfluch treffen.«
Er zuckte mit den Schultern. »Ich bin nicht so wichtig wie das Wohl des Hofs. Dieses Risiko gehe ich ein.«
Bei den Toren der Hölle! Ehrenhafte, mutige, sich selbst aufopfernde Verrückte sind so ziemlich die schlimmsten Gegner, mit denen man es überhaupt zu tun bekommen kann. Ich versuchte es mit einem letzten Ausweichmanöver und hoffte das Beste. »Das müsste ich allerdings schriftlich haben, und der Rat bekommt eine Kopie. Es müsste von allen anerkannt und offiziell nach dem Abkommen besiegelt werden.«
»Stimmen Sie dem Duell zu, wenn dies geschieht?«
Ich holte tief Luft. Natürlich hatte ich keine große Lust, gegen ein übernatürliches Ungeheuer anzutreten. Ich hatte Angst vor Vampiren. Sie waren stark, viel zu schnell und außerdem extrem widerlich. Ihr Speichel war ein suchterzeugendes Rauschmittel, und ich war ihm lange genug ausgesetzt gewesen, um hin und wieder ein eigenartiges Jucken zu verspüren und mich zu fragen, wie es wohl wäre, wenn ich eine weitere Dosis bekäme.
In der letzten Zeit war ich nach Einbruch der Dunkelheit kaum noch draußen gewesen, und zwar unter anderem, weil ich keine Lust hatte, immer wieder Vampiren zu begegnen. Ein Duell wäre ein fairer Kampf, und ich hasse faire Kämpfe, weil man dabei viel zu schnell verliert, wie es mal eine mörderische Feenfürstin mir gegenüber ausgedrückt hatte.
Doch ob ich mich nun auf Ortegas Angebot einließ oder nicht, ich musste so oder so gegen ihn kämpfen und vermutlich an einem Ort und zu einer Zeit, die höchst ungelegen für mich sein würden. Außerdem zeigte er nicht das übergroße Selbstvertrauen und die Überheblichkeit, die ich von anderen Vampiren kannte. Sein ganzes Gebaren sagte mir, dass es ihm vor allem um mein Ableben ging, ganz egal wie es dazu käme. Nicht nur das, ich war sicher, er würde Wort halten und über Menschen herfallen, die mir wichtig waren, wenn ich nicht einwilligte.
Das perfekte Klischee eines Filmbösewichts.
Und ein unglaublich wirkungsvolles Druckmittel.
Ich würde gern behaupten, ich hätte alle Fakten abgewogen und sei voller Vernunft zu der rationalen Entscheidung gekommen, ein kalkuliertes Risiko einzugehen, aber so war es nicht. In Wahrheit dachte ich vor allem daran, dass Ortega und Konsorten den Menschen, die mir wichtig waren, etwas antun könnten, und sofort war ich wütend genug, um ihn auf der Stelle anzugehen.
Mit zusammengekniffenen Augen sah ich ihn an und machte mir nicht einmal die Mühe, meine Wut zu zügeln. Der Dämpfungsspruch bröckelte, und ich hatte nicht die Nerven, ihn weiter zu erhalten. Schließlich brach er völlig zusammen, und die aufgestauten wilden Energien rasten lautlos und unsichtbar durchs Studio.
Die Lautsprecher auf der Bühne knisterten und rauschten, bevor sie mit lautem Knacken ausfielen. In den Scheinwerfern über uns blitzte und knackte es, dann ging ein Funkenregen auf die Bühne nieder. Eine der beiden noch aktiven Kameras explodierte und fing Feuer, bläuliche Flammen schlugen aus dem Gehäuse. Aus sämtlichen Steckdosen in der Wand stoben orangefarbene und grüne Funken. Larry Fowler sprang mit einem erschrockenen Schrei auf und schlug auf seinen Gürtel, ehe es ihm gelang, sein schmorendes Handy auf den Boden zu werfen. Das Licht erlosch, die Zuschauer gerieten in Panik und schrien.
Ortega, nur noch von den rieselnden Funken beleuchtet, machte eine grimmige und irgendwie begierige Miene. Tiefe Schatten tanzten über sein Gesicht und spiegelten sich in seinen riesigen dunklen Augen.
»Na schön«, sagte ich. »Geben Sie mir das schriftlich, dann bin ich dabei.«
Die Notbeleuchtung flammte auf, der Feueralarm schlug an, die Menschen stolperten eilig zu den Ausgängen.
Ortega lächelte jetzt breit, huschte von der Bühne und verschwand im Dunkeln.
Leicht zitternd stand ich auf. Anscheinend war irgendetwas heruntergefallen und hatte Mort am Kopf getroffen. Er hatte eine kleine, stark blutende Platzwunde am Schädel und schwankte bedenklich, als er aufzustehen versuchte. Father Vincent und ich stützten den kleinen Ektomanten auf beiden Seiten und schleppten ihn zum Notausgang.
Draußen bugsierten wir ihn eine Treppe hinunter, bis wir endlich das Gebäude verlassen konnten. Die Chicagoer Polizei war schon mit blinkendem Blaulicht im Einsatz. Auch die Feuerwehr und ein paar Krankenwagen rückten an.
Wir lieferten Mort bei einer Gruppe von Zuschauern mit kleineren Verletzungen ab und zogen uns zurück. Nach der Anstrengung beobachteten wir ein wenig atemlos die Sanitäter, die sich um die Verletzten kümmerten.
»Ich muss Ihnen etwas beichten«, sagte Father Vincent schließlich.
»He«, erwiderte ich, »glauben Sie nicht, dass mir die Ironie entgeht.«
Vincent verzog die ledrigen Lippen zu einem gequälten Lächeln. »Ich bin nicht nur nach Chicago gekommen, um in der Sendung aufzutreten.«
»Nein?«
»Nein. Eigentlich bin ich vor allem hier, weil …«
»Weil Sie mit mir reden wollen«, unterbrach ich ihn.
Er zog die Augenbrauen hoch. »Woher wissen Sie das?«
Seufzend fischte ich die Autoschlüssel aus der Tasche. »Es ist mal wieder einer dieser Tage.«
2. Kapitel
Ich setzte mich in Bewegung und bedeutete Father Vincent, mir zu meinem Auto zu folgen. Das tat er auch, und ich schritt so schnell aus, dass er Mühe hatte, mir zu folgen.
»Allerdings«, sagte er, »muss ich auf strikter Vertraulichkeit bestehen, wenn ich Ihnen mein Problem schildere.«
Mit gerunzelter Stirn antwortete ich ihm: »Sie halten mich doch im besten Fall für einen Verrückten und im schlimmsten Fall für einen Scharlatan. Warum soll ich dann für Sie einen Auftrag übernehmen?«
Nicht dass ich ihn abweisen würde. Ich wollte den Auftrag durchaus übernehmen. Genauer gesagt brauchte ich das Geld. Meine finanzielle Situation war nicht ganz so katastrophal wie im vergangenen Jahr, doch das bedeutete lediglich, dass ich die Gläubiger nur noch mit einem Baseballschläger statt mit einem Revolver abhielt.
»Wie ich hörte, sind Sie in diesem Bereich der beste Privatdetektiv in der Stadt.«
Misstrauisch beäugte ich ihn. »Dann geht es also um etwas Übernatürliches?«
Er verdrehte die Augen. »Nein, natürlich nicht. Ich bin doch nicht naiv. Aber soweit ich weiß, kennen Sie sich in der okkultistischen Szene besser aus als jeder andere Privatdetektiv in der Stadt.«
»Oh«, antwortete ich, »das meinen Sie.«
Nach kurzem Nachdenken musste ich sogar einräumen, dass er vermutlich recht hatte. Die okkultistische Szene, die er meinte, war die übliche New-Age-Gemeinde, die es in jeder großen Stadt gibt, mit Kristallkugeln, Tarotkarten, Handlesen.
Die meisten Jünger waren harmlos, viele verfügten sogar über geringfügige magische Fähigkeiten. Hinzu kamen noch die Feng-Shui-Künstler, ein paar Wicca-Leute verschiedener Spielarten und Geschmacksrichtungen, ein paar halbwegs begabte Medien, die Religion mit Magie vermengten, dazu einige Voodoo-Anhänger und eine Handvoll Satanisten, all das garniert mit reichlich jungen Menschen, die gern Schwarz trugen – und schon hat man das, was die meisten Leute als »okkultistische Szene« bezeichnen.
Natürlich fand man in diesem Gemenge hin und wieder auch echte Zauberer, Nekromanten, Monster und Dämonen. Die ernsthaften, bösen Mitspieler betrachteten diese Szene mit den gleichen Augen wie ein Zehnjähriger seine alten Bauklötze. Mein inneres Frühwarnsystem schlug Alarm.
»Wer hat Sie eigentlich an mich verwiesen?«
»Oh, ein Priester aus der Nähe«, erwiderte Vincent. Er zückte ein kleines Notizbuch und schlug den Namen nach. »Father Forthill von Saint Mary of the Angels.«
Darauf blinzelte ich verdutzt. Father Forthill und ich waren in religiösen Fragen alles andere als ein Herz und eine Seele, doch er war ein anständiger Kerl. Vielleicht etwas steif, aber ich mochte ihn und war ihm die eine oder andere Gefälligkeit schuldig. »Das hätten Sie gleich sagen sollen.«
»Dann übernehmen Sie den Fall?«, fragte Father Vincent, während wir uns dem Parkhaus näherten.
»Zuerst würde ich zwar gern die Einzelheiten erfahren, wenn Forthill jedoch meint, ich könnte Ihnen helfen, dann werde ich es tun. Aber Sie müssen mein normales Honorar bezahlen«, fügte ich hastig hinzu.
»Selbstverständlich«, erwiderte Father Vincent. Er spielte mit dem Kruzifix an seinem Hals. »Darf ich annehmen, dass Sie mir den Zaubererzirkus ersparen?«
»Magier«, erwiderte ich.
»Gibt es denn da einen Unterschied?«
»Zauberer treten auf Bühnen auf. Magier arbeiten mit echter Magie.«
Er seufzte. »Ich brauche keinen Unterhaltungskünstler, nur einen Privatdetektiv.«
»Dafür verlange ich nicht, dass Sie mir glauben, solange Sie mich nur bezahlen. Wir werden schon zurechtkommen.«
Unsicher sah er mich an. »Aha.«
Inzwischen hatten wir mein Auto erreicht, einen verbeulten alten VW Käfer. Er hatte das, was manche Menschen als Charakter bezeichnen. In Wahrheit beruhte dieser Eindruck auf zahlreichen nicht zusammenpassenden Ersatzteilen. Der ursprüngliche Wagen war einmal blau gewesen, inzwischen hatte er grüne, weiße und rote Bestandteile, nachdem die Originale auf die eine oder andere Weise beschädigt worden waren. Die Kofferraumhaube wurde nur noch von einem verbogenen Drahtkleiderbügel festgehalten, damit sie nicht aufsprang, wenn der Wagen über eine Bodenwelle fuhr, und die Stoßstange war immer noch verbeult, nachdem ich im vergangenen Sommer mit dem Auto ein Monster erlegt hatte. Vielleicht konnte ich sie reparieren lassen, wenn Vincent gut zahlte.
Er betrachtete blinzelnd den Käfer. »Was ist denn da passiert?«
»Bin vor Bäume gefahren.«
»Sie haben Ihr Auto gegen einen Baum gelenkt?«
»Nein. Mehrzahl. Bäume. Außerdem war noch ein Müllcontainer im Spiel.« Schuldbewusst erwiderte ich seinen Blick. »Es waren kleine Bäume.«
Seine Unsicherheit vertiefte sich. »Aha.«
Ich schloss auf. Nicht dass ich mir Sorgen gemacht hätte, jemand könnte mein Auto stehlen. Ein Autoknacker hatte mir sogar mal angeboten, mir zum Sonderpreis etwas Besseres zu beschaffen. »Wollen Sie mir die Details unter vier Augen erzählen?«
Father Vincent nickte. »Ja sicher. Wenn Sie mich zum Hotel fahren könnten? Dort habe ich ein paar Fotos, und …«
Ich hörte das Scharren der Schuhe auf dem Beton gerade rechtzeitig, um aus dem Augenwinkel den Killer zu bemerken, der sich eine Reihe weiter zwischen zwei geparkten Autos aufrichtete. Trübe spiegelte sich das Licht auf seiner Pistole, und ich sprang über die Haube des Käfers, um ihm zu entgehen. Dabei prallte ich gegen Father Vincent, der erschrocken aufschrie, und als wir zu Boden gingen, begann der Mann zu schießen.
Es knallte nicht so laut, wie es sonst der Fall ist, wenn jemand eine Pistole abfeuert. Schusswaffen sind erheblich lauter als alles, was normale Menschen Tag für Tag hören. Diese Kanone brüllte, bellte oder knallte nicht. Sie gab ein lautes Geräusch von sich, etwa so, als hätte jemand ein dickes Wörterbuch auf den Tisch geworfen. Der Killer benutzte einen Schalldämpfer.
Ein Schuss traf mein Auto und prallte von der gekrümmten Haube ab. Die zweite Kugel zischte knapp an meinem Kopf vorbei, als ich noch mit Father Vincent rang, die dritte zertrümmerte das Sicherheitsglas eines teuren Sportwagens, der nebenan parkte.
»Was hat das zu bedeuten?«, stammelte Father Vincent.
»Seien Sie still!«, fuhr ich ihn an.
Der Killer setzte sich in Bewegung, und ich hörte seine Schritte, als er mein Auto umrunden wollte. Ich kauerte bereits davor und fummelte an dem Draht herum, der die Haube festhielt. Endlich gab der Draht nach, die Haube klappte auf, und ich konnte in den Kofferraum langen.
Als ich aufschaute, sah ich den Mann, mittelgroß und von normaler Statur, etwa Mitte dreißig, bekleidet mit einer dunklen Hose und einer Jacke, wie er eine kleinkalibrige Pistole mit einem dicken Schalldämpfer hob. Wieder schoss er, doch er hatte sich nicht die Zeit genommen, richtig zu zielen. Obwohl kaum noch sechs Meter entfernt, verfehlte er mich.
Ich nahm die Schrotflinte aus dem Kofferraum, legte den Sicherungshebel um und drückte eine Patrone in die Kammer.
Der Killer riss die Augen weit auf und rannte sofort weg. Unterwegs schoss er noch einige Male auf mich und zerstörte einen Scheinwerfer des Käfers.
Ich ging hinter dem Auto in Deckung und zählte die Schüsse. Es waren elf oder zwölf, als er aufhörte. Dann stand ich wieder auf, legte die Schrotflinte an und zielte. Der Killer verschwand hinter einer Säule und rannte weiter.
»Verdammt!«, zischte ich. »Steigen Sie ein.«
»Aber …«, stammelte Father Vincent.
»Steigen Sie gefälligst ein!«, herrschte ich ihn an. Ich stand auf, sicherte die Haube wieder mit dem Draht und glitt auf den Fahrersitz.
Als Vincent neben mir saß, drückte ich ihm die Schrotflinte in die Hand. »Halten Sie die fest.«
Mit weit aufgerissenen Augen fummelte er damit herum, während ich den Motor des Käfers aufheulen ließ. Na ja, eigentlich heulte er nicht direkt auf. Ein Käfermotor heult nicht. Aber irgendwie knurrte er vernehmlich, und ich legte den ersten Gang ein, noch bevor der Priester die Tür ganz geschlossen hatte.
Gleich danach raste ich durch die Kurven der Ausfahrt.
»Was haben Sie vor?«, fragte Father Vincent.
»Das war ein Auftragskiller des organisierten Verbrechens«, fauchte ich. »Die passen sicher an der Ausfahrt auf.«
Mit quietschenden Reifen fuhren wir um die letzte Kurve und näherten uns der Ausfahrt des Parkhauses. Irgendjemand rief atemlos etwas, und auf der anderen Straßenseite stiegen gerade zwei große, unfreundlich wirkende Männer aus einem Auto. Einer hatte eine Schrotflinte, der andere eine schwere Halbautomatik, vielleicht eine Desert Eagle.
Den Ganoven mit der Schrotflinte erkannte ich nicht, aber der Dritte im Bunde war ein riesiger Mann mit rötlichem Haar und einem billigen Anzug – Cujo Hendricks, der wichtigste Vollstrecker des Verbrecherkönigs von Chicago, Gentleman Johnny Marcone.
Ich musste den Käfer in der Ausfahrt des Parkhauses auf den Gehweg lenken, um die Schranke zu umfahren, wobei ich auch einige Formschnittbüsche erwischte. Dann holperten wir den Bordstein hinunter auf die Straße. Ich zog das Lenkrad abrupt nach rechts und gab Vollgas.
Im Rückspiegel konnte ich den ersten Killer beobachten, der inzwischen vor dem Notausgang stand und die Pistole mit dem Schalldämpfer auf uns richtete. Er feuerte noch einige Schüsse ab, von denen ich jedoch nur die letzten hörte. Von dort aus hatte er keine gute Schussposition, dennoch landete er einen Glückstreffer und zerstörte meine Heckscheibe. Ich schluckte erschrocken und bog an der nächsten Ecke trotz roter Ampel ab, wobei ich fast mit einem Umzugswagen zusammengestoßen wäre. Eilig fuhr ich weiter.
Zwei Blocks entfernt beruhigte sich mein Herzschlag so weit, dass ich nachdenken konnte. Ich hielt mich jetzt mehr oder weniger an die Geschwindigkeitsbegrenzung und dankte meinem Glücksstern, dass der Dämpfungsspruch schon im Studio und nicht erst im Auto die Wirkung verloren hatte. Schließlich kurbelte ich die Scheibe nach unten und streckte den Kopf hinaus, um zu erkunden, ob Hendricks und seine Kumpane uns folgten. Als ich niemanden entdeckte, beschloss ich, das Beste zu hoffen.
Ich zog den Kopf wieder ein und stellte fest, dass die Schrotflinte direkt auf mein Kinn zielte. Father Vincent war kreidebleich im Gesicht und fluchte leise auf Italienisch.
»He!«, sagte ich und schob den Gewehrlauf fort. »Seien Sie mit dem Ding vorsichtig. Sie wollen mich doch nicht umbringen, oder?« Dann legte ich den Sicherungshebel um. »Verstauen Sie die Waffe im Fußraum. Wenn uns ein Polizist damit sieht, sind wir dran.«
Father Vincent schluckte schwer und versuchte, das Gewehr hinter dem Armaturenbrett verschwinden zu lassen. »Ist die Waffe denn illegal?«
»Illegal ist so ein starkes Wort«, antwortete ich abwesend.
»O Mann«, keuchte Father Vincent. »Diese Leute … Die wollten Sie umbringen.«
»Dazu sind Auftragskiller der Mafia gewöhnlich da«, stimmte ich zu.
»Woher wissen Sie denn, wer die waren?«
»Der erste hatte eine Waffe mit Schalldämpfer. Es war ein guter Schalldämpfer aus Metall und Glas, kein billiges Plastikzeug.« Wieder sah ich mich aufmerksam um. »Er benutzte eine kleinkalibrige Waffe und versuchte, sehr nahe heranzukommen, ehe er schoss.«
»Warum ist das so wichtig?«
Hinter uns war alles in Ordnung. Meine Hände zitterten, ich fühlte mich etwas schwach. »Es bedeutet, dass er leichte Munition benutzt hat, die nicht die Schallgrenze überschreitet. Wenn dies geschieht, verliert ein Schalldämpfer seinen Sinn. Als er gemerkt hatte, dass ich bewaffnet war, ist er sofort weggerannt und wollte offensichtlich Hilfe holen. Er ist ein Profi.«
»O mein Gott«, stöhnte Father Vincent.
»Außerdem habe ich einen der Männer erkannt, die am Ausgang gewartet haben.«
»Am Ausgang war noch jemand?«, fragte Father Vincent.
»Und ob. Ein paar von Marcones Vollstreckern.« Seufzend betrachtete ich die zerstörte Heckscheibe. »Verdammt. Wohin sollen wir jetzt fahren?«
Immer noch schockiert, beschrieb Father Vincent mir den Weg, und ich konzentrierte mich auf die Straße, verdrängte das Flattern im Bauch und unterdrückte das Zittern meiner Hände. Ich komme meist nicht gut damit klar, wenn man auf mich schießt.
Hendricks. Warum zum Teufel ließ Marcone seine Killer auf mich los? Marcone war der König der Unterwelt, aber normalerweise ging er nicht so brutal vor. Seiner Ansicht nach war das schlecht fürs Geschäft, außerdem hatte ich mit Marcone eine Art Abkommen getroffen, uns gegenseitig in Ruhe zu lassen. Warum also schlug er jetzt auf diese Weise zu?
Vielleicht hatte ich eine Grenze überschritten, von deren Existenz ich nichts wusste.
Ich warf einen Blick zu Father Vincent, der erschüttert neben mir hockte.
Bisher hatte er mir nicht verraten, was er wollte, aber was es auch war, es war wichtig genug, um einen Mitarbeiter des Vatikans nach Chicago zu führen. Vielleicht sogar wichtig genug, um bei der Gelegenheit auch gleich einen neugierigen Magier umzubringen.
O Mann.
Was für ein mieser Tag.
3. Kapitel
Father Vincent lotste mich zu einem Motel, das ein Stück nördlich vom O’Hare lag. Es gehörte zu einer großen Kette, war billig, aber sauber und hatte rings um den Parkplatz viele Zimmer. Ich bog von der Straße ab und fuhr um das Gebäude herum. Es sah nicht gerade aus wie eine Unterkunft, die Vincent freiwillig buchen würde.
Kaum dass ich die Handbremse angezogen hatte, sprang der Priester schon aus dem Auto, eilte zu seiner Tür, schloss auf und huschte mit eingezogenem Kopf hinein.
Ich folgte ihm. Vincent sperrte hinter uns ab und ließ die Rollos herunter. Dann nickte er in Richtung des Tischchens. »Bitte, setzen Sie sich.«
Das tat ich und streckte erleichtert die Beine aus. Father Vincent zog unterdessen eine Schublade der schlichten Kommode auf und nahm eine Mappe heraus, die von einem dicken Gummiband zusammengehalten wurde. Er setzte sich mir gegenüber, zog das Gummiband ab und sagte: »Die Kirche möchte gern einen gestohlenen Wertgegenstand zurückholen.«
Schulterzuckend erwiderte ich: »Das scheint mir eher ein Job für die Polizei zu sein.«
»Die Ermittlungen laufen bereits, und ich unterstütze Ihre Polizei, so gut ich nur kann. Aber … Wie kann ich es höflich ausdrücken?« Er runzelte die Stirn. »Die Geschichte ist ein guter Lehrer.«
»Sie trauen der Polizei nicht«, erwiderte ich. »Alles klar.«
Er schnitt eine Grimasse. »In der Vergangenheit bestanden leider gewisse Verbindungen zwischen der Chicagoer Polizei und verschiedenen Größen der Unterwelt.«
»So was gibt es nur noch im Film, Father. Vielleicht haben Sie es nicht mitbekommen, aber Al Capone ist schon eine Weile tot.«
»Nur leben seine Erben vielleicht noch. Jedenfalls will ich alles in meiner Macht Stehende tun, um den gestohlenen Gegenstand zurückzubekommen. Dazu gehört es auch, einen unabhängigen und diskreten Privatdetektiv einzuschalten.«
Aha. Er traute der Polizei nicht, und ich sollte verdeckt für ihn arbeiten. Deshalb trafen wir uns in einem billigen Motel und nicht dort, wo er wirklich logierte. »Was soll ich für Sie suchen?«
»Ein Relikt«, erwiderte er.
»Wie bitte?«
»Ein Artefakt, Mister Dresden. Eine Antiquität, die seit mehreren Jahrhunderten im Besitz der Kirche ist.«
»Oh, verstehe.«
»Ja. Der Gegenstand ist sehr alt. Wir glauben, dass er momentan nicht entsprechend seines Alters und seines Werts behandelt wird. Daher ist es äußerst wichtig, dass wir ihn so schnell wie möglich finden.«
»Was ist damit passiert?«
»Er wurde vor drei Tagen gestohlen.«
»Wo?«
»In einer Kirche in Norditalien.«
»Das ist weit weg.«
»Wir glauben, jemand hat das Artefakt hierher nach Chicago gebracht.«
»Warum?«
Nun zog er ein großes Foto aus einem Umschlag und reichte es mir. Es zeigte eine verstümmelte Leiche auf einem Kopfsteinpflaster. Das Blut war in die Fugen gelaufen, um den Toten hatte sich eine kleine Lache gebildet. Vermutlich handelte es sich um einen Mann, doch das war kaum zu erkennen, denn die Täter hatten ihm das Gesicht und den Hals praktisch in Stücke geschnitten. Glatte, gerade, saubere Schnitte. Professionelle Messerarbeit.
»Der Mann hieß Gaston LaRouche. Er war Anführer einer Diebesbande, die sich ›Kirchenmäuse‹ nennen. Sie sind darauf spezialisiert, Kathedralen und Heiligtümer auszurauben. Am Morgen nach dem Raub fand man ihn tot in der Nähe eines kleinen Flugplatzes. In seiner Aktenmappe befanden sich mehrere gefälschte amerikanische Ausweise und Flugtickets nach Chicago.«
»Aber das, was Sie vermissen, hatte er nicht bei sich.«
»Genau.« Father Vincent zog zwei weitere Fotos aus der Mappe. Sie wirkten grobkörniger, als wären sie mehrmals vergrößert worden. Beide zeigten Frauen von durchschnittlicher Statur mit dunklen Haaren und dunklen Sonnenbrillen.
»Fotos von Überwachungskameras?«, fragte ich.
Er nickte. »Interpol. Anna Valmont und Francisca Garcia. Wir vermuten, dass sie LaRouche erst beim Diebstahl geholfen, ihn dann jedoch ermordet und das Land verlassen haben. Interpol bekam einen Hinweis, dass Valmont hier am Flughafen gesehen wurde.«
»Wissen Sie, wer der Käufer ist?«
Vincent schüttelte den Kopf. »Nein, und genau das wäre Ihr Auftrag. Sie sollen die übrigen Kirchenmäuse finden und das Artefakt wiederbeschaffen.«
Mit gerunzelter Stirn betrachtete ich die Fotos. »Ja, so soll das aussehen.«
Vincent blinzelte verständnislos. »Was meinen Sie damit?«
»Irgendjemand will …« Ich schüttelte den Kopf. »Betrachten Sie doch mal das Foto. LaRouche wurde nicht dort ermordet.«
Jetzt runzelte er die Stirn. »Wie kommen Sie darauf?«
»Es ist nicht genug Blut. Ich habe mehr als einmal Menschen gesehen, die zerfetzt wurden und verblutet sind. Dabei fließt höllisch viel Blut, deutlich mehr als hier.« Nach einer kleinen Pause fügte ich hinzu: »Entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise.«
»Warum hat man dann seinen Leichnam dort gefunden?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Das ist die Arbeit von Profis. Sehen Sie sich die Schnitte an. Sie sind methodisch. Wahrscheinlich war er bewusstlos oder stand unter Drogen, denn wenn man einem Menschen ein Messer ans Gesicht setzt, hält er nicht so still, dass man gerade schneiden könnte.«
Father Vincent presste sich eine Hand flach auf den Leib. »Oh.«
»Also haben Sie irgendwo auf der Straße eine Leiche gefunden, an deren Hals im Grunde ein großes Schild hing mit der Aufschrift: ›Sucht in Chicago weiter!‹ Entweder, hier war irgendjemand unglaublich dumm, oder jemand hat versucht, Sie herzulocken. Doch es handelt sich um einen professionellen Mord. Also wollte jemand mit dieser Leiche einen Hinweis geben.«
»Wer sollte so etwas tun?«
»Genau das sollte ich herausfinden. Haben Sie noch bessere Fotos von den Frauen?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, man hat sie bisher auch nie verhaftet. Keine Vorstrafen.«
»Dann sind sie bei dem, was sie tun, wirklich gut.« Ich nahm die Fotos. Hinten waren kleine Zettel mit Informationen angeklemmt: Tarnnamen, Aufenthaltsorte. Nichts wirklich Nützliches. »Das wird nicht sehr schnell gehen.«
»Das ist oft so, wenn man etwas Wichtiges anstrebt. Was brauchen Sie sonst noch von mir?«
»Einen Vorschuss. Tausend Dollar dürften reichen. Außerdem benötige ich eine Beschreibung des Artefakts. Je detaillierter, desto besser.«
Father Vincent nickte sofort, zog einen stählernen Geldclip aus der Tasche, zählte zehn Abbilder von Ben Franklin ab und schob sie mir zu. »Das Artefakt ist ein längliches Stück Stoff, etwa viereinhalb Meter lang und einen Meter zehn breit. Es besteht aus handgewebtem Leinen. Auf dem Stoff befinden sich mehrere Flicken und Flecken, und …«
Ich unterbrach ihn mit erhobener Hand. »Warten Sie mal. Wo, sagten Sie, wurde das Ding gestohlen?«
»In der Kathedrale des heiligen Johannes«, erklärte Father Vincent.
»In Norditalien?«
Er nickte.
»Genauer gesagt, in Turin.«
Wieder nickte er.
»Also hat jemand das Turiner Grabtuch gestohlen?«
»Ja.«
Ich lehnte mich zurück und betrachtete wieder die Fotos.
Das änderte einiges. Eigentlich alles.
Das Grabtuch. Angeblich das Tuch, in den Joseph von Arimathäa den Leichnam Christi nach der Kreuzigung gewickelt hatte. Das Tuch, in das Christus angeblich bei seiner Wiederauferstehung gehüllt war und das sein Abbild und sein Blut trägt.
»Mann«, sagte ich.
»Was wissen Sie über das Grabtuch?«
»Nicht viel. Es ist das Leichentuch Christi. In den siebziger Jahren fanden mehrere Untersuchungen statt, die aber zu keinem eindeutigen Ergebnis führten. Vor ein paar Jahren wäre es bei einem Brand in der Kathedrale beinahe zerstört worden. Es heißt, es habe heilende Kräfte, zwei Engel sollen es angeblich immer noch bewachen. Außerdem gibt es viele weitere Geschichten, an die ich mich nicht erinnern kann.«
Father Vincent stemmte die Hände auf den Tisch und beugte sich vor. »Das Grabtuch ist möglicherweise das wichtigste Artefakt der Kirche. Es ist ein mächtiges Symbol unseres Glaubens, das viele Menschen für echt halten. Auch politisch ist es von Bedeutung. Für Rom ist es von größter Wichtigkeit, dass es so schnell wie möglich wieder in die Obhut der Kirche gelangt.«
Ich starrte ihn einen Moment lang an und wählte meine nächsten Worte mit Bedacht. »Wären Sie beleidigt, wenn ich andeute, dass dieses Grabtuch möglicherweise auch … äh … in magischer Hinsicht eine große Bedeutung hat?«
Vincent presste die Lippen zusammen. »Ich mache mir da keine Illusionen. Es ist ein Stück Tuch, kein fliegender Teppich. Seinen Wert gewinnt es ausschließlich aus der historischen und symbolischen Bedeutung.«
Bei den Toren der Hölle, genau dadurch entsteht ja ein großer Teil der magischen Kraft. Das Grabtuch war alt und für viele Menschen etwas ganz Besonderes, an das sie glaubten. Das allein reichte aus, um ihm eine gewisse Macht zu verleihen.
»Es gibt Menschen, die das anders sehen«, widersprach ich.
»Aber natürlich«, stimmte er zu. »Deshalb könnte sich Ihr Wissen über die einheimischen Okkultisten als äußerst wertvoll erweisen.«
Nachdenklich nickte ich. Vielleicht handelte es sich um eine ganz und gar mondäne Angelegenheit. Irgendjemand hatte ein schimmeliges Stück Tuch geklaut, um es an einen Verrückten zu verkaufen, der es für ein magisches Leichentuch hielt. Das Grabtuch war möglicherweise tatsächlich nichts weiter als ein Symbol, zwar ein antikes, historisch wichtiges und wertvolles Stück und unbezahlbar, aber letzten Endes eben nur das.
Andererseits bestand die Möglichkeit, dass das Tuch echt war, dass es tatsächlich mit Gottes Sohn in Berührung gekommen war, als er von den Toten auferstanden war.
Ich schob den Gedanken eilig beiseite. Falls das Tuch in magischer Hinsicht etwas Besonderes war, ließ ich mich womöglich auf ein ausgesprochen hässliches Spiel ein. Unter all den verrückten, dunklen oder bösen Kräften, die an diesem Tuch interessiert sein mochten, gab es sicherlich keine einzige, die etwas Erfreuliches damit zu tun beabsichtigte. Hier konnten alle möglichen übernatürlichen Parteien im Spiel sein.
Selbst wenn ich diese Möglichkeit ausschloss, waren sterbliche Interessenten am Grabtuch schon unangenehm genug. Nicht ausgeschlossen, dass John Marcone mit von der Partie war, außerdem die Polizei von Chicago, wahrscheinlich Interpol und das FBI. Waren keine übernatürlichen Kräfte im Spiel, waren die Cops ziemlich gut darin, gesuchte Personen aufzustöbern. Es sprach also einiges dafür, dass sie binnen weniger Tage die Diebe finden und das Tuch sicherstellen würden.
Mein Blick wanderte von den Fotos zu dem Geld, und ich musste daran denken, wie viele Rechnungen ich mit diesem hübschen großen Vorschuss von Father Vincent bezahlen konnte. Wenn ich Glück hatte, geriet ich nicht einmal in die Schusslinie.
Aber sicher doch.
Man muss nur daran glauben.
Ich steckte das Geld ein und nahm auch die Fotos an mich. »Wie kann ich Sie erreichen?«
Father Vincent schrieb eine Telefonnummer auf das Briefpapier des Motels und riss das Blatt ab. »Hier. Das ist mein Telefonservice, während ich in der Stadt bin.«
»In Ordnung. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde tun, was ich kann.«
Father Vincent stand auf. »Danke, Mister Dresden. Father Forthill hat Sie in den höchsten Tönen gelobt.«
»Er ist ein echter Freund.« Ich stand ebenfalls auf.
»Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich habe noch einige Termine.«
»Das glaube ich gern. Hier ist meine Karte, falls Sie mich erreichen wollen.«
Ich gab ihm meine Visitenkarte, schüttelte ihm die Hand und ging.
Die Schrotflinte verstaute ich wieder im Kofferraum meines Käfers, nachdem ich die Patrone aus der Kammer genommen und den Sicherungshebel geprüft hatte. Anschließend holte ich ein Stück Holz hervor, das ein wenig länger als mein Unterarm und mit Runen und Siegeln verziert war, die mir halfen, meine Magie präziser einzusetzen. Meine Jacke warf ich über die Schrotflinte, und dann zog ich ein silbernes Armband aus der Tasche, an dem ein Dutzend winzige Schilde mit mittelalterlichen Motiven hingen. Ich legte es um den linken Arm, und auf den Ringfinger der rechten Hand steckte ich einen Silberring. Als Letztes holte ich meinen Sprengstock hervor und lehnte ihn an den Beifahrersitz, ehe ich einstieg.
Ich hatte einen neuen Fall, war einem Killer der Mafia begegnet und hatte Herzog Ortegas Herausforderung mehr oder weniger angenommen. Drei gute Gründe, mich nicht mit heruntergelassener magischer Hose erwischen zu lassen.
Ich lenkte den Käfer zu meiner Mietwohnung, die sich im Keller einer riesigen alten Absteige befand. Als ich dort eintraf, war es schon nach Mitternacht. Es war Ende Februar, hin und wieder fiel eine feuchte Schneeflocke, die sich aber auf dem Boden nicht lange halten konnte. Meine Aufregung nach der Larry-Fowler-Show und dem Anschlag ebbte allmählich ab. Inzwischen taten mir nur noch die Knochen weh, ich war müde und machte mir Sorgen. Fest entschlossen, sofort ins Bett zu gehen und früh aufzustehen, um an Vincents Fall zu arbeiten, stieg ich aus.
Auf einmal spürte ich das Aufbranden einer kalten, wabernden Energie. Aus der Richtung der Treppe, die hinab in meine Kellerwohnung führte, hörte ich ein gedämpftes Poltern.
Ich zückte den Sprengstock und aktivierte das Schildarmband am linken Handgelenk, doch bevor ich die Stufen erreichte, kamen zwei Gestalten herauf und landeten schwer auf dem halbgefrorenen Boden neben dem mit Kies bestreuten Parkplatz. Sie rangen miteinander und rollten übereinander, bis eine von ihnen einen Fuß unter den Bauch des auf ihr liegenden Gegners stemmte und dann zustieß.
Der Angreifer flog gut fünf Meter durch die Luft, landete mit vernehmlichem Knirschen auf dem Kies und hustete erschrocken, dann sprang er auf und rannte davon.
Mit aktiviertem Schild näherte ich mich dem zweiten ungebetenen Besucher, bevor dieser aufstehen konnte. Gleichzeitig schickte ich etwas Willenskraft in den Sprengstock, bis die eingravierten Runen rot aufflammten. An der Spitze züngelten Flammen, so hell wie eine Signalfackel, doch ich hielt den Schlag vorerst zurück und zielte mit der Spitze des Sprengstocks auf den Eindringling. »Eine falsche Bewegung, und ich grill dich!«
Das rote Licht fiel auf eine Frau.
Sie trug Jeans, eine schwarze Lederjacke, ein weißes T-Shirt und Handschuhe. Das lange pechschwarze Haar hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden, und dunkle, verhangene Augen glühten unter langen Wimpern. Ihr schönes Gesicht zeigte einen Ausdruck müder Belustigung.
Mein Herz schlug heftig vor Aufregung und auch vor unverhofftem Schmerz.
»Also«, sagte Susan, während sie an der lodernden Spitze des Sprengstocks vorbeilugte, »es heißt zwar, es sei immer nett, eine alte Flamme zu treffen, aber das muss man doch nicht gleich wörtlich nehmen.«
4. Kapitel
Susan.
Mein Verstand setzte gute zehn Sekunden aus, während ich meine ehemalige Geliebte anstarrte. Ihr Haar duftete, dazu nahm ich den frischen Ledergeruch ihrer Jacke und noch etwas anderes wahr. Mit ihren dunklen Augen betrachtete sie mich unsicher und nervös. Seitlich am Mund hatte sie eine kleine Platzwunde, die Blutstropfen erschienen im roten Licht des Sprengstocks schwarz.
»Harry«, sagte Susan mit ruhiger, fester Stimme, »du machst mir Angst.«
Ich riss mich aus meinem Schockzustand und ließ den Sprengstock sinken. »Bei den Sternen und Steinen, ist dir etwas passiert?«
»Nur ein paar Prellungen«, sagte sie. »Nichts Schlimmes.«
»Wer war das?«
Susan blickte in die Richtung, in die der Angreifer gelaufen war, und schüttelte den Kopf. »Der Rote Hof. Das Gesicht konnte ich nicht erkennen.«
Verdutzt blinzelte ich sie an. »Du hast ganz allein einen Vampir abgewehrt?«
Nun lächelte sie strahlend, und die Anspannung wich einer gewissen Freude. »Ich habe hart trainiert.«
Ich sah mich um und tastete mit meinen Magiersinnen die Umgebung nach der unschönen Energie ab, die von den Roten ausging. Nichts. »Er ist weg«, beruhigte ich sie. »Aber wir sollten nicht hier draußen rumstehen.«
»Gehen wir rein?«
Ich wollte zustimmen, dann hielt ich inne. Ein schrecklicher Verdacht keimte in mir. Ich ließ ihre Hand los und wich einen Schritt zurück.
Zwischen ihren Augenbrauen erschien eine Furche. »Harry?«
»Ich hab ein schwieriges Jahr hinter mir«, sagte ich. »Ich würde gern mit dir reden, aber ich bitte dich nicht herein.«
Verständnis und Kummer zeichneten sich in Susans Gesicht ab. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und nickte. »Verstehe. Du hast gute Gründe, vorsichtig zu sein.«
Ohne ein weiteres Wort ging ich zu meinem Eingang. Susan entfernte sich ein paar Schritte und blieb stehen, wo ich sie gut im Auge behalten konnte. Erst dann stieg ich die Treppe hinunter und schloss die Stahltür auf. Mit einer Willensanstrengung deaktivierte ich vorübergehend die Schutzsprüche, die als magisches Gegenstück einer Tretmine und einer Alarmanlage meine Bleibe sicherten.
Als ich drinnen stand, warf ich einen raschen Blick zum Kerzenhalter, der neben der Tür an der Wand befestigt war, und murmelte: »Flickum bicus.« Nach einem kleinen Energiestoß erwachte eine tanzende Flamme zum Leben und tauchte meine Wohnung in weiches orangefarbenes Zwielicht.
Im Grunde war meine Wohnung nur eine Höhle mit zwei Räumen. Der größere war das Wohnzimmer mit vielen Bücherregalen, außerdem hatte ich ein paar Wandteppiche und ein altes Star-Wars-Poster aufgehängt. Der Boden war mit verschiedenen Läufern bedeckt. Neben handgewirkten Navajo-Teppichen gab es auch ein sechzig Zentimeter breites schwarzes Ding mit dem Gesicht von Elvis mitten darauf. Wie den Käfer würden manche Leute meine bunte Sammlung von Bodenbelägen vermutlich als eklektisch bezeichnen. Für mich waren es einfach schützende Schichten, die mir den Kontakt mit dem eiskalten Steinboden ersparten.