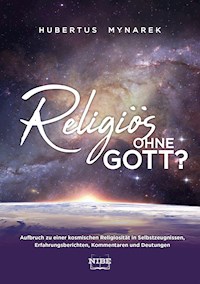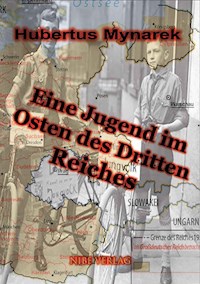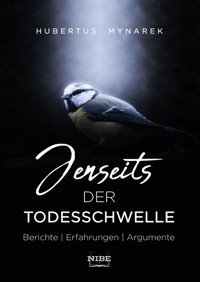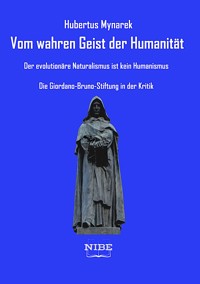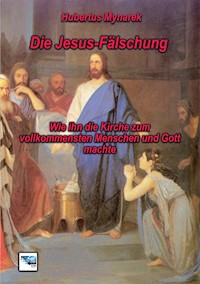
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NIBE Media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
"Ein hochgescheites, kritisches und mit feiner Ironie durchsetztes Buch". Dr. Norbert Copray in "Publik-Forum" "Fundiert und klar wird hier dem verbreiteten verkitschten Jesus-Bild (z. B. Franz Alt, Drewermann, Sölle usw. usw.) entgegentreten". Prof. Dr. Franz Buggle, Autor des Buches "Denn sie wissen nicht, was sie glauben". "Ich empfinde diese Neuerscheinung als anstößig im besten Sinne dieses Wortes". Prof. Dr. Gerd Stein "Mynarek zeigt einen Jesus, der gar nicht dem Goldschnitt-Jesus der Kirche entspricht". Henry Gelhausen im Luxemburger "Tageblatt" "Mynarek macht auf den verloren gegangenen erotischen Zug des Christentums aufmerksam". Prof. Dr. Uwe Gerber, Institut für Theologie an der TH Darmstadt. "Der Religionswissenschaftler, Philosoph und Theologe Prof. Dr. Hubertus Mynarek zählt unbestritten zu den prominentesten Religions- und Kirchenkritikern im deutsch-sprachigen Raum." MIZ-Redaktion "Rebellen sind gefährliche Zeitgenossen … Der Name Hubertus Mynarek wirkt auf frommkatholische Kenner wie die Warnung vor einem Tsunami … Ein Theologieprofessor und Dekan, der aus der Kirche austritt. Die Öffentlichkeit war schockiert. Noch dazu, wo sich die Medien auf sein explosives Buch >Herren und Knechte der Kirche< warfen … Auch Mynareks neuestes Werk ist ein brillant geschriebenes Buch, sehr lesenswert". Mynarek bleibt "ein leidenschaftlich-kompromissloser Wahrheitssucher". Rudolf Schermann, Chefredakteur der Wiener Zeitschrift "Kirche In". "Hubertus Mynarek wirkt mit seinem stupenden Wissen und seiner Sprachmächtigkeit … und dies seit vielen Jahrzehnten in einer Fülle von Publikationen, wie sie heute von keinem auf diese Weise mehr geleistet werden kann: von der Kirche-, Papst- und Institutionskritik … den ethischen Fragen der modernen Naturwissenschaft bis hin zu Problemen der praktischen Lebensgestaltung und der Ethik". Prof. Dr. Michael Kilian
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Hubertus Mynarek
Die Jesus-Fälschung
Wie ihn die Kirche zum vollkommensten Menschen und Gott machte
Impressum
©NIBE Media ©Hubertus Mynarek
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags und des Autors reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Created by NIBE Media
NIBE Media
Broicher Straße 130
52146 Würselen
Telefon: +49 (0) 2405 4064447
E-Mail: [email protected]
www.nibe-media.de
Inhaltsverzeichnis:
I. Teil: Jesus - Ein jüdischer Prophet, kein Religionsstifter
1. Jesus hat keine christliche Religion und keine Kirche gegründet
II. Teil: War Jesus einzigartig, vollkommen, fehlerlos, alle anderen Persönlichkeiten der Weltgeschichte überbietend?
2. Das Jesusbild der Kirche, der kirchlichen Theologen und Bücherschreiber
3. Jesus als Kind und Jugendlicher
4. Uneheliche Herkunft Jesu und sein Anspruch, einzigartig zu sein
5. Die Widersprüche der Evangelien bei der Darstellung der Herkunft Jesu
6. Das Christentum: Eine Religion der Träume und Mythen
7. Eine Vergewaltigung am Anfang der Jesus-Biografie?
8. Halbgott Jesus – Leihmutter Maria oder transsexuelle Mutation?
9. Widersprüche in den Genealogien Jesu und unmoralische Vorfahren
10. Arroganz und Schroffheit im Charakter Jesu?
11. War Jesus verheiratet?
III. Teil: Jesus war kein Priester, kein Zölibatär und hatte diverse Kontakte mit Frauen
12. War Jesus ein majestätischer, aber auch gütig herablassender Macho?
13. Jesus-Phantasien über zehn Bräute
14. Der Erhabene und die Frau aus dem Volk
15. Maria Magdalena – Geliebte oder Ehefrau Jesu?
16. Eine reiche Lady in der Liebeskommune Jesu
17. Zwei Schwestern – Rivalinnen im Ringen um die Gunst des Meisters
18. War Jesus kein Demokrat? War er Verfechter eines Systems von Herren und Knechten?
19. Der Gegensatz zwischen jesuanischem und katholischem Zölibat, zwischen jesuanischer und kirchlicher Ehe- und Familienethik
IV. Teil: Der Mega-Schwindel der Kirche mit Maria, der Mutter Jesu
20. Absolut einzigartige Karriere einer Frau
Resümee: Eklatante Differenzen zwischen Jesusmoral und Kirchenmoral
Urteile zur Bio- und Bibliografie von Hubertus Mynarek
Bücher von Hubertus Mynarek
Kurzbiografie von Hubertus Mynarek
Anmerkungen:
I. Teil: Jesus - Ein jüdischer Prophet, kein Religionsstifter
1. Jesus hat keine christliche Religion und keine Kirche gegründet
Die römisch-katholische Kirche verkündet seit dem ersten Beginn ihrer Existenz als eines ihrer zentralen Dogmen, dass sie die authentische Kirche Jesu Christi sei, dass Jesus sie gegründet habe. Auch die protestantische Kirche, die lutherische ebenso wie die reformierten Kirchen Calvins und Zwinglis leiten sich mit voller Überzeugung von Jesus Christus ab. Alle Theologen dieser Kirchen sind Agitatoren, Propagatoren und Apologeten der These von der Herkunft ihrer Kirche aus dem Ursprung, der Jesus Christus heißt.
In radikalem Gegensatz dazu muss als sicher gelten: Jesus war Jude, blieb Jude und hat nie vorgehabt, eine christliche Religion oder eine sich christlich nennende Kirche zu gründen. Die Frage, ob es diesen Jesus wirklich gegeben, ob er wirklich gelebt hat, können wir hier außer Acht lassen.
Sie ist bis heute wissenschaftlich nicht endgültig entschieden. Aber wenn er gelebt hat, war er Jude und hat er nicht an ein Christentum und schon gar nicht an die Stiftung einer christlichen oder katholischen Kirche gedacht. Daran hinderte ihn nicht nur seine tiefe, innere Zugehörigkeit zur jüdischen Religion, sondern auch der Umstand, dass er fest an die sehr bald hereinbrechende Gottesherrschaft auf Erden glaubte, dass sein Leben ganz im Zeichen dieser Naherwartung stand. Wie sollte er da an die Gründung einer neuen Religion oder gar an eine Organisation wie die katholische Kirche denken?
Die „Kirche Jesu Christi“ hängt also in der Luft, sie hat keinen real-historischen Ursprungs- und Herkunftsort, weil sie sich auf den jüdischen Jesus legitimerweise nicht berufen kann.
Diese Kirche enthält noch einen zweiten Fehler, denn vom jüdischen Jesus wissen wir nicht, ob er sich als Christus, als Messias empfand. Wenn ja, dann eben nur als den Messias und Retter des jüdischen Volkes, nicht als Retter der ganzen Welt oder auch nur anderer Völker. Nirgendwo bei den Juden war „ein Messias als Gott gedacht wie in der späteren Dogmatik der Christen. Auch der von den Juden erwartete Retter, der ebenfalls als Messias bezeichnet wurde, war als Mensch gedacht. Sicherlich hat auch Jesus selbst mit seinen Glaubensbrüdern den Messias erwartet.“1
Die ursprüngliche Botschaft Jesu vom nahen Gottesreich war ebenfalls jüdisch. Sie war kein originelles Sondergut innerhalb der jüdischen Religion. Auch andere Juden verkündeten sie. „Wichtig aber ist, dass Jesus, wenn er das Reich Gottes verkündet, nicht sich selbst verkündet. In den älteren Schichten der Evangelien erscheint Jesus als frommer Jude, der an den einzigen Gott glaubt und zum Glauben an diesen aufgerufen hat, aber nicht zum Glauben an seine eigene Person.“2
Mit so einem Juden Jesus und seiner Art von Predigt konnte das Christentum jedoch nichts anfangen. Es wäre dann nichts als eine Variante, eine der vielen Varianten der jüdischen Religion gewesen und geblieben. Es musste also eine Umgestaltung dieses Menschen Jesus von einem Verkünder zum Verkündeten, vom einfachen Verkünder der messianischen Botschaft zum Messias höchstpersönlich in Gang gesetzt werden. Er selbst musste zum Zentrum und Kern der Botschaft werden. Mit anderen Worten: Der Jude Jesus musste verfälscht, zum Christen und Gründer der christlichen Religion umfunktioniert werden. Wehren konnte er sich dagegen ja nicht mehr, er war sehr früh, im ersten Mannesalter getötet worden.
Die frühchristlichen Gemeinden verstanden also, um es milder auszudrücken, unter der »Frohen Botschaft« etwas durchaus anderes als Jesus selbst. Es war „die Überzeugung, dass in Jesus der versprochene Messias erschienen sei und dass er wiederkommen werde. Die ersten Christen verstanden also unter Evangelium etwas ganz anderes als Jesus. Der Bedeutungsinhalt des Begriffs hatte sich gewandelt … Im Verständnis der Gemeinde spielte das Reich Gottes, an dem Jesus so interessiert war, immer weniger eine Rolle. Heiden konnten mit dieser jüdischen Vorstellung wenig anfangen … Stattdessen wartete die Gemeinde auf die Wiederkunft Jesu …“3
Als auch diese nicht stattfand, wurde aus der Hoffnung auf sie der Glaube an ein jenseitiges Leben, an dessen Beginn Gottmensch Jesus den Verstorbenen mit seiner Frohbotschaft oder dem Gerichtsurteil über den Todsünder empfängt.4 Die weitere Umgestaltung der christlichen Religion, die Entfernung vom Mutterboden der jüdischen ging zügig voran. Jesus wurde zu Gott, zum Gottessohn, wesensgleich mit Gott Vater, der ihn auf die Erde gesandt hat, um die Menschen durch seinen Kreuzestod von ihren Sünden zu erlösen. Um sein Werk nach seinem Wiederaufstieg in den Himmel auf Erden weiterzuführen, habe Jesus die Kirche gegründet.
Das also ist im Wesentlichen die „Kirche Jesu Christi“ nach der Lehre der katholischen Dogmatik und auch der heutigen Theologen.
Allen Ernstes stellen sich diese gegen den eindeutigen Befund der gesamten historisch-kritischen Erforschung des Neuen Testaments, wenn sie erklären: „Der Christus der Christen ist niemand anders als Jesus von Nazaret.“5 Dagegen steht das bekannte Wort Adolf von Harnacks, eines der bedeutendsten Bibelforscher und Theologen, das alle wissenschaftlich ernstzunehmenden Exegeten unterschreiben können, nämlich dass „nicht der Sohn, (sondern) allein der Vater in das Evangelium gehört, das Jesus verkündet hat.“
Wenn der an Hunderttausende verteilte katholische Jugendkatechismus YOUCAT posaunt: „In der Kurzformel Jesus ist der Christus kommt der Kern des christlichen Glaubens zum Ausdruck“, dann klingt das gar nicht anders als der mit Ziffer 5 versehene Ausspruch. Der ursprüngliche jüdische Jesus wird von einer »Jesus ist der Christus«-Theologie total an den Rand gedrängt, ja verdrängt.
Heidenchristlich-hellenistische Vorstellungen von Jesus als auf die Erde herabgestiegenem Gottessohn und Heilsbringer haben sich unter dem mächtigen Einfluss eines Paulus von Tarsus und der daran anschließenden Bewegung des Frühkatholizismus über das ursprüngliche Bild des Juden Jesus geschoben, haben dessen Verstehenshorizont durch einen ganz anderen, ihm nicht gemäßen ersetzt. Man ist „eigentlich gar nicht an dem interessiert, was Jesus wirklich dachte und sagte, sondern viel eher an einer an den Haaren herbeigezogenen Bestätigung der viel späteren Dogmatik der Kirche. Ihr hat sich alles unterzuordnen, selbst der historische Jesus“.6
Papst Benedikt alias Joseph Ratzinger glaubt, dass diese Verschiebung von der göttlichen Vorsehung, von Gott gewollt war, dass die Hellenisierung des Christentums das Mittel darstellte, um die christliche Religion größer, mächtiger, auch nobler und hoffähiger auf der weiten Arena des Imperium Romanum zu machen. Die gesamte Evolution des Christentums bis hin zur Alleinherrschaft des Papsttums sei das Produkt der Lenkung durch Gott und seinen Christus gewesen. Deshalb habe das Christentum nicht beim Judentum als einer lediglich von ihr abgespaltenen Sekte bleiben dürfen.
Gelegentlich macht Ratzinger-Benedikt gar kein Hehl aus seiner Einschätzung der jüdischen als einer im Vergleich mit dem griechischen Geist niederen Religion, etwa wenn er sagt: „Für die Griechen war das Christentum … Barbarei gegenüber der eigenen Kulturhöhe. Der griechische Geist hat dem christlichen Glauben wesentliche Formen des Denkens und Redens geliefert … Abraham, Isaak, Jakob, Mose erscheinen mit all ihren Schlichen und ihrer Schläue, mit ihrem Temperament und ihrer Neigung zur Gewaltsamkeit zumindest recht mittelmäßig und armselig neben einem Buddha, Konfutse oder Laotse, aber selbst so große prophetische Gestalten wie Hosea, Jeremia, Ezechiel machen bei einem solchen Vergleich keine ganz überzeugende Figur …
Vor der Erhabenheit mythischen Denkens erscheinen die Träger der Geschichte des Glaubens beinahe pöbelhaft …
Religionsgeschichtlich gesehen, sind Abraham, Isaac und Jakob wirklich keine großen religiösen Persönlichkeiten“.7
Es klafft ein an sich unüberspringbarer Graben zwischen dem ursprünglichen, durch und durch jüdischen Jesus und dem hellenistischen Christus, wie ihn das frühe Christentum der ersten vier Jahrhunderte konstruiert hat. Diese Konstruktion wird bis heute, auch noch – trotz ihrer scheinbaren Antagonismen und Animositäten – in seltener Einmütigkeit von den Theologen den Gläubigen als der wahre, ja als der historische Jesus verkündet. Alle Kirchentheologen von links bis rechts wollen nicht wahrhaben, nicht akzeptieren, dass drei Jahrhunderte intensivster Forschung in Neuzeit und Gegenwart den erwähnten Graben ständig noch immer breiter werden ließen.
Diese urteilt eindeutig: „Jesus war Jude, der seinen Glauben reformieren wollte. Eine neue Religion stiften wollte er nicht.“8 Eine andere Expertenstimme: „Man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass Jesus Jude war, dass er nichts anderes als Jude sein wollte und nur aus dem Judentum heraus verstanden werden kann. Er bewegte sich im Rahmen der jüdischen Traditionen und Sitten, von der Beschneidung über die Speisevorschriften zum Synagogenbesuch und der Sabbatheiligung, er war im Wesentlichen toratreu und setzte die göttliche Erwähltheit des Volkes Israel voraus. Alles, was er tat, dachte und sagte, bezog sich auf das Judentum und war an das Volk Israel gerichtet.“9
Auch der evangelische Neutestamentler Gerd Theißen gibt zu, dass die früheste Jesusbewegung nur „in Wechselwirkung mit der umgebenden jüdisch-palästinensischen Gesellschaft“ verstanden werden könne. Es habe sich um „eine Bewegung vagabundierender Charismatiker“ gehandelt, also um „wandernde Apostel, Propheten und Jünger, die von Ort zu Ort zogen … Es war eine innerjüdische Erneuerungsbewegung, die der Menschensohn da, fern der großen Städte im Hinterland, ins Leben rief, und die anfangs mit vielen anderen innerjüdischen Reformbewegungen in Konkurrenz stand.“10
Aber man braucht zu dem heiß debattierten Punkt eigentlich gar nicht das Urteil der Bibelexegeten zu bemühen. Wer lesen kann, wird ganz eindeutige Stellen in den Evangelien finden, die Jesu exklusive Ausrichtung auf die jüdische Religion beweisen. Die frühkatholische Kirche hat es eben nicht ganz geschafft, all die Stellen in den vier kanonischen, also von ihr amtlich anerkannten Evangelien zu löschen, die gegen ihren vermeintlich von vornherein christlichen Jesus sprechen. Eine Stelle ist in unserem Zusammenhang besonders zu erwähnen, und sie zeigt, dass der ursprüngliche jüdische Jesus auch in seinem Charakter von dem nur noch lieb und lieblich gezeichneten christlichen Jesus, dem »Jesus Christus« der Amtskirche und der Theologen wesentlich abweicht.
Es handelt sich um die Stelle Mk. 7,24-30 (und Mt. 15,21-28), die darüber berichtet, wie Jesus sich gegenüber einer „Heidin, aus Syrophönizien gebürtig,“ verhält. Sie bittet Jesus, doch den Dämon, den unreinen Geist, der ihrer Tochter schwer zu schaffen mache, aus dieser auszutreiben. Die Frau hatte erfahren, dass sich der Wunderheiler Jesus in Phönizien, also dem Land nordwestlich von Galiläa, genauer im Gebiet von Tyros und Sidon, aufhielt. Vielleicht war nun Jesus schon deshalb ungehalten, weil die Frau ihn in einer Situation überraschte, die er verbergen, die er geheim halten wollte. Markus sagt nämlich: „Er ging in ein Haus und wollte nicht, dass es jemand erführe.“ Fügt aber auch hinzu, dass das „nicht verborgen bleiben konnte“. Das Matthäusevangelium, das ja später verfasst wurde, hat offenbar schon bemerkt, dass diese Formulierungen des Markusevangeliums einige unerwünschte Mutmaßungen über die Art des Hauses nahelegen konnten. Deshalb sagt es nur kurz und knapp, Jesus habe sich in die Gegend von Tyros und Sidon zurückgezogen, und dort sei ihm dann die heidnische Frau entgegengetreten.
Sie wirft sich Jesus zu Füßen, zeigt so ihre ganze Ohnmacht, Hilflosigkeit, Demut vor dem jüdischen Wunderheiler, dessen Ruf ihm schon über die Grenzen seines Heimatlandes hinweg vorausgeeilt war. Im Fußfall drückt sich aber auch ihre ganze Hoffnung aus, dass dieser Mann ihr arg leidendes Töchterchen heilen könnte. Sie fleht ihn an, er möge ihre vom Dämon böse drangsalierte Tochter befreien. Jesus aber ist hier ganz und gar männliche Hoheit und Überlegenheit. Er nimmt die heidnische Frau, die da vor ihm im Staub liegt und ihn anfleht, gar nicht zur Kenntnis, sie ist einfach Luft für ihn, existiert sozusagen überhaupt nicht. Er ist der Mann, der eine religiöse Mission zu erfüllen hat. Und die ist auf Israel beschränkt. Hier, im Grenzgebiet, aber schon jenseits Palästinas, hält er sich nur zum Vergnügen, zur Erholung oder im Rahmen eines Ausweichmanövers vor seinen Gegnern, jedenfalls inoffiziell, auf. Er ist hier gleichsam inkognito anwesend. Was will also diese Frau? Sie hat bei ihm nichts zu suchen. „Er aber antwortete ihr nicht ein Wort!“
(Mt. 15,23).
Doch eine liebende Frau gibt so schnell nicht auf, und diese Mutter liebt nun einmal ihre Tochter über alles. So verwandelt sich ihr Flehen und Bitten in ein ungestümes, lautes Schreien. „Und sie schrie laut: Erbarme dich meiner, Herr, du Sohn Davids" (Mt. 15,22). Aber auch das ändert nichts an der schroff abweisenden, ja sie total ignorierenden Haltung Jesu. Er ist längst an ihr vorübergegangen, die Sache ist an sich schon für ihn abgehakt, erledigt. Doch die Frau sagt sich: „Hat er mein Flehen nicht erhört, so werde ich ihn durch mein Geschrei zwingen.“ Fühlte sie doch offenbar mit ihrem weiblichen Instinkt, dass dieser israelitische Wunderheiler hier im Ausland möglichst wenig auffallen möchte. Tatsächlich geht den Jüngern, die Jesus begleiten, ihr Gebrüll auf die Nerven. Die Situation wird ihnen zunehmend unangenehm, peinlich, vielleicht erscheint sie ihnen hier, auf dem ungewohnten Parkett jenseits der Grenze ihres Heimatlandes, sogar gefährlich. Also bitten sie jetzt ihrerseits den Chef: „Fertige sie doch ab, denn sie schreit uns nach!“ (Mt. 15,23). Aber der Chef bleibt stur und ungerührt. Immerhin lässt er sich zwar nicht der Frau, wohl aber den Jüngern gegenüber zu einer Erklärung herab: „Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt“ (Mt. 15,24).
Offenbar ist Jesus bei dieser Erklärung einen Moment stehengeblieben. Das gibt der verzweifelten Mutter Gelegenheit, wieder heranzukommen. Sie wirft sich erneut vor ihm zu Boden und bittet inständig: „Herr, hilf mir!“ (Mt. 15,25). Jetzt endlich macht dieser Mann, der bisher ihr gegenüber nur unnahbare Majestät und eisiges Schweigen war, endlich den Mund auf und redet auch sie an. Aber das, was er nun von sich gibt, bekundet tiefste Verachtung der Heiden, die nun einmal nicht zu den Kindern des auserwählten Volkes gehören: „Es ist nicht recht, den Kindern das Brot zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen“ (Mk. 7,27; Mt. 15,26).
Sie und alle Heiden sind also Hunde. Die arme Frau musste diese Charakterisierung wie ein Keulenschlag treffen. Ihre ganze Würde als Mensch, als Frau, als Person tritt dieser Mann mit einer so verächtlichen Bemerkung einfach nieder. Aber aus unsagbarer Liebe zu ihrer Tochter schluckt sie auch diese Beleidigung. Sie rafft sich zu einsamer Größe, zur Genialität der Niedrigkeit und Schwäche auf und schlägt Jesus mit dessen eigenen Waffen, mit dem Instrumentarium seiner eigenen hässlichen Bemerkung: „Sie aber sagte: Doch, Herr, denn auch die Hunde fressen von den Brocken, die vom Tisch ihrer Herren fallen“ (Mk. 7,28; Mt. 15,27). Jetzt ist der Chauvi besiegt, er streckt die Waffen, ist überwältigt von der Größe ihrer Liebe zur Tochter. „Um dieses Wortes willen geh hin; der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren“, lässt das Markusevangelium Jesus sagen (7,29). Matthäus macht aus der ganzen Geschichte schon wieder einen Sieg des Glaubens an den Messias („0 Weib, dein Glaube ist groß“ 15,28), während der realistischere, faktennähere Markus durchaus noch sieht und zugibt, dass Jesus sich von der Frau widerlegt fühlt, sich durch ihre Antwort geschlagen gibt. „Um dieses Wortes willen geh hin!“ Das heißt: „Weil du diese Antwort gefunden hast, der ich nichts mehr entgegenzusetzen habe, will ich deine Tochter heilen.“
Wie der apologetische Verfasser des Matthäusevangeliums halten es bis heute selbst die kritischsten kirchlichen Theologen und Schriftsteller: Sie sind eifrig bemüht, das außerordentlich Peinliche an der Begegnung zwischen Jesus und der heidnischen, kanaanäischen oder syrochaldäischen Frau möglichst gar nicht wahrzunehmen oder aber herunterzuspielen, wegzuerklären und schließlich und endlich doch wieder in einen Triumph der Größe und Vollkommenheit des Gottessohnes umzuwandeln. Selbst feministische Theologinnen behaupten allen Ernstes, dass Jesus in dieser Begegnung mit der heidnischen Frau in grandioser Weise seinen Schatten besiegt und als erster Mann „die Androzentrik der antiken Welt durchbrochen“ habe. Im Endresultat all seiner Begegnungen mit Frauen zeige sich der Galiläer stets als reifer, integrierter Mensch, der imstande ist, Männliches (Animus) und Weibliches (Anima) gleichermaßen zu entfalten und zur gleichberechtigten Harmonie zu bringen.11 Selbst wo man zunächst einmal – selten genug übrigens – eingesteht, dass der Mann Jesus sich daneben benommen hat, macht man am Ende daraus doch wieder einen Beweis für die enorme Lernfähigkeit und schnelle, geistesgegenwärtige Situationserfassung dieses „größten“ Lehrers der Menschheit: „Nur weil er selbst durch die Phase der Menschenverachtung gegangen ist und bereit war, sich eines Besseren belehren zu lassen, konnte er zum Lehrer anderer werden – denn hinter ihm stand die Autorität der Selbsterfahrung.“12 Franz Alt, der, wie er dankend vermerkt, erst durch seine Frau Bigi auf die feministische Theologie, „diese Befreiungstheologie in den reichen Ländern“, gestoßen worden ist, hängt sich an die eben zitierte Aussage Christa Mulacks und überbietet sie noch: Zwar sei Jesus zunächst „noch ganz gefangen in Sexismus und Nationalismus.“ Die heidnische Frau sei als Frau für ihn anfangs „gar kein richtiger Mensch“. Aber dann „lernt Jesus, sein eigenes Verhalten als ›hündisch‹ zu begreifen“, weil er sich als fähig erweist, diese Frau ernst zu nehmen. „Er sieht seinen Schatten, seinen männlichen Stolz, seine noch nicht integrierte Anima. Er beginnt, auf das Weibliche in sich zu hören … Jesus hat von der nichtjüdischen Frau viel gelernt … Jesu Lernbereitschaft gegenüber Frauen ist deshalb so neu und überraschend, weil Männer zu seiner Zeit noch gar keine psychische Beziehung zum Weiblichen hatten“.13
Man sieht: In den Augen von Christus-Bewegten kann dieser Jesus gar nichts falsch machen. Am Schluss ist er doch immer der Größte, und das in jeder, auch der peinlichsten Situation. Macht Jesus schon mal einen (allerdings nur oberflächlich als solcher erscheinenden) Fehler, dann behebt er ihn in einer Weise, wie es kein anderer könnte.
Daher betont auch die evangelische Theologin Moltmann-Wendel: „Aus dem Nationalisten, der sich auf sein eigenes Volk beschränken möchte, wird Jesus – dank der kanaanäischen Frau – auch der Helfer und Heiler der Heiden, der Kanaanäer.“14
Was Kirchentreue und von der »absoluten Person Jesus« (Drewermann) Überzeugte in die Begegnung mit der heidnischen Frau hineindeuten, ist totaler Unsinn. Nichts, aber auch gar nichts gibt diese Begegnung her für einen Beweis der Lernbereitschaft Jesu, der Überwindung seines Macho-Schattens, der Entdeckung der Weiblichkeit, der Befreiung von der Verachtung ausländischer, heidnischer Frauen und der Bekehrung vom Nationalisten zum Kosmopoliten. Wer die Stellen bei Markus und Matthäus so liest, wie sie dort aufgezeichnet sind, kann lediglich feststellen: Dieser Jesus ist einfach nur baff erstaunt über die clevere Antwort der heidnischen Frau und weiß im Moment wirklich nichts darauf zu erwidern. Dass er deshalb seinen Machismo aufgegeben hätte, ist den Texten in keiner Weise zu entnehmen. Auch ein halbwegs intelligenter Macho unserer Tage kann mal einer witzig, spritzig, klug argumentierenden Frau recht geben oder sich für einen Augenblick durch sie geschlagen bekennen. Das wird ihn bei weiteren Konfrontationen mit Frauen kaum daran hindern, seine gewohnte Rolle wieder zu spielen, wird ihn höchstens dazu bewegen, beim nächsten Mal in seinen eigenen Argumentationen vorsichtiger zu agieren, um sich nicht wieder eine Blöße zu geben.
Das Gegenteil bestätigt sich. Denn es gibt genug Stellen in den Evangelien, in denen die Überzeugung Jesu, „nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt“ zu sein, zum Ausdruck kommt. Seine Apostel sendet er mit dem strikten Verbot der Heidenmission aus: „Gehet nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel“ (Mt. 10,5 f). Ebenso exklusiv betont Jesus: „Das Heil kommt von den Juden“ (Joh. 4,22). Es gibt für ihn kein anderes Gesetz als das jüdische, als das der Thora: „Leichter ist es, dass Himmel und Erde vergehen, als dass auch nur ein Tüpfelchen vom Gesetz wegfiele“ (Lk. 16,17). „Meinet nicht, ich sei gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen.
Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen“ (Mt. 5,17).
Freilich, Jesus nimmt das jüdische Gesetz (ein christliches kennt er nicht, kommt ihm auch gar nicht in den Sinn) locker-relativ. Nicht so stur, traurig-ernst und schwer wie die Schriftgelehrten, Pharisäer und Essener. Seinen eigenen äußerst freizügigen Lebensstil glaubt er leicht mit dem Willen Abbas, seines himmlischen Daddys, vereinbaren zu können, denn dieser sein Gott „lässt ja auch seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte“ (Mt. 5,45). Dieser Gott ruft im Verständnis Jesu selber zu heiliger Sorglosigkeit auf: „Schaut die Vögel des Himmels: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen – und euer himmlischer Vater ernährt sie“ (Mt. 6,26). Genau so hat sich Jesus von den von ihm begeisterten Frauen ernähren lassen, nicht direkt zwar vom himmlischen Vater, aber eben indirekt, über die Frauen. „Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen: sie mühen sich nicht ab und spinnen nicht, aber ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Pracht war gekleidet wie eine von ihnen“ (Mt. 6,28f). Wie ein jüdischer König, wie Salomo hat sich auch Jesus gefühlt. Warum also hätte er sich weiterhin in seinem Bauhandwerkerberuf in Nazareth abmühen sollen? Deshalb ist Jesus auch im Allgemeinen toleranter zu den Randsiedlern der Gesellschaft, den Dirnen, Ehebrecherinnen, Versagern, korrupten Zöllnern und Kollaborateuren mit der verhassten römischen Besatzungsmacht. Das aber nur unter der Bedingung, dass sie Juden sind.
Jesus versteht sich als Reformer des Judentums, will tatsächlich erneuern – aber stets im Rahmen des jüdischen Volkes, der jüdischen Gesellschaft. Die anderen, die Nichtjuden, sind für ihn tatsächlich »Hunde«, denen er nichts zu sagen hat. Nur widerwillig lässt er sich herab, ihnen auch einmal seine magische Heilkraft angedeihen zu lassen. Wir haben das bei der Kanaanäerin, der Nichtjüdin, gesehen.
Beim heidnischen Hauptmann von Kapernaum, der um die Heilung seines Knechtes bittet, ist Jesus schneller zur Hilfe bereit. Aber da handelt es sich auch um einen Mann. Und vielleicht will sich's Jesus in diesem Fall auch nicht mit der römischen Obrigkeit verderben (Mt. 8,5-13). Denn immerhin stand in Kapernaum, damals einer blühenden Stadt mit dreißig- bis vierzigtausend Einwohnern, heute ein kleines Araberdorf, das geräumige, wohlhabende Haus des Simon Petrus, in dem Jesus gern weilte und sich wohl fühlte. Diese Gelegenheit hätte Jesus gefährdet, wenn er den Wunsch des heidnischen Hauptmanns nicht erfüllt hätte. Die Präsenz römischer Soldaten in Kapernaum war überall fühlbar, weil diese Stadt für Rom von strategischer Bedeutung war.
Jesus war wohl keineswegs frei von jedem Opportunitätsdenken. Doch gibt es Autoren, die die Schuld, dass Jesus der heidnischen Frau nicht so schnell und willig wie dem heidnischen Offizier geholfen hat, dieser selbst zuschreiben. Sie sei ja doch „sehr aufdringlich“, „neurotisch“ gewesen und habe „ihren eigenen bösen Geist auf ihre Tochter übertragen.“15
Jüdische, also nichtchristliche Religionswissenschaftler haben weit weniger Schwierigkeiten als ihre christlichen Kollegen, das spezifisch und exklusiv Jüdische des Galiläers zu sehen. Joseph Klausner z.B. betont ganz zu Recht:
„Jesus war Jude und blieb es bis zu seinem letzten Atemzug. Sein einziges Ziel hieß: den Gedanken vom nahe bevorstehenden Kommen des Messias in das Herz des Volkes einzupflanzen.“ Klausner, der am Beginn der modernen jüdischen Leben-Jesu-Forschung steht, glaubt, dass Jesus überzeugt gewesen sei, sein Volk sei Gott das liebste. Stolz über das eigene Volk und seinen Glauben, Reserviertheit gegenüber den Nichtjuden nach dem Motto „Du hast uns erwählt, o Herr“, hätten Jesus gekennzeichnet.16 Geza Vermes hat weitere rabbinische Quellen über Klausner hinaus erschlossen, die Jesus noch deutlicher als Juden erweisen.
In Werken wie „Jesus der Jude“ und „Jesus and the World of Judaism“ zeigt Vermes den Nazarener als einen in der prophetischen Tradition Israels fest verankerten Menschen.
Jesus sei ein galiläischer Chassid gewesen, ausgestattet mit magisch-charismatischen Heilkräften und besonderen Einblicken in die Beziehung des Menschen zu Gott. Viele Chassidim, nicht nur Jesus, hätten damals mit der religiösen Obrigkeit in Jerusalem im Streit gelegen. Vermes hat uns auf diese Weise weitere Aspekte des Judeseins Jesu eröffnet.17 Auch Paul Winter, berühmt durch seine eingehende Untersuchung des Gerichtsprozesses gegen Jesus („On the Trial of Jesus“), den er als hervorragender Kenner des römischen und des talmudischen Rechtes unter juristischen und historischen Aspekten detailliert beschreibt, stellt eindeutig fest: „Jesus war Jude. Er lebte unter Juden, lernte von Juden, lehrte Juden. Die Erfolge, die er genoss, und die Schwierigkeiten, unter denen er sein Leben lang litt, teilte er mit anderen Juden. Diejenigen, die er lobte und die er tadelte, waren gleichermaßen Juden.“18
Prof. David Flusser ist sogar überzeugt, „dass der synoptische Jesus nie gegen die damalige (jüdische) Gesetzespraxis verstößt“, mit einer einzigen Ausnahme, nämlich dem Ährenausraufen am Sabbath.19 Flusser zeigt, vor allem in seinem bekannten Jesus-Buch, auf, dass dessen Gestalt nahtlos in die jüdische Umwelt des ersten Jahrhunderts hineinpasste.20
Schalom Ben-Chorin vermag Jesus in all dessen Gedanken und Aktionen als seinen »jüdischen Bruder« zu erkennen, auch wenn er keineswegs alles moralisch positiv bewertet, was dieser tut. Aber auch bei vielen Elementen in Lehre und Wirksamkeit Jesu, die Christen gern als originär neu und allein von diesem initiiert ansehen, weist Ben-Chorin jüdische Quellen und Parallelen nach.21
Man mag es merkwürdig, paradox, komisch oder tragikomisch finden. Aber der sog. Stifter des Christentums, der als sein Gründer geltende Jesus, war tatsächlich selber kein »Christ«, sondern zeitlebens, bis zu seinem Tode, ein Jude.
Und er wollte auch nie etwas anderes sein als ein frommer, guter Jude in seinem durchaus nicht immer dem späteren christlichen entsprechenden Verständnis von fromm und gut.
Die verrückte Menschheitsgeschichte hat so manche Kapriolen geschlagen. Aber die Umwandlung Jesu von einem Juden in einen Christen, ja Antisemiten, könnte die paradoxeste aller Kapriolen sein.
Wir haben mit Klausner, Vermes, Winter, Ben-Chorin und Flusser lediglich eine kleine Auswahl hervorragender Kenner der Materie zum jüdischen Charakter Jesu zu Wort kommen lassen. Ihre Ansichten sind auch gar nicht speziell auf dessen Begegnung mit der kanaanäischen Frau bezogen.
Aber sie bestätigen meine Interpretation dieser Begegnung.
In der hier behandelten Begegnung zeigt nur eine Person wahre Größe: die heidnische Frau, Jesus nicht, bis zuletzt nicht.
Im Grunde können wir für Mk. 7,24-30, wo die Begegnung Jesu mit der heidnischen Frau zum ersten Mal erzählt ist, aus Gründen der historischen Wahrheit nur überaus dankbar sein. Wir stoßen hier auf Urgestein, das in die in allen Evangelien anzutreffende Erhöhungstendenz Jesu gar nicht hineinpasst, von der harmonisierenden Endredaktion der Evangelisten offenbar übersehen wurde. Die vier kanonischen Evangelien sind ja in griechischer Sprache verfasst, in griechisch-hellenistischer Umwelt und Kultur zu einem Zeitpunkt geschrieben, als Jesus längst tot war, das Christentum sich längst jenseits der Grenzen Israels in der Weite des römischen Imperiums ausbreitete. Da musste man Jesus selbstverständlich universale, kosmopolitische Aussagen in den Mund legen. Das »Logion«, also der Ausspruch Jesu beispielsweise: „Den Weg zu den Heidenvölkern schlagt nicht ein und betretet auch keine Samariterstadt, geht vielmehr (nur) zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel“ (Mt. 10,5 f), muss deshalb als echt gelten, „weil die Christenheit ja alsbald Heidenmission betrieb, also das Gegenteil dieses Jesusbefehls praktizierte. Erfunden hätte sie ein solches Wort, das gegen ihre Praxis spricht, sicher nicht.
Um diese Praxis aber zu rechtfertigen, schmuggelte man, im Widerspruch zu dem eben zitierten (echten) Ausspruch Jesu, später an den Schluss des Matthäusevangeliums den Taufbefehl, in dem der ›auferstandene‹ Jesus die Weltmission gebietet. Dieser Befehl, den die Christen ausführten, bevor er gegeben war, gilt … als Fälschung.“22
Überhaupt alle Aussagen Jesu in den Evangelien, die die „ganze Welt“, „alle Völker“, die „Verkündigung des Evangeliums an alle Geschöpfe“ zum Gegenstand haben, wie auch Mk. 16,15, widersprechen in eklatanter Weise den Intentionen des Galiläers. Dass wir das so bestimmt und eindeutig konstatieren können, verdanken wir unter anderem ganz besonders dem Markus-Bericht über die kanaanäische Frau. Wie christliche Autoren gerade aus dieser Stelle der Evangelien eine neue, nationale Grenzen überschreitende Selbsterfahrung Jesu, eine im Vergleich zur gesamten Antike revolutionär neue psychische Beziehung zum Weiblichen herauslesen können, ist in keiner Weise zu begründen. In Wirklichkeit fehlt Jesus in der analysierten Situation jede Einfühlung in das konkrete Elend, den aktuellen Schmerz der heidnischen Frau um ihr Töchterchen. Seine Gefühlskälte gegenüber der Ausländerin lässt uns schaudern. Es gibt wahrscheinlich keine Stelle, keine Begebenheit in den Evangelien, wo Jesus derart eindeutig ein krass schroffes Macho-Gehabe aus nationalreligiösen Gründen an den Tag legt.
Wie also konnte es dazu kommen, dass der ursprüngliche, der ganz und gar jüdische Jesus zum Jesus Christus der (christlichen) Kirche wurde? An sich durfte es gar nicht dazu kommen, denn diese Umwandlung, Umgestaltung, Umfunktionierung Jesu geschah nach seinem Tod. Er konnte nichts dagegen tun, wurde nicht gefragt, ob er mit ihr einverstanden sei. Wenigstens Küng ist so ehrlich, dies in etwa zuzugeben, freilich nicht in seinem Buch „Ist die Kirche noch zu retten?“ (2011), weil er da ja die katholische Kirche als die Kirche Jesu Christi und diese als die Kirche des ursprünglichen, des historischen Jesus einfach behauptet, einfach ohne Belege oder irgendeinen Beweis vor die Leser hinstellt, um seine Reformversuche als Versuche erscheinen zu lassen, die auch die ursprüngliche Gestalt der Kirche, wie sie nach Küngs irrtümlicher Meinung schon Jesus im Sinn hatte, wieder erstehen lassen sollen. Nein, in seinem viel differenzierteren, durchdachteren Buch „Christ sein“ von 1974 gibt er die Diskontinuität zwischen dem ursprünglichen jüdischen Jesus und dem nachösterlichen Christus der frühchristlichen Gemeinden durchaus noch zu:
„Weder die unbestrittene Flucht der Jünger vor Ostern noch die ebenso unbestreitbare neue Qualifikation ihres Glaubens nach Ostern lassen sich hermeneutisch eskamotieren zugunsten einer durch den Tod Jesu kaum unterbrochenen Kontinuität des Glaubens. Erst jetzt bekennt ihn der Glaube als den auferweckten Messias, den erhöhten Herrn, den kommenden Menschensohn, den Gottessohn. Keine unmittelbare Fortsetzung der Sache Jesu nach seinem Tod ist bezeugt, sondern betont eine Diskontinuität“.23
Freilich macht es sich Küng auch in diesem weit früheren Werk zu einfach, wenn er diese »Diskontinuität« ohne Rekurs auf irgendwelche irdische Ursachen einfach als gottgewollt, als Werk Gottes selbst hinstellt: „Sämtliche neutestamentlichen Osterzeugnisse sind gekennzeichnet durch einen nicht eliminierbaren Gegensatz zwischen dem, was die Jünger taten und tun, und dem, was Gott an und durch Jesus getan hat“.24 Jene empfanden sich als in ihrem Glauben an Jesus Gescheiterte, hatten also nach Küng den neuen „christlichen“ Jesus gar nicht erfinden können. Gott selbst habe eingreifen, die Diskontinuität überbrücken müssen, indem er ihnen durch Ostererfahrungen, also Erscheinungen des auferstandenen Christus klarmachte, dass der jüdische Jesus in seiner vorösterlichen Erdenzeit doch zugleich der jetzt Auferstandene ist. „Der Osterglaube ist ein Neuansatz, der im Neuen Testament übereinstimmend nicht auf irgendwelche Vorbilder, nicht auf eigene Erkenntnisse, nicht auf einen heimlich durchgehaltenen Glauben, sondern auf – freilich zugleich gelebte und interpretierte – neue Erfahrungen, auf wahre Begegnungen mit dem auferweckten Gekreuzigten zurückgeführt wird.“25
Hier macht es sich Küng wieder entschieden zu leicht, indem er die irdischen, weltlichen, oft sogar sehr weltlichen Ursachen einfach überspringt und den neuen Jesus Christus, den Auferstandenen des frühen Christentums, als Werk Gottes bezeichnet.
Küngs urwüchsiges Vertrauen ins Sein, mit dem er ja auch seinen eigenen Gottesglauben legitimiert, scheint auch hier wieder eine maßgebende Rolle gespielt zu haben.
In Wirklichkeit muss hier die überragende, maßgebliche, ja entscheidende Rolle des „Mythenschmieds“26 Paulus aus Tarsus ins Spiel gebracht werden. Er ist der hauptsächliche Schöpfer des christlichen Jesus, des Jesus Christus der Kirche, des Christentums, wie wir es kennen. Paulus, der clevere Diaspora-Jude aus Tarsus, hatte glasklar erkannt, dass mit der Variante jüdischer Religion, wie sie der ursprüngliche Jesus vertreten hatte, kein Staat zu machen, sprich: keine Weltreligion zu gründen und zu schaffen war.
Eine Religion für die ganze kulturelle Atmosphäre und Weite des Imperium Romanum musste anders aussehen!
Also brachten Paulus und seine zahlreichen Mitarbeiter das ganze voluminöse Mythenarsenal der damaligen Welt in ihre neue Religionsform ein: Babylonisches, Ägyptisches, Persisches, Griechisches, Römisches usw., alles zentriert aber nicht mehr um die Gestalt und Biografie des jüdischen Wanderpredigers aus Galiläa, sondern um einen überirdischen, auf die Erde herabgestiegenen »Christus«, der auf ihr gelitten hatte, getötet wurde, doch durch Gott von den Toten auferweckt war und dessen Leiden und Sterben von diesem Gott als Erlösungstat, als Sühne für die Sünden der Welt akzeptiert wurde.