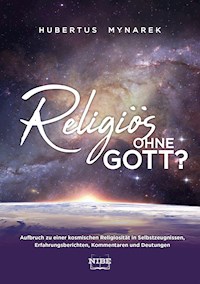Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Der bekannte Religionswissenschaftler und Kirchenkritiker Hubertus Mynarek (Jahrgang 1929), der nach seiner 1958 erfolgten Ausreise aus dem inzwischen polnischen Schlesien eine fulminante Karriere in Westeuropa durchlief (u.a. Professuren an den Universitäten Bamberg und Wien, Dekan der katholisch-theologischen Fakultät dortselbst), legt mit diesem Buch eine hochinteressante Biografie seiner Jugend im Osten des Dritten Reiches vor. Anschaulicher, konkreter, farbiger und detaillierter, aber auch spannender und frappanter ist eine Schulzeit unter dem Nationalsozialismus kaum jemals geschildert worden. Das Gleiche gilt von den in seinem Buch plastisch zu Tage tretenden Erfahrungen und Erinnerungen des Oberjungzugführers Mynarek an die Hitlerjugend. Eine Milieustudie über die HJ, die in ihrer Menge unbekannter Details wohl ziemlich einzigartig dasteht. Die Charaktere und Mentalitäten der Lehrer und Schüler in den Volksschulen und Oberschulen unter dem Hakenkreuz, ihre offiziellen und inoffiziellen Einstellungen und Meinungen, ihre Gruppenbildungen und ihre trotz der intensiv propagierten 'Volksgemeinschaft' sich herausbildenden Polaritäten sind eine Fundgrube für Chronisten und Historiografen des Dritten Reiches. Der Autor präsentiert Hunderte von Alltagsfacetten des Lebens unter den Nazis, Blitzlichter, die aufschlussreicher und informativer sind als ganze Reihen wissenschaftlicher Sachbücher. Mynarek schildert auch seinen Weg vom HJ-Führer zu einem der Wegbereiter der deutsch-polnischen Versöhnung, im Zusammenhang damit seine Kontakte zu bedeutenden Vertretern des polnischen Geisteslebens, Schriftstellern und Kirchenführern wie den Kardinälen Wyszyński und Kominek oder dem Leiter des oberschlesischen Priesterseminars, Dr. Jan Tomaszewski. Ein ganzes Kapitel unterschlagener bzw. unterdrückter deutsch-polnischer Geschichte unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wird so in diesem Buch zu neuem Leben erweckt. Wer dieses Buch gelesen hat, erhält einen tiefen Einblick in deutsch-polnische Grenzmentalität, kann berechtigterweise mitreden, wenn es um das schwierige Werk des Brückenbaus zwischen den komplizierten Seelenlagen und unterschiedlichen Kulturinteressen von Deutschen und Polen geht. Mynareks autobiografischer Bericht ist nur ein Mosaikstein, aber ein wichtiger in der Erinnerungsliteratur jener zu Ende gehenden Generation, deren ganze Jugend noch in die Zeit des Dritten Reiches fiel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine Jugend im Osten
Impressum
© NIBE Verlag © Hubertus Mynarek
Überarbeitete Ausgabe
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für den Inhalt des Buches ist allein der Autor verantwortlich und muss nicht der Meinung des Verlags entsprechen.
Created by NIBE Verlag
Printed in Germany
NIBE Verlag
Brassertstraße 22
52477 Alsdorf
Telefon: 02404/5969857
www.nibe-verlag.de
eMail: [email protected]
Hubertus Mynarek
Eine Jugend im Osten
des Dritten Reiches
Meinen Eltern
In steter Dankbarkeit
Inhalt
Einleitungskapitel
Warum dieses Buch – warum dieses Thema?
Zweites Kapitel
Meine Eltern und das Dritte Reich
Drittes Kapitel
Meine Erfahrungen in und mit der Hitlerjugend
Viertes Kapitel
Die Versöhnungsversuche ehemaliger Hitlerjungen mit Polen
Fünftes Kapitel
Als Schüler im Dritten Reich
Anmerkungen
Zur Person des Autors
Buchveröffentlichungen von Hubertus Mynarek
Einleitungskapitel
Warum dieses Buch – warum dieses Thema?
Eine Jugend im Osten des Dritten Reiches. Macht es überhaupt einen Sinn, solch ein Thema zu bearbeiten? Ja, wenn es sich um Berlin, Hamburg, Dresden oder München in der Zeit der Nazi-Herrschaft handelte, könnte man dem Thema vielleicht mehr Sinn abgewinnen, dürfte so mancher sagen. Aber Groß Strehlitz, eine Kreisstadt in Oberschlesien an der äußersten östlichen Grenze des Reiches, bevor Hitler seinen Überfall auf Polen inszenierte, wodurch diese Stadt ja nun plötzlich keine Grenzstadt mehr war, weil zum Dritten Reich jetzt auch das halbe Polen gehörte; bald sogar das ganze, als der Diktator den Hitler-Stalin-Pakt brach und in Sowjetrussland einmarschierte, nachdem er die Demarkationslinie, die mitten durch Polen verlief, mit seinen Armeen blitzkriegartig überschritten hatte – also dieses Groß Strehlitz erscheint ja auf den ersten Blick so unwichtig, dass eine Reportage irgendwelcher Art sich darüber gar nicht lohnt.
Nein, diese Stadt kann sich größenmäßig und im Hinblick auf seine Kulturgüter wirklich nicht mit Großstädten messen – und dennoch passierte hier ein gar nicht so unbedeutender Teil der Geschichte des Dritten Reiches. Ja, auch schon vorher zog diese Stadt die Blicke der Politik auf sich. Gehört doch zu ihr der nur etwa 10 km entfernte Annaberg, der heilige Berg Oberschlesiens, der bedeutendste Wallfahrtsort Schlesiens, der Mutter der Gottesmutter Maria gewidmet. Bis heute überschreitet die Zahl der zu diesem Berg pilgernden Katholiken nicht selten die magische Grenze von 100.000 Wallfahrern.
Mit dem Annaberg als dem höchsten, etwa 600 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Berg Oberschlesiens ist deutsche wie polnische, tschechische, habsburgische wie preußische, politische wie kirchliche Geschichte eng verbunden. Um ihn als Wahrzeichen Oberschlesiens tobten die Kämpfe des deutschen Freikorps mit den polnischen Insurgenten in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Hier errichteten später die Nazis eine kitschig-monumentale Gedenkstätte und ein gewaltiges Amphitheater, das die oberschlesischen Massen anziehen und von den Wallfahrten zur heiligen Mutter Anna, der der Berg gewidmet ist, abziehen sollte. Als Verwalter des heiligen Berges fühlen sich bis heute die Mönche des Franziskus von Assisi, deren wuchtiges Kloster, fast genau an der höchsten Stelle des Berges errichtet, die Täler ringsum beherrscht. Während des Zweiten Weltkriegs mussten die Mönche das Kloster verlassen, die SS quartierte sich ein.
Groß Strehlitz lag seit dem Altertum (archäologische Untersuchungen bezeugen eine Besiedlung des Groß Strehlitzer Raums schon seit der Bronzezeit) an wirtschaftlich bedeutenden Handelsrouten; im Altertum an der berühmten Salz- und Bernsteinstraße, im Mittelalter an der von Hamburg nach Kiew führenden Handelsstraße der Hanse, weswegen Strzelce Opolskie, so der heutige Name der Stadt, auch 1998 in das Städtebündnis der Neuen Hanse aufgenommen wurde.
Wegen dieser bevorzugten Lage wälzten sich im Spätsommer 1939 durch die Hauptverkehrsstraße der Stadt die siegesgewissen deutschen Truppen in Richtung Polen, und – dramatische oder je nach Sichtweise tragische Umkehrung der Geschichte – im Januar 1945 die geschlagene deutsche Armee und die Trecks der Flüchtlinge in genau umgekehrter Richtung, nämlich nach Westen ins Altreich, das kein Großdeutschland mehr war. Als Zehnjähriger erlebte ich mit eigenen Augen diesen gewaltigen Marsch gen Osten, als knapp 16jähriger empfand ich noch massiver und intensiver das Zurückfluten der sich auflösenden Bestandteile der deutschen Armee durch Groß Strehlitz in Richtung Oder, um dort eine letzte Widerstandsfront gegen den „bolschewistischen Erzfeind“ zu organisieren.
Wir Kinder winkten eifrig und freudig der deutschen Armee des Jahres 1939 zu. Aber es war ganz seltsam, denn so ganz ungehemmt konnte ich meiner Begeisterung keinen freien Lauf lassen, weil ich spürte, dass die Erwachsenen rings um mich eher bedrückt waren. Eine bleierne, düstere Schwere schien auf ihnen zu lasten. Zu Hause fragte ich deswegen meinen Vater. Der ließ sich mit der Antwort Zeit. Er wusste ja, dass Kinder alles ausplaudern, was man ihm als Wehrkraftzersetzung hätte ankreiden können: „Weißt du“, sagte er dann nur, „viele Leute hier sind ja schon älter, die denken halt an die Schrecken des Ersten Weltkriegs und dessen furchtbares Ende. Aber davon weißt du ja kaum etwas. Ein Krieg ist eben immer etwas Furchtbares!“ Die Worte meines Vaters machten einen starken Eindruck auf mich. Aber bald kamen die triumphalen Siegesmeldungen des Oberkommandos der Wehrmacht von der deutsch-polnischen Front, die diesen Eindruck zunächst einmal wieder verwischten.
Nachträglich würde ich mir wünschen, dass Daniel Goldhagen mit seiner berühmten These vom deutschen Volk als „Hitlers willigen Vollstreckern“ die düstere Stimmung der Einwohner von Groß Strehlitz miterlebt hätte. Ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass viele Deutsche so empfanden wie die in Groß Strehlitz, dass sie keinen Krieg wollten und keine Verbrechen an anderen Völkern. Freilich, sie standen nicht gegen Hitler auf, machten keine Rebellion, geschweige Revolution gegen ihn. Aber in welchem Volk unter welcher Diktatur geschieht das schon? Und die Nazi-Diktatur war ja eine der technisch bestorganisierten und am strengsten kontrollierenden der Geschichte. Dieses Übermaß an Mut, an Zivilcourage, das nötig gewesen wäre, um z.B. ein Attentat auf Hitler zu planen und durchzuführen – dazu waren natürlich nur wenige fähig.
Aber kehren wir zur Hauptfrage dieses einleitenden Kapitels zurück. Groß Strehlitz ist auch deshalb für die Geschichte des Dritten Reiches nicht ohne Bedeutung, weil es die erste Stadt Schlesiens in den vor Beginn des Zweiten Weltkrieges bestehenden Grenzen des Deutschen Reiches war, die von der Sowjetarmee eingenommen wurde. Es war die Nacht vom 20. zum 21. Januar 1945, also noch fast vier Monate vor dem offiziellen Ende dieses Krieges am 8. Mai desselben Jahres. Dieser Einmarsch der Russen und die Folgen sind nicht Thema des vorliegenden Buches. Ich habe dieses Thema aber ausführlich und detailliert in meinem Buch „Zwischen Gott und Genossen“ behandelt und verweise den interessierten Leser auf die dortigen Ausführungen.
Diese wenigen Hinweise auf die Bedeutung meiner Heimatstadt mögen vorerst genügen. Ich hoffe, der Leser kann erkennen, dass Groß Strehlitz zwar nur ein Mosaikstein in der Geschichte des Dritten Reiches ist, dass aber dieser Stein einen unverzichtbaren Bestandteil dieser Geschichte darstellt, was sich in den folgenden Ausführungen des vorliegenden Buches noch deutlicher zeigen wird. Lassen sich doch diese Ausführungen sehr wohl auf einige Gesamtaspekte des Dritten Reiches hin verallgemeinern.
Zweites Kapitel
Meine Eltern und das Dritte Reich
Als das Dritte Reich begann, war mein Vater, Heinrich Mynarek, gerade 40 Jahre alt geworden. In der ersten Begeisterungswelle für Hitler trat er 1933 der Nazi-Partei, der NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), bei, trat aber noch im selben Jahr aus ihr auch wieder aus, als er bemerkte, dass sie mit dem, was er unter Moral, Ethik, Humanität und Christlichkeit verstand, wenig oder gar nichts im Sinn hatte. Ihn störte das arrogant-überhebliche, grobschlächtige Auftreten der SA-Leute; die Gleichschaltung der Presse, so dass in allen Zeitungen jetzt nur noch eine Meinung, die des Regimes, geduldet wurde; die Tatsache, dass anständige Leute, die er zu seinem Bekanntenkreis zählte, nur deshalb ständig verhört wurden bzw. ins Gefängnis kamen, weil sie der Sozialdemokratie, dem Zentrum oder irgendeiner anderen nichtbraunen Partei der Weimarer Zeit angehört hatten.
Vaters Austritt aus der Partei war zwar keine revolutionäre Tat, aber ein sehr mutiger Schritt war es schon, denn er wusste, was ihm nun blühte: Zwar kein Berufsverbot, denn er war ein selbstständiger Handwerker, Sattlermeister, aber der Entzug aller staatlichen und behördlichen Aufträge. Keine Koppel mehr für die Wehrmacht, keine Sattel und anderes Pferdegeschirr für die berittene Polizei und die Reitertruppe des Militärs, keine Aktentaschen für die Angestellten und Beamten des Rathauses und des Landratsamtes in Groß Strehlitz, keine Hand- und Fußbälle für die Schulen (die Bälle stellte man damals noch weitgehend in Handarbeit her) usw. usf. In einer Kleinstadt wie Groß Strehlitz spricht sich alles sehr schnell herum. Also kauften viele, die sich bei den Nazis nicht unbeliebt machen wollten, auch nicht mehr im Geschäft meiner Mutter ein. (Die Mutter führte unser Lederwaren- und Polstereigeschäft am Alten Ring, der Vater hatte die Sattlerei an der Malapaner Straße).
Die Folgen von Vaters Austritt aus der NSDAP wogen umso schwerer, als er das Geschäft und die Werkstatt gerade erst aufgebaut hatte. Stammte er doch aus ärmsten Verhältnissen (als Kind bekam er manchmal Kartoffeln in die Hand gedrückt, weil ihm die Eltern kein Brot für die Schule mitgeben konnten), und so war er besonders stolz darauf, es zu etwas gebracht zu haben, nachdem er, als mittelloser Soldat aus dem Ersten Weltkrieg gekommen, 1920 die Existenzgründung seiner Sattlerwerkstatt mit nur einer Ahle und einem Ledermesser (!) vollzogen hatte. Und nun sollte diese langsam, aber stetig wachsende Prosperität seiner beiden Unternehmen (Werkstatt und Geschäft) durch seinen Parteiaustritt jäh wieder unterbrochen sein.
Zum Glück zog damals meine Mutter mit, die eine sehr selbstbewusste, selbstständige, bisweilen auch eigensinnige Frau war. Beim Vater dominierte der Verstand, die Intelligenz, und diese brachte mich immer wieder zum Erstaunen, weil ich doch wusste, dass er nur die Volksschule eines Dorfes (Hohenkirch, heute Wysoka, am Annaberg) und nie ein höheres Bildungsinstitut besucht hatte. Umso mehr bewunderte ich seinen Scharfsinn, die Logik seiner Rede, das Denken in größeren Zusammenhängen. Mutter war nicht unintelligent, aber bei ihr dominierte das Emotionale. Und das war in dieser Situation von Vorteil. Denn meine Mutter hatte ganz instinktiv, ganz intuitiv-emotional einen Widerwillen gegen die Nazis, insbesondere gegen Hitler. Deshalb war sie voll einverstanden mit Vaters Entscheidung, aus der Nazipartei auszutreten, und zwar ohne Rücksicht auf die Folgen.
Ich hatte so manchmal große Angst um meine Mutter, denn sie hielt sich auch vor Kunden im Geschäft vor Schimpfereien gegen die Nazis nicht zurück. In unserem Lederwarenladen hing zwar ein Bild von Hitler, weil das der Kreisleiter so angeordnet hatte, aber immer wieder entfuhr es ihr unwillkürlich, auch wenn Leute im Geschäft waren, die sie näher gar nicht kannte: „Wenn ich nur die Visage von diesem Mann sehe, wird mir schlecht.“ Wie oft dachte ich: „Die kommen eines Tages und werden meine Mutter abholen!“ Meinem Vater wäre das ganz sicher passiert, wenn er solche Reden gegen die Nazis geführt hätte. Aber bei einer Frau ließen die Nazis doch mehr durchgehen. Anders kann ich mir nicht erklären, warum sie nicht gegen meine Mutter vorgingen. Denn Mutter lieferte ihnen ja immer noch weitere Gründe, gegen sie vorzugehen. Ich denke da ganz besonders an ihre Rolle beim Judenpogrom des Jahres 1938.1 Denn auch in Groß Strehlitz wie in vielen Städten Deutschlands brannte die Synagoge, wurden jüdische Geschäfte demoliert, jüdische Privatwohnungen „erstürmt“. Damals war ich zwar erst 9 1/2 Jahre alt (geb. im April 1929), aber die Erschütterung über diese Vorgänge wirkte lange in mir nach, weil ich sie aus unmittelbarer Nähe miterlebt hatte. Wir wohnten im Zentrum der Stadt (Alter Ring, Nr. 25), in einem großen schönen Zweifamilienhaus. (Dieses Haus gibt es jetzt nicht mehr. Es wurde wie alle Häuser des Platzes von den Sowjets 1945 zerstört, die Polen haben viele Jahre später neue, kleinere Häuser an deren Stelle gesetzt). In der Mitte des Alten Ringes stand und steht heute noch das Rathaus, das zwar auch ausgebrannt war, aber in seinem Innenraum von den Polen wiederhergestellt werden konnte, weil die Grundmauern dem Brand widerstanden hatten. lm Haus, in dem meine Eltern und wir Kinder – fünf an der Zahl, drei Mädchen, zwei Jungen – wohnten, befand sich links unten im Erdgeschoss neben unserem Geschäft, nur durch einen Hauseingang getrennt, die Praxis des jüdisches Arztes Dr. König. Seine Familie mit Ehefrau und ebenfalls fünf Kindern, zwischen siebzehn und drei Jahre alt, bewohnte die Räume im ersten Stock über der Praxis und dem Geschäft. lm zweiten Stock wohnte unsere Familie.
Zwischen unseren Familien herrschten gut nachbarliche Beziehungen. Es waren aber keine engen Beziehungen. Die gewisse Distanz hatte wohl ihren Grund in der sehr streng jüdisch-orthodoxen Frömmigkeit dieses Arztes und seiner Familie. Meine Eltern respektierten diese Art von Religiosität, auch wenn sie schon mal mit einem gewissen Mitleid vor uns erwähnten, dass diese nicht getauften Juden noch immer den Messias, der doch längst gekommen sei, erwarteten. Aber davon war selten die Rede, im Grunde eigentlich nur dann, wenn Familie König ihre auf Hebräisch gesungenen Abendgebete sehr lang und sehr laut durchs ganze Haus hallen ließ.
Dann kam jener Abend des Jahres 1938, an dem die Praxis des jüdischen Arztes gestürmt wurde. Meine Mutter und ich standen gerade vor unserem Geschäft, als eine Meute von etwa hundert SA-Männern und Zivilisten, die letzteren meist jugendliche Rowdies aus den Außenbezirken der Stadt, auf dem Platz vor dem Rathaus erschien, Steine aus dem Straßenpflaster herausriss und damit bewaffnet auf die Praxis losstürmte. Die Fensterscheiben krachten, und schon sprangen die ersten aus der Meute durch die Fenster in die Räume der Arztpraxis, wo sie die teuren Geräte mit Steinen bombardieren, die Sessel aufritzten und die Arzneiflaschen an die Wände schmetterten. Die draußen Gebliebenen „begnügten“ sich damit, frenetisch-hasserfüllt „Juden raus“ zu grölen und Steine in die Fenster der Wohnung im ersten Stock zu werfen, wo sich, wie wir später erfuhren, die jüdische Familie in panischer Angst in die hintersten Räume geflüchtet hatte.
Nun geschah etwas, was mich noch mehr als das bisher Geschehene mit stechender Angst erfüllte. Denn, obwohl noch ein Kind, spürte ich, dass gegen diese bösartige Übermacht im Augenblick jeder Widerstand sinnlos war. Meine Mutter, außer sich vor Erregung, hatte nämlich plötzlich zu schreien und zu schimpfen angefangen, aber nicht etwa mit der Meute, sondern gegen sie. „Ihr Idioten, ihr, Banditen“, schrie sie, „was hat euch denn dieser Mann gemacht? Ihr seid doch alle zu ihm hingelaufen, wenn Ihr krank wart. Und“ – hier sprach wohl der praktische Sinn aus meiner Mutter – „wenn ihr jetzt die teuren Instrumente in seiner Praxis zerschlagt, kann er euch doch nicht mehr behandeln.“ Einen Augenblick lang legte sich lähmende Stille über die makabre Szene. Dann schrie ein SA-Mann: „Schafft diese kreischende Hexe weg.“ Ein höhnisches Gelächter folgte, und dann machte sich die Meute wieder an ihre Arbeit, als wäre nichts geschehen. Ein Schupo fasste meine Mutter hart am Arm und zerrte sie in unseren Laden. Nachdem er die Tür von innen geschlossen hatte, mahnte er sie: „Frau Mynarek, halten Sie den Mund. Sie reden sich um Kopf und Kragen. Ich muss Sie verhaften, wenn sie noch mal so etwas tun.“ Er sagte das alles ohne Gehässigkeit. Ich würde heute meinen, dass er mit der Aktion der Horde da draußen innerlich keineswegs übereinstimmte.
Meine Mutter hatte sicher keine tieferen weltanschaulichen Gründe, so zu handeln. Es war einfach die instinktiv-emotionale Reaktion auf ganz offensichtliches Unrecht. Aber merkwürdigerweise war sogar eine solche unmittelbare, humane Reaktion fast allen Mitbürgern unserer Stadt bereits abhandengekommen, denn niemand leistete den geringsten Widerstand, als an diesem Abend noch weitere jüdische Geschäfte und Wohnungen angegriffen wurden und die Synagoge in Flammen aufging. Dabei hatte es bis zu diesem Zeitpunkt sogar teilweise recht dicke Freundschaften zwischen jüdischen und „arischen“ Kaufleuten gegeben und von Feindschaft zwischen Juden und Christen war meinen Eltern und uns Kindern nie etwas aufgefallen.
Nach der Kristallnacht war es für die Juden in unserer Stadt praktisch unmöglich, unbehelligt auf die Straße oder in die Geschäfte zu gehen. Es war für die Nichtjuden schon gefährlich, mit ihnen Kontakte zu haben. Meine Mutter focht das nicht an. Sie versorgte die Familie König, von der es keiner mehr wagte, das Haus zu verlassen, mit Lebensmitteln und allem Notwendigen. Verhindern aber konnte sie auch nicht, dass eines Tages alle Angehörigen dieser Familie auf einen Lastwagen verladen wurden und für immer aus unserem Gesichtskreis verschwanden.2
Man kann mit dem lähmenden Bewusstsein offensichtlichen Unrechts, das anderen geschieht, nicht lange leben, ohne zu resignieren, ohne depressiv und apathisch zu werden. Meine Mutter aber war ein reger, energisch-praktischer Typ. So tröstete auch sie sich mit der offiziellen Version, die in Groß Strehlitz nach dem Abtransport aller Juden ausgegeben worden war und die davon sprach, dass diese Menschen in eine rein jüdische Stadt in Polen verbracht würden, wo sie in völliger Ruhe und ungestörtem Frieden ganz unter sich sein könnten. Auch der Rest unserer Familie glaubte dieser Version gern.
Eines Tages aber wurde dieser Glaube bei jedem zerstört. Es klingt absurd, aber ich wurde diesbezüglich durch einen „Witz“ eines Schulkameraden aufgeklärt. Irgendwann Ende 1943 oder Anfang 1944 erzählte mir dieser: „Zwei Juden treffen sich. Nachdem sie ein längeres Gespräch miteinander geführt haben, verabschieden sie sich mit der Bemerkung: >Also auf Wiedersehen in der Seifenschublade irgendeiner Apotheke!<“ Mein Schulkamerad lachte grölend. Aber ich verstand nichts. „Was, du Naivling weißt nicht, dass man die Juden vergast und Seife aus ihnen macht?“ „Das glaube ich nicht“, sagte ich entrüstet. Er wisse es ganz genau, antwortete er, sein Bruder sei doch bei der Waffen-SS und wenn er auf Urlaub komme, erzähle er noch ganz andere Sachen; zum Beispiel, wie er mit seinen Kameraden jüdische Mütter mit Kindern auf dem Arm vor ausgeschaufelten Gräbern postiere und dann abknalle.
Als ich, immer noch am Wahrheitsgehalt dieser Schilderung zweifelnd, am Abend den Eltern davon erzählte, merkte ich, dass sie bereits informiert waren. Ein Kaplan, den wir öfter bei uns zu Gast hatten, hatte sie eingeweiht. Ihm selbst hatte eine Sekretärin, die früher in kirchlichen Diensten stand und jetzt im Konzentrationslager Auschwitz beschäftigt war, Grauenvolles über das Schicksal der Juden in diesem Lager berichtet.
Meine Mutter, spontan und direkt, wie sie nun einmal war, hörte ich jetzt noch öfter als früher vor uns Kindern sagen, dass Hitler ein Verbrecher sei. Mein Vater war da vorsichtiger, aber ich bemerkte, wie er jetzt immer öfter, obwohl das im Krieg unter schwerer Strafe verboten war, „feindliche Sender“ mit seinem Radioapparat abhörte. Dabei bekam auch ich einige Male mit, wie anders doch die Situation an den Fronten von den Alliierten dargestellt wurde. Erste Zweifel am „Endsieg“ regten sich in mir.
Sie wurden noch stärker, als wir, d. h. vierzehn- und fünfzehnjährige Jungen, in den beiden letzten Kriegsjahren in Viehwagen ins Innere Polens transportiert wurden, um dort Panzer- und Auffanggräben für die immer näher rückende Ostfront auszuschachten. Allein schon die intensive Partisanentätigkeit im Rücken der Front, der auch einige meiner Kameraden zum Opfer fielen, erfüllte uns mit Angst und Schrecken.
Als wir nach vier Wochen Schwerstarbeit für die „Verteidigung der Heimat“ Urlaub bekamen und ich, nach Hause zurückgekehrt, von den Strapazen und Gefahren berichtete, mit denen man dort täglich konfrontiert wurde, war meine Mutter nicht zu halten. Sie lief schnurstracks zum Bannführer, um ihm Vorhaltungen zu machen. Der Bannführer war der am Ort Zuständige für den Einsatz der Hitlerjugend im Rücken der Front. Als man meine Mutter, angeblich wegen einer dringenden Sitzung, in der er sich befinde, nicht zum Bannführer vorließ, stürmte sie einfach in den Sitzungsraum. Was dann passierte, war diesem „Führer“ wahrscheinlich in seinem ganzen bisherigen Leben noch nicht untergekommen. In Anwesenheit einiger anderer „Größen“ der örtlichen Parteiprominenz fragte sie ihn, ob er sich überhaupt vorzustellen vermöge, was es bedeute, ein Kind zu gebären und großzuziehen. Er solle, so fuhr sie fort, erst einmal selber eine Familie gründen, Kinder zeugen und erziehen, dann könne er in dieser Sache mitreden. Ihr Sohn werde jedenfalls von nun an zu Hause bleiben. „Gehen Sie doch selber an die Front, anstatt sich in der Heimat herumzutreiben und mit Frauen zu poussieren. Mein ältester Sohn hält auch an der Ostfront seinen Kopf hin, warum können Sie das nicht? Ich werde jedenfalls bis zu den höchsten Instanzen gehen, wenn Sie meinen Sohn dafür bestrafen sollten, dass er den Einsatz im Osten nicht mehr mitmachen wird.“ Sagte es und entfernte sich, noch ehe der verblüffte Bannführer überhaupt antworten konnte.
Ganz Groß Strehlitz lachte über diesen Vorfall, denn die mithörenden Sekretärinnen erzählten ihn weiter. Am meisten lachte man über die Passage von der Poussage, denn die zahlreichen Liebesaffären des Bannführers, und zwar auch mit verheirateten Frauen, deren Männer an der Front waren, kannten viele in unserer Stadt.
Interessanterweise unternahm der Bannführer nach diesem Vorfall nichts Direktes gegen mich. Ich wurde nicht aus dem Haus geholt, als der neue Transport mit der Hitlerjugend gen Osten rollen sollte, obwohl das einigen Jungen, die ebenfalls nicht mehr mitwollten, tatsächlich passierte. Nur als einige Wochen später auch dieser Transport zurückgekehrt war, übrigens triumphal begrüßt und wie eine siegreiche Armee gefeiert von der örtlichen Naziprominenz und den mir heute eher stupid im Ohr nachklingenden Fanfarenzügen, und die Schule wieder ihre Tätigkeit aufgenommen hatte, merkte ich an der Einstellung des Herrn Oberstudiendirektors und einiger Studienräte, insbesondere des Klassenleiters, dass etwas gegen mich unternommen worden sein musste. Ich war jedenfalls Luft für sie und wenn ich mich meldete, wurde ich nicht drangenommen. In Klassenarbeiten und dem nächsten Zeugnis wurden meine Noten ohne erkennbaren Grund heruntergedrückt. Das war zwar nicht weiter schlimm, denn da ich vorher Primus der Klasse war, konnte man mir schlecht eine Fünf oder Sechs geben. Aber mit Noten wie sehr gut oder gut war es nun aus. Die Betragensnote im Zeugnis lautete sogar „kaum ausreichend“, und das war nun eine sehr schlechte Zensur, wenn man bedenkt, dass die meisten in der Klasse das Gesamtergebnis ihres Zeugnisses gerade durch eine „sehr gute“ oder mindestens „gute“ Betragensnote aufbesserten.
In diesem Zusammenhang erinnere ich mich noch an eine Mathematikarbeit. Es waren bei dieser Klassenarbeit drei Aufgaben zu lösen. Ich glaubte, sie alle gelöst zu haben, und gab mein Heft ab. Mathematik erteilte bei uns der Chef des Gymnasiums, der oben schon erwähnte Oberstudiendirektor, ein blind ergebener Nazi. Als wir die zensierten Hefte zurückbekamen, bemerkte ich, dass innerhalb der von mir durchgeführten drei Aufgabenlösungen zwar nichts rot angestrichen war, dass jedoch unter dem Ganzen als Fazit durch den Herrn Direktor vermerkt war: „Eine Aufgabe völlig falsch gelöst, eine zur Hälfte falsch, daher nur befriedigend.“ Ich verglich mein Heft mit den Heften derer, die alle drei Aufgaben richtig gelöst und die Note gut erhalten hatten. Es waren weder in der Durchführung der Lösung noch im Ergebnis selbst Unterschiede festzustellen. Ich erwähne diese Begebenheit hier auch nur, um den absoluten Autoritarismus dieses Nazi-Lehrers zu demonstrieren. Denn als ich in der nächsten Mathematikstunde keine Berichtigung in meinem Heft vorweisen konnte (wie sollte ich etwas berichtigen, das richtig war?), brummte er mir eine Stunde Arrest auf und befahl mir, die Berichtigung nachzuholen. Als ich auch in der nächsten Mathematikstunde keine Berichtigung meiner Aufgaben vorlegte, bekam ich zwei Stunden Arrest, einen Tadel ins Klassenbuch und die Mitteilung, dass meine Eltern von meinem Betragen verständigt würden. Zugleich geriet der Herr Oberstudiendirektor noch während dieser Mathematikstunde derart in Rage, dass er zur Freude der Mitschüler den durchzunehmenden Unterrichtsstoff sausen ließ und mich etwa dreißig Minuten lang beschimpfte, wobei er sich immer mehr in ein Wutgebrüll hineinsteigerte.
Die Situation war, objektiv betrachtet, lächerlich-komisch, obwohl sie mir damals gar nicht so erschien, denn diese Wut, ja dieser Hass des mächtigen Schulchefs, der mich doch aus dem Gymnasium verweisen konnte, machte schon Eindruck auf mich. Aber obwohl ich wie die meisten Schüler diesen Mann fürchtete, sagte ich mir, dass ich nichts Böses getan hatte, und schaute ihn daher offen und unverwandt an. Genau das aber irritierte ihn am meisten, denn plötzlich schrie er: „Ich werde weiterreden und denke ja nicht, dass ich Angst vor deinen Augen habe.“ Da stand er nun, gestikulierte wild mit den Händen, stampfte mit den Füßen auf den Boden und schien doch verunsichert zu sein. Er war klein, höchstens 160 Zentimeter groß, schmalbrüstig, ein Kümmerling mit einem unwahrscheinlich unsympathischen Säufergesicht und einer Glatze. Aber er fühlte sich als Repräsentant der nordischen Herrenrasse und immer wieder kommentierte er schwärmerisch den Spruch: „Mens sana in corpore sano“ (ein gesunder Geist in einem gesunden Körper). Wenn schon nicht seine Gesundheit, so schien er doch die Standfestigkeit seines Körpers dem Alkohol gegenüber sträflich zu überschätzen, denn nicht selten konnte man ihn zu später Abendstunde torkelnd aus einem Nobel-Restaurant unserer Stadt herauskommen sehen. Von dem ganzen Vorfall hatte ich bisher zu Hause nichts berichtet. Ich hatte mir zum Prinzip gemacht, von negativen Dingen in der Schule zu Hause nicht zu erzählen, weil bei meinen Eltern die Autorität der Lehrer im Allgemeinen sehr hoch stand, infolge dessen sie im Endeffekt doch immer recht hatten. „Du wirst schon etwas ausgefressen haben, wenn er dich so behandelt hat“, war eine häufige Redewendung meiner Mutter, wenn eines meiner Geschwister sich über das Verhalten eines Lehrers beklagte. Also erschien es vorteilhafter zu schweigen. Diesmal aber musste ich reden, um der nicht zu vermeidenden Benachrichtigung der Eltern durch den Schulleiter zuvorzukommen. Vater riet, die ganze Sache, die ja nicht so schlimm sei, auf sich beruhen zu lassen. Aber mit diesem Rat traf er bei Mutter auf Granit. Sie ging zum Direktor und verlangte mein inzwischen schon eingezogenes Mathematikheft von ihm. Sie würde es beim Schulkuratorium in Oppeln (das war die Hauptstadt unseres Regierungsbezirks) einreichen und dort prüfen lassen, ob die Bewertung durch den Herrn Direktor gerecht sei. „Ihr Sohn kann ruhig unsere Schule verlassen und in Oppeln zur Schule gehen, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, aber das Heft kriegen Sie nicht“, antwortete er meiner Mutter. Unverrichteter Dinge kehrte sie nach Hause zurück. Selbst meine zwei Nachsitzstunden musste ich absolvieren, auch daran hatte sie nichts ändern können.
Der Autoritarismus des Herrn Gymnasialdirektors, der sich in der Nazi-Ära so recht entfalten konnte, trieb auch noch andere seltsame Blüten. Er konnte stundenlang, den eigentlichen Unterrichtsstoff vergessend, in Betrachtungen über die ungeheuren Räume des Weltalls schweigen. „Und wenn wir von einem Stern zum anderen fliegen könnten, so gäbe es immer noch Sterne, die wir noch nicht erreicht hätten, und immer neue Räume würden sich vor unserem staunenden Auge eröffnen.“ Er war in einer ganz weihevoll-feierlichen Stimmung, wenn er so sprach, und wehe, wir Schüler hätten einen die in solchen Augenblicken herrschende Stille unterbrechenden Muckser getan. Da konnte er ausfällig werden wie ein Stallknecht.
Eines Tages aber genügten ihm die sich unendlich fortsetzenden Räume anscheinend nicht mehr. Er fragte plötzlich in die schläfrige Klassenstille hinein, was denn nach dem letzten Stern komme. Wahrscheinlich hatte er sich die Frage nur selber gestellt, vielleicht war es nur eine rhetorische Frage. Jedenfalls hatten weder er noch die meisten in der Klasse mit einer Antwort eines Mitschülers gerechnet. Aber eine Hand ging hoch, es war die Hand des größten Spaßmachers der Klasse, der nur Ulk im Kopfe hatte und sonst eher ihr Schlusslicht bildete. Dementsprechend war die herablassend-wohlwollende Erlaubnis des Direktors: „Na, Ulrich, du kannst es ja kaum wissen, aber versuch's mall“ Und Ulrich versuchte es: „Herr Oberstudiendirektor, dann kommt die berühmte Bretterwand.“
Was dann als Reaktion seitens des „Direx“ folgte, übertraf alles bisher Dagewesene. Und wir Schüler waren einiges von ihm gewohnt. „Ihr undankbares Gesindel, ihr Gassenstrolche, Halunken, Rabauken“ – es wimmelte nur so von solchen, uns entgegengeschleuderten Attributen. „Da unterbreite ich euch die tiefsten astronomischen und philosophischen Wahrheiten, und das ist eure Reaktion!“ Aber niemand konnte ernst bleiben. Wir wieherten, versteckten und kugelten uns unter den Bänken, hielten die Hände vor dem Gesicht, um unser Lachen zu unterdrücken. Aber es war vergeblich, der Lachkrampf wollte kein Ende nehmen. Der Direktor verließ fluchtartig den Raum und konnte im Hinausgehen nur noch brüllen: “Das wird Konsequenzen haben!“
Die Konsequenz bestand dann in zwei Stunden Nachsitzen für die ganze Klasse und einem vom Klassenleiter ins Klassenbuch einzutragenden Tadel für Ulrich, der dann am Ende des Schuljahres sitzenblieb. Ob die Nichtversetzung eine Folge des eben geschilderten Vorfalls war, vermag ich nicht zu beurteilen.
Mein Vater reagierte nie so spontan wie meine Mutter. Außerdem wurde von den Nazis einer Frau doch mehr nachgesehen als einem Mann. Aber einmal platzte auch ihm der Kragen angesichts der autoritären Willkür eines Jugendführers. Folgendes war geschehen: Unser Fähnlein, zu dem ich damals als etwa elfjähriger Pimpf gehörte, stand schon stundenlang auf dem Sportplatz unserer Stadt untätig, aber in Reih und Glied herum. Wir warteten auf etwas, aber was es war, wussten ja immer nur die Führer.
Diese Warterei war weiß Gott nichts Unübliches bei HJ-Veranstaltungen. Wir Pimpfe vertrieben uns die Langeweile mit Geschwätz und Gelächter. Das mochte nun der Fähnleinführer, ein bullig wirkender 19jähriger Bursche, der aber wegen einer Zuckerkrankheit nicht bei der Wehrmacht war, gar nicht. Einige Male brüllte er: „Aufhören!“ Aber nach einer gewissen Zeit wurden wir doch stets wieder lauter. Da griff er sich einen, nämlich mich, heraus und schlug wild auf mich ein. Erst als ich halb ohnmächtig am Boden lag und ziemlich stark aus der Nase blutete, kam er zur Besinnung und hörte mit seinen Schlägen auf. Meine Kameraden, empört über das Verhalten des Fähnleinführers, drängten mich, es zu Hause zu melden. Aber ich wollte den Vorfall verheimlichen, weil ich mich nicht ganz schuldlos fühlte. Immerhin hatte ich den brutalen Kerl durch meinen Ungehorsam gereizt, obwohl keiner von uns Pimpfen aus Bosheit zu laut gewesen war, sondern einfach nur aus Langeweile.
In meinem Zustand konnte ich aber, wenn ich die Sache verheimlichen wollte, auch nicht nach Hause gehen. Aus der Nase blutete ich noch immer ein wenig, und die linke Gesichtshälfte war geschwollen. Also trieb ich mich mit einem Kameraden nach dem HJ-Dienst in der Stadt herum. Inzwischen war es schon dunkel geworden, und zu Hause machte man sich Sorgen um mich. So setzte sich mein Vater aufs Fahrrad und fuhr die Straßen der Stadt auf der Suche nach mir ab. Schließlich fand er mich. Mein Kamerad konnte seinen Mund nicht halten und erzählte Vater die ganze Geschichte. Die Hälfte davon war ja ohnehin von meinem Gesicht abzulesen.
In den folgenden Tagen ermittelte mein Vater, wann sich der Fähnleinführer allein in seiner Wohnung aufhielt. Dann ging er hin, klingelte an seiner Wohnungstür und als dieser öffnete, verprügelte er ihn. Der Fähnleinführer war viel kräftiger gebaut als mein Vater und überragte ihn mindestens um einen Kopf. Aber er war so verblüfft oder auch so feige, dass keine Gegenwehr erfolgte. Nachdem er seine Prügel bezogen hatte, konnte er noch von meinem Vater die Worte hören: „Vergreifen Sie sich noch einmal an meinem Kind, dann ergeht's ihnen noch schlimmer!“ Der Fähnleinführer hatte keine Zeugen für diesen Vorfall, er bombardierte daher meinen Vater mit diversen Schreiben, um eine schriftliche Antwort von ihm und damit einen Beweis gegen ihn in die Hand zu bekommen. Aber mein Vater lieferte ihm diesen Beweis nicht. Mir gegenüber war dieser Fähnleinführer in der Folgezeit dann aber immer die Höflichkeit in Person, er war geradezu zahm geworden.
Sicherlich war das Verhalten meiner Eltern gegen gewisse Repräsentanten des Nazi-Systems nicht in erster Linie politisch motiviert. Der Widerstand entsprang zunächst einfach der Tatsache, dass einem Mitglied der Familie durch Vertreter der herrschenden politischen Macht Unrecht zugefügt worden war. Freilich fiel es meinen Eltern insofern leichter, gegen lokale Nazi-Größen so vorzugehen, wie sie es taten, als sie eben in ihrem Herzen mit dem Nazi-System nicht übereinstimmten, sich nie mit ihm identifiziert hatten.
Die Abneigung meiner Eltern gegen die Nazis rührte zum Teil auch daher, dass sie so katholisch waren. Das klingt zunächst paradox, denn es ist ja bekannt, dass der deutsche Episkopat während des Dritten Reiches mit dem Breslauer Erzbischof und Kardinal Bertram als Vorsitzendem nie etwas gegen die Nazis sagte oder unternahm. Gerade Kardinal Bertram sandte immer wieder Devotionsbekundungen an Hitler und die Reichsregierung, feierte nach dem Ableben Hitlers sogar noch eine Totenmesse für ihn, der ja nie aus der Kirche ausgetreten war und brav seine Kirchensteuer bis zu seinem Tod bezahlt hatte. Selbst der berühmte, inzwischen seliggesprochene Bischof von Münster, Kardinal Galen, kritisierte zwar in Predigten scharf die Euthanasiepolitik des Dritten Reiches gegenüber Behinderten und Debilen, unterstützte aber mit starken Worten dessen Angriff auf die Sowjetunion.
Es gab auch genug Geistliche aus dem niederen Klerus, die für Hitler waren. Gar kein Zweifel! Aber meine Eltern orientierten sich nicht an Bischöfen, Päpsten und hohen kirchlichen Würdenträgern, sondern am Pfarrer der Kirchengemeinde Groß Strehlitz, dem Priester Karl Lange, der sicher kein Nazi war. Auch damals – wie heute vielleicht noch mehr – war es unter Priestern nicht ungewöhnlich, eigene Privatinteressen und -genüsse den Pflichten eines Seelsorgers vorzuziehen.3