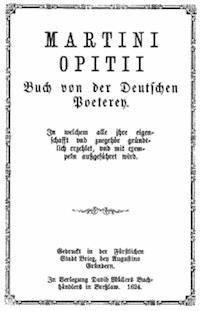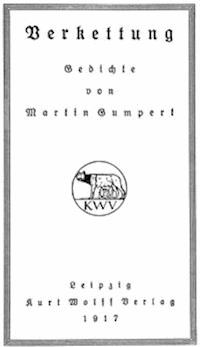0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Ähnliche
Die Komposition des Buches Jes. c. 28–33.
Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doktorwürde
bei der
philosophischen Fakultät der Universität Leipzig.
Eingereicht
von
Martin Brückner, Pastor.
Inhaltsangabe:
Seite:
Einleitung
1
–3
I. Die jesajanischen Stücke:
Ihre innere Zusammengehörigkeit
3
–14
a) Ihre Gleichartigkeit nach Form und Inhalt
3
–8
b) Ihr sachlich-chronologischer Zusammenhang
9
–14
Ihre äussere Unvollständigkeit und Zusammenhangslosigkeit
14
–24
a) Die mangelhaften Eingänge
14
–21
b) Das Fehlen redaktioneller Verbindung
21
–24
Die Herkunft der jes. Stücke aus einem grösseren geschichtlichen Zusammenhange
25
–34
a) Die verschiedene Redeform der einzelnen Stücke
25
–30
b) Die Eingänge von c. 28,7. 28,14. 29,19. 30,8. 31,4
30
–34
Bestätigung des gewonnenen Resultates
34
–48
a) Die kurzen Stücke
34
–37
b) Die geschichtlichen Darstellungen in c. 6–8,18 Zusammenfassung. c. 32,9–14
37
–48
II. Die nichtjesajanischen Stücke:
Ihr Verhältnis zu den jesajanischen Stücken
48
–54
Ihr Verhältnis zu einander
54
–61
Die Fortsetzungen jesajanischer Stücke
54
–56
Die selbstständigen Stücke
56
–61
Resultat und Abfassungszeit
62
–65
III. Zusammenfassende Darstellung der Entstehungs-Geschichte des Buches Jes. c. 28–33
65
–69
Schlussbemerkungen
69
–71
Anhang:
c. 28,23–29
71
–77
c. 32,15–20
77
–84
Im ersten, ungedruckten Teile der vorliegenden Dissertation ist namentlich auf Grund der von Duhm in seinem Kommentare zu Jesaia[1] und von Hackmann in seiner Schrift über die Zukunftserwartung des Jesaia[2] vorgenommenen Untersuchungen eine eingehende Analyse des Buches Jes. c. 28–33 gegeben worden. Dieselbe hat zu folgendem Resultate geführt:
1. Von Jesaia stammen folgende Stücke: c. 28,1–4, v. 7–13, v. 14–22, c. 29,1–3. 4a. 7, v. 9 f., v. 13 f., v. 15, c. 30,1–5, v. 6 f., v. 8–17, c. 31,1–4, c. 32,9–14.
2. Die übrigen Abschnitte: c. 28,5 f., v. 23–29, c. 29,4b. 5 f. 8, v. 11 f., v. 16–24, c. 30,18–26, v. 27–33, c. 31,5–9, c. 32,1–8, v. 15–20, c. 33 gehören einer späteren Zeit an.
Schon Duhm und Hackmann sind bei ihren Untersuchungen über die Entstehung unseres Buches unabhängig von einander[3] in der Hauptsache zu auffallend gleichem Resultate geführt worden.
Die Ergebnisse meiner Untersuchungen stimmen meist mit denen Hackmanns überein und sind nur eingehender begründet worden, als es für Hackmann im Rahmen seiner Schrift möglich war.
Zu bedeutenderen Abweichungen in der Analyse bin ich nur in betreff der beiden Stücke c. 28,23–29 und c. 32,15–20 gekommen. Die Begründung meiner Stellungnahme zu beiden Stücken soll deshalb der vorliegenden Schrift in einem Anhange beigefügt werden.[4]
Es ist nun die Aufgabe der vorliegenden Abhandlung, nachzuweisen, wie es gekommen ist, dass die verschiedenen Bestandteile des Buches Jes. c. 28–33 zu dem vorliegenden Buche zusammengeschmolzen sind. Wir haben also die Entstehungsgeschichte des Buches zu rekonstruieren.
Diese positive Arbeit der Kritik ist ebensosehr wünschenswert wie notwendig.
Sie ist wünschenswert zur eigenen Rechtfertigung der kritischen Arbeit. Denn es würde sich ja sonst die Frage erheben, wie es möglich sei, dass ein Buch aus so disparaten Bestandteilen entstanden und zu einem Ganzen zusammengewachsen sei. Stellt es sich aber heraus, dass sich für die Beantwortung dieser Frage wissenschaftlich wohl zu begründende Hypothesen aufstellen lassen, so erhält dadurch die Richtigkeit der im ersten Teile gewonnenen Resultate eine neue und starke Stütze. Denn bisher sind alle Versuche gescheitert, die Komposition unseres Buches oder einzelner Kapitel desselben, namentlich des c. 28, bei Annahme jesajanischer Autorschaft zu erklären.
Wünschenswert ist die Beantwortung der Frage nach der Entstehungsgeschichte unseres Buches auch aus sachlichen Gründen. Einmal wird erst dadurch Zweck und Anlage des Buches klar, wenn man weiss, wie es entstanden ist, und sodann wirft die Erkenntnis der Entstehung des Buches auch ein Licht auf die Verfasser und ihre ganze Zeit.
Diese sachlichen Rücksichten machen die Arbeit aber auch notwendig. Die Aufgabe der Kritik erschöpft sich keineswegs damit, dass vorhandene Anschauungen zerstört oder als irrig nachgewiesen werden, sondern es ist vielmehr das Ziel und der eigentliche Zweck derselben, an Stelle der alten Anschauungen neue, der Wahrheit entsprechendere zu setzen.
Wenden wir uns nun der Lösung dieser Aufgabe an unserem Buche selbst zu, so ergeben sich aus dem im ersten Teile unserer Untersuchung festgestellten Charakter des Buches ganz von selbst zwei Teile zur Behandlung des vorhandenen Materials:
Die jesajanischen Bestandteile des Buches.
2. Die nichtjesajanischen Stücke desselben.
Im ersten Teile wird zu fragen sein, ob die jesajanischen Bestandteile unseres Buches ein zusammengehöriges Ganze für sich bilden, oder woher sie, falls und soweit das nicht der Fall ist, entnommen sind.
Sodann wird zu untersuchen sein, ob und wie weit die nichtjesajanischen Stücke von dem Hersteller des Buches selbst verfasst oder auf verschiedene Autoren zurückzuführen sind.
Als Abschluss des Ganzen soll dann aus den gewonnenen Resultaten in kurz zusammenfassender Darstellung ein Ueberblick über die Entstehungsgeschichte unseres Buches gegeben werden, wobei vor allem Zweck und Anlage des Buches berücksichtigt werden müssen.
Auf diese Weise werden wir in der Beantwortung der Frage nach der Komposition des Buches Jesaia c. 28–33 zu annähernd sicheren Resultaten gelangen können.
I.
Wir haben es also zunächst mit den jesajanischen Bestandteilen unseres Buches zu thun.
Wenn man die oben angegebenen jesajanischen Stücke des Buches c. 28–33 hintereinander durchliest[5], so fällt zunächst ein doppeltes auf, das man sonst im ganzen Jesaia-Buche nicht wieder antrifft, nämlich einmal der durchweg gleichartige Charakter der einzelnen Stücke, und sodann die innerhalb derselben erkennbare chronologisch-sachliche Entwicklung.
Auf beides ist im ersten Teile der Untersuchung schon hingewiesen worden, muss aber an dieser Stelle noch näher eingegangen werden. Was die Gleichartigkeit aller dieser Stücke betrifft, so bezieht sich diese sowohl auf die Form als auch auf den Inhalt derselben. Schon ganz äusserlich, in wiederkehrenden Wendungen und Gedanken, fällt diese Gleichartigkeit auf. Bezüglich des Ausdruckes ist hinzuweisen auf das immer wiederkehrende הוי im Anfange der Rede c. 29,1. 29,15. 30,1. 31,1; ferner auf das העם חזה 28,11. 28,14. 29,13. vgl. ferner die Wendungen und Gedanken c. 28,12 mit c. 30,15; c. 29,15 mit c. 30,1 und 31,1; c. 28,7 f. mit c. 29,9 f; c. 30,5 mit c. 30,7; c. 30,1 mit 30,9; c. 28,21 mit 29,14 und c. 31,2 (c. 28,11); c. 28,15. 17b. 18a. mit c. 30,2 f.
Sämmtliche Stücke enthalten Drohworte, sei es in Form der Rede oder Schilderung. Die Adressaten der Reden sind immer die Leiter des Volkes, die Propheten und Priester oder die weltlichen Würdenträger; an sie sind die Drohreden gerichtet, die aber doch immer in ihrem Verlaufe das ganze Volk bedrohen.
Endlich ist auch die Anlage der Reden meist gleichartig: erst kommt der Grund der Drohung, dann folgt die Drohung selber. So ist es c. 28,9 ff. c. 28,14 ff. c. 29,13 f. c. 30,1 ff. c. 30,8 ff. 31,1 ff. Dabei ist auch die äussere Gleichmässigkeit der Form zu beachten; mehrere Reden wiederholen das Schema: לכן כה אמד יהוה — יען כי vgl. c. 28,15. 16 mit c. 29,13. 14. und c. 30,12; c. 30 und 31 sind ganz parallel gebaut.[6]
Sehen wir nun auf den Inhalt der Drohungen und ihrer Begründung, so ergiebt sich auch hier eine durchgehende Gleichartigkeit. Ganz deutlich ist es in c. 30 und 31 ausgesprochen, um was es sich bei den Drohreden Jesaias handelt, nämlich um das ägyptische Bündnis. Die Volksleiter führen damit einen Beschluss aus, der nicht von Jahwe ist, und um dessentwillen sie seinen Mund nicht befragt haben c. 30,1 f. c. 31,1. Es ist an diesen Stellen nicht nur ausgesprochen, dass sich Jesaias Drohreden wider das ägyptische Bündnis richten, sondern auch zugleich gesagt, warum sie das thun, nämlich weil der Anschluss an Aegypten wider Jahwes Willen ist; weil sie sich damit nicht nur an fremde Hülfe wenden, sondern das auch thun mit Umgehung Jahwes und seines Propheten. Halten wir diese Begründung fest, dann wird es klar, dass auch in den vorhergehenden Stücken nur von diesem ägyptischen Bündnisse die Rede sein kann. Am durchsichtigsten ist das noch bei c. 29,15. Hier weist nicht nur die ganze parallele Anlage, sondern auch der Ausdruck עצה darauf hin, dass unter dem Beschluss, den man vor Jahwe und seinem Propheten verbergen will, derselbe gemeint ist, wie in c. 30,1 f., nämlich „hinabzuziehen nach Aegypten um Hülfe“.
Aber schon in c. 29,13 f. scheint von diesen politischen Dingen nicht mehr die Rede zu sein. Es scheint vielmehr nur ganz allgemein die ethische Seite der Religion gegenüber dem blos äusserlichen Kultus hervorgehoben zu werden. Indessen glaube ich einmal, dass man immer gut thun wird, sich bei den Aussprüchen der alten Schriftsteller, namentlich der bedeutenderen unter ihnen, nicht bei allgemeiner Deutung zu beruhigen, sondern nach besonderen, konkreten Beziehungen zu fragen, und sodann scheint mir hier die an den Ausspruch angeknüpfte Drohung auf ein bestimmtes Faktum hinzuweisen. In v. 14b wird gesagt, dass sich die Weisheit der Weisen des Volkes verstecken, und die Einsicht seiner Einsichtigen untergehen wird. Die Drohung geht also auf die Leiter des Volkes, die sich in ihren Plänen verrechnet haben werden. Das führt uns im Blicke auf die folgenden Stücke auf das ägyptische Bündnis oder auf damit zusammenhängende Maassnahmen, etwa den Abfall von Assur. Dann lässt sich aber auch v. 13 gut auf diese politischen Dinge deuten. Die Entfernung des Herzens von Jahwe besteht darin, dass man ihn nicht um Rat fragt, dass man in Ungehorsam wider ihn diese politischen Dinge unternimmt und doch dabei äusserlich, in Opfern und Gottesdienst sich gebährdet, als ob man ihn auf das Höchste ehrt. Darum ist Jahwes Urteil darüber:
דאת ם אתי מצות אנשים מלמדה
„Ihr mich fürchten“, ist hier Ausdruck für „Religion“, indem es das Wesen des Begriffes religio bezeichnet und damit andeutet, worin ihre Religion bestehen müsste, nämlich in Gottesfurcht, die sie abhalten müsste, wider Jahwe und seinen Propheten zu handeln, ihre Religion ist aber nur ein gelerntes Gebot, „ein bindender Rechtsbrauch, der gelernt werden muss“ (Duhm).
Für das kurze Drohwort c. 29,9 f. lässt sich natürlich auch nicht mit absoluter Sicherheit eine konkrete Beziehung angeben. Nur so viel lässt sich sagen, dass sich der Ausdruck und der Ton des Stückes am besten aus der Beziehung auf jene politische Dinge erklären lässt. v. 9b: Seid trunken, doch nicht von Meth, taumelt, doch nicht von Wein, weist auf den Taumel des von Freiheitsdurst und Siegesträumen erhitzten Volkes hin. Bezüglich des Tons der Rede hebt Duhm hervor, dass die Erregtheit, mit der sie hervorgestossen wird, einen Kampf mit den Volksleitern zu reflektieren scheint.
In der Rede c. 29,1 ff. findet sich keine Begründung der Drohung. Die ironische Aufforderung: fügt Jahr zu Jahr, lasst die Feste kreisen! will ihnen nur entgegenhalten, dass ihnen die blos äussere, wenn auch noch so eifrige Ausübung des Kultus als blosser Lippendienst (c. 29,13) nichts helfen wird.
In c. 28,14 ff. kann unter der v. 13 und 18 f. erwähnten Geissel nach allem, was wir sonst von Jesaia wissen, nichts anderes gemeint sein, als Assur. Damit hat auch diese Rede inhaltlich politischen Charakter genommen, was damit stimmt, dass sie an die Beherrscher des Volkes gerichtet ist. Deshalb könnte man annehmen, dass auch der Bund mit dem Tode und der Vertrag mit Scheol v. 15 auf politische Verträge mit Assur oder Aegypten zu deuten seien. Es scheinen aber vielmehr nach den Ausdrücken, die gebraucht sind, abergläubische Praktiken gemeint zu sein. Zu diesen Mitteln greifen sie, anstatt bei Jahwe Zuflucht zu suchen, aber deshalb, weil sie durch ihren ohne Jahwes Befehl vollzognen Abfall von Assur den Zorn und die Rache Jahwes heraufbeschworen haben.
Davon, dass sie wider Jahwes Willen abgefallen sind und den Krieg mit Assur herbeigeführt haben, scheint c. 28,12 zu reden. Das Stück c. 28,7–13 wendet sich gegen die Priester und Propheten, die den Willen Jahwes nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, jedenfalls aber Prophezeiungen geben, die den Offenbarungen, welche Jesaia erhalten hat, widersprechen. Jesaia forderte im Namen Jahwes Unterwerfung und Ausharren, jene werden, wahrscheinlich auch im Bewusstsein, in Jahwes Namen zu reden, zu Abfall von Assur und Krieg geraten haben. Der Spruch Jahwes v. 12: „Dies ist die Ruhe, gebt Ruhe dem Müden, und dies ist die Erholung!“ bedeutet dann im Zusammenhange die Verzichtleistung auf politische Unternehmungen. Das ist jedenfalls die beste und auch genügende Erklärung der sonst unverständlichen Worte, die auch durch den parallelen Ausspruch c. 30,15 ihre Bestätigung erhält.
So haben alle Stücke[7] des Buches Jesaia c. 28–31 ihre Beziehung auf dieselben politischen Verhältnisse, nämlich auf den Abfall Judas von Assur und das damit zusammenhängende ägyptische Bündnis.
Dementsprechend haben auch die Drohungen den gleichen Inhalt in allen Stücken, nämlich die Unterwerfung und Vernichtung Judas durch Assur. In einigen Stellen tritt das ganz klar zu Tage. In c. 29,3 wird die Belagerung Jerusalems durch Schanzen und Belagerungswerke, die das feindliche Heer errichtet, beschrieben. In c. 30,17 wird gesagt, dass die judäischen Truppen trotz der ägyptischen Hülfe von dem feindlichen Heere zersprengt werden würden, so dass von ihrem ganzen Heere nur versprengte Flüchtlinge, wie ein einzelner Signalmast auf dem Berge, übrig bleiben werden. Nach c. 31,3 wird Jahwe wie ein Löwe im Heerzuge über den Berg Zions und seinen Hügel herfallen. Es ist schon oben erwähnt worden, dass die c. 28,15 und 18 erwähnte Geissel nichts Anderes bedeuten kann als Assur, und auch v. 21 lässt auf eine aus Kriegsgefahr entstehende Not schliessen. So wird auch das Bild von der einstürzenden Mauer c. 30,13 f. im Munde des Jesaia auf den Sturz der Mauern Jerusalems zu deuten sein, vgl. 29,1 ff., auch 32,13 f., c. 22 und 5,1 ff.
Die Vergleichung der einzelnen jesajanischen Stücke unseres Buches ergiebt, dass dieselben sowohl der Form als auch dem Inhalte nach zusammengehören. Ausgenommen sind dabei das erste und das letzte Stück des Buches, c. 28,1–4 und c. 32,9–14. Das erste Stück c. 28,1–4 hat es überhaupt nicht mit Juda und Jerusalem zu thun, sondern mit Ephraim und weissagt den schnellen Untergang Samarias durch Assur. Das letzte Stück c. 32,9–14 wendet sich zwar gegen Jerusalem und weissagt sogar am deutlichsten den definitiven Untergang der Stadt; es zeigt aber doch so bedeutende Abweichungen von den vorangehenden Stücken, dass es nicht ohne Weiteres mit denselben zusammengethan werden kann. Nicht nur in der poetischen Form weicht es von denselben ab, auch inhaltlich unterscheidet es sich von ihnen dadurch, dass es nicht an die Volksleiter, sondern an die Frauen Jerusalems gerichtet ist, und dass ihm im Zusammenhange damit jede Beziehung auf das ägyptische Bündnis fehlt. Abgesehen von diesen beiden Stücken aber herrscht, wie wir gesehen haben, eine weitgehende formelle wie sachliche Uebereinstimmung unter den jesajanischen Stücken des Buches c. 28–33. Wir werden aber noch weiter gehen können. Es lässt sich zeigen, dass innerhalb derselben eine chronologische und sachliche Entwickelung stattfindet.
Nach c. 31,2 f. nimmt Jesaia, wie schon bemerkt worden ist, als ausgemachte Thatsache an, dass die Aegypter Juda zu Hülfe kommen und darum auch mit demselben zu Grunde gehen werden. Das setzt voraus, dass das Bündnis mit Aegypten eine abgeschlossene Thatsache ist. Aus v. 1 und 3a ist übrigens auch zu schliessen, dass die Aegypter Juda nicht blos sachliche Unterstützung, etwa Geld und Pferde, sondern auch die Hülfe eines Kriegsheeres versprochen haben, und v. 3a zeigt, wie grosse Hoffnung die Judäer auf diese Unterstützung gesetzt haben. Aus c. 30,9 ff. ist das noch nicht klar; da richtet sich auch die Drohung nur gegen Juda. Indessen ergiebt sich dort auch aus v. 15 ff., dass der Vertrag mit Aegypten bereits abgeschlossen ist.
c. 30,1 ff. wendet sich gegen die, die einen Beschluss ausführen wollen, der nicht von Jahwe ausgegangen ist, die Gussopfer giessen wollen, aber nicht mit Jahwes Geist, d. h. die nach Aegypten hinabziehen, um dort den wider Jahwes Willen eingegangenen Bund abzuschliessen.
c. 30,6 f. schildert sie, wie sie den dafür zu entrichtenden Tribut nach Aegypten bringen.
Dreimal also, in c. 30,1 ff, in c. 30,6 f. und in c. 31,1 ff. ist von einem Hinabziehen nach Aegypten die Rede. Aber jedes Mal hat dasselbe einen anderen Zweck. Duhm meint, dass c. 30,6 f. inhaltlich ziemlich identisch mit dem vorhergehenden sei und hält c. 31,1 ff. für ein vom Redaktor zusammengestelltes kürzeres Seitenstück zu c. 30. Das ist indessen nicht der Fall. In c. 30,1 ff. ziehen sie hinab, um den Bund abzuschliessen (vgl. v. 1 und die Ausdrücke in v. 2b), nach c. 30,6 f. thun sie es, um ihre Güter und Schätze hinzubringen, d. h., um den für die versprochene Hülfe zu leistenden Tribut zu entrichten; endlich nach c. 31,1 ff. ziehen sie dem versprochenen Hülfsheer entgegen. Darauf deuten die Ausdrücke in v. 1: die auf Rosse schauen und auf den Tross, weil er gross, und auf die Reiter, weil sie sehr stark sind. Darauf deutet auch der weitere Inhalt der Rede, der sich mindestens ebenso sehr gegen die Hülfe der Aegypter als gegen Juda selbst wendet.