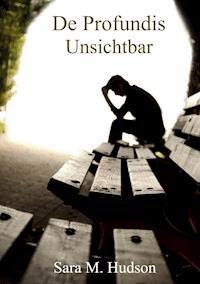4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Die alleinstehende, 48- jährige Ellen Bleckmann wird jäh aus ihrem Alltag gerissen: Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Keine Hoffnung auf Heilung. Am liebsten möchte sie in ihrer Verzweiflung allein sein, doch dafür hat sie im Krankenhaus die falsche Zimmergenossin erwischt. Ellen macht Bekanntschaft mit der exzentrischen Witwe Josephine Althoff, die mit einer ähnlichen Diagnose leben muss. Die 68-Jährige, die mit ihrem Udo-Jürgens -Spleen und einigen anderen Marotten die ganze Station auf Trab hält, nimmt ihr Schicksal ganz anders an als Ellen. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten empfindet Ellen Josephines etwas andere Art als wohltuend und als Josephine vorschlägt, ihre letzte Zeit gemeinsam zu verbringen, zieht Ellen spontan zu ihrer neuen Freundin. Schon bald merken die Frauen, dass sie nicht umhinkommen, sich in Sachen Pflege einige Gedanken zu machen. Die Möbelpacker, Tim und Ed, die Ellen für ihren Umzug angeheuert hatte, erweisen sich als äußerst nützlich. Die beiden Kleindealer finden in Josephine und Ellen treue Kunden für ihr selbstangebautes Marihuana. Könnte man da nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und die beiden als Haushaltshilfen und Schmerztherapeuten einstellen? Josephine möchte trotz ihres stetig schlechter werdenden Zustands unbedingt noch einmal nach New York und endlich nach Hawaii und das nicht nur, weil Udo Jürgens davon singt. Während ihres Aufenthalts auf Hawaii kommt jeder auf seine Weise zum Nachdenken über sein eigenes Leben, den Tod und das was danach noch kommt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Ähnliche
Sara M. Hudson
Die Krebs-WG
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Impressum neobooks
0
VorwortIch danke allen, die mich bei diesem Buch unterstützt haben und meine Ungeduld ertragen mussten, vor allem bei den Korrekturarbeiten! Ja, Geduld ist eine Tugend, die mir nicht in die Wiege gelegt wurde, …. Mein Dank gilt vor allem meinem Mann Jan, Nicola, Bärbel und Sandra, die die Aufgabe hatten, das Manuskript zu lesen.
An dieser Stelle denke ich an alle, die von dieser schrecklichen Krankheit betroffen sind, entweder selbst oder als Angehörige. Ich möchte meinen Respekt denen ausdrücken, die den Kampf schon zu Ende gekämpft haben. Dazu gehören unter anderem meine Eltern, aber auch viele Freunde, Verwandte und Bekannte. Es ist schlimm zu sehen, dass diese Krankheit vor keiner Altersstufe Halt macht. Ich möchte denen, die diesen Kampf aktuell kämpfen Mut machen, nicht aufzugeben und sich festzuhalten, an dem, was mir in schweren Zeiten sehr wichtig geworden ist: „Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist.“ (Hebräer 13;14)
Wir müssen auch in den dunkelsten Stunden nicht allein sein!
Auch wenn das Thema sehr ernst ist, so möchte ich Sie einladen, dieses Buch mit einer Prise Humor zu lesen, denn auch in den schlimmsten Zeiten, darf uns der nicht fehlen.Ihre
Sara M. Hudson
1
„Es tut mir Leid, Ihnen solch schlechte Nachrichten übermitteln zu müssen, Frau Bleckmann, aber Ihr Karzinom ist bereits so weit fortgeschritten, dass eine vollständige Entfernung unmöglich ist.“ Der Arzt machte eine Pause und wartete auf eine Reaktion seiner Patientin, die ihn fassungslos anschaute. Als diese jedoch nichts erwiderte, blickte der Mediziner wieder auf die vor ihm liegende Krankenakte und fuhr fort: „Ihre Biopsie Ergebnisse hatten ja bereits gezeigt, dass es sich um einen bösartigen Tumor handelt. Jetzt habe ich auch die Ergebnisse der Ganzkörper CT vorliegen und diese zeigen Metastasen an mehreren Stellen… Wir könnten es allerdings noch mit einer Chemotherapie versuchen….“ Die Worte des Arztes nahm Ellen Bleckmann wie in Trance wahr. Starr saß sie auf dem Stuhl in dem spartanisch eingerichteten Besprechungszimmer von Prof. Dr. Dr. Wagner. Die Farbe war fast gänzlich aus ihrem Gesicht gewichen. Sie nickte gelegentlich, obwohl sie das Gehörte gar nicht wirklich verstand. Nicht wegen der Fachbegriffe, die der Arzt verwendete, nein! Im Prinzip stellte er den Sachverhalt anschaulich und gut nachvollziehbar dar: Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium, Metastasen an Lymphen, Lunge und Knochen. Krebsart: schnellwachsend. Lebenserwartung ohne Chemotherapie: 6 Monate. Mit Chemotherapie bei gutem Gesundheitszustand: vielleicht ein Jahr. Das bestimmt nur, wenn die Chemo überhaupt anschlug. Was gab es da nicht zu verstehen? Als Ellen noch immer nicht reagierte, fuhr Professor Dr. Dr. Wagner, dem eine gewisse Routine in dieser Art von Gespräch anzumerken war, fort: „Die Medizin ist heute so fortgeschritten, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, den Krebs auch in einem sehr fortgeschrittenem Stadium so gut wie möglich in Schach zu halten.“ Besonders beruhigend klang das in Ellens Ohren nicht. „In Schach halten“, an all den Stellen, die ihr der Arzt eben genannt hatte?„Vielen Dank für Ihre Mühe, Herr Professor“, brachte sie schließlich schwach hervor, stand langsam auf und schlurfte zur Tür. Obwohl das Gespräch von seiner Seite aus noch nicht beendet war, hinderte der Arzt sie nicht daran zu gehen. Jeder Patient reagierte schließlich anders auf schlechte Nachrichten. Manche heulten, manche wurden ungehalten und aggressiv. Er hatte auch schon erlebt, dass Patienten die Diagnose verdrängten und so taten, als sei alles in Ordnung. Diese Frau hier ergriff die Flucht. Eine Information wollte der Professor allerdings noch loswerden und rief Ellen hinterher: „Der soziale Dienst wird Sie im Laufe des Nachmittags in Ihrem Zimmer aufsuchen und ihnen Informationen zu….“ Mehr hörte Ellen nicht mehr. Die Tür war bereits hinter ihr zugefallen. Geistesabwesend lief sie Richtung Gynäkologische Station. Sie hatte noch nicht einmal Gelegenheit gehabt, ihre Tasche auszupacken. Erst heute Morgen war sie hier angekommen und hatte damit gerechnet, eine ganze Weile hier zu bleiben. Sie sollte doch morgen operiert werden. Das Gespräch mit Prof. Dr. Dr. Wagner hätte eigentlich nur die Vorbesprechung zur OP werden sollen. Der computertomographischen Untersuchung hatte sie sich bereits vor einigen Tagen unterzogen. Da war noch keine Rede davon gewesen, dass ihr Krebs unheilbar sei. Ganz im Gegenteil: „Nur um sicherzustellen, dass wir bei der OP auch nichts übersehen“, hatte es geheißen als man sie in „die Röhre“ schob und man schien recht zuversichtlich, dass alles wieder in Ordnung kommen würde. Und nun… Nun hieß es, ihr Krebs sei unheilbar? Nur mit einer Chemo „in Schach zu halten“? Und von einer OP war plötzlich auch gar nicht mehr die Rede. Das konnte doch nicht wahr sein! Warum ausgerechnet sie?
Gedankenversunken und mit gesenktem Kopf betrat Ellen ihr Zimmer. Sie schaute weder nach links noch nach rechts, sondern lief sofort zu ihrer Tasche, die neben dem Bett an der Tür stand, öffnete diese und begann auszupacken. Dabei bemerkte sie nicht, dass sie nicht alleine im Zimmer war. Eine ältere Frausaß strickend in ihrem Bett am Fenster und beobachtete ihre neue Zimmergenossin neugierig dabei, wie sie ihren Schrank einzuräumen begann. Ellen spürte, dass die schlechten Nachrichten des Arztes langsam in ihrem Bewusstsein ankamen. Die Tränen begannen in ihr hochzusteigen. „Hallo, ich bin Josephine“, stellte sich die Frau ungefragt vor. Ellen zuckte zusammen und schaute in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. „Tag“, erwiderte sie knapp und widmete sich sofort wieder ihren Kleidern. Dabei wischte sie sich verstohlen eine Träne von der Wange. Die Fremde sollte schließlich nicht mitkriegen, dass sie weinte. „Warum sind Sie denn hier?“ wollte die Frau wissen. Sie musterte Ellen von oben bis unten, ohne dabei mit dem Stricken aufzuhören und lächelte freundlich, als Ellen wieder kurz aufschaute. Ellen antwortete nicht und hängte ihre braune Tweedjacke auf einen Kleiderbügel. Wieso räumte sie eigentlich ihren Schrank ein? Sie wusste ja nicht einmal, ob sie noch hier bleiben musste. Sie hatte das Besprechungszimmer verlassen, bevor der Arzt zu Ende geredet hatte.„Der Menge an Kleidern zu urteilen, die sie mitgebracht haben, bleiben Sie länger hier“, bohrte die Frau weiter, offensichtlich erpicht darauf, ein Gespräch zu beginnen. „Ich habe eine anstehende O…“ Ellen wollte OP sagen, merkte aber gerade noch, dass das ja nun wohl nicht mehr der Fall war. „Ich habe einige Untersuchungen hier“, gab sie dann zur Antwort, ohne sich umzudrehen und hoffte, dass die Frau sich mit dieser Information zufrieden geben und sie nicht weiter mit Fragen belästigen würde. Ganz schön dreist, gleich zu fragen, warum sie hier sei, dachte Ellen. So etwas machte man doch nicht. Die Frau musste doch sehen können, dass sie mit den Tränen zu kämpfen hatte und ihr nicht nach Reden zumute war. Es gab schon komische Leute.„Brustkrebs oder Unterleibskrebs?“ fragte die Frau, die sich mit ‚Josephine‘ vorgestellt hatte, weiter. Ohne auf eine Antwort von Ellen zu warten, fuhr sie fort: „Ich selber habe Unterleibskrebs. Naja, damit hat es angefangen. Hab schon die 6. OP hinter mir. Alles schon raus: Gebärmutter, Eierstöcke…, aber der verdammte Krebs macht eben auch an anderen Stellen weiter. Morgen kommt die 7. OP. Weiß gar nicht, warum ich mir das immer wieder antue. Ist eh nichts mehr zu machen. Alles nur ein Hinauszögern. Aber man hängt halt irgendwie doch am Leben oder hat Angst vor dem Sterben, nicht wahr? Und das selbst in meinem Alter.“ Ohne Ellen die Chance zu geben, etwas darauf zu erwidern, redete sie weiter: „Vor 3 Jahren habe ich meinen Mann verloren. Auch Krebs. Ein Jahr später hat man ihn dann bei mir festgestellt. Seit zwei Jahren verbringe ich fast meine ganze Zeit in Krankenhäusern oder auf Kur. Hätte mir meine Rente auch ein bisschen anders vorgestellt, aber was soll man machen? Man muss die Dinge eben so nehmen, wie sie kommen, finden sie nicht auch?“„Mhhh“, meinte Ellen nur. Eigentlich hatte es sie gar nicht interessiert, was die Frau zu erzählen hatte, als sie aber hörte, dass auch sie Krebs hatte, war sie hellhörig geworden. Ellen setzte sich auf ihr Bett. Erst jetzt nahm sie wahr, dass das mittlere Bett im Zimmer nicht belegt war. Deshalb hatte sie zunächst auch gedacht, dass sie alleine sei, als sie das Zimmer betreten hatte. Sie sah zu der Frau hinüber, die ihr gerade so unbefangen ihre gesamte Lebensgeschichte in wenigen Sätzen erzählt hatte, obwohl sie eine Wildfremde für sie war. Sie musste mindestens zwanzig Jahre älter sein als sie selbst, hatte kurze, graue Haare, die, obwohl sie sehr dünn waren, sorgfältig geföhnt und toupiert waren. Ihre goldenen Ringe, die alle mit schweren Edelsteinen bestückt waren, klapperten bei jeder Handbewegung mit den Stricknadeln um die Wette. Auf ihrem Nachttisch stand ein Blumenstrauß, der lieblos in der bunten Plastikfolie, in der er gekauft worden war, in eine Vase gestellt worden war und schon recht welk aussah. Daneben stand eine Saftflasche.„Wie kommen Sie darauf, dass ich Krebs habe?“ fragte Ellen, verärgert über die Indiskretion ihrer Zimmergenossin. „Wenn auf der gynäkologischen Station jemand das Zimmer betritt und kein neugeborenes Baby auf dem Arm hält und stattdessen heult, dann ist das normalerweise einer schlechten Diagnose zuzuschreiben. Wie ich eben sagte: Ich habe viel Zeit in Krankenhäusern verbracht und meine Erfahrungen gesammelt.“„Brustkrebs“, bekannte Ellen kaum hörbar und sah aus dem Fenster. Die Tränen stiegen ihr wieder in die Augen. Sie hatte gehofft, dass die Frau mit dieser Antwort endlich Ruhe geben würde, aber sie redete ohne Punkt und Komma weiter:„Ach wissen Sie, da gibt es ja heute so viele Möglichkeiten und Sie sind ja noch jung, da würde ich mir keine Gedanken machen. Diese Klinik ist fachlich sehr gut, auf dem neuesten Stand. Wurde mir von meiner Frauenärztin empfohlen und ich muss sagen, ich bin im Großen und Ganzen zufrieden. Naja, bis auf ein paar Ausnahmen. Es gibt den ein oder anderen Arzt, den ich menschlich nicht mag und der mich, glaube ich, auch nicht auf seine Liste der Top 10 Lieblingspatientinnen setzen würde. Aber die machen gute Arbeit hier. Ich meine, immerhin haben sie mir noch ganze 6 Monate garantiert“, sie kicherte und nahm ihr Strickzeug wieder auf, das sie abgelegt hatte, als sie ihre Krankheitsgeschichte erzählt hatte. „Das haben Ihnen die Ärzte so gesagt, dass sie nur noch 6 Monate haben?“ fragte Ellen, die erstaunt darüber war, mit welcher Gelassenheit die alte Dame über ihre Krankheit sprach.„Ja, ja, das haben sie gesagt“, meinte die Frau, ohne von ihrem Strickzeug aufzuschauen.„Und das nehmen Sie so einfach hin? Da würde ich glaube ich anders reagieren“, erwiderte Ellen und biss sich auf die Zunge. Wie denn? fragte sie sich im selben Augenblick. Immerhin hatte sie gerade dasselbe gesagt bekommen. Wie oft die Ärzte hier diesen Satz wohl aussprachen? fragte sie sich.„Ach, wissen Sie, wenn man mal in meinem Alter ist…Ein Arzt hatte mir sogar mal nur drei Monate gegeben, aber das ist schon neun Monate her.“ „Man sieht Ihnen aber gar nichts an.“ Ellen hatte ein anderes Bild von sterbenden Menschen im Kopf: Alt, dünn, fahl und gebrechlich. Diese Frau war zwar blass, sah aber nicht aus wie jemand, der in Kürze nicht mehr unter den Lebenden sein würde. Aber wie sieht eigentlich so jemand aus? Bestimmt nicht so vital wie die strickende Frau hier und auf keinen Fall Ende vierzig wie sie selbst. „Ich bin 68 Jahre und vier Monate alt“, sagte die Frau, als hätte Sie gewusst, dass Ellen über ihr Alter rätselte. „Mit etwas Glück erlebe ich den nächsten Geburtstag noch, aber allzu große Hoffnungen mache ich mir da nicht.“„Sie nehmen die Sache ja ganz schön locker“, meinte Ellen, strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und musterte die Frau nun etwas genauer. Viel war nicht von ihr zu sehen, da sie die Bettdecke ziemlich weit nach oben gezogen hatte. Sie trug ein rosa Nachthemd und ein wollenes Bettjäckchen darüber. Ob sie es wohl selbst gemacht hatte? Die Wolle, mit der sie strickte, war dunkelbraun und es sah aus, als sollte es ein Pullover werden. „Was soll man denn sonst machen?“, meinte die Frau mit einer Gelassenheit, die Ellen verblüffte. „Es hilft ja nichts, sich verrückt zu machen. Ich habe in den letzten Jahren viel erlebt. Ich habe es satt, ständig in Krankenhäusern zu sein. Aber das sind nun mal meine Aussichten wenn es nach den Ärzten geht. Ich habe keine Kinder, nur eine Nichte, mit der ich mich nicht besonders gut verstehe. Die dürfte so in ihrem Alter sein. Ich lebe alleine in einem riesigen Haus, das mir mein Mann hinterlassen hat. Finanziell könnte ich mir fast alles leisten, was ich will. Aber Gesundheit lässt sich nun mal nicht kaufen.Eigentlich wollten mein Mann und ich gemeinsam noch ein paar schöne Jahre in unserem Haus verbringen. Jetzt ist es mein Mausoleum. Anfangs habe ich sehr damit gehadert und war verbittert, dass das ausgerechnet mir passieren musste, nachdem ich doch gerade meinen Mann verloren hatte. Ich habe ständig gedacht, dass es anderen besser geht als mir und dass mir alles Schlechte passiert und anderen immer alles in den Schoß fällt. Damit habe ich fast zwei Jahre meines Lebens verschwendet, bis mir schließlich klar wurde, dass ich das alles nicht so sehen darf. Immerhin ging es mir viele Jahre lang gut. Dafür darf ich nicht undankbar sein.Heute freue ich mich über jeden Tag meines Lebens, der mir noch ohne Schmerzen bleibt und ich versuche es, trotz der vielen Krankenhausaufenthalte, zu genießen.“ Sie hielt Inne und sah Ellen eindringlich an. „Das sollten Sie auch tun, Kindchen. Egal, was die Prognose ist. Das sollte jeder tun, ob er nun krank ist oder nicht.“ Ellen schwieg eine ganze Weile, während sie die Frau genau beobachtete. Sie spürte, wie die Emotionen sie übermannten und schließlich konnte Ellen die Tränen nicht mehr zurückhalten. Schluchzend brachte sie hervor: „Ich… ich... Mir wurde gerade gesagt, dass ich Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium habe. Metastasen an mehreren Stellen. Sechs Monate ohne, ein Jahr oder so mit Chemo.“ „Ach Kindchen“, sagte die Frau in sanftem Ton, „das mag sich jetzt herzlos anhören, aber es hätte auch noch schlimmer sein können.“ „Schlimmer?“ schluchzte Ellen und suchte verzweifelt nach einem Taschentuch in ihrer Handtasche. „Immerhin haben Sie mit einer Chemo noch Aussichten auf ein Jahr plus. Das hat nicht jeder.“ Ellen hörte für einen Moment auf zu weinen und schaute die Frau fassungslos an. Dann schnäuzte sie sich kopfschüttelnd in ihr Taschentuch. So etwas Plumpes hatte sie noch nie erlebt. Gerade hatte sie sich dieser Wildfremden geöffnet, ihr gesagt, dass auch sie bald sterben würde und die kam ihr so? „Haben Sie eigentlich gerade gehört, was ich gesagt habe? Haben Sie denn gar kein Mitgefühl?“ rief Ellen wütend.„Ach, Mitgefühl. Mitgefühl. Was hilft Ihnen denn Mitgefühl? Davon wird’s auch nicht besser. Was Sie jetzt brauchen, ist jemand, der Ihnen klar sagt, wie die Dinge stehen, ohne diese Mitleidsmasche. Das bringt doch nichts. Ist nur Zeitverschwendung. Sie verkriechen sich im Selbstmitleid, bedauern Tag und Nacht Ihre Lage und bevor Sie sich umschauen, ist ein Jahr vorbei und Sie haben nichts Sinnvolles damit angefangen. Machen Sie doch einfach noch was mit der Zeit, die Ihnen bleibt. Und wenn ich Ihnen einen gutgemeinten Rat mitgeben darf: Nehmen Sie die sechs Monate ohne Chemo und nicht das Jahr mit. Sie fühlen sich während einer Chemo die meiste Zeit so elend, dass Sie eh nichts von dem Jahr haben. Glauben Sie mir, ich weiß wovon ich rede. Bis zum Ruhestand schaffen Sie es vielleicht nicht mehr, aber Sie haben noch ein wenig Zeit geschenkt bekommen. Nutzen Sie diese weise.“ Das war Ellen nun wirklich zu viel. „Sie sind doch total wahnsinnig“, brachte sie fassungslos hervor. Dann sprang sie auf, drehte sich auf dem Absatz um und stürmte wutentbrannt aus dem Zimmer. Das war ja die Höhe. Wo war sie denn da gelandet?
Schnurstracks lief sie zum Schwesternzimmer, um sich zu beschweren. Ohne anzuklopfen riss sie die Glastür auf. Die Oberschwester, eine beleibte Frau, die schon einige Dienstjahre hinter sich zu haben schien, fuhr von ihrer Schreibarbeit auf, als Ellen lospolterte: „Das geht so nicht. Wo haben Sie mich denn da reingesteckt? Ich will ein anderes Zimmer.“ „Na, na, na“, entgegnete Oberschwester Linde kopfschüttelnd. „Nun kommen sie doch erst einmal an. Sie sind ja noch keine zehn Minuten hier. Wir sind nun mal kein Fünf-Sterne-Hotel. Sind Sie Privatpatientin? Nur dann haben Sie Anspruch auf ein Einzelzimmer.“ Mit feldwebelhaftem Ton wies sie ihre völlig aufgebrachte Patientin zurecht. Was sich manche Leute immer erdreisteten. Kaum waren sie hier, schon wurde gemeckert. „Es geht mir nicht um Luxus“, erwiderte Ellen schnippisch. „Aber bei dieser Frau bleibe ich keine Sekunde länger“.„So? In welchem Zimmer sind wir denn?“, fragte Oberschwester Linde spöttisch.„Zimmer 211“, antwortete Ellen knapp. Schlagartig änderte sich der Tonfall der Oberschwester. „Ach so, Zimmer 211. Ja, ja. Da haben Sie tatsächlich nicht das einfachste Los gezogen, was? Unsere werte Frau Althoff. Gewöhnungsbedürftig, exzentrisch, da gebe ich Ihnen recht.“ „Gewöhnungsbedürftig?“ rief Ellen. „Das ist ja wohl etwas milde ausgedrückt. Die Frau ist der Gipfel. Ich bin sehr krank und ich bleibe keine Sekunde länger mit dieser Person im gleichen Zimmer.“ Beruhigend strich die Schwester über Ellens Oberarm. „Es tut mir wirklich leid, Frau ehm…“ ein schneller Blick auf ihren Zimmerplan, „…Frau Bleckmann. Aber wir haben momentan kein anderes Bett mehr frei. Naja, eins, aber das… das befindet sich eben auch in Frau Althoffs Zimmer.“ Sie kicherte, hörte damit aber sofort wieder auf, als sie merkte, dass Frau Bleckmann wohl nicht zu Scherzen aufgelegt war. „Sobald eins frei wird, werde ich schauen, was sich machen lässt“, fuhr sie fort. „Ich bitte Sie, solange Geduld zu haben. Morgen könnte sich eventuell etwas ergeben.“ Sie schaute kurz auf ihren Belegungsplan, der vor ihr an der Wand hing. Obwohl sie wusste, dass momentan keine Entlassungen vorgesehen waren, machte sie dieser verzweifelten Patientin falsche Hoffnungen. Aber was sollte sie denn sonst tun? Sie war müde. Es war ein langer Tag gewesen und in einer Stunde hatte sie Dienstschluss. Mit diesem Problem könnten sich ihre Kolleginnen morgen befassen, wenn sie ihren freien Tag hatte.„Ich soll also eine ganze Nacht mit dieser Frau verbringen?“ rief Ellen. „Das ist doch hier ein Krankenhaus und meines Wissens sollte ein Krankenhaus eine Verbesserung des Gesundheitszustandes der Patienten zum Ziel haben. Wie kann es einem aber besser gehen, wenn man mit einer Person in einem Zimmer ist, die einem sagt, dass man doch mit seiner schlimmen Diagnose zufrieden sein soll und es immerhin noch schlimmer sein könne? Und dass ich lieber sechs Monate ohne Chemo als ein Jahr mit nehmen soll, da ich es ohnehin nicht bis zum Ruhestand schaffen werde.“ Sie schnaubte wütend, als sie daran dachte, mit welcher Gleichgültigkeit diese Frau das zu ihr gesagt hatte. „Ach deshalb sind Sie wütend. Ich dachte es sei wegen…“, Oberschwester Linde hielt abrupt inne und fuhr dann in bestimmtem Ton fort: „Nun, es tut mir wirklich leid, aber ich kann Ihnen nichts anderes mitteilen, als dass Sie bis morgen warten müssen. Dann kann ich Ihnen sagen, ob irgendwo anders ein Bett freigeworden ist.“ Damit schob sie Ellen aus dem Dienstzimmer und schloss die Tür hinter sich. Ratlos stand Ellen im Gang. Was hatte Oberschwester Linde gemeint mit „ich dachte es sei wegen…“? Was sollte sie nun tun? Zurück in ihr Zimmer wollte sie im Moment auf keinem Fall. Sie hatte keine Lust auf ein weiteres Gespräch mit dieser Wahnsinnigen. Ihre Handtasche hatte sie bei sich und so machte sie sich auf den Weg in die Cafeteria.
2
Drei Espressi und ein Stück Marmorkuchen später fand sich Ellen wieder in ihrem Zimmer ein. Ihre Mitbewohnerin war gerade nicht da. Eine willkommene Gelegenheit, sich etwas hinzulegen und die Augen zu schließen. Sie faltete ihre dunkelbraune Jeans und hängte ihre farblich abgestimmte Bluse auf einen Kleiderbügel. Ihre braunen Wildlederstiefel stellte sie sorgsam unter das Bett. Dann schlüpfte sie schnell in ihren Pyjama und zog die Bettdecke bis an die Nase, obwohl ihr gar nicht kalt war. Bevor sie es sich versah, war sie in einen unruhigen Schlaf gefallen und träumte von Ärzten, OPs und ihrer Arbeit. Im Traum stand ihr Chef lachend vor ihr und sagte, sie sei zu alt und zu krank für ihre Arbeit. Er stellte ihr eine junge, blonde Schönheit vor, die ihren Platz eingenommen hatte. „Sie kommen ohnehin nicht mehr zurück“, rief er spöttisch. „Nie, nie wieder.“ Plötzlich fuhr Ellen hoch. Immer wieder hatte sie Udo Jürgens Schlager „Ich war noch niemals in New York…“ in ihrem Traum gehört. Sie saß senkrecht und schweißgebadet in ihrem Bett und brauchte erst einen Moment, um zu verstehen, wo sie eigentlich war. Schließlich stellte sie fest, dass sie von dem Lied gar nicht geträumt hatte, sondern dass ihre liebe Mitpatientin mit Kopfhörern strickend in ihrem Bett saß und lautstark einen Vers nach dem anderen schmetterte. In der Zwischenzeit war es dunkel geworden und das Tablett mit Essen stand unberührt auf Ellens Nachttisch. Sie musste einige Stunden geschlafen haben, wenn sie sogar nicht einmal mitbekommen hatte, dass ihr das Essen gebracht worden war. Frau Althoff hatte nicht mitbekommen, dass Ellen aufgewacht war und sie fassungslos anstarrte. Endlich war das Lied zu Ende. Doch schon begann sie „Griechischer Wein“ zu singen.Nachdem Ellen einige Male „hallo, etwas leiser, bitte“ gerufen hatte und keine Reaktion erhielt, sah sie keine andere Möglichkeit, als aufzustehen und zu der Frau hinüber zu gehen, um diesen Wahnsinn zu beenden. „He, Sie sind hier nicht allein im Zimmer“, Ellen schrie fast. Als die Frau aber noch immer nicht reagierte, zupfte Ellen sie unsanft am Ärmel. Frau Althoff zuckte zusammen und blickte von ihrem Strickzeug auf. „Oh, verzeihen Sie. War ich wieder zu laut? Ich vergesse mich immer, wenn ich Udo Jürgens höre. Tut mir leid.“ Diese Worte schrie sie, denn sie trug noch immer ihre Kopfhörer und hatte die Musik offensichtlich voll aufgedreht. Ellen erwiderte etwas, was Frau Althoff allerdings nicht verstehen konnte.„Sie müssen schon lauter sprechen, Kindchen“, meinte sie und entfernte ihre Kopfhörer erst, als Ellen wild gestikulierend vor ihrer Nase rumfuchtelte. „Ach so, deshalb habe ich nichts verstanden“, meinte Frau Althoff. „Was haben Sie gesagt?“ „Ich habe gesagt, dass Sie hier nicht alleine im Zimmer sind“, wiederholte Ellen genervt. „Es ist immerhin…“, sie schaute kurz auf ihre goldene Armbanduhr „halb acht“, vervollständigte sie dann ihren Satz kleinlaut. Es hatte sich für sie schon viel später angefühlt. „Haben Sie vielleicht Lust, Karten zu spielen? Ich finde es immer so langweilig im Krankenhaus. Ich bin eine Nachtschwärmerin, müssen Sie wissen, und zu Hause gehe ich vor zwei Uhr morgens nicht ins Bett.“ Na, das konnte ja heiter werden, dachte Ellen. „Nein danke“, antwortete Ellen knapp. „Dann vielleicht einen Film schauen? In einer dreiviertel Stunde beginnt das Abendprogramm. Sie dürfen wählen.“ Ellen atmete tief ein. Diese unmögliche Person hatte absolut kein Gespür dafür, dass sie überhaupt keine Lust hatte sich mit ihr zu unterhalten, geschweige denn mit ihr fernzusehen. Sie wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden und sich mit ihrem Schicksal auseinandersetzen.„Geben Sie mal ihr Glas her. Ich habe hier was Gutes für Sie, “ sagte Frau Althoff und griff nach der Saftflasche, die auf ihrem Nachtisch stand. Sich selbst schenkte sie zuerst einen ordentlichen Schluck ein, bevor sie auf Ellens Glas deutete. Diese fuhr sie zornig an:„Hören Sie, ich habe keinen Nerv zum Kartenspielen oder Fernsehen. Mir wurde heute mitgeteilt, dass ich, egal wie ich’s mache, nicht mehr lange zu leben hab. Mein Kopf spielt verrückt. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen und Sie kommen mir mit Udo Jürgens, Kartenspielen, Fernsehen und Saft trinken. Heute Nachmittag erzählen Sie mir noch, dass ich es eh nicht bis zum Ruhestand schaffen werde. Haben Sie denn gar kein Taktgefühl?“Die alte Dame sah Ellen von oben bis unten an. Sie atmete tief ein und begann dann mit ruhiger Stimme: „Gerade weil ich weiß, wie es Ihnen geht, mache ich Ihnen diese Vorschläge, Kindchen. Ich habe doch das Gleiche schon hinter mir. Mir hat damals niemand wirklich geholfen, weder als ich meinen Mann verloren hatte, noch als bei mir selbst diese Krankheit diagnostiziert wurde. Da musste ich ganz alleine durch. Die Hand getätschelt zu bekommen und gesagt zu kriegen, wie schlimm das ja alles ist, hätte ich aber auch schon damals nicht für besonders hilfreich gehalten. Da Sie weder jemand hier her begleitet, noch bisher besucht hat, gehe ich davon aus, dass Sie, wie ich, keine Familie haben, oder mit der Sache irgendwie selbst fertig werden wollen. Ich weiß, dass das alles nur schwer alleine geht, Kindchen. Das ist eben meine Art, Ihnen Hilfe anzubieten.“ Ellen antwortete nicht. Sie hatte sich kraftlos auf das leere, mit Schutzfolie überzogene Bett fallen lassen, das zwischen ihnen stand und sah Frau Althoff mit großen Augen an. Die Frau hatte ja recht: Sie hatte wirklich niemanden, der ihr jetzt zur Seite stehen würde. Wer war da denn schon? Ihre Kollegen? Oder etwa ihr Chef? Außerhalb der Arbeit hatte sie mittlerweile nur wenige Kontakte und als Einzelkind, dessen Eltern seit deren Ruhestand am Gardasee lebten, auch niemanden, der in ihrer unmittelbaren Nähe lebte und sich um sie kümmern würde. Ihren Eltern hatte sie von der Krankheit noch gar nichts gesagt. Sie wollte sie nicht beunruhigen. Ihr Vater hatte ohnehin Herzprobleme und konnte Aufregung nicht vertragen. Sie hatte geglaubt, damit durchzukommen, ihnen alles zu verschweigen. Von der OP hätten sie nie etwas erfahren müssen. Sie wäre in ein paar Tagen wieder zu Hause gewesen, hätte ihren Eltern vielleicht erzählt, dass sie für ein paar Tage verreist war und die Sache wäre erledigt gewesen. Aber jetzt…„Wie dem auch sei“, sagte Frau Althoff bestimmt. „Sie müssen auf andere Gedanken kommen. Ich weiß, wir kennen uns nicht. Aber nehmen Sie meinen wohlgemeinten Rat an: Es hilft wirklich nichts, zu jammern und in Selbstmitleid zu versinken. Das tut ihrem Gesundheitszustand überhaupt nicht gut. Was sie tun müssen, ist weitermachen. Kämpfen solange es geht! Je schneller Sie ihr Schicksal annehmen, desto besser! Dann bekommen Sie auch die Kraft, zu kämpfen und geben Ihrer verbleibenden Zeit mehr Qualität. Außerdem erwischt es früher oder später eh jeden von uns.“ In Ellens Augen blitzten Zorn und Verzweiflung auf und sie schrie: „Sie mit Ihren blöden Weisheiten! Wie soll ich denn weitermachen, wenn es nicht mehr lange zum Weitermachen gibt? Ein halbes Jahr, ein Jahr… Das sind doch keine Aussichten! Wie können Sie nur sagen, dass ich das alles lockerer sehen muss?“ Frau Althoff stand auf, legte ihren tragbaren CD-Player auf ihren Nachttisch, nahm die Saftflasche und ein frisches Glas und setzte sich neben Ellen aufs Bett. Die Schutzfolie knisterte. „Das hat nichts mit ‚locker sehen‘ zu tun. Sie wissen nie, wann es vorbei ist, Kindchen. Ob Sie nun gesund sind oder nicht. Es kann immer aus sein, ohne dass man damit rechnet. Ein Unfall, ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt…. Der Tod macht vor keinem Halt. Die Wenigsten machen sich darüber rechtzeitig Gedanken und meinen, das reicht noch, wenn man alt ist. Aber wer sagt, dass man so lange Zeit hat? Nicht viele wissen, wann und an was sie sterben werden. Wir wissen es. Naja, nicht genau wann, aber wir können den Zeitraum ziemlich eng eingrenzen.“ Ellen schüttelte verständnislos den Kopf. Mit den seltsamen Ansichten und Lebensweisheiten dieser Frau konnte sie sich absolut nicht anfreunden. Trotzdem ließ sie Frau Althoff gewähren, als sie ihr einen großen Schluck roten Saft einschenkte und ihr hinhielt. Sie drehte sich auch nicht von ihr weg, als sie ihr die Hand auf die Schulter legte und sagte: „Trinken Sie, dann geht es Ihnen gleich wieder besser.“ Misstrauisch nahm Ellen das Glas und roch daran. „Das ist ja gar kein Saft“, schniefte sie und wischte sich eine Träne von der Wange. „Naja, aber wenn man es genau nimmt, war es mal Saft. Jetzt nennt man es Port. Zum Wohl“, erwiderte Frau Althoff kichernd, langte zu ihrem Nachttisch hinüber und holte sich ihr eigenes Glas. Sie prostete Ellen zu und trank es dann in einem Zug leer. Ellen lächelte müde, hob aber schließlich doch ihr Glas, prostete Frau Althoff zu und trank.
Einige Zeit später betrat die Nachtschwester Zimmer 211 auf ihrem abendlichen Rundgang. Sie hatte im Berichtbuch gelesen, dass es Probleme in diesem Zimmer gab. Sie erwartete Gezeter und Beschwerden und hatte sich deshalb dieses Zimmer auf ihrer Runde bis zum Schluss aufgehoben. Sie wollte erst alle anderen Patientinnen versorgt wissen, da sie bestimmt heute Abend noch so einige Scherereien mit den Bewohnern dieses Zimmers haben würde. Wo Frau Althoff war, gab es immer Beschwerden. Sie war ja nicht das erste Mal hier und war, sowohl dem Pflegepersonal als auch den Ärzten, wohl bekannt. Meistens ging es um ihren Udo-Jürgens-Tick. Frau Althoff pflegte, ohne Rücksicht auf andere, lauthals einen Udo-Jürgens-Schlager nach dem anderen zu schmettern. Manchmal auch mitten in der Nacht. Als die Nachtschwester nun das Zimmer betrat, hatte sie aber eher das Gefühl zu stören, denn die beiden Patientinnen saßen einvernehmlich am Tisch, spielten Karten und kicherten vergnügt. Sie blickten nicht einmal von ihrem Blatt auf, als sie sie fragte, ob sie noch etwas zum Schlafen bräuchten und beide verneinten. Schwester Daniela wünschte den beiden Frauen eine gute Nacht und nahm auf dem Weg nach draußen Ellens Tablett mit, das noch immer vom Abendessen dastand. Zurück im Schwesternzimmer warf sie verwirrt einen Blick ins Stationsbuch. „Probleme in Zimmer 211. Patientin Bleckmann wünscht verlegt zu werden, weil sie mit Patientin Althoff nicht klarkommt.“ So stand es eindeutig und unmissverständlich im Buch, hatte aber eben nicht danach ausgesehen.
„Haben Sie denn gar nichts zu Essen bekommen?“ fragte Ellen ihre Mitbewohnerin. „Ich werde doch morgen operiert, da krieg ich nichts mehr“, war deren Antwort. „Und dann trinken Sie Alkohol?“ fragte Ellen entsetzt. „Ja, ja, das geht schon“, beschwichtigte sie diese. „Was soll denn schon passieren? Mehr als sterben kann ich schließlich nicht.“ Missbilligend schüttelte Ellen den Kopf. Schon wieder so eine sarkastische Bemerkung. „Wie haben Sie ihn eigentlich bemerkt?“ wollte Frau Althoff wissen. „Bemerkt? Den Krebs?“ fragte Ellen. Frau Althoff nickte und nahm einen großen Schluck von ihrem Glas. Ellen atmete tief ein. Die Erinnerung an diesen Tag vor ungefähr sechs Wochen war schmerzhaft. „Ich hab’s beim Duschen gemerkt. So eine Beule unter der Achsel, die ich beim Abtrocknen spürte. Ich habe erst so ein bisschen daran herumgedrückt und dann meine Brust abgetastet. Da bemerkte ich einen weiteren Knoten. Erst dachte ich, ich bilde mir das ein, dann habe ich alles auf den Stress in der Arbeit geschoben. Geschwollene Lymphknoten hat schließlich jeder mal. Ich dachte einfach, dass ich da wohl eine Grippe ausbrütete.“„Sind Sie nicht gleich zum Arzt gegangen?“ fragte Frau Althoff. „Das war ja das Problem“, sagte Ellen bitter. Ich habe es erst einmal verdrängt und noch ganze vier Wochen gewartet, bis ich endlich zu meiner Frauenärztin gegangen bin.“ „Aha, das hätte ich nicht von Ihnen gedacht“, meinte Josephine und legte ihre Karten auf den Tisch. „Wie meinen Sie?“ wollte Ellen wissen. „Ich kenne Sie zwar erst seit ein paar Stunden, aber Sie scheinen mir eher der Mensch, der sofort einen Arzt aufsucht, wenn er merkt dass etwas nicht stimmt. So kann man sich täuschen.“ „So ganz falsch schätzen Sie mich da nicht ein“, gab Ellen zu. „Ich wäre normalerweise wirklich sofort zum Arzt gegangen. Man liest ja auch immer wieder, dass man das ab einem gewissen Alter vorsorglich regelmäßig tun sollte. Aber in der Arbeit war gerade einfach zu viel los. Da konnte ich doch nicht….“ Sie hielt inne und dachte daran, ob es wohl einen Unterschied gemacht hätte, wenn sie sechs Wochen früher hierher gekommen wäre. „Ah, die Arbeit!“ sagte Frau Althoff. „Wie nett von Ihnen, Ihre Bedürfnisse für die Arbeit zurückzustellen. Ich hoffe, Ihr Chef wird es Ihnen danken. Was machen Sie denn?“ Ellen ging nicht auf die zynische Bemerkung ihrer Zimmergenossin ein und antwortete: „Ich bin in der Werbung tätig. Naja, um genau zu sein, bin ich die zweite Geschäftsführerin einer kleineren Werbeagentur. Das ist sehr stressig. Wenn man da mal eine Weile aussetzt, ist man weg vom Fenster. Man steht in ständigem Konkurrenzkampf mit jungen Kollegen, die frisch vom Studium kommen und mit den neuesten Techniken vertraut sind. Da muss man mit 48 Jahren schon schauen, dass man den Anschluss nicht verpasst. Mein Chef hat hohe Ansprüche und, obwohl ich schon zwanzig Jahre für ihn arbeite und viel Erfahrung habe, hatte ich in letzter Zeit immer das Gefühl, dass er mich loshaben wollte.“„Wie das?“ fragte Frau Althoff interessiert.„Naja, er hat immer solche Bemerkungen gemacht, wie wichtig es sei, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Dabei hatte ich immer das Gefühl, dass er dabei mich meinte. Außerdem lobte er die jüngeren Mitarbeiter für jede Kleinigkeit, beachtete mich aber kaum noch. Bei wichtigen Entscheidungen stellte er mich immer öfter vor vollendete Tatsachen, statt Dinge mit mir abzusprechen. Vielleicht habe ich mir das alles auch nur eingebildet. Jedenfalls habe ich die letzten Monate deshalb noch härter gearbeitet als sonst, habe freiwillig Überstunden geschoben, bin auf eigene Kosten auf Fortbildungen gegangen und habe mir kaum eine freie Minute gegönnt. Dabei habe ich eben auch die Alarmzeichen meines Körpers ignoriert.“„Kommt mir irgendwie bekannt vor“, sagte Frau Althoff lächelnd. „Wann sind sie dann zum Arzt?“„Als die Knoten nicht weggingen, holte ich mir dann endlich einen Termin bei meiner Frauenärztin. Das war vier Wochen nachdem ich sie entdeckt hatte.“ Frau Althoff zog die Augenbrauen nach oben. „Die war gleich bei der Untersuchung beunruhigt und redete von einer Verdichtung des Gewebes. Selbst dann sah ich den Ernst der Lage nicht. Was sollte schon sein? Ich wollte mich einfach nicht verrückt machen lassen. Als dann letzte Woche die Ergebnisse der Biopsie zurückkamen, hatte ich den Salat.“„Und dann mussten Sie, ob sie wollten oder nicht, die Arbeit loslassen, von der Sie so unentbehrlich zu glauben schienen“, ergänzte Frau Althoff Ellens Geschichte.„Mein Chef war sehr verständnisvoll und sagte, dass die Arbeit warten könne und ich erst einmal gesund werden solle.“ „Sie meinen, dann war Ihre Tätigkeit doch nicht so wichtig, wie sie dachten? Erstaunlich.“„Können Sie eigentlich nichts ernst nehmen?“ fragte Ellen gereizt.„Das habe ich, leider viel zu lange, “ rief Frau Althoff bitter. „Wissen Sie, ich habe auch viel zu viel Zeit in meinem Leben damit zugebracht, mich für andere aufzureiben und das ganz ohne Kinder und Familie. Ich hatte, ähnlich wie Sie, eine Führungsposition in einer großen Firma. Mein Mann war dort Prokurist. Tag und Nacht haben wir gearbeitet und viel zu wenig Zeit zusammen verbracht. Wir hatten uns gegen Familie entschieden, weil uns unsere Karrieren wichtiger waren, Geld anhäufen, unabhängig sein. Nur selten haben wir uns einen längeren Urlaub gegönnt. Aber wenn, dann richtig. Luxusurlaub der besonderen Klasse. Die Hotels konnten gar nicht genug Sterne für uns haben. Aber die Urlaube waren kurz. Maximal zwei Wochen, denn wir waren in der Arbeit ja unabkömmlich. Im Ruhestand, da wollten wir dann all das tun, wofür wir uns nie Zeit genommen hatten: monatelange Kreuzfahrten, Weltreisen und, und, und.Schon wenige Monate, nachdem mein Mann in den Ruhestand getreten war, bekam er die Diagnose: Darmkrebs. Zunächst sah es ganz gut für ihn aus. Aber am Schluss hat er den Kampf dann doch verloren. Typisch, nicht wahr? Jeder schiebt die schönen Dinge des Lebens immer auf den Ruhestand hinaus. Mir wird das nicht passieren, denkt man leichtsinnig. Ich werde schon gesund bleiben.Bei meinem Mann und mir hat das leider nicht geklappt.“ Ellen sah Frau Althoff nachdenklich an. „Tut mir leid, dass das alles so für Sie gelaufen ist“, sagte Ellen voller Mitgefühl. Die Frau hatte nun schon wirklich viel mitgemacht und stellte sich dabei nicht so an, wie sie selbst. Frau Althoff griff schweigend zur Saftflasche und schenkte ihnen beiden nach. Sie prosteten sich zu und widmeten sich dann wieder ihrem Kartenspiel.
3
„Nennst du mich jetzt endlich Josephine?“, wollte Frau Althoff wissen, als sie am nächsten Morgen auf die Visite warteten. „Wer einen so haushoch beim Canastaschlägt, darf einen nicht mehr siezen. Oder hast du etwa geschummelt?“ „Geschummelt? Sie, ich meine du hast mich doch gewinnen lassen. Ich heiße übrigens Ellen.“ Trotz der schlimmen Nachrichten vom Vortag hatte Ellen wunderbar schlafen können, auch ohne Schlafmittel. Oder hatte das der Port von Josephine bewirkt? Gemeinsam hatten sie doch tatsächlich die ganze „Saftflasche“ geleert.
Kurze Zeit später betrat der Chefarzt begleitet von einer Schar Weißkitteln das Zimmer. Er warf einen kurzen Blick auf Ellens Akte und begann dann ohne Umschweife: „Guten Morgen, die Damen. Frau Bleckmann. Sie haben gestern keine so erfreuliche Diagnose erhalten. Haben sie schon die Zeit gefunden, sich Gedanken dazu zu machen, ob eine Chemotherapie für sie in Frage kommen würde?“ Ellen blickte nervös zu Josephine hinüber. Diese war allerdings schon wieder ins Stricken vertieft und ignorierte die Ärzte völlig. „Ja“, antwortete Ellen. „Ich spiele mit dem Gedanken, eine Chemo zu machen.“ Josephine hielt inne blickte aber nicht von ihrem Strickzeug auf. Erst als Ellen verstohlen zu ihr hinübersah, sahen sich die beiden Frauen einen Moment lang an. In Josephines Ausdruck war zunächst Erstaunen zu erkennen, aber als sie Ellens Verzweiflung in ihrem Blick bemerkte, nickte sie ihr beruhigend zu. Sie selbst hätte sich anders entschieden, aber Ellen hatte noch nicht die Erfahrungen gemacht wie sie selbst und klammerte sich offenbar an jeden Strohhalm. Diese Entscheidung musste man einfach akzeptieren.
„Gut, Frau Bleckmann. Wir werden ihnen die Informationen zu ihrer Chemotherapie im Laufe des Tages vorbeibringen. Wenn sie sich dafür entscheiden, müssten sie sich in der Onkologie vorstellen. Dort wird dann alles Weitere veranlasst. Wir sollten unverzüglich mit der Therapie beginnen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die Therapie würde nicht stationär von statten gehen. Sie könnten also schon heute oder spätestens morgen mit einer Entlassung rechnen.“„Dann werde ich also nicht operiert?“, fragte Ellen unsicher. „Das würde gegebenenfalls erst nach der Chemothereapie geschehen, wenn die Tumore geschrumpft sind. Allerdings nur an den Stellen, an denen sie auch entfernt werden können. Bei Ihnen wären das….“ Er warf einen Blick in Ellens Krankenakte. „… eigentlich nur an der Brust und den axillaren Lymphknoten. War der soziale Dienst gestern bei Ihnen?“ Ellen schüttelte den Kopf. Vielleicht hatte sie ihn verpasst, als sie in der Cafeteria gewesen war, oder als sie geschlafen hatte. „Der hätte eigentlich schon mit Ihnen gesprochen haben müssen. Ich werde das sofort veranlassen.“ Damit war die Sache für den Arzt erledigt und er fuhr fort, ohne von seinem Clipboard aufzublicken: „Nun zu ihrem kleinen zwischenmenschlichen Problem. Sie wollten in ein anderes Zimmer verlegt werden? Wir haben…“„Nein, nein, nein“, fuhr ihm Ellen ins Wort. „Das hat sich erledigt.“ Sie schaute kurz zu Josephine hinüber und lächelte etwas beschämt. Sie hatte ihr von ihrem Vorhaben nach dem netten gemeinsamen Abend gestern natürlich nichts mehr erzählt. „Gut, gut. Es ist ohnehin nichts freigeworden. Und da sie ja nun entlassen werden…“, antwortete Chefarzt Rehn und widmete sich, ohne seinen Satz zu Ende zu sprechen, Josephine Althoff.
Ellen bekam alles von dem Gespräch mit und konnte gar nicht fassen, wie souverän Josephine mit all dem Gesagten umging. Zur OP würde sie heute im Laufe des Vormittages abgeholt werden. Es wäre ein letzter Versuch, ihre Beschwerden etwas zu lindern, nachdem die letzte Behandlung auch nicht den erwünschten Erfolg gebracht hatte. Trotzdem müsse sie mit starken Schmerzen rechnen, die auch nach der OP früher oder später unvermeidlich kommen würden, wenn sich der Krebs immer weiter ausbreitete. Ob sie schon einen Pflegedienst zu Hause hätte. Sie könne sich gerne mit der Dame vom Sozialdienst darüber unterhalten, die im Laufe des Nachmittages auch bei ihr vorbeischauen werde.„Nö“, antwortete Josephine unbeschwert. „Noch krieg ich meinen Kram ganz gut alleine hin und wenn es soweit ist, kann sich der soziale Dienst ja dann darum kümmern. Dafür hat man ihn doch, oder?“ Der Chefarzt zog missbilligend die Augenbrauen nach oben. Er war mit derart provokativen Antworten dieser Patientin vertraut. Dieser Kommentar war noch relativ mild für ihre Verhältnisse. „Ihre Entscheidung“, antwortete er schließlich gefühlskalt. „Sind ihre Angehörigen über die Situation informiert?“ Zum ersten Mal konnte Ellen Wut in Josephines Stimme hören als sie dem Doktor zähneknirschend und etwas lauter als normal antwortete: „Wenn sie mal in Ihre Akte schauen, Herr Doktor, werden Sie sehen, dass ich bis auf eine Nichte keine Angehörigen angegeben habe, die man informieren könnte. Das hatte ich Ihnen persönlich auch schon mehrere Male gesagt. Und meine Nichte interessiert das eh nur, weil sie mein Haus und meine Kohle will. Ich bin ja nun auch nicht das erste Mal auf dieser Station und diese Frage haben Sie mir schon das letzte Mal gestellt, als ich nach der letzten Chemo mit einer Lungenentzündung hier lag und Sie mir prophezeit haben, dass ich in drei Monaten den Löffel abgeben werde. Nun, hier bin ich noch immer, neun Monate später und habe keinen Familienzuwachs bekommen.“Der Doktor kniff seine Lippen zusammen und schwieg. Kein Wunder wollte keiner mit dieser Frau in einem Zimmer bleiben. Was Frau Bleckmann dazu bewegt hatte, ihre Meinung zu ändern, verstand er nicht.Schließlich antwortete er emotionslos: „Ja, richtig. Tut mir leid, aber Sie sind nicht meine einzige Patientin, Frau Althoff. Ich kann mir nicht die Familienverhältnisse all meiner Patientinnen merken.“ Als von Josephine keine Antwort mehr kam, sagte er nach einem kurzen Blick in die Akte: „Also dann, bis später im OP. Brauchen Sie noch ein Beruhigungsmittel?“ „Nein, Sie vielleicht?“ war Josephines gehässige Antwort und schon widmete sie sich wieder ihrem Strickzeug. Die Weißkittel, die Professor Dr. Rehn wortlos begleitet hatten und denen dieser auch keine weitere Erläuterung zu den beiden Patientinnen gegeben hatte, zogen gesenkten Hauptes ab. Auch ihnen war diese Situation sichtlich unangenehm gewesen. Die beiden Frauen waren wieder alleine.„Du musst schon Klartext mit den Halbgöttern in Weiß reden, sonst machen die mit einem, was sie wollen und behandeln dich wie ein Versuchskaninchen“, schnaubte Josephine und strickte aufgeregt weiter. „Aber so kann man doch nicht mit einem Arzt reden“, antwortete Ellen kopfschüttelnd. „Und warum nicht? Es ist doch auch unmenschlich vom ihm, wenn er mir zum x-ten Mal reindrückt, dass ich keine Angehörigen mehr habe. Fachlich mag er ja sehr kompetent sein, aber den Umgang mit Menschen kann man über ein Studium nicht erwerben. Aber mach dir keine Sorge, der kriegt genug bezahlt, dass er eine solche Kritik von einer Patientin schon mal ertragen kann.“ Ihre Ausdrucksweise klang so gar nicht wie die einer 68-jährigen, betuchten Rentnerin, die einmal eine Führungsposition in einer Firma gehabt hatte, dachte Ellen. Eher wie die eines rebellischen Teenagers.„Aber er hat doch recht, wenn er sagt, dass er nicht die Geschichte aller Patientinnen auf dieser Station behalten kann“, antwortete Ellen verständnislos.„Ja, sicher, aber ich bin ja nun wirklich nicht das erste Mal hier und er fragt mich immer wieder dasselbe, als wär’s einfach ein automatischer Ablauf. Ich habe immer das Gefühl, als würde ich mich mit einer Maschine unterhalten. So jemanden kann man doch nicht auf Schwerkranke loslassen. Mit dir hat er doch auch nicht anders gesprochen. ‚Eine OP machen wir nur dann, wenn’s was gebracht hat. Sonst lohnt sich das nicht.‘ Das kann man auch anders sagen, finde ich.“„Pfff“, machte Ellen. „Das sagt die Meisterin des Feingefühls.“ „Ach komm, das ist doch was anderes. Ich rede so wie ich rede aus Überzeugung. Es kommt zwar plump rüber, das tut mir leid. Ich bin wohl über die Jahre etwas hart geworden. Aber als Mediziner sollte man auch darin geschult sein, seine Patienten nicht wie eine Fallstudie oder eine Nummer auf einem Blatt Papier, sondern wie Menschen zu behandeln.“„Vielleicht ist er über die Jahre auch hart geworden“, gab Ellen zu bedenken. „Für ihn ist es bestimmt auch nicht leicht, Menschen Tag für Tag sagen zu müssen, dass sie Krebs haben und zu sehen, dass auch der Medizin Grenzen gesetzt sind.“Josephine war erstaunt über Ellens Verständnis für die Art, wie Professor Dr. Rehn mit seinen Patientinnen sprach.