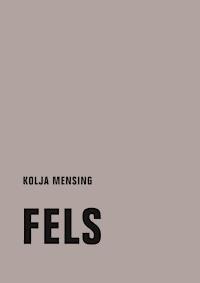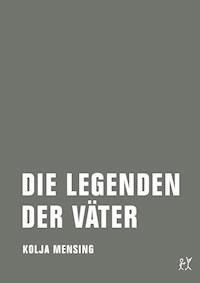
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
1946 wird ein Kind im Nordwesten Deutschlands geboren. Der Vater ist Pole, Soldat der polnischen Besatzungsarmee, die in der britischen Besatzungszone agiert, die Mutter Deutsche. Die Liebe scheitert, der Soldat geht zurück nach Polen, und das Kind - ein Sohn - wächst ohne Vater auf. Erst viele Jahre später gibt es einen Kontakt. Und noch einmal viele Jahre später begibt sich Kolja Mensing, der Enkel, auf eine Spurensuche in Deutschland und Polen. Er entdeckt, dass Familiengeschichten nie so eindeutig sind, wie sie erzählt werden, und dass Krieg und Besatzungszeit auch seine Generation noch prägen. Das Buch ist eine vollständig überarbeitete Neuausgabe mit einem aktuellen Nachwort des Autors. Kolja Mensing beleuchtet darin - 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs - die historischen Umstände der polnischen Besatzungszone, die zwischen 1945 und 1947 im nördlichen Emsland und rund um Oldenburg und Leer existierte und bislang nur wenig bekannt ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kolja Mensing
Die Legenden der Väter
DRAUSSENist es längst Nacht. Die anderen haben sich tief unter ihren Decken vergraben, jemand hustet im Schlaf. Der junge Mann greift nach dem angebrochenen Päckchen mit den Zigaretten, das auf dem schmalen Ablagebrett unter dem Fenster liegt. Über der Tür des Zugabteils brennt eine Lampe, und sein Gesicht spiegelt sich in der dunklen Scheibe, über die der Regen feine Linien zieht. JózefKoźlikist vierundzwanzig Jahre alt, doch er hat das weiche, blasse Gesicht eines kleinen Jungen. Selbst nach zwei Tagen im Zug sind auf seinen Wangen und rund um das Grübchen auf dem Kinn kaum Bartstoppeln zu erkennen. Erst die Zigarette macht ihn älter. Eine dunkle Haarsträhne fällt ihm ins Gesicht, als er sich vorbeugt, dem brennenden Streichholz entgegen. Józef kneift die Augen zusammen und zieht den Rauch tief in die Lungen.
Es ist kalt im Abteil. Er wickelt sich fester in die Wolldecke, die ihm ein Mitarbeiter der Militärmission beim letzten Halt in die Hand gedrückt hat, zusammen mit einem Becher lauwarmem Tee. Acht Stunden hatten sie in Lübeck auf dem Bahnhof gestanden, ohne aussteigen zu dürfen,vierhundert Männer in zwölf Waggons, bis dieVerbindungsoffizierenoch einmal sämtliche Papiere durchgegangen waren und den Zug zur Weiterfahrt nach Stettin freigegeben hatten. Es ist einer der letzten Transporte mitpolnischen Soldaten, die aus Deutschland in ihre Heimat zurückkehren. Sie haben eine Wochenration Lebensmittel aus den Beständen der britischen Armee mit auf den Weg bekommen, englische Militärpolizisten mit weißen Handschuhen und einem Revolver am Gürtel haben den Zug bis zur Zonengrenze begleitet.
Die Polen tragen Zivil. Es wird schon lange nicht mehr gekämpft. Die meisten Soldaten sind in den ersten beiden Jahren nach dem Krieg zurückgegangen, zusammen mit den ehemaligen Zwangsarbeitern und Häftlingen aus den befreiten Lagern. Jetzt, im Dezember 1949, sitzen nur noch diejenigen im Zug, die keine Wahl haben, Schieber, die nach dem Krieg ein Vermögen gemacht haben, um es über Nacht wieder zu verlieren, gescheiterte Abenteurer, die sich durch das zerstörte Europa haben treiben lassen, bis ihr Heimweh so groß war, dass sie sich trotz der beunruhigenden Nachrichten aus Polen zuletzt doch noch in die Rückreiselisten der Militärmission eingetragen haben. Es riecht nach Enttäuschung undVerzweiflungin den Abteilen und nach Angst. Keiner der Soldaten weiß genau, was sie in Stettin erwartet, der Stadt, die vor dem Krieg zu Deutschland gehörte und jetzt ein polnischer Grenzort ist.
Józef ist auf dem Weg nach Steblau, einem Dorf in Oberschlesien. Dort lebt seine Mutter. Vor fünf Jahren hat er sie das letzte Mal gesehen, kurz nachdem sein Vater mitten im Krieg gestorben ist. Er zieht ein letztes Mal an der Zigarette, dann drückt er sie vorsichtig unter der hölzernen Sitzbank aus und wirft einen Blick auf den abgewetzten Koffer, der zu seinen Füßen steht. Er ist nur halb gefüllt, mit ein bisschen Kleidung, billigem Weinbrand, den er vor ein paar Tagen in Hamburg im Bahnhof gekauft hat, und einer Stange englischer Zigaretten. Im Seitenfach hat er eine goldene Taschenuhr verstaut, einer der letzten Wertgegenstände, die ihm geblieben sind.
Er richtet sich auf. Vorsichtig tastet er in der Innentasche seines Mantels nach dem braunen Umschlag, der ein paar zerknitterte Dollarnoten enthält, einen Bogen Briefpapier einer Firma namens Globus-Lichtspiele und eine Handvoll Schwarz-Weiß-Bilder. Ein Porträtfoto zeigt eine junge Frau mit dunklen Locken, und Józef wendet das Bild, um die Widmung auf der Rückseite zu lesen. Auf dem nächsten Bild sitzt die Frau mit einem Baby auf dem Arm in einem Park. Es sind Fotos wie aus einem Familienalbum. Józef trägt eine Uniform und schiebt einen Kinderwagen über eine Schotterstraße, dann wieder sieht man ihn und die Frau in einem Garten, unter hohen, alten Bäumen. Das Kind ist zwei Jahre alt, ein Junge mit blonden Locken. Er steht zwischen den Erwachsenen und hält sich an ihren Händen fest.
Józef holt ein Foto nach dem anderen hervor, und während er die Aufnahmen im schwachen Licht der kleinen Lampe im Abteil betrachtet, entsteht vor seinen Augen das Panorama einer norddeutschen Kleinstadt, mit einem Kirchturm, einem Bahnhof und einer halb zerfallenen Schlossanlage, schmalen Straßen mit Kopfsteinpflaster, Obstgärten und duftendem Flieder. Er steckt die Bilder zurück in den Umschlag und greift zur Zigarettenschachtel. Vor dem Fenster des Abteils dämmert der Morgen.
ICH MOCHTE ES, wenn mein Vater mir Geschichten aus seiner Kindheit erzählte. Sein Großvater war Tischler gewesen, und mein Vater hatte oft ganze Nachmittage in derWerkstatt verbracht. Er spielte mit Holzresten, sortierte rostige Nägel in Kästen und Gläser und blätterte stundenlang in Musterbüchern undKatalogen für Messingbeschläge, Scharniere und Schlösser. Sein Großvater, er hieß Arnold, trug bei der Arbeit einen grauen Kittel, und mein Vater sah ihm gern über die Schulter, wenn er mit seinen Schnitzwerkzeugen aufwändige Verzierungen für Schränke und Kommoden anfertigte.
Die Erzählungen meines Vaters waren Berichte aus einem verzauberten Land. Auf den Hobelbänken lagen Werkzeuge mit klingenden Namen, Putzhobel und Fuchsschwänze, Schraubzwingen und Rundfeilen, und während in dem Leimtopf, der in der Mitte der Werkstatt auf einem Ofen leise köchelte, zähe Blasen aufstiegen und träge an der Oberfläche zerplatzten, lauschte mein Vater den einsilbigen Unterhaltungen der Gesellen, die sich in einer Art Geheimsprache über Maßzahlen und die Wahl der richtigen Holzsorte verständigten.
Die Hobelbänke standen im ersten Stock der Tischlerei. Im Erdgeschoss war die kleine Beizstube untergebracht, deren Wände von oben bis unten mit bunten Geldscheinen aus der Zeit der Inflation tapeziert worden waren. Hier arbeitete Karl, Arnolds jüngerer Bruder, und gleich daneben lag der Maschinensaal. Durch die Wand drangen die gefährlichen Geräusche der Hobelmaschine, der Furnierpresse und der Bandsäge, die vor dem Krieg von einer gewaltigen Dampfmaschine angetrieben worden waren und jetzt durch Elektromotoren in Gang gehalten wurden. Der Zutritt zu diesem Raum war meinem Vater streng verboten, und in der Werkstatt versuchte er immer wieder, einen Blick auf den verstümmelten Daumen des Altgesellen zu erhaschen, der sich vor langer Zeit an einer der Maschinen verletzt hatte und trotzdem geschickter als alle anderen mit Spitzbohrer und Winkel umgehen konnte.
Am Abend wurde es still in der Tischlerei. Die Maschinen verstummten. Der Lehrling fegte Sägemehl und Holzwolle zusammen, die Gesellen rauchten am Holzschuppen noch eine Zigarette. Während Arnold einen letzten Blick in das Auftragsbuch warf, lief mein Vater an den Johannisbeerbüschen vorbei über den Hof.
Auch diese letzten Stunden des Tages bekamen in seinen ErzählungeneinenmärchenhaftenGlanz.Essensduftschlugihmentgegen,wennerdasgroßeWohnhausbetrat.Arnolds Vater, der ebenfalls Tischler gewesen war, hatte vor dem Ersten Weltkrieg Möbel an ostpreußische Gutsbesitzer und Industrielle in ganz Deutschland verkauft. Er hatte sich in seiner Heimatstadt in der Nähe des Bahnhofs eine Bürgervilla im Stil eines englischen Landhauses mit verwinkeltem Grundriss bauen lassen, mit einer Diele, die Halle genannt wurde, und einem Herrenzimmer mit Klavier und gerahmten Stichen an der Wand, in dem Gäste empfangen wurden. Jetzt schürte Anna, die Großmutter meines Vaters, in der Küche das Feuer und setzte eine schwere, gusseiserne Pfanne auf den Herd, um Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln zuzubereiten. Sie holte Einmachgläser mit roter Beete, eingelegten Gurken und süßem Kompott aus dem schierunerschöpflichenVorrat der Speisekammer, die sich in einem kühlen Kellerraum unter der Küche befand. Die Regale bogen sich unter der Last der Gläser mit Erbsen und Bohnen, auf dem Fußboden standen bauchige Flaschen mit selbst hergestelltem Obstwein.
Mein Vater schien sich an jede Einzelheit zu erinnern, an den dampfenden Becher mit heißem Kakao, der an seinem Platz bereits auf ihn wartete, wenn er abends ins Haus kam, an die strahlend weiße Kittelschürze seiner Großmutter, auf der niemals ein Fleck zu sehen war, an die Sticheleien zwischen seiner Mutter Marianne und ihrer jüngeren Schwester Eleonore, die noch ein Teenager war und von allen nur Lorchen genannt wurde, und an das brauneFläschchen mit Jodtinktur, aus dem Arnold nach dem Essen einige Tropfen in ein Glas Wasser gab. Er hatte einen empfindlichen Magen und schwor darauf, sich auf diese Art vor Krankheitskeimen zu schützen. Anschließend zog er sich ins Wohnzimmer zurück, legte sich auf die Chaiselongue und blätterte in einer zerlesenen russischen Grammatik.
Dann wurde mein Vater zu Bett geschickt. Er wusch sich am Spülstein in der Küche unter der Pumpe, dann ging er auf die Toilette, die im Stall neben der Küche untergebracht war und damals noch keine Wasserspülung hatte. Er lief durch die Diele in das Zimmer, das er sich mit seiner Mutter und Eleonore teilte, und bevor er einschlief, lauschte er auf die leisen Geräusche im Obergeschoss des Hauses. Dort hatten Arnolds Geschwister ihre Zimmer, der Junggeselle Karl, der in der Beizstube arbeitete, Rudolf, der Polsterer, und Lore, die ihren Mann an der Ostfront verloren hatte und am Ende des Krieges aus Berlin mit ihrem Sohn in ihr Elternhaus zurückgekehrt war. Arnolds Vater war bereits vor langer Zeit gestorben, aber seine Mutter, die Urgroßmutter meines Vaters, lebte noch. Auch sie hatte ein Zimmer im oberen Stockwerk, und mein Vater bekam sie nur zu Gesicht, wenn sie mit ihrem Nachtgeschirr in der Hand die Treppe herunterkam.
Anna, Arnold, Marianne und Lorchen spielten in der Küche Karten, bis es auch für sie Zeit war, sich schlafen zu legen. In manchen Nächten wachte mein Vater noch einmal auf, wenn sich leise die Tür öffnete und seine Mutter und ihre Schwester in das Zimmer kamen. Sie zogen sich im Dunkeln aus, lösten ihr Haar und warfen sich ihre Nachthemden über. Es gab nur zwei Betten. Marianne schlüpfte zu meinem Vater unter die Decke, und selbst im Sommer waren ihre Füße noch kalt vom Steinfußboden.
Mein Vater erzählte mir beim Abwaschen oder auf langen Autofahrten von den Nachmittagen in der Tischlerei, von der Küche seiner Großmutter Anna und von dem Bett, in dem er auch dann noch gemeinsam mit seiner Mutter schlief, als er längst in die Schule ging. Ich war damals selbst noch ein Kind, und ich konnte nicht genug von diesen Geschichten bekommen. Sie vermittelten mir ein Gefühl von Geborgenheit. Ich glaubte fest daran, dass mir nichts passieren würde, solange mein Vater mit seiner tiefen Stimme in wenigen Sätzen die Zeit seiner Kindheit heraufbeschwören konnte. So nahe wie damals sollte ich ihm nie wieder sein.
DIE STADT,in der mein Vater aufgewachsen ist, heißt Fürstenau. Sie liegt im Nordwesten Deutschlands, im Niemandsland zwischen der niederländischen Grenze und den Dammer Bergen. In einem Autoatlas ist sie leicht zu finden, man muss nur der alten Bundesstraße 214 folgen, die vom Harz ausquer durch Niedersachsen in Richtung Westen verläuft. Ich selbst bin nie dort gewesen, und bis heute kommt es mir so vor, als ob Fürstenau in Wirklichkeit gar nicht existiert. Die ehemalige Garnisonsstadt, die in alten Urkunden Verstenowe, Fastenouwe oder Fürstenouwe genannt wird, gehört für mich in ein Land, das aus Zeit und Raum gefallen ist und das ich nur als Kind zusammen mit meinem Vater hatte betreten dürfen.
In der Mitte der Stadt befand sich ein Schloss, das von einem breiten Graben umgeben war, dem Schlossteich, und wenn die Schule vorbei war, lief mein Vater über die Brücke, die von zwei mächtigen alten Buchen begrenzt wurde und über den Schlossteich auf die Insel führte. Hier konnte man noch die Reste einer mittelalterlichen Befestigungsanlage erkennen, Bollwerke aus Sandstein und handgefertigten Ziegeln, die von Moos, Gras und Sträuchern überwuchert wurden. Mein Vater verbrachte ganze Nachmittage damit, die verborgenen Einstiege aufzuspüren, die in die Kellerräume unter dem Schloss führten. Mit einem Kerzenstummel in der Hand erkundete er die unterirdischen Gänge. Fledermäuse hingen von der Decke, und schwereEisenringe erinnerten daran, dass hier einst Gefangene angekettet worden waren.
Atemlos hörte ich zu, wenn mein Vater von diesen Expeditionen berichtete. Ich spürte im Nacken den kalten Luftzug, der durch die Verliese strich, ich erschrak, wenn die Kerzenflamme zu flackern begann, wenn die Schatten sich aus den Ecken und Mauervorsprüngen lösten und über diefeuchten Wände tanzten. Das Herz schlug mir bis zum Hals,wenn mein Vater schilderte, wie er glaubte, sich in den Gängen verlaufen zu haben, bis ich schließlich erleichtert mit ihm aufatmete, wenn im letzten Moment ein Streifen Tageslicht die Dunkelheit durchbrach und ihm den Weg zum Ausgang wies, so wie es Tom Sawyer ergangen war, als er und Becky Thatcher sich in der Höhle verlaufen hatten.
»Tom Sawyer« war eines der Bücher, die mein Vater mir vorgelesen hatte. Doch die Geschichten aus Fürstenau waren mir lieber. Ich durfte bei all den Streifzügen meines Vaters mit dabei sein. Ich schlich mit ihm durch raschelnde Kornfelder, Pfeil und Bogen griffbereit und eine Taubenfeder im Haar; ich sah ihm über die Schulter, wenn er aus einer Astgabel und einem alten Fahrradschlauch eine Steinschleuder bastelte und im Pottebruch, dem Stadtwald vonFürstenau, mit Kieselsteinen auf Krähen und Elstern schoss,die sich in den dichten Kronen der Laubbäume verbargen. An flirrenden, heißen Sommertagen lief ich mit meinem Vater den kleinen Pfad an den Bahngleisen entlang, der aus der Stadt hinausführte. Ich begegnete bärbeißigen Gleisarbeitern und schweigsamen Streckenläufern, und ich bewunderte im Geiste die Kupfermünzen, die mein Vater auf die Schienen legte, um sie von den Rädern eines vorbeirauschenden Güterzuges zu hauchdünnen Kupferscheiben pressen zu lassen, die im Sonnenlicht in allen Farben schillerten.
Hinter dem Bahnhof, nur einen Steinwurf vom Güterschuppen entfernt, lag an einer schmalen Schotterstraße Arnolds Tischlerei. Am besten gefiel es mir, wenn mein Vater mir vom Alltag in der Werkstatt und im Haus seiner Großeltern erzählte, auch wenn es im Grunde genommen nur einige wenige Begebenheiten waren, die er zu immer neuen kleinen Geschichten zusammensetzte. Er hatte als Kind eine Wasserpistole besessen, die er in Karls Beizstube heimlich mit einer der ätzenden Flüssigkeiten gefüllt hatte, um Jagd auf die Fliegen zu machen, die hinter der Tischlerei auf der Bretterwand des Holzschuppens in der Sonne saßen. Dann gab es Rex, den ungestümen Schäferhundmischling, der in einer Hütte neben der Garage gehalten wurde, in der Arnolds Borgward Isabella stand. Einmal hatte mein Vater den Hund von seiner rostigen Kette befreit und ihn anschließend mit einem Stück altem Seil wie ein Zugpferd vor einen Handwagen gespannt, nur um nach einer kurzen und halsbrecherischen Fahrt vor dem Haus im Graben zu landen. Es war Anna, seine Großmutter, die seine blutigen Knie und Hände mit Wundpflaster versorgte, um ihm dann in der Küche eine Scheibe frisches Brot mit Butter und Zucker zu machen. Sie hielt den Laib fest an die Brust gepresst, wenn sie es schnitt, so wie sie es auf dem Bauernhof gelernt hatte, auf dem sie aufgewachsen war.
Im Sommer nahm Anna meinen Vater auf dem Fahrrad mit in den Pottebruch, um Blaubeeren zu sammeln, die hier in der Gegend Bickbeeren genannt wurden. Sie kannte die besten Stellen, und abends wurden die Beeren zusammen mit frischer Dickmilch gegessen, die den Tag über mit einem Geschirrtuch bedeckt in einer großen Schüssel auf den warmen Stufen des Hauses gestanden hatte. Aus Johannisbeeren und Himbeeren machte Anna Saft, den sie auf Flaschen zog oder zu Obstwein vergor, und im Spätsommer, nach den ersten Regenfällen, zog sie los, um Steinpilze zu suchen. Im Herbst röstete sie Esskastanien auf dem Ofen, und im Winter verrührte sie Sahne, Zucker und Schnee zu Eiscreme, die sie am Sonntag zum Nachtisch servierte.
In den Erinnerungen meines Vaters wurde seine Kindheit zu einem endlos langen Ferienaufenthalt bei den Großeltern. Es war ein einziges Idyll, und ich wäre nie darauf gekommen, ihn zu fragen, warum seine Mutter Marianne in den Geschichten aus Fürstenau nur am Rande vorkam und warum von einem Vater nie die Rede war. Stattdessen bat ich ihn immer wieder, mir eine jener vielen Geschichten zu erzählen, die ich längst auswendig kannte.
Fürstenau war eine Geisterwelt, bevölkert von Menschen, von denen ich die meisten nie selbst kennengelernt habe. Eleonore zum Beispiel, die jüngere Schwester meiner Großmutter, kannte ich nur aus den Geschichten meines Vaters, bei Geburtstagen und anderen Festen im Haus meiner Großeltern war sie nicht zugegen, obwohl ihr Name gelegentlich fiel und alle sie weiterhin Lorchen nannten.
Auch an Anna, die Großmutter meines Vaters, habe ich keine Erinnerungen, nur an Arnold, ihren Mann. Er war 1977 gestorben, und die letzten Jahre seines Lebens hatte er bei seiner Tochter Marianne gelebt. Wenn wir sonntags bei ihr zu Besuch waren, saß er im Wohnzimmer in einem Schaukelstuhl, eine hellblaue Wolldecke über den Beinen. Manchmal fuhr er mir mit seiner zittrigen Hand über den Kopf, aber die meiste Zeit döste er vor sich hin. Er war weit über achtzig Jahre alt. An den Gesprächen am Kaffeetisch nahm er nicht teil, und wenn er doch einmal etwas sagte, drangen nur unzusammenhängende Worte aus seinem zahnlosen Mund.
Arnold war Jahrgang 1891. Er hatte als Minenwerfer am Ersten Weltkrieg teilgenommen, und als er zurück nach Fürstenau kam, war sein Vater gestorben. Anstatt sein Studium an der Kunstgewerbeschule in Düsseldorf zu Ende zu bringen, übernahm Arnold die Tischlerei in Fürstenau. Mit dem Krieg müssen ihn glückliche Erinnerungen verbunden haben, denn 1939 ging er noch einmal an die Front. Er war mit achtundvierzig Jahren bereits zu alt, um als Wehrpflichtiger eingezogen zu werden, doch er meldetesich gleich nach Kriegsausbruch freiwillig zum Einsatz.
Arnold war alsOffiziermit der Wehrmacht in Frankreich und in Russland. Auf dem Vormarsch in Richtung Osten sah er bei Smolensk die Reste der Brücken, die Napoleon hier einst hatte über den Dnjepr bauen lassen, und an einem klaren Tag im November des Jahres 1941 waren vor ihm am Horizont die Stadtmauern von Moskau aufgetaucht, kurz bevor die deutschen Truppen zurückgedrängt wurden und bei Schnee und Eis den Rückzug antreten mussten. Arnold hatte ein Baubataillon mit Turkmenen, Afghanen und Usbeken angeführt, die auf die deutsche Seite übergelaufen waren. Aus dieser Zeit stammten seine Russischkenntnisse, die er aus dem Krieg mit nach Hause gebracht hatte und mit Hilfe der Grammatik aufrechtzuerhalten versuchte.
Wenn mein Vater von seinem Großvater sprach, nannte er ihn Atti, nicht Opa Atti, einfach nur Atti. Lange Zeit hatte ich geglaubt, dass es sich um eine Kurzform von Arnold handele, denn auch die anderen Erwachsenen nannten ihn so. Erst als die Kindheitserinnerungen meines Vaters erste Kratzer und Schrammen bekamen, verstand ich, dass dem Namen eine Verwechslung zugrunde lag. Als mein Vater sprechen lernte, nannte er seine Mutter Mutti, seine Großmutter Oma und für seinen Großvater, der die Rolle seines Vater eingenommen hatte, benutzte er das Wort Atti, eine kindliche Form von Vati. Korrigiert hat ihn niemand.
Eine der Geschichten meines Vaters drehte sich um eine Konfektschachtel, die Arnold von einer seiner seltenen Geschäftsreisen mitgebracht hatte. Ein Schokoladenfabrikant im Ruhrgebiet hatte sich den Tischler aus Fürstenau empfehlen lassen, der sich auf altdeutsches Schnitzwerk verstand. Es ging um einen lukrativen Auftrag, ein Erbe aus der Zeit, als die Tischlerei in Fürstenau unter Arnolds Vater noch Kunden überall in Deutschland beliefert hatte, und als er nach Hause kam, hatte er nicht nur eine stattliche Anzahlung in der Tasche, sondern auch eine Schachtel Pralinen aus der Herstellung des Fabrikanten im Gepäck.
Das war etwas Besonderes. Die Speisekammer im Keller war immer reich gefüllt, und Anna kochte mehrmals in der Woche in großen Töpfen Vanillepudding, zu dem es eingeweckte Kirschen und Mirabellen gab. Doch gekaufte Süßigkeiten waren eine Seltenheit, und Arnold hatte das Konfekt darum an einem sicheren Ort versteckt. Eines Abends, als mein Vater, seine Mutter und Eleonore allein zu Hause waren, machten sie sich auf die Suche. Sie rissen die Schubladen sämtlicher Kommoden und Schränke auf, bis sie sich schließlich gierig eine Handvoll Pralinen in den Mund stopfen konnten. Wenn mein Vater mir davon erzählte, wirkte es nicht, als seien Mutter, Sohn und Tante, sondern drei Geschwister durch das Haus getobt, außer Rand und Band, weil sie der elterlichen Aufsicht entkommen waren.
Selbst wenn es Streit zwischen meinem Vater und seiner Mutter gab, war es so, als würden eine ältere Schwester und ihr kleiner Bruder aneinandergeraten. Am Wochenende ging es oft hoch her, wenn in der Waschküche ein großer Kessel mit Wasser erhitzt wurde und mein Vater gebadet werden sollte. Dampfschwaden füllten den Raum, der Boden des Kessels, in dem sonst Wäsche ausgekocht wurde, war glühend heiß, und Marianne traktierte ihn so lange mit einer harten Bürste, bis er splitternackt und krebsrot vom heißen Wasser in den Garten lief und sich im hohen Gras zu verbergen suchte. Ein anderes Mal flüchtete er sich nach einer Auseinandersetzung auf das Dach der Garage und winkte seiner Mutter von oben herab triumphierend zu. Mein Vater hatte sie ausgetrickst wie ein kleiner frecher Bruder seine ältere Schwester.
Es waren Erinnerungen an harmlose Kinderspiele, zumindest kam es mir damals so vor. Mein Vater hatte mich zu seinem Komplizen gemacht. Indem ich ihm zuhörte, half ich ihm dabei, die Illusion aufrechtzuerhalten, dass es die heile Welt seiner Kindheit tatsächlich gegeben hatte. Dass noch ein anderer, bedrohlicher Ton in diesen Geschichten mitschwang, bemerkte ich erst sehr viel später. Erst einmal kam Józef ins Spiel.
ICH WARsechs Jahre alt, als ich den Namen JózefKoźlikzum ersten Mal hörte. Es war an einem Sonntagabend, nach einem Besuch bei meinen Großeltern.
Mein Großvater war ein vermögender Mann. Er trug goldene Manschettenknöpfe, fuhr eine dunkelblaue Mercedes-Limousine mit holzverkleideten Armaturen, und zu dem großzügigen Anwesen, das meine Großeltern bewohnten, gehörten eine Veranda mit einer Hollywoodschaukel und ein beheizter Swimmingpool. Ich verbrachte den Tag vor dem Fernseher im Gästezimmer, und bevor wir am Abend wieder abfuhren, nahm mein Großvater mich beiseite und steckte mir einen Zehnmarkschein zu.
Damals kam mir der Luxus, in dem meine Großeltern lebten, normal vor. Mir fiel auch nicht auf, dass mein Vater meine Großmutter mit »Mutti« ansprach, meinen Großvater dagegen immer nur bei seinem Vornamen nannte. Über die angespannte Stimmung, die nach den Besuchen bei meinen Großeltern auf der Rückfahrt zwischen meinen Eltern herrschte, machte ich mir ebenfalls keine Gedanken. Sie stritten auch an anderen Tagen.
An einem dieser Sonntage kam mein Vater abends noch einmal in mein Zimmer. Er hatte mir vorgelesen, wie jeden Abend, und eigentlich hätte ich bereits schlafen sollen. Er schaltete die Lampe auf dem Nachttisch wieder an, setztesich an mein Bett und erklärte mir, dass der Mann meiner Großmutter nicht sein leiblicher Vater sei, sondern sein Stiefvater. Mein richtiger Großvater sei ein Pole namens JózefKoźlik, der während des Krieges als Soldat nach Deutschlandgekommen sei.
Es war eine abenteuerliche Geschichte. Mein Vater erzählte mir, dass mein Großvater als junger Mann nach dem Überfall der Deutschen auf Polen sein Heimatland verlassen habe. Er sei mit falschen Papieren über die Karpaten nach Ungarn, Rumänien und Jugoslawien bis nach Griechenland geflohen und habe sich schließlich in Palästina den britischen Truppen angeschlossen, um gegen die Deutschen zu kämpfen. Als der Krieg vorbei gewesen sei, erklärte mein Vater mir, sei Józef mit der britischen Armee nach Deutschland gekommen und habe in Fürstenau meine Großmutter kennengelernt. Sie hätten ein Kind bekommen, ihn, meinen Vater. Kurz darauf sei Józef nach Polen zurückgekehrt. Meine Großmutter sei im Haus ihrer Elterngeblieben, er selbst könne sich nicht an seinen Vater erinnern.
Das war die Geschichte, so wie mein Vater sie mir erzählte. Er löschte das Licht und ging aus dem Zimmer. Die Tür zum Flur ließ er angelehnt, wie jeden Abend. Nicht alles verstand ich sofort. Mir blieb zunächst nur das Bild von einem jungen Mann im Kopf, der durch eine mondlose Nacht lief, im Schutz der Dunkelheit auf Züge aufsprang und sich tagsüber in verfallenen Scheunen und unter Brücken versteckte.
Mein Vater erzählte mir dann immer wieder von Józef. Mit der Zeit prägten sich mir alle Details ein, die falschen Papiere, die Ziegenhirten, die die alten Wege durch die Berge kannten, die flirrende Hitze in den Camps in Palästina, Orte wie Tobruk und Monte Cassino, an denen mein Großvater Seite an Seite mit englischen Soldaten gekämpft hatte.
AN EINEM DIENSTAGim Oktober beschloss mein Vater, von zu Hause auszureißen. Er war zwölf Jahre alt. Er aß das Mittagessen, das Anna im Ofen für ihn warm gehalten hatte. Anschließend brachte er seinen Ranzen in das Schlafzimmer, das er sich jetzt nur noch mit seiner Mutter teilte. Mariannes Schwester hatte im Jahr zuvor die Schule beendet und das Haus verlassen, um zu studieren. Hastig suchte mein Vater Unterwäsche, Socken und einen warmen Pullover zusammen und lief mit dem Bündel die Treppe in den ersten Stock hinauf und weiter bis zum Dachboden. Aus einer der Holzkisten zog er den alten Seesack hervor, den ein Verwandter in den Jahren nach dem Krieg in Fürstenau zurückgelassen hatte.
Anna arbeitete im Garten, und mein Vater schaffte aus der Speisekammer ein Glas eingemachte Kirschen und eine Packung Zwieback auf den Dachboden. Im Laufe des Nachmittags füllte sich der Seesack. Mein Vater packte eine Wolldecke und einen Esbit-Kocher ein und auch sein Taschenmesser, nachdem er mit der längeren der beiden Klingen ein paar Münzen aus dem Sparschwein geangelt hatte, das im Schlafzimmer auf der Frisierkommode stand. Abends schlich er sich ein letztes Mal auf den Dachboden. Er trug den Seesack nach unten und warf ihn kurzerhand aus dem Fenster in den Garten, um ihn anschließend im Schutz der Dunkelheit zwischen den Ligustersträuchern am Bahndamm zu verbergen.
Am nächsten Morgen wurde er erst spät wach. Mittwochs musste er nicht zur Schule. Es gab zu wenige Lehrer in den Fünfzigerjahren, weil viele Männer im Krieg gefallen waren, und am Gymnasium war der Unterricht so lange zusammengestrichen worden, bis schließlich ein ganzer Tag für schulfrei erklärt worden war. Marianne hatte damals gerade angefangen, als Sekretärin in einer Eisenwarenhandlung in Rheine zu arbeiten. Sie verließ das Haus früh am Morgen, und als Anna in die Stadt gegangen war, um auf dem Markt und in Knockes Kolonialwarenladen Einkäufe zu erledigen, holte er sein Fahrrad aus der Garage. Er schob es aus der Einfahrt und sah sich vorsichtig nach allen Seiten um, bevor er den Seesack aus dem Gebüsch zog, ihn auf den Gepäckträger warf und den Bahndamm entlang hinaus in die Felder fuhr.
Mein Vater muss an jenem Mittwoch im Oktober rund hundert Kilometer mit seinem Fahrrad zurückgelegt haben. Die Ausläufer des Teutoburger Waldes hinter Osnabrück hatten ihn viel Kraft gekostet. Er war erschöpft, und mit der Müdigkeit kamen die Zweifel. Er war sich längst nicht mehr sicher, ob er die Nacht wirklich allein am Rande eines Feldes verbringen wollte, in eine Wolldecke gewickelt, den Kopf auf dem rauen Stoff des Seesacks. In einer kleinen Ortschaft hielt er an einem Gasthof. Er setzte sich an einen Tisch in der Ecke, kratzte seine letzten Pfennige zusammen und bestellte ein Glas Limonade. Es war Abend, mein Vaterwar zwölf Jahre alt, und der Wirt hatte ihn noch nie gesehen. Er musste nicht viele Fragen stellen, um herauszubekommen, dass der Junge, der in seiner Schankstube saß, von zu Hause weggelaufen war. Er griff zum Telefon, und eine Stunde später traf Marianne in Arnolds Borgward ein.
Das war das Ende des Abenteuers, zumindest in der ersten Version dieser Geschichte. Später, nachdem mein Vater mir von Józef erzählt hatte, bekam die Geschichte einen neuen Schluss. Als Marianne in Fürstenau in der Küche den Seesack auspackte, fand sie darin nicht nur Kleidungsstücke, den Campingkocher, ein leeres Kompottglas und eine angebrochene Packung Zwieback, sondern auch einen Schulatlas. Auf der Karte, die den nördlichen Teil Deutschlands zeigte, hatte mein Vater mit einem Bleistift die Route eingetragen, die er in den nächsten Tagen und Wochen mit dem Fahrrad hatte zurücklegen wollen.
Der schmale, graue Strich führte über Osnabrück, Hannover und Berlin und von dort aus immer weiter nach Osten. Mein Vater hatte im Oktober 1958 nicht einfach nur von zu Hause weglaufen wollen. Er hatte ein ganz konkretes Ziel gehabt: Er war auf dem Weg nach Polen gewesen.
Ich hatte mir gewünscht, dass es eine einfache Geschichte werden würde. Eine junge Frau lernt kurz nach dem Krieg einen polnischen Soldaten kennen. Für beide ist es die erste große Liebe. Sie bekommen ein Kind, doch dann kehrt der Soldat zurück in sein Heimatland. Der Frau bricht es das Herz, sie verliert nie wieder ein Wort über den Mann, und für den Sohn bleibt der Vater für immer ein Geheimnis. Doch die Geschichte von meinem Vater und meinem polnischen Großvater ließ sich nicht in wenigen, überschaubaren Sätzen zusammenfassen.
1953, mit sechs Jahren, sollte mein Vater zu Ostern eingeschult werden. Die Volksschule lag nicht weit vom Haus seiner Großeltern entfernt an der Bahnhofstraße, auf der anderen Seite der Gleise. Das große Gebäude mit den spitzen Giebeln beherbergte gleich zwei Schulen, eine evangelische Volksschule im rechten Flügel und eine katholische im linken; eine Mauer teilte den Schulhof. Marianne war evangelisch, genau wie ihre Eltern, und mein Vater würde eine Klasse im rechten Flügel des Schulgebäudes besuchen. Es gab nur ein Problem. Er war noch nicht getauft.
Die Zeremonie fand zu Hause statt. An einem grauen Nachmittag im Januar traf der Pastor ein, und die Familie versammelte sich im Herrenzimmer, hinter zugezogenen Gardinen. Auch Großonkel Rudolf war da, der mittlerweile eine Wohnung in der Nähe seiner Polsterwerkstatt bezogen hatte. Es war eine seltsame Stimmung, was nicht nur daran lag, dass Rudolf und Anna sich nicht leiden konnten. Alles ging sehr schnell, ohne viele Worte. Der Pastor sprach das Glaubensbekenntnis, sprengte Wasser über den Kopf meines Vaters, und anschließend gab es eine Tasse Kaffee.
Mein Vater spürte, dass etwas nicht in Ordnung war, doch niemand erklärte ihm den Grund dafür, dass er mitten in der Woche in aller Stille zu Hause getauft wurde und nicht am Sonntagmorgen in der Kirche. Dass es dabei um den Vater ging, den er nicht hatte, begann er erst zu ahnen, als er wenige Wochen später in die Schule kam.
Viele Kinder wuchsen damals ohne Vater auf. Die jüngeren von ihnen waren auf einem der letzten Fronturlaube gezeugt worden, bevor der Krieg in seine letzte Phase getreten war und noch einmal unzählige Soldaten gefallen waren. Doch mein Vater war nach dem Krieg geboren worden, im August 1946, und als er im Frühjahr 1953 in die Schule kam, war er das einzige Kind in seiner Klasse, das auf die Frage des Lehrers nach Namen und Beruf des Vaters keine Antwort geben konnte.
Das Feld in der rechten Spalte des Klassenbuchs blieb leer. Erklärungen gab es keine. Dafür sei sie zuständig, sagte Marianne, wenn sie auf einer Behörde oder bei einem Arztbesuch nach dem Vater ihres Kindes gefragt wurde, in einem Tonfall, der keine Nachfragen zuließ. Mein Vater begriff früh, dass es einen Bereich im Leben seiner Mutter gab, an den er besser nicht rührte.
Er bemerkte auch, dass über ihn geredet wurde. Die Gesellen tuschelten, wenn er nach der Schule in der Werkstatt saß und mit seinem Taschenmesser aus einem Stück Holz eine Pistole schnitzte, und das Gespräch brach ab, wenn er zu ihnen hinübersah. Nachbarn wechselten Blicke, wenn er sich mit einem Fußball unter dem Arm an ihnen vorbei in Richtung Sportplatz auf den Weg machte, ältere Schüler ließen in der Pause anzügliche Bemerkungen fallen, die er nicht verstand.
Mein Vater besuchte noch immer die Volksschule, als er sich an einem Samstagnachmittag durch den Liguster am Bahndamm zwängte, mit zwanzig Pfennig in der Tasche, die er von Arnold bekommen hatte, um sich Limonade zu kaufen. Er betrat die Bahnhofsgaststätte. In einer Ecke des dunklen Schankraums fiel eine Bemerkung, und die Wirtin brachte die Männer, die dort beim Bier saßen, mit einer erschrockenen Geste zum Schweigen. An diesem Tag hatte mein Vater zum ersten Mal das Wort »Polenkind« gehört, das ihn von nun an begleiten sollte und das ihn schließlich, als er dessen volle Bedeutung begriffen hatte, dazu brachte, sich mit dem Fahrrad auf die Suche nach seinem Vater zu machen.
Eines hatte er gleich verstanden. Ihm haftete ein Makel an. Es gab ein dunkles, unaussprechliches Geheimnis, das seine Herkunft betraf, und das Gefühl der Scham, das ihn seitdem begleitete, verschloss ihm den Mund.
Mein Vater fragte weder seine Mutter noch seine Großeltern, was es mit seinem Vater auf sich habe, und auch als er mir später von ihm erzählte, geschah das nur unter dem Siegel der Verschwiegenheit. An jenem Sonntagabend nach dem Besuch bei meinen Großeltern hatte er mir eingeschärft, die Geschichte von JózefKoźlikfür mich zu behalten. Ich sollte mit niemandem darüber sprechen, vor allem nicht mit meiner Großmutter. Damit war der Bund zwischen uns endgültig besiegelt. Wir teilten ein Geheimnis, das sich wie eine schützende Mauer um die Welt legte, in der wir beide zu Hause waren.
Als Kind interessierte mein Vater sich für alles, was mit dem Militär zu tun hatte. Arnold erzählte oft von seiner Zeit in Russland, wenn er mit anderen Männern zusammensaß, die ebenfalls im Krieg gewesen waren, und mein Vater hockte dann auf den Treppenstufen, die von der Halle hinunter in die Küche führten, und spitzte die Ohren.
Er las die Groschenhefte mit den Landser-Geschichten, die in der Schule während der Pause getauscht wurden, er verfolgte in den Illustrierten seiner Mutter die Vorabdrucke der Romane, die in Stalingrad spielten, und mit einem aus einem Stück Draht gebogenen Dietrich verschaffte er sich heimlich Zugang zu dem verschlossenen Schrank auf dem Dachboden, der vollgestopft war mit Büchern aus den ersten Jahren des Krieges, mit reißerischen Berichten über die ersten, siegreichen Feldzüge der Wehrmacht.