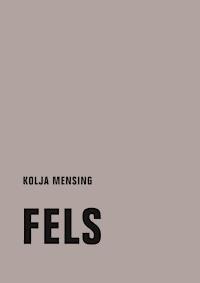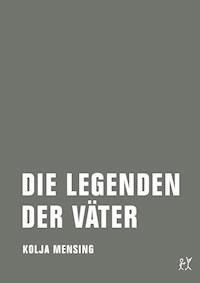Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
FELS lesen...
Impressum und Copyright
Über dieses Buch
Am Freitag wird er in die Heil- und Pflegeanstalt verlegt. Es ist ein kühler Frühlingstag, und im Krankenhaus haben sie ihm seinen zerschlissenen Wintermantel über die Schultern gelegt. Als einer der Wärter, ein stämmiger Mann in Kittel und Schürze, ihm beim Aussteigen aus dem Krankenwagen helfen will, beginnt der Patient sich zu wehren. Wortlos schlägt er um sich, der Mantel fällt zu Boden.
Ein zweiter Wärter kommt dazu. Die beiden Männer greifen dem Patienten unter die Arme und schleppen ihn über das Kopfsteinpflaster im Innenhof des ehemaligen Klostergebäudes. Im Treppenhaus versucht er sich zu befreien und klammert sich mit aller Kraft an die Messinghandläufe und die hölzernen Sprossen des Geländers. Im ersten Stock befindet sich die Männerstation. Mit einem abgewetzten Ledergurt fixieren sie ihn auf einem Bett im hinteren Teil des großen Schlafsaals. Die Wunde hat wieder zu bluten begonnen, und auf dem Kopfverband zeichnen sich rote Flecken ab.
Der Stationsarzt legt eine Krankenakte mit der Aufnahmenummer 5463 an: Albert Fels, geboren am 27. Februar 1870 in Wenzen, Kreis Gandersheim. Als das Mittagessen gebracht wird, lösen die Wärter den Gurt. Der Patient sieht den Teller mit der dünnen Suppe nicht einmal an. Den Rest des Tages dämmert er auf dem Bett vor sich hin. Auch das Abendessen, zwei Scheiben Brot, Margarine, ein Apfel, rührt er nicht an.
Nachts schreckt er immer wieder auf, schreit, dann schläft er weiter. Am nächsten Morgen wird der Verband abgenommen, und der Arzt, der bereits am Tag zuvor an seinem Bett war, wirft einen prüfenden Blick auf die Kopfverletzung. Er greift zum Stethoskop und hört Herz und Lunge ab, dann schiebt er das Nachthemd des Patienten hoch und schüttelt den Kopf, als er den unbehandelten Leistenbruch entdeckt, einen voluminösen Hautsack, der bis zur Mitte des Oberschenkels reicht.
Der Verband wird gewechselt, und der Arzt trägt die Ergebnisse der Untersuchung auf dem Krankenblatt ein. Anschließend legt er die Sippentafel an und die Karteikarte für die erbbiologische Erfassung. Die Felder mit den Angaben zu den Eltern und Großeltern bleiben frei, Fragen beantwortet der Patient nicht. Mit leerem Blick starrt er die weiß gekalkte Wand des Krankensaals an, auf der sich die Umrisse der schweren Steine abzeichnen, aus denen das Krankenhaus, einst ein Kloster, errichtet worden ist.
Gerade erst war der kleine Supermarkt im Dorf geschlossen worden. Milch, Käse und Butter verkaufte jetzt der Raiffeisenmarkt, der im Güterschuppen des ehemaligen Kleinbahnhofs untergebracht war, und zweimal in der Woche hielt ein Bäckerauto an der Straße. Meine Großmutter war weit über achtzig und lebte seit dem Tod meines Großvaters allein in dem großen Haus.
An den Wochenenden rief ich sie an und erzählte ihr vom Alltag mit meiner Familie. Ich schilderte kleine Erlebnisse mit meinem Sohn auf dem Spielplatz oder im Kindergarten, erwähnte neue Wörter, die er gelernt hatte, zählte seine wechselnden Lieblingsgerichte auf und klagte über Kinderkrankheiten und schlaflose Nächte. Meine Großmutter berichtete von Beerdigungen, bei denen sie oft der älteste Gast in der Trauergemeinde war, von Arztbesuchen, von dem neuen Hörgerät, das sich nicht einstellen ließ, und von den Pflegerinnen der Sozialstation, die morgens und abends zu ihr nach Hause kamen, ihr halfen, die Kompressionsstrümpfe anzuziehen und wieder auszuziehen, und die ihr im Badezimmer beim Waschen zur Hand gingen.
Viel erlebten wir beide nicht. Früher oder später tauchten wir darum in die Vergangenheit ab, in die Zeit, in der meine Großmutter ein Mädchen und eine junge Frau gewesen war. Sie hatte immer gern von früher erzählt, am liebsten über die Zeit, in der sie meinen Großvater kennengelernt hatte, und die Geschichte, die ich am häufigsten von ihr gehört hatte, war die von der heimlichen Verlobung mitten im Krieg.
Meine Großmutter war damals siebzehn Jahre alt und verrichtete ihren Arbeitsdienst in Altkloster, einer polnischen Kleinstadt nicht weit von Posen, die vor dem Krieg Kaszczor hieß und jetzt im Warthegau lag.
Die polnischen Bewohner waren verjagt worden. Stattdessen kamen deutsche Siedler, unter ihnen ein Bäcker, der mit seiner Familie gerade erst aus Schlesien nach Altkloster übergesiedelt war und bei dem meine Großmutter im Haushalt half. Gemeinsam mit rund zwanzig anderen jungen Frauen, darunter Lola, mit der sie sich angefreundet hatte, war sie seit dem Sommer 1943 in einem Sammellager des Reichsarbeitsdienstes untergebracht, in Holzbaracken, die auf einer Wiese vor der Stadt standen.
Mein Großvater Rudolf, alle sagten Rudi, war ein paar Jahre älter als sie und Feldwebel einer Ausbildungskompanie an der Infanterieschule für Fahnenjunker in Potsdam. Nach dem Krieg wollten meine Großmutter und er heiraten. Die Verlobung war für den März kommenden Jahres angesetzt worden. Die Ringe hatte die Mutter meiner Großmutter in Auftrag gegeben, bei einem Uhrmacher und Juwelier in Berlin, der aus ihrem Dorf stammte. Er wurde mit einem Kilo Speck bezahlt, und mein Großvater hatte die Ringe bereits abgeholt. Als er am ersten Adventswochenende von Potsdam aus für einen Tag mit der Bahn nach Altkloster fuhr, brachte er sie mit. Meine Großmutter hatte ihn darum gebeten, denn sie hatte eigene Pläne. Ihre Verlobung sollte etwas Besonderes sein, ein romantisches Ereignis, an das sie ihr Leben lang zurückdenken würde, und kurz bevor Rudi und sie sich am Bahnhof in Altkloster verabschiedeten, sprach sie mit ihm noch einmal alles durch.
Am Heiligabend verließ meine Großmutter nach dem Abendessen gemeinsam mit Lola in aller Stille das Lager und setzte sich mit ihr an das Ufer des kleinen Sees, der ganz in der Nähe der Baracken lag. Die beiden jungen Frauen holten eine Flasche Eierlikör hervor, füllten zwei Zahnputzbecher, und dann war es soweit. Nach einem kurzen Blick auf ihre Armbanduhr, sie musste ein Streichholz dafür entzünden, steckte meine Großmutter sich den goldenen Ring an, den sie seit drei Wochen in einem Seitenfach ihres Portemonnaies verwahrt hatte, und stellte sich vor, dass Rudi in Potsdam genau in diesem Moment das Gleiche machte. Lola und sie stießen mit den Zahnputzbechern an, dann wickelten sie sich in die schweren, grauen Wolldecken, die sie aus ihrer Baracke mitgebracht hatten, lehnten sich zurück und sahen in den sternklaren Nachthimmel.
Das ist die Geschichte von der heimlichen Verlobung. In meiner Familie wird sie bis heute gern erzählt. Sogar der Pastor erwähnte sie bei der Beerdigung meiner Großmutter in seiner Ansprache in der Kirche, und es gab niemanden in der Trauergemeinde, der nicht wusste, um was es ging. Über die offizielle Verlobung meiner Großeltern, im Kreis von Tanten und Cousinen, mit Kaffee und Kuchen und belegten Broten, sprach auch jetzt niemand. Die andere Geschichte war einfach besser. Sie war fast so gut wie die Geschichte von der Postkarte, die mein Großvater drei Jahre zuvor in Frankreich gefunden hatte.
Vor fünf Jahren kam meine Großmutter überraschend ins Krankenhaus. Sie hatte sich bei der Gartenarbeit am Zweig eines Rosenbusches verletzt. Es war nur eine kleine Wunde am Oberschenkel, aber sie wollte sich nicht schließen, und meine Großmutter musste über Wochen hinweg stationär behandelt werden. Das Liegen machte sie müde, sie war zu unkonzentriert, um zu lesen, und die Behandlung der offenen Stelle am Bein, bei der alle paar Tage eine neue Schicht entzündeten Gewebes abgetragen wurde, war schmerzhaft.
Woche um Woche verlängerte sich ihr Aufenthalt im Krankenhaus, und wenn wir nach der Visite telefonierten, war meine Großmutter jedes Mal bitter enttäuscht darüber, dass die Ärzte ihr keine Aussichten auf eine schnelle Entlassung machten. Sie klagte über das Essen und ihre Zimmernachbarin, die den ganzen Tag den Fernseher laufen ließ, und ihre Stimme klang bei jedem Anruf dünner und zerbrechlicher. Ich wollte meine Großmutter von der Tristesse im Krankenhaus ablenken, also bat ich sie, mir noch einmal zu erzählen, wie sie und mein Großvater sich kennengelernt hatten.
Diese Geschichte begann im November 1939, an einem grauen Montagmorgen, mit dichtem Nebel über den Äckern und Weiden links und rechts der Kleinbahnschienen. Meine Großmutter war damals dreizehn Jahre alt und fuhr jeden Morgen mit der Bahn in die Stadt. Sie besuchte die Höhere Mädchenschule, und an jenem Montag im November, knapp drei Monate nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Polen, brachte ihre Klassenlehrerin eine Liste mit Namen und Feldpostnummern von Soldaten mit, die sich, sagte die Lehrerin, über Post freuen würden. Also schickte meine Großmutter den ganzen Herbst und Winter über Briefe an einen fremden Mann, einen Gefreiten, der mit Nachnamen Rademacher hieß. Sie schrieb über die Schule und ihre Freundinnen und über den Kolonialwarenladen ihrer Eltern, in dem es Lebensmittel gab, Drogeriebedarf, aber auch Schürzenstoff, Manchester-Hosen und Strickjacken. Es war ein Laden für einfache Leute, hier kauften die Handwerker, die Knechte, Mägde und Lohnarbeiter, die im Dorf wohnten.
Der Soldat antwortete. Den Krieg erwähnte er nicht, meine Großmutter wusste nicht einmal, wo er stationiert war. Stattdessen schrieb er von dem Leben, das er vor der Einberufung in die Wehrmacht geführt hatte, mit seiner Frau und vier Kindern, die in einer kleinen Wohnung in einer Stadt im Südwesten Deutschlands auf seine Rückkehr warteten. Am dritten Advent packte meine Großmutter ihm ein Feldpostpäckchen mit geräucherter Wurst, einer Tafel Schokolade, einem Stofftaschentuch mit gesticktem Initial, warmen Socken, Größe vierundvierzig, und einer braunen Papiertüte mit Kaffee. Das meiste davon stammte aus dem Sortiment des Ladens ihrer Eltern, auch der kleine Tannenbaum, ein hölzerner Christbaum, der aus einzelnen, grün lackierten Sperrholzteilen zusammengesetzt werden konnte.
Ein halbes Jahr lang wechselten meine Großmutter und der Gefreite Rademacher Briefe. Im Mai 1940 griff Deutschland dann Frankreich an, und ein Teil der Truppen, die in Polen stationiert waren, wurde nach Westen verlegt. Pfingsten schrieb meine Großmutter eine Postkarte mit kurzen Grüßen, und jetzt passierte es.
Zwei Wochen nachdem sie die Karte abgeschickt hatte, bekam sie Post von einem anderen Soldaten. Er hieß Rudolf und unterschrieb mit »Rudi«. Er war mit der Nachhut nach Frankreich gekommen, und seine Einheit war durch Autrécourt-sur-Aire gezogen, eine Stadt nicht weit von der belgischen Grenze. Dort hatte die Wehrmacht in den Räumen einer Spinnerei für kurze Zeit ein Feldlazarett eingerichtet. Die Verwundeten waren längst zurück nach Deutschland geschafft worden, das Lazarett war nicht mehr in Benutzung, und als Rudis Kompanie in den Räumen der Spinnerei ihr Lager aufschlug, fand er auf dem Fußboden den Pfingstgruß meiner Großmutter. Ein paar Tage später schrieb er an die Adresse, die als Absender angegeben war. Meine Großmutter antwortete, und bald tauschten die beiden in schneller Folge Briefe. Von dem Gefreiten Rademacher, an seinen Vornamen konnte meine Großmutter sich nicht erinnern, hörte sie nie wieder.
Das war der Anfang. Mit der Feldpostkarte, die Rudi im Frühjahr 1940 in einem aufgelassenen Lazarett in Frankreich fand, begann die Liebesgeschichte, die meine Großmutter mir jetzt, während sie im Krankenhaus lag, noch einmal ausführlich erzählte. Wir sprachen jeden Tag am Telefon, und endlich heilte auch die Wunde an ihrem Oberschenkel.
Zu Hause erholte meine Großmutter sich schnell. Wir fanden zu unserem alten Rhythmus zurück und telefonierten nur noch an den Wochenenden, aber wir unterhielten uns weiter über die Vergangenheit, über die Jahre, die zwischen dem Fund der Postkarte und der heimlichen Verlobung im Winter 1943 lagen. Und eines Tages erwähnte meine Großmutter dann Albert Fels.
Ich war meiner Großmutter immer nah gewesen. Als ich ein Kind war, wohnten wir eine Stunde Autofahrt von ihrem Dorf entfernt, in einer Siedlung am Rand des Moors, und weil meine Eltern beide berufstätig waren, half meine Großmutter im Haushalt. Mein Großvater reiste als Vertreter und war die Woche über unterwegs. Meine Großmutter war Hausfrau. Sie war noch jung, als ich auf die Welt kam, gerade vierundvierzig Jahre alt, und sie kam jeden Donnerstag zu uns, um Wäsche zu waschen, zu bügeln, zu putzen und zu kochen. Manchmal nahm sie mich abends mit zu sich. Ich blieb über das Wochenende, und oft war ich auch in den Ferien bei ihr zu Besuch, während meine Eltern allein in den Urlaub fuhren.
Im Sommer gingen wir gleich nach dem Frühstück in den Garten. Das Dorf lag an einem Fluss, und am frühen Morgen, wenn die feine, blasse Erde noch feucht war, hing ein Hauch von Kalkgeruch in der Luft. Meine Großmutter zupfte Unkraut und harkte die Beete zwischen den Rosenbüschen, während ich mit dem alten Tretroller die Einfahrt hinunterfuhr und dann weiter über den schmalen, gepflasterten Weg, der durch den Garten führte, zwischen dem Tulpenbaum und dem Schuppen hindurch, am Hühnerstall, an der Waschküche und am ehemaligen Schweinestall entlang, in dem jetzt die Gartengeräte aufbewahrt wurden, bis zu den Himbeersträuchern. Im hinteren Teil des Gartens standen ein Apfelbaum und ein Mirabellenbaum, und davor lag der Nutzgarten, in dem meine Großmutter Gemüse anbaute, Kartoffeln, Schwarzwurzeln, Salat und Petersilie. Das Kühlhaus der Schlachterei, die dem Vetter meiner Großmutter gehörte, schloss den Garten ab, und wenn ich mit meiner Großmutter nach den Gemüsebeeten sah, in der Hand den alten Drahtkorb, in den wir die Mohrrüben für das Mittagessen legten, konnte ich das sanfte Brummen der Aggregate hören.
Bei der Gartenarbeit erzählte meine Großmutter von früher. Das älteste Gebäude auf dem Grundstück war der Schweinestall. Er stammte aus dem neunzehnten Jahrhundert, die Wände bestanden aus verwitterten Ziegelsteinen, und an der Rückseite des Stalls konnte man noch die Umrisse der Öffnung erkennen, durch die die Tiere in das Schweinehock gelangten. Später war die Waschküche dazugekommen, in der noch ein alter Herd mit einem großen Topf stand. Meine Großmutter hatte natürlich längst eine Waschmaschine, die im Haus im Badezimmer stand, aber sie sammelte die Schmutzwäsche weiter in der Waschküche. Das war umständlich, doch meine Großmutter machte die Dinge gern so, wie sie immer gemacht worden waren, und erst einige Jahre vor ihrem Tod, als sie begann, einen Rollator zu benutzen, hörte sie auf, die Wäsche durch den Garten zu tragen.
Die Wirtschaftsgebäude begrenzten den Garten auf der Seite zum Fluss hin. Auf der Straßenseite stand das Haus, in dem meine Großmutter geboren worden war und in dem sie ihr ganzes Leben verbringen sollte. Ihr Elternhaus war immer wieder umgebaut worden, aber es gab ein altes Foto, auf dem die Fachwerkfassade noch zu erkennen war. Küche und Wohnzimmer lagen im hinteren Teil, mit kleinen Fenstern zum Garten hinaus, die Schlafzimmer waren im Obergeschoss, und die Ladenräume öffneten sich zur Straßenseite, mit einem kleinen Schaufenster, das der Vater meiner Großmutter zu Ostern und in der Adventszeit festlich dekorierte.
Vor dem Zweiten Weltkrieg wohnte in dem kleineren Haus nebenan ihr Onkel mit seiner Familie. Er hieß Hermann Dilly und war Schlachter und Viehhändler. Sein Haus, alle sagten »das Nebenhaus«, war etwas niedriger, und die Wohnung im Erdgeschoss bestand nur aus einer Küche, dem Wohnzimmer und zwei Schlafzimmern, eins für die Eltern, eins für die drei Kinder. Außerdem gab es auch hier einen kleinen Ladenraum, das sogenannte Lädchen, in dem Hermann Dilly Fleisch und Wurstwaren aus eigener Herstellung verkaufte, Räucherspeck und Schinken, Mettwürste, Leberwurst.
Zu dem Nebenhaus gehörte auch eine Diele mit einem Boden aus gestampftem Lehm. Ein großes, über zwei Meter hohes Tor führte aus der Diele auf einen kleinen Platz, der gerade so groß war, dass der Pferdewagen dort halten und wenden konnten, mit dem Schweinehälften und Rinderviertel in die Fleischfabrik transportiert wurden. Von dem Platz vor der Diele aus blickte man über einen kleinen Gemüsegarten hinweg auf den Kleinbahnhof mit dem Güterschuppen. Es waren nur ein paar Schritte bis zum Schlachthaus und zur alten Scheune, in der die Felle nach dem Schlachten getrocknet und gelagert wurden, und hier, vor der Scheune, stand die Bank, auf der Albert Fels nachmittags gern in der Sonne saß.
Ein paar Tage nachdem meine Großmutter aus dem Krankenhaus entlassen worden war, erwähnte sie seinen Namen zum ersten Mal. Albert Fels, erklärte sie mir, hatte bereits als Knecht für ihren Großvater gearbeitet, den alten Dilly. Anfang der Dreißigerjahre war er ein älterer Mann, der nur noch gelegentlich in der Schlachterei aushalf und bei der Familie ihres Onkels seinen Lebensabend verbrachte.
Fels schlief in einer Kammer auf der Diele, genau wie die Magd und der andere, jüngere Knecht, und nachmittags, wenn er auf der Bank vor der Scheune saß, sah er meiner Großmutter und ihren Cousinen beim Spielen im Garten zu. Wenn die Mädchen sich stritten, schüttelte er nur den Kopf und lächelte. Na, na, na, sagte er dann, in einem leicht abgehackten Tonfall, den meine Großmutter am Telefon nachmachte, ansonsten sprach er wenig.