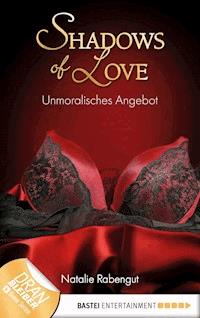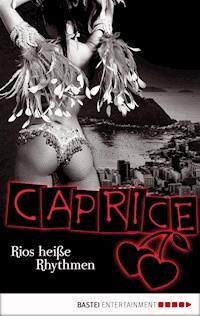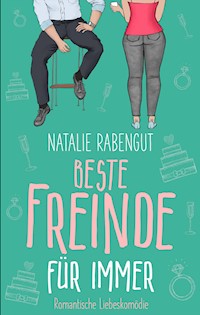Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Black Umbrella Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Hippert-Schwestern
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ich bin verflucht. Anders kann ich mir nicht erklären, dass sämtliche meiner Ex-Freundinnen unmittelbar nach mir ihren Traummann gefunden und geheiratet haben. Dabei würde ich selbst gern eine Familie gründen, aber leider eilt mir mein Ruf inzwischen voraus: wer mit mir zusammen ist, wird heiraten – nur eben nicht mich. Ich bin zu einem sehr begehrten Zwischenschritt auf dem Weg zum Liebes- und Lebensziel anderer Menschen geworden. Wie soll ich unter diesen Voraussetzungen jemals die Eine finden? Ich weiß nur, dass meine Traumfrau das exakte Gegenteil von Sarah Hippert ist. Am liebsten würde ich ihre Existenz nicht einmal zur Kenntnis nehmen, doch zum einen muss ich mit ihr arbeiten, und zum anderen macht sie kein Geheimnis daraus, dass sie mit mir ins Bett will. Bloß für eine Nacht, sagt sie. Ich will aber keine Affäre, sondern eine Ehefrau, und diese Ehefrau ist garantiert nicht Sarah, die findet, dass die Ehe eine Institution ist, die der Teufel persönlich erfunden hat. Außerdem weiß ich genau, dass sie die ganze Sache plötzlich auf magische Weise anders sehen wird, falls ich nachgebe – und noch einmal stecke ich es nicht weg, schon wieder nicht der Bräutigam zu sein. Selbst, wenn es ausgerechnet Sarah Hippert ist, die da heiratet. Also werde ich stark bleiben. Egal, wie penetrant Sarah ihr Ziel verfolgt, mich ins Bett zu bekommen. So unerträglich, wie ich sie finde, kann das doch nicht so schwer sein … Liebesroman. In sich abgeschlossen. Gefühlvolle Handlung. Ein Schuss Humor. Explizite Szenen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIE NEIN-NUMMER
DIE HIPPERT-SCHWESTERN
BUCH 2
NATALIE RABENGUT
ROMANTISCHE LIEBESKOMÖDIE
Copyright: Natalie Rabengut, 2023, Deutschland.
Korrektorat: http://www.swkorrekturen.eu
Covergestaltung: Natalie Rabengut
ISBN: 978-3-910412-23-1
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung ist nachdrücklich nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin gestattet.
Sämtliche Personen in diesem Text sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig.
www.blackumbrellapublishing.com
INHALT
Die Nein-Nummer
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Über Natalie Rabengut
DIE NEIN-NUMMER
Ich bin verflucht. Anders kann ich mir nicht erklären, dass sämtliche meiner Ex-Freundinnen unmittelbar nach mir ihren Traummann gefunden und geheiratet haben.
Dabei würde ich selbst gern eine Familie gründen, aber leider eilt mir mein Ruf inzwischen voraus: Wer mit mir zusammen ist, wird heiraten – nur eben nicht mich. Ich bin zu einem sehr begehrten Zwischenschritt auf dem Weg zum Liebes- und Lebensziel anderer Menschen geworden. Wie soll ich unter diesen Voraussetzungen jemals die Eine finden?
Ich weiß nur, dass meine Traumfrau das exakte Gegenteil von Sarah Hippert ist. Am liebsten würde ich ihre Existenz nicht einmal zur Kenntnis nehmen, doch zum einen muss ich mit ihr arbeiten, und zum anderen macht sie kein Geheimnis daraus, dass sie mit mir ins Bett will. Bloß für eine Nacht, sagt sie. Ich will aber keine Affäre, sondern eine Ehefrau, und diese Ehefrau ist garantiert nicht Sarah, die findet, dass die Ehe eine Institution ist, die der Teufel persönlich erfunden hat.
Außerdem weiß ich genau, dass sie die ganze Sache plötzlich auf magische Weise anders sehen wird, falls ich nachgebe – und schon wieder nicht der Bräutigam zu sein, stecke ich nicht noch einmal weg. Selbst wenn es Sarah Hippert ist, die da heiratet.
Also werde ich stark bleiben. Egal, wie penetrant Sarah ihr Ziel verfolgt, mich ins Bett zu bekommen. So unerträglich, wie ich sie finde, kann das doch nicht so schwer sein …
Romantische Liebeskomödie. In sich abgeschlossen. Gefühlvolle Handlung. Ein Schuss Humor. Explizite Szenen.
1
SARAH
Ich hörte das sanfte Trällern, das sich trotzdem wie ein heißer Nagel in meine Stirn bohrte. Mit einem Schnaufen wälzte ich mich herum, ließ den Arm auf den Boden hängen und tastete nach meinem Handy, das zweifellos für das Geräusch verantwortlich war.
Statt Laminat ertastete ich …
Ich zog die Finger zurück, öffnete ein Auge und begutachtete den Teppichboden, der genauso merkwürdig klebrig aussah, wie er sich anfühlte.
Okay, ich war definitiv nicht zu Hause.
Das Trällern hielt an, weshalb ich näher zur Bettkante robbte und den Kopf hängen ließ. Unter meiner schwarzen Stoffhose fand ich den Übeltäter.
Es dauerte einen Moment, bis ich die winzige Uhrzeit oben rechts in der Ecke erkennen konnte. 9:15 Uhr – ich war definitiv nicht zu spät zur Arbeit dran, wenn ich der Anzeige glauben durfte und heute in der Tat Mittwoch war.
Warum rief meine Geschäftspartnerin Fee also an? Sie wusste doch, wie ungern ich früh aufstand. Wobei meine jüngere Schwester Marie vermutlich gerade mit den Augen rollte, weil ich nach neun als »früh« bezeichnete.
»Was gibt’s?«, krächzte ich in den Hörer und räusperte mich.
Fee keuchte mir erst einmal schmerzerfüllt ins Ohr, und bevor sie überhaupt etwas sagen konnte, hörte ich ihren Mann. »Schatz«, flehte er. »Schatz, bitte, können wir nicht jetzt zum Krankenhaus fahren?«
Christopher klang, als wäre er der Hysterie nah, während Fee ein schmerzerfülltes Knurren hören ließ.
»Sarah«, presste sie zwischen den Zähnen hervor. »Die Wehen haben eingesetzt.«
Ich richtete mich ruckartig im Bett auf, bereute es allerdings im nächsten Moment, als mein Gehirn versuchte, sich selbst durch meine Schädeldecke nach draußen zu katapultieren. »Du musst ins Krankenhaus. Hör auf Christopher«, verlangte ich.
»Einen Scheiß muss ich. Bevor du mir nicht versprichst, dich um die Geschäfte zu kümmern, gehe ich … Oooooh …«
Ich musste das Handy von meinem Ohr weghalten, weil Fee einen markerschütternden Schrei von sich gab.
»Gehe ich nicht ins Krankenhaus«, sprach sie weiter, als hätte nicht gerade eben ein Dämon von ihr Besitz ergriffen.
»Natürlich kümmere ich mich um die Geschäfte. Du erinnerst dich daran, dass mir die Hälfte von Fair(y)tale Snacks gehört, richtig?«
»Ich … aaaaaaah … ich kann sonst auch selbst noch zu dem Treffen mit …«, sie unterbrach sich selbst, um laut zu hecheln, »Leon Bohm gehen.«
Leon Bohm. Leon Bohm. Leon Bohm. Ich kramte in meinem Gedächtnis, tiefer und tiefer, bis ich es hatte. »Der Unternehmensberater, auf den du so scharf bist.«
»Bitte was?«, fragte Christopher empört im Hintergrund.
»In Bezug auf Fair(y)tale Snacks. War der nicht auf so einer Liste mit superwichtigen Business-Menschen?«, fragte ich.
Fee nuschelte etwas, aber es ging zwischen all den Schmerzenslauten unter. »10 Uhr, Café Sonnenschein, am Rosenplatz. Schaffst du das?«
»Sekunde.« Ich nahm mein Handy vom Ohr, warf den Ortungsdienst an und öffnete Google Maps. Es war 9:19 Uhr. »Ja«, behauptete ich enthusiastischer, als ich mich fühlte. Ich wusste so gerade eben, welcher Wochentag heute war, hatte keine Ahnung, wer da neben mir im Bett lag, und würde ein Wunder vollbringen müssen, um pünktlich im Café Sonnenschein zu sein, damit ich Leon Bohm zwischen Vollkornbrötchen und Cappuccino mit Hafermilch davon überzeugen konnte, dass er uns unter seine Fittiche nehmen wollte.
Mir war klar, dass ich es schaffen musste, weil Fee ihr Baby sonst im Café Sonnenschein bekommen würde, während sie Leon emotional damit erpresste, dass sie ihren Sohn nach ihm benennen würde, sollte er uns offiziell beraten.
»Ich mach’s.« Ich schwang das erste Bein aus dem Bett und erinnerte mich schlagartig an den klebrigen Teppich. Wow. Ich musste wirklich aufhören, mit Typen nach Hause zu gehen, die nicht mindestens eine Acht auf der Skala waren. »Ich bin praktisch schon auf dem Weg. Und du lässt dich jetzt ins Krankenhaus bringen.«
»Vorher schick ich dir noch die E-Mails, die ich mit Leon ausgetauscht habe.«
»Die kannst du auch von unterwegs schicken«, hielt ich dagegen. »Oder meinetwegen aus dem Kreißsaal.«
»Versprichst du mir, dass du nett zu ihm bist?«, nölte Fee, nachdem sie mir ein weiteres Mal schmerzerfüllt ins Ohr gekreischt hatte.
Klar, wollte ich sagen, ich war immer nett zu Turbo-Kapitalisten, aber ich wusste, dass jeder Witz jetzt vergebliche Liebesmühe war. Fee musste ins Krankenhaus. »Ich schwöre auf das Leben meines Lieblingsdealers.«
»Danke!« Sie klang ehrlich erleichtert. »Oh, und bevor ich es vergesse …«
Ihre Stimme verlor sich, weil Christopher ihr offenbar das Handy wegnahm. »Es reicht«, sagte er. »Bye, Sarah, du machst das schon.«
»Klar. Alles Gute euch.«
Ich war mir nicht sicher, ob er mich überhaupt noch gehört hatte, denn in der Leitung war es still.
Ich nahm einen tiefen Atemzug und stellte eine Liste mit Prioritäten zusammen. Zuerst würde ich mir mindestens die Zähne putzen müssen, denn wenn ich zu spät kam, was sehr wahrscheinlich war, wollte ich den armen Leon nicht noch mit meinem Todesatem traumatisieren. Dann musste ich irgendwie zum Café Sonnenschein kommen.
Mein Blick wanderte nach links zur anderen Bettseite.
»Hi«, sagte der Kerl mit einem verliebten Lächeln.
Er einigermaßen attraktiv, mit strahlend grün-blauen Augen und ein paar Sommersprossen auf dem Nasenrücken. Deshalb war ich mit ihm nach Hause gegangen. Ich erinnerte mich wieder. Seine Augen, das blonde Haar und der Hauch von Surfer-Charme hatten mich angesprochen, weil ich irgendwie urlaubsreif war.
Bei näherem Hinsehen wurde mir klar, dass ich mich beim Alter allerdings ziemlich verschätzt haben musste. Ich vermutete, dass er gute zehn Jahre jünger war als ich. Das erklärte allerdings seinen … äh … wiederholten Enthusiasmus.
»Hi.« Ich beäugte ihn und schaute dann auf mein Handy. Laut Google war das Café Sonnenschein mit dem Auto knapp zehn Minuten entfernt. Ich räusperte mich. »Hast du ein Auto?«
»Ja.« Er strahlte mich an und fuhr mit dem Zeigefinger ehrfürchtig die Rundung meiner Brust nach. »Du bist so hübsch.« Er rutschte näher zu mir, zog die Bettdecke weg und presste einen Kuss auf meinen Oberschenkel.
»Ich muss leider ziemlich dringend weg. Besteht die Chance, dass du mich fährst? Ist auch nicht weit.« Da ich vermutete, er könnte noch studieren, beschloss ich, mein Angebot ein wenig zu versüßen. »Ich gebe dir natürlich auch Geld fürs Benzin.«
»Kein Problem«, behauptete er.
Ich verstand ihn so gerade eben, weil er mit dem Gesicht zwischen meinen Schenkeln steckte. Etwas, das er auch gestern Nacht mit großem Eifer getan hatte – nur leider nicht besonders gut. Ich hatte versucht, ihn zu coachen, aber relativ schnell wieder aufgegeben. Deshalb presste ich meine Beine jetzt auch fest zusammen. »Das ist echt nett von dir«, hauchte ich und tätschelte seine Wange. »Wo war noch gleich das Bad?«
»Da raus, rechts und dann am Ende des Flurs.«
»Danke.« Ich schlüpfte aus dem Bett, suchte meine Sachen zusammen und eilte auf Zehenspitzen ins Bad.
Nachdem ich die Tür hinter mir geschlossen hatte, atmete ich laut aus. Ich musste wirklich mal einen Schritt kürzertreten. Der Sex war ja nett gewesen, aber immer dieses Drumherum. Ich seufzte.
Zuerst war ich so damit beschäftigt, mein Gesicht und meine Achseln zu waschen, bevor ich mich schnell anzog, dass mir der Charme des Badezimmers erst gar nicht auffiel.
Das musste die größte Sammlung Axe Bodyspray sein, die ich je gesehen hatte. Ich griff nach der erstbesten Dose. Axe Bodyspray Gold Caramel Billionaire Limited Edition inspiriert vom Magnum Eis des Jahres 2021.
Aber in der Dusche stand bloß eine Flasche 3-in-1-Duschgel für Gesicht, Haare und Körper. Auch fand ich weder ein Handtuch noch eine Zahnbürste. Ich schaute in den Schrank, hinter den Duschvorhang, selbst auf die Fensterbank. Axe, Kondome, Axe, Kopfschmerztabletten, Axe, Toilettenpapier, Axe, Duschgel, Axe, Axe, Axe, Axe.
Ich sollte wirklich aufhören, mit solchen Typen nach Hause zu gehen. Ab sofort würde ich darauf achten, dass sie mindestens … vielleicht vierzig waren? Auf der anderen Seite war es okay, wenn ein Mann Anfang zwanzig dachte, Axe Bodyspray würde ihn für Frauen unwiderstehlich machen, doch wäre das hier das Badezimmer eines Fünfundvierzigjährigen, würde ich sofort aus dem Fenster klettern. Ach was, klettern. Stürzen würde ich mich.
Keine Zahnbürste. Ich unterdrückte ein leises Würgen und dankte einem guten Dutzend Gottheiten für die Tatsache, dass Marie Hippert meine jüngere Schwester war. Ich wühlte durch meine Handtasche, bis ich das kleine Stofftäschchen fand, das Marie mir zum Geburtstag geschenkt hatte. Es war mit allem ausgestattet, was ich brauchte: Zahnbürste, Zahnpasta, einer Reiseapotheke, Kondome, Gleitmittel, Haarspray, ein kleines Nähset und eine Strumpfhose – wenn ich mit frischem Atem etwas für mein Gesicht brauchte, falls ich eine Bank überfallen wollte. Marie wusste nämlich, dass ich keine Strumpfhosen trug.
Ich putzte mir die Zähne, fuhr mir mit nassen Fingern durch die Haare, zupfte sie in Form, half mit dem Haarspray nach und hoffte, dass mein von gestern übrig gebliebenes Make-up nach »kaum geschminkt« und nicht nach »Guck mal, was die Katze im Gebüsch gefunden hat« aussah.
Als ich aus dem Bad kam, hatte ich noch gute zwanzig Minuten, um es pünktlich zu dem Frühstück mit Leon Bohm ins Café zu schaffen.
Meine Eroberung der letzten Nacht lungerte bereits im Flur herum und starrte mich begeistert an. »Du siehst so gut aus!«
»Danke.« Ich tastete nach meinem Haar. »Willst du auch noch ins Bad?«
»Nein, nein. Du hast gesagt, dass du es eilig hast, deshalb habe ich einfach schnell in die Küchenspüle gepinkelt. Ist nicht schlimm. Das mache ich öfter.«
Ich wollte mich an Ort und Stelle übergeben. Es war schon nahezu unmöglich, mir die Sache mit der Zahnbürste schönzureden, aber das?
»Clever«, sagte ich bloß und nickte. Wahrscheinlich war es besser, wenn ich zu Fuß ging.
In diesem Moment klimperte er mit dem Autoschlüssel und öffnete die Wohnungstür. »Ladys first.« Er zwinkerte mir übertrieben zu.
»Haha«, machte ich schwach und schob mich an ihm vorbei.
Leider überwogen die Vorteile, wenn ich mich von ihm fahren ließ. Ich würde unter Garantie pünktlich kommen, wäre nicht verschwitzt und konnte unterwegs Fees E-Mails wenigstens überfliegen.
Meinetwegen. Schlimmer als sein Bad konnte sein Auto gar nicht sein und danach würde ich ihn nie wiedersehen. Und ich musste meine Standards anheben.
Ich war zweiunddreißig – irgendwann sollte ich solchen One-Night-Stands wahrscheinlich abschwören.
Mein Maßstab war das Gesicht meiner Schwester – würde Marie pikiert gucken, aber versuchen, es zu verbergen, wenn ich ihr von meinem heutigen Morgen erzählte? Definitiv.
Also musste ich etwas ändern.
Zu meinem Erstaunen fuhr er keinen bis in die Unendlichkeit getunten Sportwagen, der innen komplett zugemüllt war, sondern einen alten Mercedes mit gehäkelter Spitzendecke auf der Hutablage.
Das erste Warnzeichen war, dass er mit ziemlich ungelenken Griffen den Rückspiegel einstellte, bevor er den Rückwärtsgang einlegte, wobei das Getriebe unter Protest kreischte.
Der Mercedes machte einen Satz nach hinten, mir flog beinahe das Handy aus der Hand und ich krallte mich am Armaturenbrett fest.
In nur sieben Zügen kurbelte er aus der Parklücke, wobei sein Gefühl für die Kupplung wirklich zu wünschen übrig ließ.
Als wir endlich auf der Straße waren, überfuhr er prompt ein Stoppschild und nahm einer alten Dame die Vorfahrt, die daraufhin wild hupte.
»Hey.« Ich bemühte mich, einen lockeren Tonfall anzuschlagen. »Weißt du was, da bekommt man eh so schlecht Parkplätze – fahr einfach rechts ran, ich steige aus und laufe den Rest des Weges.«
»Quatsch.« Seine Fingerknöchel traten weiß hervor, so fest umklammerte er das Lenkrad, während er wie ein Kind beim ersten Mal Autoscooter lenkte.
»Doch. Fahr bitte rechts ran.«
Der Wagen schlingerte und schoss dann nach vorn. »Wir sind praktisch schon da.«
»Bremse«, schrie ich, weil er auf die große Kreuzung zufuhr. »Bremse!«
Offenbar war ihm der Unterschied zwischen Bremse und Gas nicht geläufig, denn er beschleunigte, fuhr mitten auf die Kreuzung und erwischte einen schwarzen BMW am Kotflügel.
2
LEON
Ich wusste schon Bescheid, als ich den Briefumschlag mit der Prägung sah, den ich zusammen mit drei Werbeprospekten aus dem Briefkasten holte. Das naturweiße strukturierte Mattpapier und die Goldfolie ließen eigentlich nur einen Schluss zu.
Ein scharfer Schmerz fuhr durch meinen Unterkiefer, weil ich die Zähne zu fest aufeinanderpresste. Ich hatte meine Schiene nicht wie sonst über Nacht getragen und offensichtlich eifrig mit den Zähnen geknirscht.
Als ich wieder oben in meiner Wohnung war, legte ich den Umschlag auf den Tisch und betrachtete ihn, als würde sich dahinter eine heimtückische Falle verbergen.
Ich trank den letzten Schluck Kaffee aus und griff nach dem Briefumschlag. Linus hatte offenbar tief in die Tasche gegriffen, um Kris glücklich zu machen, denn die Einladungskarten mit den abgerundeten Ecken auf dem 350 Gramm schweren Mattpapier mit dem Laserdruck und der Goldveredlung waren nicht gerade günstig.
Kris hatte eine handgeschriebene Notiz dazugelegt, dass sie sich sehr freuen würde, wenn ich zu der Hochzeit – ausgerechnet in der Pfalz – kommen würde. Immerhin hatte ich ihr Linus, ihren absoluten Traummann, vorgestellt. Dabei ließ sie dezent unter den Tisch fallen, dass sie zu dem Zeitpunkt noch mit mir zusammen gewesen war. Ich hätte ihr meinen Kumpel ganz sicher nicht vorgestellt, wenn ich gewusst hätte, dass sie ihn nur zehn Monate später heiraten würde. In der Pfalz.
Obwohl ich wusste, dass ich lernen musste, besser mit meinen Emotionen umzugehen, riss ich das kleine Holzherz ab, das mitten auf der Karte klebte, und schnippte es durch die Küche. Ungefähr so, wie Kris es mit meinem Herzen gemacht hatte.
Allerdings war es offenbar ernst gemeint gewesen, als sie gesagt hatte, dass wir Freunde bleiben sollten. Freunde, die bis in die Pfalz fuhren und in einem romantischen Landhotel übernachteten, um der Hochzeit ihrer Ex beizuwohnen.
Meine Laune wurde noch schlechter, was wirklich erstaunlich war, denn sie hatte vorher schon auf dem Boden gelegen.
Mein erster Termin heute – Fee Hermann – fand in einem dieser Hippie-Öko-Vegan-Cafés statt, die jetzt vermehrt in der Innenstadt zu finden waren. Ich hatte nicht vor, Frau Hermann überhaupt als Klientin anzunehmen, aber sie war dermaßen penetrant und unverfroren gewesen, dass mir keine andere Wahl geblieben war, als mich wenigstens einmal mit ihr zu treffen, um ihr persönlich ins Gesicht zu sagen, dass mir ihre veganen Weltverbesserer-Snacks am Arsch vorbeigingen. Am Telefon und per E-Mail schien diese Botschaft nämlich nicht angekommen zu sein.
Ich stützte die Ellbogen auf den Küchentisch und fuhr mir mit beiden Händen durchs Gesicht. Nein, das würde ich ihr nicht sagen. Fee Hermann konnte nämlich nichts für meine Laune. Und auch nichts dafür, dass bereits zwei Hochzeitseinladungen an meinem blöden Kühlschrank hingen. Dabei hatten wir erst Februar. Es war zum Schreien.
Ich würde sie zwar trotzdem zurückweisen, aber sanft und mit den üblichen Floskeln, dass ich viel zu tun hatte, bla, bla, bla.
Ich räumte meine Kaffeetasse in die Spülmaschine, schaltete überall das Licht aus, zog mein Jackett über und schob mein Smartphone in meine Hosentasche, bevor ich die Wohnung verließ und die Tür abschloss.
Als ich auf dem Weg nach unten war, kam mir mein Nachbar Mats entgegen.
»Guten Morgen.«
Er grinste. »Du meinst wohl ›Gute Nacht‹.«
Mats war Barkeeper, arbeitete meist bis zwei oder drei Uhr morgens und stieg dann in der Regel zu seiner jeweiligen Eroberung ins Bett, bevor er irgendwann zwischen Morgengrauen und Mittag nach Hause kam.
Für mich war das nichts, aber er wirkte zufrieden.
»War gut?«, fragte ich eher aus Höflichkeit, weil wir sonst nicht viel gemeinsam hatten. Aber Mats war nett und spendierte mir immer Drinks, wenn ich im Pegelstand war, der Bar, in der er arbeitete, weshalb ich natürlich öfter in besagte Bar ging.
»Oh ja. Hübsches Gesicht, tolle Titten, unglaublich verdorben.« Er führte die Finger an die Lippen und gab ein lautes Kussgeräusch von sich. »Absolute Empfehlung.«
»Na dann.« Ich nickte ihm zu und eilte über die Stufen nach unten. Ich war zwar nicht zu spät dran, doch ich wollte früh genug in dem Café sein, um einen strategischen Sitzplatz zu wählen, der mir eine schnelle Flucht ermöglichte, sollte Fee Hermann bei unserem Treffen ebenso eine Nervensäge sein wie am Telefon.
Ich holte zwei welke Blätter unter dem Scheibenwischer hervor und warf sie zu den anderen auf die Straße, ehe ich mich hinters Steuer setzte und den Motor startete. Noch während ich mich anschnallte, fuhr ich los und überlegte, wo ich am besten parken konnte.
Außerdem formulierte ich die Absage in meinem Kopf bereits vor. Begrenzte Kapazitäten. Ja, das war gut.
Ausnahmsweise war der Verkehr mal auf meiner Seite, doch davon hatte ich letztens Endes auch nichts, weil ein Mercedes aus einer der Seitenstraßen geschossen kam und meinen Kotflügel erwischte. Ich bremste zwar, weil sich hinter mir glücklicherweise niemand befand, der Zusammenstoß klang aber trotzdem beeindruckend – und teuer.
Mir passierte nichts, der Gurt griff, und bis auf den harten Ruck, der durch meinen Körper ging, merkte ich kaum etwas.
Mit einem Seufzen schaltete ich die Warnblinkanlage an und stieg aus. Genau das hatte ich heute noch gebraucht. Ich wählte bereits die Nummer der Polizei, als die Beifahrertür des Mercedes aufschwang und eine Frau ausstieg.
Für einen Moment vergaß ich, was ich hatte tun wollen, weil sie unfassbar attraktiv war. Sie musterte meinen Kotflügel und seufzte.
Ich erinnerte mich, dass es gerade Wichtigeres als ihr herzförmiges Gesicht mit den vollen Lippen gab, und rief die Polizei.
Der Fahrer stieg auch aus. Er war wesentlich jünger als sie und starrte mich aus großen Augen an. »Ist Ihnen etwas passiert?«, fragte er mit einem zittrigen Ton in der Stimme.
»Nein«, gab ich zurück und wandte mich ab, weil jemand mein Gespräch entgegennahm. Ich gab dem Mann die Daten durch, und er kündigte an, dass ein Streifenwagen in sieben bis zehn Minuten da sein würde. Damit wäre ich dann offiziell zu spät für meine Verabredung mit Fee Hermann. Ich hasste es, unpünktlich zu sein.
»Ich bin dann mal weg«, sagte die Frau zu dem Fahrer des Mercedes.
Ich drehte mich um. »Weg? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie sich nicht einfach vom Unfallort entfernen sollten.«
»Warum nicht?« Sie rümpfte ihre irgendwie bezaubernde Stupsnase. »Ich bin ja nicht gefahren.«
»Die Polizei wird trotzdem Ihre Daten aufnehmen wollen. Sie sind immerhin eine Zeugin.«
Sie runzelte die Stirn. »Zeugin? Es ist klar, was passiert ist.«
Bevor ich etwas erwidern konnte, schüttelte der Fahrer des Wagens panisch den Kopf. »Keine Polizei. Bitte.«
»Zu spät«, sagte ich trocken. Einmal, mit Anfang zwanzig, hatte ich den Fehler gemacht, nicht die Polizei zu rufen, weil eine junge Mutter mit Kindern versprochen hatte, den Schaden so zu bezahlen, ohne ihre Versicherung zu bemühen – nur um mir falsche Daten zu nennen und sich nie wieder zu melden. Daraus hatte ich definitiv gelernt.
»Oh nein!« Er schlug die Hände über dem Kopf zusammen. »Das ist nicht mein Auto.«
Seine Beifahrerin drehte sich zu ihm. »Nicht?«
»Nein, es gehört meiner Oma. Sie bringt mich um.« Er schaute mich an. »Und die Drogen …« Er schluckte schwer.
»Drogen?« Ich traute meinen Ohren kaum.
»MDMA.« Der junge Mann schob die Unterlippe vor. »Hat sie mir gegeben.« Er deutete auf die hübsche Frau.
Mein Blick schwang zu seiner Beifahrerin, und ich fragte mich, in welchem Verhältnis sie wohl zueinander standen.
»Was gucken Sie mich denn jetzt so an? Keine Ahnung, wovon er redet. Ich kenne ihn nicht sonderlich gut. Wir hatten bloß Sex«, behauptete sie.
Der Mund des Fahrers klappte auf und zu, weil sie ihm mit ihrer lapidaren Aussage gerade offenbar das Herz gebrochen hatte.
»Es bleiben trotzdem alle hier, bis die Polizei kommt«, entschied ich.
»Ich habe einen Termin«, protestierte sie und stemmte die Hände in die Hüften.
»Den habe ich auch. Und wenn ich zu spät komme, werden Sie wohl ebenfalls zu spät kommen.«
Für einen kurzen Moment funkelte sie mich an und überlegte offenbar, ob sie einfach gehen sollte, doch da kam bereits der angekündigte Streifenwagen.
Ich dachte wirklich, das Ganze könnte kaum noch skurriler werden, und wurde eines Besseren belehrt.
Ein älterer Polizist nahm meine Personalien auf, ehe ich versuchte, Fee Hermann anzurufen, die allerdings nicht ans Handy ging. Dafür bekam ich einen Anruf von einer unbekannten Nummer, den ich wegdrückte. Ich konnte mich gerade wirklich nicht um noch mehr kümmern.
»Thomas?«, fragte die Polizistin. »Kannst du mal kommen?«
Ihr Kollege gesellte sich zu ihr, und da ich Ohren hatte, konnte ich schlecht überhören, wie sie sagte: »Der Herr hat keinen Führerschein und es ist auch nicht sein Wagen.«
»Hat er keinen Führerschein oder hat er ihn nicht dabei?«
»Er hat keinen.«
»Du hast keinen Führerschein?«, wiederholte seine Beifahrerin entsetzt.
»Nein. Sorry, Melanie.«
»Melanie?« Die Polizistin sah auf ihren Block. »Ich dachte, Ihr Name wäre Sarah Hippert?«
»Mein Name ist Sarah Hippert.«
»Oh«, machte die Polizistin, der offenbar aufging, dass Sarah ihrem Beifahrer nicht ihren richtigen Namen gesagt hatte.
Prompt fragte ich mich, ob der Kerl wohl in Bezug auf die Drogen, die sie ihm angeblich gegeben hatte, vielleicht doch die Wahrheit gesagt hatte.
Sarah Hippert tippte auf ihrem Handy herum. »Sie haben meine Daten doch jetzt. Kann ich gehen? Ich habe einen Termin und darf wirklich nicht zu spät kommen.« Sie warf dem älteren Polizisten ein strahlendes Lächeln zu. »Bitte?«
Ich konnte nicht fassen, dass es funktionierte. Während mein Handy schon wieder mit einem Anruf der unbekannten Nummer klingelte, entließ der Polizist Sarah Hippert – weil sie ein bisschen mit den Wimpern geklimpert hatte.
Sie stolzierte mit einem ansehnlichen Hüftschwung davon und ich drückte den Anruf weg. Unfassbar. Einfach nur unfassbar.