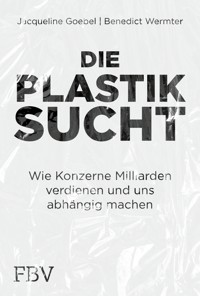
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Wir leben im Plastikzeitalter. Kunststoffe sind das Werkzeug unserer Zeit, ohne sie gäbe es die moderne Gesellschaft nicht. Doch was wir hinterlassen, ist Müll, der in der Umwelt Ewigkeiten überdauert. Bereits in dreißig Jahren soll es mehr Plastik als Fische im Ozean geben. Schon heute verursachen Plastikproduktion und Plastikmüll mehr als drei Prozent der weltweiten Klimagasemissionen – mehr als ganze Staaten. Die Profiteure der Plastikkrise nehmen das in Kauf. Die Ölindustrie, Chemiekonzerne und die bekanntesten Marken der Welt sind abhängig von Plastik. Denn sie haben ihr Geschäftsmodell auf Müll gebaut. Und sie planen noch mehr Plastikfabriken, wollen noch mehr Produkte in Wegwerfverpackungen verkaufen – in Ländern, in denen Plastik bisher kaum gesammelt oder recycelt wird. Diese Konzerne wissen, dass Recycling allein das Problem nicht lösen wird. Trotzdem schmieden sie mächtige Allianzen, um weiter die Hoffnung auf eine Kreislaufwirtschaft zu schüren. Sie weichen Verboten aus und setzen ihre ganze Lobbymacht ein, um Einwegplastik grüner erscheinen zu lassen. Für noch mehr Müll, der unseren Planeten umhüllen wird. Diese Sucht schadet uns allen. Ein Entzug ist nötig. Jacqueline Goebel und Benedict Wermter haben jahrelang zu Plastikindustrie und Kreislaufwirtschaft recherchiert. Sie zeigen schonungslos die Methoden und Probleme der Industrie auf – und erklären, wie wir uns der Plastikkrise endlich entziehen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 398
Ähnliche
Jacqueline Goebel | Benedict Wermter
DIE PLASTIK SUCHT
Jacqueline Goebel | Benedict Wermter
DIE PLASTIK SUCHT
Wie Konzerne Milliarden verdienen und uns abhängig machen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
Originalausgabe, 1. Auflage 2023
© 2023 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Sämtliche Inhalte dieses Buchs wurden – auf Basis von Quellen, die die Autoren für vertrauenswürdig erachten – nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und sorgfältig geprüft. Der Verlag haftet für keine nachteiligen Auswirkungen, die in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit den Informationen stehen, die in diesem Buch enthalten sind. Textstellen, die direkt oder indirekt Zitate wiedergeben und nicht anderweitig belegt sind, stammen aus persönlichen Gesprächen, E-Mails oder sonstiger schriftlicher Kommunikation der Autoren mit den betreffenden Personen.
Projektleitung: Tobias Schudok
Redaktion: Petra Sparrer
Korrektorat: Manuela Kahle
Umschlaggestaltung: Karina Braun
Umschlagabbildung: Art Kovalenco/shutterstock.com
Illustrationen: Müjde Puzziferri
Recycling-Symbol am Kapitelanfang: TotemArt/Shutterstock.com
Satz: Daniel Förster
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-697-9
ISBN E-Book (PDF) 978-3-98609-339-6
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-340-2
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter:
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.
Inhalt
Vorwort Aufgewachsen im Plastikzeitalter
Kapitel 1 Die Kunststoffküche
Hunderte Millionen Tonnen Plastik
Ein Ersatz für die Natur – die ersten Kunststoffe
Potenziell toxisch
Boiled Egg Communities – die Nachbarn der Plastikküchen
Niemals satt – noch mehr Plastikfabriken
Kapitel 2 Der Treibstoff des Konsums
Verpackungen: Vom Überlebenswerkzeug zum Werbemittel
Schnell. Einfach. Billig.
Im Verpackungswahn
Sachets: Konsum in Tagesrationen
Die Müllmacher
Kapitel 3 Der Traum vom Kreislauf
Die Massenkunststoffe: Eine Übersicht
Eine geniale Idee: Die Verursacher zahlen
Im Sortierlabyrinth: Schwächen im System
Von Müllfürsten und Abfallsammlern
Ab ins Zementwerk: Plastik brennt gut
Mischplastik: In der Parkbank versenkt
Einwegflaschen: Die Jagd auf den Recyclingschatz
Nicht lebensmitteltauglich
Der Traum vom Kreislauf verblasst
Niemals kreisförmig
Kapitel 4 Im Müllkarussell
HS 3915 – wenn Plastikmüll Grenzen überschreitet
Die Abfallkolonien
Das Geschäft der Müllmakler
Undercover zwischen Müllschiebern
Verbote mit begrenzter Wirkung
Kapitel 5 Geschichtenerzähler und Lobbyisten
Mission Circular Economy
Die neue Plastikwirtschaft
Eine Allianz im Müll
Kapitel 6 Schlechte Lösungen und falsche Versprechen
Kommt nicht aus dem Meer: Ozeanplastik
Macht nicht reich: Soziales Plastik
Kleines Lexikon des Greenwashing
Begrenzt abbaubar: Bioplastik
Irreführende Versprechen: Alles recyclingfähig
Keine Lösung: Plastikmüll chemisch zerlegen
Kapitel 7 Leben in der Plastikpandemie 2050
Kapitel 8 Der Entzug
Zwölf Schritte gegen die Plastiksucht
Prävention: Weniger ist mehr
Therapie: Konsum der Zukunft
Schadensminimierung: Gutes Design und ehrliches Aufräumen
Regulation: ein Plastikpakt für die Welt
Nachwort
Quellenverzeichnis
Fotoverzeichnis
Vorwort
Aufgewachsen im Plastikzeitalter
In unserem Blut schwimmen höchstwahrscheinlich Plastikpartikel. Diese Partikel sind sehr winzig, deshalb bemerken wir sie nicht. Wie lange sie bereits in unserem Blut schwimmen, wie sie dorthin gelangt sind, was sie in unserem Körper anrichten, auch das wissen wir nicht.
Erst im Jahr 2022 ist es einem Forschungsteam gelungen, Mikroplastik im menschlichen Blut nachzuweisen. Wissenschaftler der Freien Universität Amsterdam mussten erst eine Methode finden, um kleinste Plastikpartikel chemisch erkennen zu können – die Plastikteilchen in der Studie waren bis zu 0,0007 Millimeter klein. Die Forschenden fanden in 17 von 22 Blutproben Plastikpartikel.1 Eine Trefferquote von 77 Prozent, gleich beim ersten Versuch.
Das Forschungsteam konnte verschiedene Plastiksorten bestimmen und untersuchen, wie häufig sie im Blut einer Testperson vorkamen. Im Durchschnitt fand es in allen Proben 1,6 Mikrogramm auf einem Milliliter Blut. Wäre das Blut ein Glas voller Murmeln, dann wären gut eineinhalb von hundert Murmeln aus Plastik. Am häufigsten bestanden diese Plastikpartikel aus Polyethylenterephthalat (oder kurz PET). Die Hälfte der freiwilligen Testpersonen hatte diesen Kunststoff in ihrer Blutbahn.
Es ist nicht nur in unserem Blut. Mikroplastik ist überall auf der Welt zu finden, selbst an Orten, die für Menschen nicht zu erreichen sind. Im Jahr 2019 fand ein Forschungsteam der britischen Newcastle Universität eine bis dahin unbekannte Gattung von Flohkrebsen in der tiefsten Schlucht der Erde, dem Marianengraben. Sie tauften die frisch entdeckten Tierchen mit dem glatten, borstenlosen Panzer auf den Namen Eurythenes Plasticus. Der Flohkrebs hatte Mikroplastik in seinem Körper, obwohl er beinahe 7 Kilometer unter der Meeresoberfläche lebte. In seinem Darm fanden die Forscher eine Plastikfaser von 0,65 Millimetern, ebenfalls aus PET.2
Dieser Kunststoff ist einer der wichtigsten Werkstoffe der Welt. Wir kleiden uns in Pullovern aus diesem Kunststoff, schnallen uns mit Sicherheitsgurten aus PET an, verpacken Erdbeeren und Steaks in Schalen und trinken Wasser aus PET-Wegwerfverpackungen. PET macht etwa 6 Prozent der weltweiten Kunststoffproduktion aus.3 Ist es da ein Wunder, dass wir dieses Plastik im Blut und in Därmen von Lebewesen aus den tiefsten Schluchten der Erde finden? Wahrscheinlich nicht.
Wir unterscheiden heute die frühen Epochen der Menschheitsgeschichte in Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit. Wir haben diese Epochen nach den wichtigsten Werkstoffen benannt, aus denen die Menschen damals ihre Werkzeuge formten. So gesehen leben wir heute im Plastikzeitalter.
Kunststoffe bringen der Menschheit technischen Fortschritt und Wohlstand. Kein Windrad dreht sich heute ohne Plastik, kein Elektroauto fährt ohne Kunststoffe, keine Blutkonserve käme ohne Kunststoff in die Operationssäle, es gibt kaum einen Supermarkteinkauf, von dem wir nicht mit Plastik in der Einkaufstasche zurückkehren. Plastik ist ein Treibstoff, der unsere Wirtschaft und unseren Konsum befeuert. Das hat uns abhängig gemacht. Unsere Gesellschaft hat sich an den einfachen, billigen, überall verfügbaren Konsum gewöhnt, den Einwegprodukte und Plastikverpackungen ermöglichen. Viele Konzerne haben ihre Geschäftsmodelle und ihre Zukunft auf Kunststoff aufgebaut – und kommen nun nicht mehr davon ab. Wie Suchtkranke kämpfen sie um ein Mittel, das ihnen vielleicht mehr schadet als hilft.
Selbst wenn Plastik einer der wichtigsten Werkstoffe der Menschheit ist, müssen wir bedenken, dass wir Plastik nicht nur als Werkzeug für spätere Gesellschaften hinterlassen. Im vergangenen Jahrhundert sind rund 5 Milliarden Tonnen Plastik in der Umwelt und auf Deponien gelandet, schätzte ein Forschungsteam bereits vor einigen Jahren.4 Diese Abfälle könnten sich als Sedimente auf dem Meeresgrund ablagern und eine Plastikschicht bilden, die selbst in Jahrmillionen noch auffindbar wäre.5
Das wäre ein trauriges Zeugnis der Moderne. Denn Plastik ist einer der größten Treiber der Erderwärmung. Die Kunststoffe werden aufwändig aus Öl gewonnen, dann mit hohem Energieaufwand in gigantischen Raffinerien verarbeitet, in Spaltöfen chemisch zerlegt und neu zusammengesetzt, in Produkte gepresst und geformt und um die Welt geschickt. Jeder dieser Schritte erzeugt Treibhausgase. Plastikabfälle können das Grundwasser kontaminieren, wenn sie in der Umwelt abgeladen werden. Plastikmüll kann krebserregende Stoffe bilden, wenn Menschen die Abfälle in ihren Gärten verbrennen oder in Müllverbrennungsanlagen und Zementwerken verfeuern. Fische, Robben und Wale schlucken Plastik statt Plankton und sterben daran. Und wir Menschen verzehren diesen Müll mit dem Fisch. Lange bevor Forschungsteams Mikroplastik in unserem Blut fanden, entdeckten sie die Partikel schon in Darm und Kot.
Wir – die Autorin und der Autor dieses Buchs – sind beide in Deutschland aufgewachsen, einem Land, in dem man Mülltrennung schon in Kindergarten und Schule kennenlernt. Die Deutschen gelten als Recyclingweltmeister, in kaum einem anderen Land haben Umweltschützer, Politiker und die Entsorgungswirtschaft so lange und hartnäckig versucht, Plastikmüll in einen Rohstoff zu verwandeln. Gelungen ist das nur begrenzt. Die Tausenden Plastikarten in der Welt sind auch für die Recycler eine Herausforderung. Recycling rechnet sich nicht. Es birgt Umweltrisiken, vor allem kann das Recyclingsystem nur einen Teil des Plastikabfalls auffangen.
Plastik ist weltweit ein Problem. Die Lieferkette der Kunststoffe streckt sich häufig über mehrere Kontinente. Das Öl wird in einem Land gefördert, in einem anderen zu Plastik verarbeitet, im dritten zu einem Produkt geschmolzen, im vierten verkauft und im fünften Land als Müll entsorgt. Plastikmüll kennt keine Grenzen, wenn er von Flüssen ins Meer und bis in internationale Gewässer getragen wird. Deshalb wollen wir in diesem Buch die globale Perspektive der Plastiksucht darstellen. Wir haben deshalb nicht nur in Europa recherchiert, sondern waren häufig in Asien unterwegs, haben mit Menschen aus Nordamerika und aus Afrika gesprochen, um die globale Dimension der Plastikkrise darstellen zu können.
Bei unseren Recherchen haben wir Konsumenten kennengelernt, die diese Auswirkungen jeden Tag zu spüren bekommen. Wir verwenden in diesem Buch das generische Maskulinum. Wir stellen an dieser Stelle klar, dass wir ausdrücklich alle Geschlechtsidentitäten einbeziehen. Die Umweltverschmutzung und Klimabelastung durch Plastik machen kaum Unterschiede zwischen Geschlechtern. Sie kennt aber einen Unterschied zwischen der Herkunft.
Viele der Menschen, die unter der Plastikkrise am meisten leiden, leben in Ländern, die nicht als wohlhabend gelten. Vor ihren Häusern leert keine Müllabfuhr Mülltonnen, es gibt keine geregelte Recyclingindustrie. Einige von diesen Menschen stellen wir in diesem Buch vor. Wir können nicht immer ihre wahren Namen nennen. Wer sich öffentlich gegen jene stellt, die in ihren Ländern Geld mit Plastik verdienen, lebt gefährlich. In anderen Fällen haben wir Quellen anonymisiert, weil es sich um Insider aus der Industrie handelt, die auf diese Weise offener und ehrlicher über die Verhältnisse und über kriminelle Machenschaften in der Branche sprechen können. Wenn wir Namen geändert haben, stellen wir das transparent dar.
Wir haben für dieses Buch mit Aktivisten und Gegnern der Plastikindustrie gesprochen. Wir haben auch mit jenen gesprochen, die Plastik produzieren, Produkte in Plastik verkaufen oder auf andere Weise finanziell von Plastik abhängig sind, wenn wir die Möglichkeit dazu hatten. Einige Unternehmen beantworteten unsere Fragen nur schriftlich oder reagierten gar nicht. Auch das legen wir offen.
Wer dieses Buch liest, soll danach verstehen, warum wir so süchtig nach Plastik sind und wo die wirtschaftlichen Ursachen dieser Abhängigkeit liegen. Wir wollen dafür den gesamten Lebenszyklus von Plastik nachzeichnen.
Im ersten Kapitel zeigen wir auf, wie Öl zu Plastik wird – und wer davon finanziell profitiert. Auch wenn wir schon lange darüber sprechen, wie wir weniger Plastik verbrauchen können: Die Industrie wettet weiter auf Wachstum des Plastikkonsums und kündigt neue Plastikfabriken an. Wir haben diese Baustellen besucht und erklären an ihrem Beispiel, wieso vielleicht nicht der Müll, sondern die Produktion die größte Herausforderung der Plastikkrise ist.
In Kapitel zwei gehen wir der Frage nach, wie Plastik uns als Gesellschaft geprägt hat. Unsere Konsumgesellschaft baut heute auf einer Infrastruktur auf, die ohne Plastik kaum möglich wäre. Das gilt insbesondere für die Plastikverpackung, das wichtigste Produkt der Plastikindustrie. Wir erklären deshalb, wie eine Verpackung entsteht und wann sie zu einem Problem wird.
In Kapitel drei beschäftigen wir uns mit dem Traum vom Recycling-Kreislauf – und warum dieser Traum bis heute nie vollständig Realität werden konnte. Wir zeigen auf, wie heute mit moderner Technik und harter Arbeit Müll sortiert wird, um Plastikabfälle wieder in einen Rohstoff zu verwandeln. Wir erklären, was Plastikrecycling zu einer Herausforderung macht und wieso das Recycling nach über 30 Jahren Müllsammeln noch immer nur einen Teil der Abfälle auffangen kann.
Das vierte Kapitel beleuchtet die Mechanismen des weltweiten Handels mit Plastikmüll. Die wohlhabenden Staaten und größten Müllverursacher haben über Jahrzehnte davon profitiert, die Abfälle in jene Länder zu schicken, in denen Arbeitskraft billig und Umweltstandards niedrig sind. Aber diese Exporte sind zu einem internationalen Problem geworden. Denn in den Importländern führt die Abfallflut aus dem Ausland immer wieder zu Umweltskandalen. Das liegt auch daran, dass viele das Geschäft mit betrügerischen und kriminellen Methoden unterwandern. Wir haben eine Scheinfirma gegründet und undercover recherchiert, um die Methoden der unseriösen Abfallhändler offenzulegen und an die Öffentlichkeit zu bringen.
Kapitel fünf stellt die Abwehrbewegung der Süchtigen dar. In dem Kapitel zeichnen wir auf, wie Big Oil und Big Plastic mit Lobbyismus für Plastik kämpfen. Die Industrie will ihr Image und ihr Geschäft verteidigen. Sie startet Ablenkungsmanöver und präsentiert Politik und Öffentlichkeit vermeintliche Lösungen für die Plastikkrise.
Kapitel sechs heißt deshalb »Schlechte Lösungen und falsche Versprechen«. In diesem Kapitel zeigen wir auf, wieso viele Ansätze der Industrie im Kampf gegen die Plastiksucht fehlgeleitet sind. Die Unternehmen hängen finanziell am billigen Werkstoff Plastik – und kommen davon kaum los.
Diese Plastiksucht ist nicht schön. Ihre Auswirkungen sind nicht schön. Und auch Kapitel sieben ist nicht schön. Wir wagen ein Zukunftsexperiment: Was passiert, wenn wir den Plastikkonsum auf der Welt nicht eindämmen können? Was passiert, wenn weiterhin so viel Plastik in der Umwelt landet, wenn wir keine neuen Methoden und Ansätze finden, um diese Abhängigkeit zu durchbrechen? Wie würde sich das Leben im Jahr 2050 dann anfühlen? Dieses Szenario ist eine Dystopie. Doch diese Dystopie ist unwahrscheinlich. Denn die gute Nachricht ist: Wir stehen an einem Wendepunkt.
In Kapitel acht stellen wir dar, warum wir Hoffnung haben, dass diese Wende gelingt. Denn es gibt sie: gute Ideen und echte Lösungen für die Probleme der Plastikkrise. Es gibt Methoden wie Pfand und Mehrwegsysteme, die sich bewährt haben. Es gibt neue Ideen, wie wir Konsum und Verpackungen verändern können. Rund um die Welt erlassen Regierungen zudem Gesetze, Verbote und Gebühren, um die Sucht nach Plastik zu durchbrechen. Unternehmen zeigen Veränderungsbereitschaft, wenn sie nur die nötige Unterstützung bekommen.
Wir haben aus diesen verschiedenen Ideen die Maßnahmen identifiziert, mit denen wir die Abhängigkeit von Plastik reduzieren können. Dieses Maßnahmenkonzept steht auf vier Säulen: Es beschreibt, wie wir Plastik vermeiden können, wie wir unsere Abhängigkeit mit neuen Mehrwegkonzepten therapieren können, wie wir den Schaden durch Plastik an der Umwelt und an unserer Gesundheit minimieren und wie ein weltweites Regelwerk aussehen muss. Denn die größte Hoffnung ist vielleicht Folgende: Während wir dieses Buch schreiben, verhandelt die internationale Staatengemeinschaft über einen bindenden Vertrag gegen die Plastikverschmutzung.
Aber wenn wir einen Ausweg aus dem Plastikzeitalter finden wollen, dann brauchen wir Ehrlichkeit. Wir müssen uns ehrlich eingestehen, inwiefern wir von Plastik als Werkstoff abhängig sind, ehrlich darüber informieren, wie Plastikmüll entsteht, ehrlich damit umgehen, dass nicht alle propagierten Lösungen uns künftig voranbringen. Wir müssen als Gesellschaft darüber diskutieren, wie wir unseren Konsum verändern können. Dazu wollen wir beitragen. Und deshalb schreiben wir dieses Buch.
1 Die Kunststoffküche
Dieses Kapitel erklärt:
wie Erfinder Plastik entdeckten und die Menschheit damit bis auf den Mond brachten,
warum die Plastikindustrie ein großer Treiber für den Klimawandel ist,
wieso die Plastikproduktion auch gefährlich für die Menschen sein kann,
wie die Ölindustrie auf weiteres Plastik-Wachstum wettet.
Wenn Kamon Bunmi sein Haus verlässt, hat er zwei Möglichkeiten: Wenn er mit seinem Pickup links abbiegt, fährt er durch eine friedliche Landschaft, in der er sich zuhause fühlt. Über einen kleinen, in der Mitte bewachsenen Sandweg gelangt er auf die Hauptstraße, die vorbei an der örtlichen Grundschule führt, vorbei an den Häusern von Familie und Bekannten. Er könnte zu den Fischrestaurants oder zur Tankstelle weiterfahren, um einen Eiskaffee zu trinken. Er könnte noch weiterfahren, zu den Farmen und Feldern. Hier, in der thailändischen Provinz Rayong, drei Autostunden von Bangkok entfernt, leben viele Bauern. Ihre Gegend bringe die besten Mangos im Königreich hervor, sagen sie. Wenn Kamon Bunmi von seinem Haus aus links abbiegt, ist der Anfang 60-Jährige ein ganz normaler Pensionär, der sich die Zeit vertreibt und niemanden stört.
Biegt Bunmi rechts ab, fährt er nicht über den Sandweg, sondern an einem 3 Meter hohen Zaun entlang, dahinter Dickicht. Nach ein paar Minuten Fahrt lichtet sich das Gestrüpp. Hinter dem Zaun erscheint eine Landschaft aus Edelstahl, Hunderte Rohre sind zu sehen, manche so dick, dass man darin laufen könnte. Sie sind alle miteinander verbunden, laufen in gigantische Tanks, so hoch wie Plattenbauten im Ostblock. Dutzende Schornsteine ragen weit über den Zaun empor, einige pumpen dunkle Wolken in die Luft, auf anderen brennt eine helle Flamme. Die Kunststoffküche. Wenn Bunmi nach rechts abbiegt, ist er ein Eindringling, ein Störfaktor. Es dauert nicht lange, bis ein grauer Pick-up mit dunklen Scheiben hinter Bunmi auftaucht und seinem Wagen folgt.
Was Bunmi hinter dem Zaun sieht, sind Ausschnitte eines der größten Industriegebiete, das Menschen je erschaffen haben. Hunderte Firmen raffinieren an der Küste von Thailand Öl, destillieren es zu Treibstoffen für Autos und Flugzeuge. Sie kochen Kunststoffe für Verpackungen, synthetischen Kautschuk für Autoreifen, sie ziehen Kunstfasern als Garne für die Textilindustrie. Sie produzieren Zusatzstoffe für Plastik. Im Tiefseehafen Map Ta Phut können Öltanker mit über 300 Metern Länge anlegen. Kohlekraftwerke produzieren Strom für die Ölindustrie und die Plastikküchen.
In der Region befinden sich gleich drei Industriegebiete. Dort angesiedelt sind unter anderem der US-Chemiekonzern Dow Chemicals, der hier Kunststoff herstellt, der wohl weltgrößte Hersteller von Plastikflaschen Indorama Ventures produziert hier Plastikbausteine und der Ölkonzern Total betreibt eine Anlage für Bioplastik. Die Flächen erstrecken sich über 100 Hektar. Damit gehören die Industriegebiete in der thailändischen Provinz Rayong wohl zu den größten Petrochemie-Komplexen der Welt.
Kamon Bunmi ist nicht nur Anwohner eines dieser Komplexe, er ist auch ein Beobachter, der die Bewegung besorgter Nachbarn in der Region leitet. Die Runde entlang des Zauns eines dieser Industriegebiete fährt er häufig. Er schaut dann, ob sich hinter dem Zaun etwas verändert hat, ob sich etwas Merkwürdiges tut, und informiert seine Dorfgemeinschaft per WhatsApp.
Die Betreiber der Fabriken mögen es nicht, wenn Bunmi oder seine Nachbarn dem Zaun zu nahekommen und hier herumschnüffeln. Deshalb folgt ihm der graue Pick-up, erzählt Bunmi. Aus diesem Grund heißt er hier anders als in der Realität, auch seine äußerliche Erscheinung haben wir leicht verfremdet.
Nach einer Viertelstunde hat Bunmi das Gelände halbwegs umfahren, er ist jetzt an der Stelle, wo der Industriekomplex an die Küste grenzt. Bunmi hält an einem Strand. Der graue Pick-up stoppt ebenfalls ab, am Zaun, noch in Sichtweite. Nicht weit entfernt fahren Schiffe vorbei, die Teile eines Ölteppichs bergen, indem sie Ölfetzen in sich aufsaugen. Die Wellen führen schwarze Brocken im Wasser. Erst vor kurzem hat es einen Zwischenfall gegeben: Der Firma Star Petroleum riss in der Tiefe ein Teil der Pipeline. 160 Tonnen Rohöl liefen aus.1 Noch jetzt, einige Wochen später, liegen Teerfetzen am Strand, es stinkt atemberaubend.
Das Leben neben diesem Industriegebiet ist gefährlich, sagt Bunmi. Nicht gut für die Umwelt, auch nicht für die Gesundheit. Über Plastik wird auch in seinem Land gestritten, Thailand hat etwa Plastiktüten in großen Supermärkten verboten2, will auch den Import von Plastikmüll stoppen.3 Aber über das, was die Plastikproduktion anrichtet, was die Kunststoffküchen für die Nachbarn bedeutet, wird kaum gesprochen.
Die Menschen in der Provinz Rayong sollen laut einer Studie die höchste Blutkrebsrate im gesamten Königreich Thailand aufweisen.4 In Blutproben der Patienten fanden Mediziner eines Krankenhauses die Chemikalien Benzol und Butadien. Die Menschen in Rayong sollen häufig an Atemwegserkrankungen wie Asthma und an erhöhten Entzündungswerten im Körper leiden. Zwar können die Studien keinen direkten Zusammenhang zum Schadstoffausstoß der Petrochemie belegen – doch der Verdacht besteht.
Aus anderen Regionen der Welt gibt es ganz ähnliche Berichte über Gesundheitsprobleme rund um die Kunststoffküchen. Als größtes dieser sogenannten Petrochemie-Cluster gilt heute ein gigantischer Komplex in der Region Jamnagar im Westen Indiens, der von Reliance Industries betrieben wird. Die Luft in seiner Umgebung sei stark verschmutzt, berichtete kürzlich die Umweltschutzorganisation Break Free From Plastic, die vor Gefahren für die Gesundheit der Anwohner warnt.5
Bekannter ist wohl die über 130 Kilometer lange Industriezone entlang des Mississippi im US-Bundesstaat Louisiana, wo mehr als 150 Werke stehen, die Öl in Plastik und andere Produkte umwandeln. Die Amerikaner nennen das Gebiet: Cancer Alley. Die Krebs-Allee. Dass die Bezeichnung ihre Berechtigung hat, hat die US-Umweltagentur mittlerweile bestätigt. Die Behörde hat in der Region ein besonders hohes Risiko für Krebserkrankungen festgestellt. In der Stadt Reserve soll das Risiko durch Luftverschmutzung laut Medienberichten 50-Mal höher sein als im Rest der USA. Medien sprechen von Reserve deshalb als Cancer Town6 – die »Krebs-Stadt«.
In den Plastikküchen kommt es immer wieder auch zu Unfällen. In Rayong in Thailand explodierte 2014 eine Anlage.7 Tagelang brannte es, Rauchwolken hingen über Rayong, erzählt Bunmi, während er sein Auto weiter um den Komplex lenkt. »Explosionen und kleine Feuer kommen häufig vor. Etwa einmal im Monat brennt es«, sagt er. Besonders wenn der Strom ausfällt und Teile der Produktion stillstehen, knalle es in der Nachbarschaft. Dann schrillen die Sirenen und er rennt ins Haus. Immerhin hätten die Plastikküchen Bäume und Sträucher rund um den Zaun gepflanzt, die Gerüche absorbieren sollen, erzählt Bunmi. Die Fabriken auf dem Gelände hätten in Filtertechnik für ihre Anlagen investiert und die Schornsteine höher in die Luft gebaut, sagt er. Manchmal blickt Bunmi nachdenklich auf die Schornsteine. Es sind mehr geworden in den vergangenen Jahren. »Es ist wegen des Plastiks. Davon verbrauchen wir heutzutage einfach zu viel.«
Hunderte Millionen Tonnen Plastik
Der Plastikkonsum der Welt gleicht einer steilen Kurve, auch in einer Zeit, in der viele Menschen darüber sprechen, dass Plastik eingespart oder ersetzt werden müsste. Erst seit dem Zweiten Weltkrieg wird synthetisches Plastik in großem industriellem Maßstab produziert. Die Hälfte des jemals produzierten Kunststoffs kam seit Anbeginn dieses Jahrtausends in die Umwelt Erde, die jährlich produzierte Menge hat sich seitdem noch verdoppelt.8 Mittlerweile spucken die Kunststoffküchen der Welt jährlich mehr als 460 Millionen Tonnen im Jahr aus.9
Plastik ist ein gewaltiges Geschäft. Nach Schätzungen von Marktforschungsfirmen ist der Markt 600 Milliarden US-Dollar schwer. Bis 2030 könnten es über 800 Milliarden US-Dollar sein.10 Ein wesentlicher Teil davon fließt in die Kassen global agierender Öl- und Chemiekonzerne.
Steile Kurve
Die globale Plastikproduktion hat sich vervielfacht – und steigt weiter an.
Quelle: Geyer 2017, OECD Global Plastic Outlook Database, Our World in Data
Gerade einmal 20 Konzerne produzieren über die Hälfte des Plastiks in der Welt, enthüllte ein Report der australischen Minderoo Foundation im Jahr 2021.11 Ganz oben auf ihrer Liste der größten Plastikproduzenten steht der US-Konzern ExxonMobil, gefolgt vom chinesischen Staatskonzern Sinopec. Auf Platz drei steht der US-amerikanische Chemiekonzern Dow, dahinter folgt der thailändische Konzern Indorama Ventures, der auch in Rayong Plastik produziert. Auf Rang Nummer fünf steht Saudi Aramco, der größte Öl- und Gas-Konzern der Welt.12
Big Oil und Big Plastic stehen sich nicht nur nahe, sie sind teils identisch. Das hat seine Gründe: Zwar ließen sich Kunststoffe rein theoretisch auch aus Zucker oder Stärke herstellen, aber 99,4 Prozent des Plastiks auf der Welt entstand 2019 aus fossilen Rohstoffen – aus Erdöl.13
Der Prozess funktioniert so: Erdöl wird in gigantischen Raffinerien erhitzt, bis es verdampft. Die Dämpfe werden aufgefangen und bei unterschiedlichen Temperaturen abgekühlt. Am wertvollsten für die Ölkonzerne sind die schweren Bestandteile des Erdöls wie Kerosin, Diesel und Benzin. Mit diesen Treibstoffen verdienen Ölfirmen heute das meiste Geld.
Übrig bleiben die leichten Bestandteile des Erdöls: das Rohbenzin Naphta und Liquified Petroleum Gas, kurz LPG. Vor allem LPG galt lange als Nebenprodukt, die Ölraffinerien wussten kaum etwas damit anzufangen. Das Gas muss regelmäßig verbrannt werden, um Druck zu entlassen. Das ist bis heute an den Schornsteinen der Raffinerien gut erkennbar: Oft brennen dort meterhohe, helle Flammen, weithin sichtbar, wie eine Fackel. Flaring heißt der Prozess in der Fachsprache.14
Die Legende besagt, dass John D. Rockefeller persönlich Anstoß an diesen Fackeln nahm. Der Ölmagnat, reichster Mensch seiner Zeit, habe die Flammen aus den Schornsteinen seiner Raffinerie schießen sehen, schildert die Autorin Susan Freinkel in ihrem Buch Plastic – A Toxic Love Story.15 Dort verbrenne Gas, habe ein Angestellter Rockefeller erklärt. Der Ölbaron habe sich über diese Verschwendung empört: »Denkt euch was aus, was ihr damit anfangen könnt!«, befahl er. Die Wissenschaftler der Ölkonzerne begannen daraufhin, das Gas genauer zu untersuchen und damit zu experimentieren.
Für die Chemiekonzerne der Welt sind Naphta und LPG heute die Grundbausteine für ihre Chemikalien. Naphta und LPG enthalten lange Kohlenwasserstoffketten – die Bausteine für Kunststoffe. Um sie weiterverarbeiten zu können, müssen Chemiekonzerne die langen Kohlenwasserstoffketten in sogenannten Steam Crackern aufspalten und in Chemikalien wie Ethylen und Propylen umwandeln. Die riesigen Kessel der Steam Cracker sind das Herzstück jedes Chemieparks.
Die Chemieindustrie nutzt manchmal das Bild eines Baums, um die Prozesse in ihren Fabriken zu erklären. Die Wurzeln des Baums sind das Rohöl, aus dem alle Produkte entwachsen. Den Baumstamm bilden die Rohstoffe aus den Raffinerien, also Treibstoffe, Naphta und LPG. Diese Grundstoffe verfeinern und filtern die Chemiekonzerne, so entstehen die Äste des Baums. Mit jeder chemischen Reaktion verzweigen die Chemiekonzerne diese Äste weiter und treiben Blüten aus. Sie können aus den Grundchemikalien Aromastoffe zusammenbrauen, Farben und Lacke, sie können Düngemittel fabrizieren, Arzneien herstellen – oder eben Kunststoffe. Die chemischen Äste, aus denen Plastik austreibt, sind unter anderem Ethylen und Propylen. Ethylen hat kurze Kohlenwasserstoffketten und ist damit ein Baustein für Plastik, ein sogenanntes Monomer. Plastik besteht aus Polymeren, in denen sich die Monomere tausendfach wiederholen. Das eigentliche Kunststück der Plastikküchen ist es, diese Ketten aneinander zu reihen und so Materialien mit neuen Eigenschaften zu erschaffen. »Poly« stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet »viel«. Polyethylen ist also ein langes Gebilde aus Ethylen-Bausteinen.
All diese Schritte – das Raffinieren des Öls, das Spalten und Umwandeln in Monomere und das Formen von Polymeren – sind energieaufwendig und klimaschädlich. Viele der Fabriken werden mit Energie aus Kohlekraftwerken16 gespeist, das verursacht noch mehr Emissionen. Die Plastikproduktion steht damit für 90 Prozent der Treibhausgase, die durch Plastik erzeugt werden. Die restlichen 10 Prozent entfallen auf die Nutzung von Plastikprodukten oder auf die Entsorgung von Plastikmüll, berichtet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Allein im Jahr 2019 verursachte die Plastikindustrie 1,8 Milliarden Tonnen Klimagase wie CO2. Eine gewaltige Menge – und dabei rechnet die OECD die Klimaschäden durch Plastik in der Umwelt nicht mal ein. Plastik ist damit für 3,4 Prozent der klimaschädlichen Emissionen auf der Welt verantwortlich.17
Diese Emissionen entstehen in der Regel nicht in den Ländern, in denen Plastik am meisten genutzt wird. Die Plastikindustrie formt ihre Polymere dort, wo es billig ist. Beinahe die Hälfte aller Kunststoffe werden in Asien und Ozeanien produziert, 32 Prozent davon in China. Nordamerika und Mexiko stehen für 18 Prozent der Plastikproduktion. Aus den Fabriken in Europa stammen nur noch 15 Prozent der Kunststoffe, meldet der Verband Plastics Europe. Der Rest der Plastikproduktion verteilt sich auf Afrika, den mittleren Osten und Lateinamerika.18
Die Polymere und Produkte, die aus diesen Fabriken stammen, haben selten einen langfristigen Nutzen für die Menschheit. Zwar wird Plastik heute für Autos eingesetzt, in der Baubranche, kein Windrad und keine Solaranlage würde ohne Plastik auskommen. Doch diese Geschäftszweige machen gemessen an der großen Menge des verarbeiteten Plastiks nur etwa ein Drittel aus.
Der Großteil des heute produzierten Plastiks wird für Produkte verwendet, die nach wenigen Jahren, wenigen Wochen, oft genug schon nach Tagen nicht mehr zu gebrauchen sind und zu Müll werden. So wie Verpackungen. 31 Prozent des weltweit hergestellten Plastiks kommt als Verpackung auf den Markt. Ein Zehntel der Polymere werden zu Fasern und Textilien verarbeitet, zum Beispiel für die Fast-Fashion-Industrie, die daraus wieder Produkte fertigt, die schnell abgetragen sind und erst aus der Mode und dann in den Müll kommen.19
All diese Industrien, all diese Wirtschaftszweige würde es ohne Kunststoff kaum in ihrer heutigen Form geben. Ein Supermarkt ganz ohne Plastik ist derzeit kaum vorstellbar, nicht einmal ein Modegeschäft oder auch nur ein Elektrohändler kommt ohne Kunststoff aus. Plastik hat Industrien und Arbeitsplätze geschaffen – und das in nur wenigen Jahrzehnten. Wir sind davon abhängig, geradezu süchtig. Wie ist es dazu gekommen?
Ein Ersatz für die Natur – die ersten Kunststoffe
Die Geschichte des Plastiks beginnt in einer Billardhalle an der Ecke Broadway und Tenth Street in New York. Im Jahr 1859 ist der Salon eine der beliebtesten Treffpunkte für junge New Yorker. Ventilatoren drehen sich über den Tischen, Zuschauer umringen die Spieler.20 Ganz besonders zieht es Schaulustige an, wenn der Besitzer des Salons selbst zum Cue greift: Michael Phelan.
Phelan ist der wohl berühmteste Spieler in einer Zeit, in der Billard Sport, Freizeitbeschäftigung und Lebensstil zugleich ist. Er gewinnt ein Spiel nach dem anderen und damit auch hohe Preisgelder. Als 1859 in den USA das erste Billardspiel offiziell aufgezeichnet wird, gewinnt Michael Phelan auch das.21
Phelan hat Billiard im Blut. Sein Vater, ein irischer Immigrant, eröffnete in New York Billardsalons. Phelan besitzt ebenfalls einige der berühmtesten Salons der Stadt, er hat ein Buch über Billardregeln geschrieben, produziert Billardtische, er lässt sogar ein Kissen für die Tische patentieren. Sein Ziel: Michael Phelan will Billard standardisieren.
Sein größtes Problem sind die Billardkugeln, üblicherweise aus Elfenbein gefertigt. Weil sie sich schnell abnutzen, müssen sie häufig nachgeschliffen werden. Dadurch verlieren sie an Umfang, keine Kugel gleicht der anderen. Die Bälle »sollten aus dem besten ostindischen Elfenbein« gefertigt sein, schrieb Phelan selbst, möglichst einheitlich in Form und Größe, sonst könnten die Bälle »selbst die geschicktesten Spieler verblüffen«.22
Dieses Elfenbein ist teuer. Die Elefantenherden in Afrika sind bereits dezimiert. Die New York Times warnte 1867, Elefanten könnten bald zu den ausgestorbenen Arten zählen.23 Es wird immer heikler, die Tiere zu jagen. Dann müssen die Stoßzähne noch verarbeitet und über das Meer geschifft werden, das alles kostet. Für Billardkugeln ist beste Qualität notwendig, Elfenbein ohne große Poren, Risse und von hoher Dichte: Nur einer von 50 Elefantenstoßzähnen ist dafür geeignet.24
Nicht nur Michael Phelan störte sich an der teuren und unzuverlässigen Lieferkette für Elfenbein. Zu viele Industriezweige benötigten kostspielige und vor allem seltene, pflanzliche und tierische Materialien. Kämme etwa wurden aus Schildkrötenpanzer oder Horn gefertigt, waren damit sehr teuer und deshalb sogar begehrte Erbstücke. Knöpfe oder Schallplatten wurden aus Schellack gefertigt, einem Naturharz aus Sekreten der indischen Lackschildlaus, die mühsam von Bäumen abgekratzt werden müssen. Schellack eignete sich auch, um Kabel zu isolieren. Doch bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als Strom sich erst langsam als Energiequelle verbreitete, war Schellack knapp.25
Für Billardkugeln testeten die Spieler durchaus andere Materialien als Elfenbein aus. Aber Kugeln aus Holz waren zu leicht und ihr Gewicht nicht gleichmäßig verteilt. Kugeln aus Eisen oder anderen Metallen waren zu schwer, sie sprangen auch nicht wie gewünscht zurück, wenn sie gegen eine andere Kugel prallten.
Im Jahr 1863 schrieb Michael Phelan deshalb einen Preis aus, nicht für den besten Billardspieler, sondern für den besten Erfinder. Wer ein Material für Billardkugeln findet, das Elfenbein ersetzen könnte, sollte 10 000 US-Dollar bekommen – damals ein kleines Vermögen.26
Nur einige hundert Kilometer entfernt in Albany begann daraufhin ein junger Drucker zu experimentieren. John Wesley Hyatt verwendete Zellulose aus Holz mit Nitrat versetzt, ein Material, das er als Drucker gut kannte. Er festigte es mit Harz und weiteren Zusatzstoffen unter hoher Temperatur. 1865 patentierte er einen solchen Ball. Aber auch der sprang nicht so, wie er sollte.
Doch Hyatt hörte nicht auf zu experimentieren. Das Material, dass er erschaffen hatte, war Zelluloid. Nicht lange nach seiner Entdeckung ersetzte Zelluloid bereits Elfenbein in Kämmen, Handspiegeln und Klaviertasten. Und es schuf den Grundstein für die Filmindustrie: Die ersten Kinofilme erschienen auf Zelluloid. Leider ist Zelluloid auch hochentzündlich, nicht wenige Kinotheater gingen deshalb in Flammen auf, angeblich sollen auch die ersten Zelluloid-Billardbälle gerne mal mit einem Knall explodiert sein, wenn sie hart aufeinanderprallten.27
Es dauerte bis 1907, bis ein belgischer Chemiker ein Material fand, das sich auch für Billardkugeln eignete. Leo Baekeland nannte es nach sich selbst: Bakelit. Baekeland suchte gar nicht nach einem Material für Billardbälle, er wollte Schellack ersetzen, das Lausharz. Dafür experimentierte er mit Phenol und Formaldehyd. Mit Hilfe von Katalysatoren und Hitze stellte er ein Kunstharz her, er presste die weiche Masse in Form und ließ sie mit Wärme und Druck aushärten. Das so entstandene Material verbog sich nicht. Es leitete keinen Strom. Es war zwar spröde, aber es löste sich nicht in Säuren auf. Es schmolz nicht in der Hitze.
Was Baekeland nicht klar war: Er hatte damit den ersten Kunststoff erschaffen, ein rein synthetisches Plastik. Die Moleküle, die er geschaffen hatte, ließen sich so nirgendwo in der Natur wiederfinden, es war ein völlig neues Material. Das Potenzial seiner Erfindung erkannte der junge Chemiker trotzdem. Er patentierte seinen Kunststoff Bakelit und stellte ihn im New Yorker Club der Chemiker vor. »Bakelit hat ein weites Feld der Anwendungen«, erklärte er, man könne daraus etwa säurefeste Ventile, Schallplatten und »tausend und einen anderen Artikel« herstellen.28 Baekeland schloss sich mit einem Fabrikanten zusammen und gründete 1910 in Erkner bei Berlin die Bakelite GmbH. Wenige Jahre später schon putzten sich die Menschen mit Bakelit-Zahnbürsten die Zähne, kämmten sich mit Bakelit die Haare, drückten ihre Zigaretten in Bakelit-Aschenbechern aus, hörten Musik aus Bakelit-Radios und glätteten ihre Hemden und Blusen mit von Bakelit umhüllten Bügeleisen.29 Coco Chanel designte Schmuck aus Bakelit.
Nur die wenigsten Menschen wussten, was es genau für ein Material war, das sie da nutzten. Über Bakelit hieß es in der Presse: »An sich glaubt ja schon die breite Masse, Bakelite sind nichts als zusammengeleimte Sägespäne.«30
Die deutsche Sprache ist eine der wenigen, die zwei Begriffe für dieselbe Materialgruppe kennt: Kunststoffe – und Plastik. Den Begriff »Kunststoffe« gibt es bereits seit dem frühen 20. Jahrhundert, 1911 erschien erstmals ein Fachmagazin unter dem Namen. Das Wort »Plastik« hingegen stammt aus dem Griechischen, es bedeutet »formbar« oder »gestaltbar«. Im Englischen heißt es »Plastic«, im französischen »Plastique«.31
Die Branche verwendet lieber den Begriff »Kunststoffe«, das drückt die Vielfalt dieser Materialien aus, vermittelt aber auch einen anderen Eindruck. Denn »Plastik« hat im Alltagssprachgebrauch eine negative Konnotation. Billige Produkte sind aus Plastik, hochwertige aus Kunststoff? Das ist Blödsinn. Häufig handelt es sich um ein und dasselbe Material.
Allerdings war den Experimenteuren und Chemikern in den Anfangsjahren der Plastikindustrie selbst oft nicht klar, was sie genau zu schaffen versuchten. Erst dem deutschen Wissenschaftler Hermann Staudinger gelang es 1922, das Wesen der neuen Materialien zu erklären: Kleine Moleküle können sich unter bestimmten Umständen zu riesengroßen Molekülketten verbinden, in denen sich die chemischen Strukturen immer wieder wiederholen. Staudinger nannte diese Gebilde zunächst »Makromoleküle« – dazu zählen auch Polymere. Drei Jahrzehnte später erhielt er dafür den Nobelpreis für Chemie.32
In Hinterhöfen und Laboren entstanden unterdessen immer neue dieser Makromoleküle. 1928 wurde Polyvinylchlorid (PVC) in industriellem Maßstab produziert, 1930 wurde Polystyrol (PS) in Deutschland produziert, 1932 auch Plexiglas, 1937 folgte die Produktion von Polyethylen (PE).33 Diese Kunststoffe gehören heute zu den meistgenutzten der Welt.
Besonders erfindungsreich war DuPont. Das Familienunternehmen, damals schon über hundert Jahre alt, produzierte Schießpulver, später auch Nitroglyzerin und Dynamit. Die Chemiker bei DuPont entdeckten, dass sich aus den Abfallstoffen ihrer Sprengstoffe mit den nun entdeckten und wissenschaftlich beschriebenen Methoden ebenfalls Polymere herstellen lassen. Jede Menge sogar. Im Jahr 1931 erfand der Konzern Neopren, 1935 Nylon, später auch Teflon.34 Selbst Earl Silas Tupper, Erfinder der Tupperdose, arbeitete für DuPont, bevor er sich mit seinen luftdichten Dosen selbständig machte.
Einer der Verkaufsschlager von DuPont war Nylon. Der Konzern bewarb den Plastikstoff als »das erste von Menschenhand gefertigte, organische Textilgewebe«, das »fein wie ein Spinnennetz« sei. 35 Die Kundinnen liebten Nylon-Strumpfhosen, die dazu noch so viel günstiger waren als die Alternative aus Seide. Nur blieben die neuen Strumpfhosen nicht lange auf dem Markt.
Mit Plastik durch den Krieg
Der zweite Weltkrieg brach aus – und damit auch eine unerwartete Nachfrage nach Kunststoffen. Nylon etwa benötigte man auf einmal auch für Seile, Zelte und Fallschirme. Acrylglas machte U-Boote und Flugzeuge leichter. Die Essensrationen der US-Soldaten blieben dank Zellophan frisch. Ohne den Kunststoff Teflon wäre vielleicht die Atombombe niemals gebaut worden. Weil Teflon nicht korrodiert, ließen sich damit die Container beschichten, um die chemischen Substanzen für die Atombombe zu transportieren.36
Die Nationalsozialisten in Deutschland schufen ihr eigenes Vehikel, um in diesem Krieg auch auf der Materialseite nachzurüsten. Die I.G. Farben, drei Jahrzehnte zuvor als Interessensgemeinschaft mehrerer Fabrikanten gegründet, wuchs durch Absatzverträge etwa für Benzin mit dem Regime Hitlers zum damals größten Konzern Europas. Der Konzern fertigte auch Kunststoffe für das Regime. Ab 1938 produzierte die I.G Farben den synthetischen Faden Perlon, chemisch dem Nylon ähnlich.37 Im Jahr 1941 ließ die I.G. Farben eine neue Megafabrik errichten, um Kautschuk und Benzin im Auftrag der Nationalsozialisten zu produzieren, ganz nahe der Stadt Brezinzka.
Die Stadt ist auch unter dem Namen Birkenau bekannt und hat als Standort des Vernichtungslagers Auschwitz eine traurige Berühmtheit erlangt. Auch die I.G. Farben spielte dabei eine Rolle: Ein Tochterunternehmen produzierte das Gas, das dort eingesetzt wurde, um Millionen von jüdischen Menschen und andere von den Nationalsozialisten verfolgten Bevölkerungsgruppen zu ermorden.38 Der Konzern, damals einer der größten Europas, setzte auch die Zwangsarbeiter aus einem der naheliegenden Lager für seine Zwecke ein. Für 3 bis 4 Mark am Tag mussten sie die neue Megafabrik für die I.G. Farben errichten.39
Nach dem Krieg richteten die Alliierten ein eigenes Kontrollorgan für die I.G. Farben ein, entflochten wurde das Unternehmen aber erst 1951. Bei den Nürnberger Prozessen mussten sich 23 leitende Angestellte der I.G. Farben verantworten, das Gericht verurteilte 13 von ihnen zu Gefängnisstrafen.40
Der Krieg endete, die Kunststoffindustrie aber blieb. Der Hunger nach den neuen, billigen Materialien war geweckt. Die Chemieindustrie in Europa und in Übersee suchte nach neuen Anwendungsgebieten. Die Nachfolgeunternehmen der I.G. Farben brauchten dringend neue Geschäfte – die Alliierten hatten ihnen die Herstellung von künstlichem Kautschuk und anderen militärisch relevanten Produkten verboten.41
BASF setzte auf Styropor: 1952 stellte der Chemiekonzern das schaumige Material auf der Düsseldorfer Kunststoffmesse vor, auch wenn sich damals noch nicht ganz abzeichnete, was eigentlich daraus hergestellt werden sollte. Einer der ersten Kunden entschied sich für Weihnachtsbaumschmuck. Später versuchte BASF, gefestigtes Styropor als Deckel etwa für Kakaodosen zu verkaufen. Der Konzern organisierte sogar Wanderausstellungen, um das Material anzupreisen.42
Mit Plastik zum Mond
Nach und nach erkannten Unternehmen und Kunden die Möglichkeiten der neuen Materialien. Und plötzlich gab es kein Halten mehr, Plastik drang in beinahe jeden Wirtschafts- und Forschungsbereich vor. Plastik revolutionierte die Medizin. Es ermöglichte beispielsweise den Transport und die Konservierung gespendeten Bluts. Zwar wurde die weltweit erste Blutbank bereits 1919 in New York eröffnet, in diesen Anfängen nahm das medizinische Personal das Blut noch mit Gummischläuchen ab und füllte es in Glasflaschen. Das Glas allerdings war teuer und schwer zu transportieren. Die Glasflaschen voller Blut zerbrachen häufig, bevor sie bei den Patienten ankamen. Auch für die Spender waren die ersten Blutspenden gefährlich. Keime oder sogar Luftbläschen konnten in ihren Blutkreislauf gelangen. Der amerikanische Chirurg Carl W. Walter, Professor an der medizinischen Fakultät der Universität Harvard, entwarf als Erster einen Blutbeutel aus Plastik. Bereits im Korea-Krieg testete die US-Armee die Plastikbeutel ausgiebig und war schnell überzeugt. Die neuen Blutbeutel hatten nicht nur den Vorteil, dass sie stabiler und widerstandsfähiger als die Glasflaschen waren, sie ließen sich auch ausdrücken, die Mediziner konnten das Blut so schneller in die verletzten Soldaten pumpen.
Kunststoff verbesserte auch die hygienischen Bedingungen in Feldlazaretten und Krankenhäusern. Vor den Einweghandschuhen und Plastikbettpfannen, bevor auch im Operationssaal Abdeckungen aus Kunststofftextilien oder Einwegscheren zum Einsatz kamen, mussten Krankenhäuser ihr Material quasi unter Laborbedingungen sterilisieren. Wo das nicht gelang (oder wegen des Aufwands und der Kosten nicht geschah), konnten Keime in die Körper der Patienten eindringen und Infektionen auslösen.43
Die Wissenschaft ist heute in der Lage, aus Plastik ein ganzes Ersatzteillager für den menschlichen Körper zu erschaffen. Prothesen sind heute aus Kunststoff und lassen sich mithilfe von 3D-Druckern für jeden Körper maßschneidern. Selbst ein ganzes Herz aus Plastik haben Mediziner bereits transplantiert. Und vielleicht spricht man im Englischen nicht ohne Grund von »Plastic Surgery« für Eingriffe, die die Schönheit der Patienten verbessern sollen.
Plastik hat die Menschheit auf den Mond gebracht. Ohne extrem leichte, widerstandsfähige Materialien, denen sowohl UV-Licht als auch kleine Meteoriten nichts anhaben können, wäre die Mondmission wohl nie möglich gewesen. Eine eigene Forschungsabteilung der National Aeronautics and Space Administration, besser bekannt als NASA entwickelte die Kunststoffe und andere Materialien zu diesem Zweck. Die Wissenschaftler dort schufen zum Beispiel einen Kunststoffschaum, der für das Innere der Helme von Mondastronauten genutzt wurde. Der Kunststoff für die Helmvisiere – durchsichtig und auch bei hohen Temperaturen widerstandsfähig – wurde erst vier Jahre vor der Mondlandung entwickelt. Die Raumanzüge der Astronauten bestanden aus 21 Schichten, etwa aus Glasfasern, Isoliermaterialien und Kunststoffen wie Teflon, Nylon und Neopren. In 20 dieser Schichten seien Patente und Innovationen von DuPont zum Einsatz gekommen, berichtete das Unternehmen später.44
Auch die Mondkapsel wurde mit Schichten aus aluminiertem Polyamid-Folien umwickelt. Das Material stammte ebenfalls von DuPont und gab der Mondkapsel ihren Goldfolien-Look. Das reflektierende Material konnte so einen Teil der Sonnenhitze ablenken. Selbst die Flagge, die Neil Armstrong und Edwin »Buzz« Aldrin damals auf dem Mond aufstellten, bestand aus dem Kunststoff Nylon. Ein NASA-Mitarbeiter hatte sie wahrscheinlich aus einem Regierungskatalog geordert – für nur 5,50 US-Dollar.45
Potenziell toxisch
Plastik war günstig, es war vielfältig, es brachte Fortschritt. Dass die neuen Materialien auch Risiken und Nebenwirkungen haben könnten, das hinterfragten vor allem in den ersten Jahrzehnten des Konsumwunders weder die Hersteller noch ihre Kunden. Dass die Chemikalien vielleicht gesundheitsschädlich sein könnten, dass sowohl Produktion als auch Produkte gefährlich sein könnten für Umwelt und Menschen, wurde lange ignoriert.
Das zeigt das Beispiel PVC: Das Plastik, bereits 1913 von dem deutschen Chemiker Fritz Klatte patentiert, wurde schnell einer der meisteingesetzten Kunststoffe der Welt. PVC findet sich heute in Gummistiefeln, in Fußböden und es wird auch für Verpackungen verwendet. Für die Herstellung von PVC braucht man Vinylchlorid, ein extrem entzündliches Gas. Die Chemikalie galt als möglicherweise leicht betäubend, ja, sie reizte auch die Augen. Aber größere Gefahren gingen von Vinylchlorid nicht aus, betonte die Industrie.
Anfang der 1970er-Jahre vermehrten sich plötzlich Berichte über schwerkranke Fabrikarbeiter in den USA und in Europa. Im deutschen Troisdorf bei Bonn beobachtete ein Hausarzt, dass Männer mit merkwürdigen Fingerkuppen bei ihm in der Praxis auftauchten. Ihre Knochen waren untypisch kurz, ihre Fingernägel wirkten übergroß und wölbten sich über den Fingerkuppen. Alle Männer arbeiteten in der PVC-Herstellung desselben Unternehmens: Dynamit Nobel. Später wurde öffentlich, dass viele Beschäftigte des Betriebs auch unter Leberschäden litten.
Der Hausarzt informierte den Werksarzt über seine Beobachtung, er riet auch zu weiteren Tests. Doch das winkte der Betrieb ab. »Mir wurde gesagt, PVC ist ungefährlich«, schilderte der Hausarzt die Reaktion. Er schickte seine Patienten weiter zur Uniklinik, wo ein Team von Ärzten die Beschäftigten der Dynamit Nobel systematisch untersuchte und begann, ihre Erkenntnisse über die sogenannte VC-Krankheit an die Öffentlichkeit zu tragen. 46
Beinahe zeitgleich starben in den USA vier Männer an einem seltenen Leberkrebs, alle arbeiteten ebenfalls in einer PVC-Fabrik. Die Historiker Gerald Markowitz und David Rosner arbeiteten diese Fälle in ihrem Buch Deceit and Denial auf, wühlten sich dafür durch Unternehmensarchive und fanden mehr, als sie sich selbst hätten vorstellen können: Rosner und Markowitz wiesen nach, dass Entscheider in den betroffenen Fabriken bereits vor 1960 Kenntnis davon erlangten, dass ihre Mitarbeiter immer wieder dieselben Symptome zeigten. Sie regten daraufhin Tierversuche und weitere Studien an, die den Verdacht erhärteten, dass Vinylchlorid möglicherweise leberschädigend und auch krebserregend sein könnte. Gegenüber Regierungsvertretern verheimlichten und bestritten Industrievertreter diese Studienergebnisse.47
Die Skandale hatten ihre Konsequenzen. In Deutschland ist die VC-Krankheit heute als Berufskrankheit anerkannt. Inzwischen gelten strenge Grenzwerte für die Menge an Vinylchlorid, denen Menschen ausgesetzt werden dürfen. Wer mit Vinylchlorid arbeitet, muss einen Atemschutz und auch einen Körperschutz tragen. Unternehmen und Industrie haben nachgebessert, natürlich. Heute wird Plastik unter strengen Umweltstandards produziert, wie jeder Verband beteuert.
Doch PVC gilt immer noch als bedenklich. Wenn es bei zu niedrigen Temperaturen verbrannt wird, können dabei Dioxine entstehen. Diese Stoffe sind hochgiftig, können das Nervensystem schädigen, die Fortpflanzung beeinträchtigen oder sogar krebserregend wirken. Dioxine können sich außerdem in Nahrungsmitteln und tierischen Fetten ansetzen, tauchen deshalb immer wieder etwa in Eiern auf. Das ist besonders in ärmeren Ländern ohne Entsorgungsstruktur eine Gefahr, wo die Menschen Plastikmüll – und damit auch PVC – in ihren Gärten verbrennen.48 Umweltschützer von Greenpeace haben PVC deshalb bereits als »The Poisonous Plastic« bezeichnet – »der giftige Kunststoff«.49
Als besorgniserregend gelten heute auch viele sogenannte Additive. Diese Zusatzstoffe werden eingesetzt, um Plastik weicher zu machen, weniger entzündlich oder unempfindlicher gegen UV-Licht. Das Problem: In der Regel wissen Verbraucher nicht, welche Additive in den Produkten stecken, die sie verwenden – oder ob von diesen eine Gefahr ausgeht. Ein Forschungsteam der ETH Zürich identifizierte in einer Studie aus dem Jahr 2021 über 10 000 verschiedene Chemikalien, die in Plastik vorkommen. 2400 davon stuften sie als potenziell besorgniserregend ein. Schon aufgrund der unglaublich großen Zahl der Zusatzstoffe kommen Wissenschaft und Gesetzgeber kaum hinterher, all ihre Auswirkungen zu erfassen und zu regulieren. Immer wieder tauchen auch heute noch neue Studien auf, die besorgniserregende Zusammenhänge zwischen Zusatzstoffen und Krankheiten aufzeigen.
Eins der bekanntesten Beispiele für gefährliche Zusatzstoffe ist Bisphenol A, kurz BPA. Der Weichmacher wurde zum Beispiel für Babyflaschen eingesetzt – bis Studien zeigten, dass BPA die Hirnentwicklung von Föten beeinflussen und auch die menschliche Fruchtbarkeit behindern kann. In der EU gilt BPA heute als »besonders besorgniserregender Stoff«, der nach und nach vom Markt verschwinden soll.50 Der Industrieverband Plastics Europe ging gegen diese Einstufung vor Gericht vor – und verlor.51 In Asien finden Umweltorganisationen den Weichmacher jedoch heute noch in Babyflaschen.52
Oftmals sind es ganze Chemikaliengruppen, die Verdacht erwecken. Das beste Beispiel sind die sogenannten Forever Chemicals, die »Ewigkeitschemikalien«. So wird die Gruppe der per- und polyfluorierten Chemikalien (PFAS) genannt, weil sie sich biologisch und chemisch kaum zersetzen oder abbauen lassen. Sie sind in der Natur quasi kaum zu zerstören. Diese Gruppe schließt über 4700 chemische Verbindungen ein, die einander sehr ähnlich sind – und teilweise höchst gefährlich. Sie kommen bis heute massenhaft zum Einsatz. Denn die Ewigkeitschemikalien haben begehrenswerte Eigenschaften. Sie weisen Wasser, Fett und Schmutz ab und werden deshalb gerne genutzt, um Oberflächen zu veredeln, etwa von To-go-Pappbechern oder auch Skiern. Wegen des Antihaft-Effekts enthalten auch wasserdichte Kleidungsstücke wie zum Beispiel Regenmäntel häufig PFAS.
Das hat bis heute unbekannte Auswirkungen. Eine Großrecherche des Forever Pollution Projects von 15 Medienhäusern fand allein in Europa 17 000 Orte, die durch PFAS belastet sind.53 In 2000 Fällen ist die Konzentration mit Ewigkeitschemikalien womöglich so hoch, dass die Gesundheit der Menschen in der Umgebung gefährdet ist. In Deutschland durften Menschen im bayrischen Landkreis Altötting wegen erhöhter Konzentration an PFAS zeitweise kein Blut mehr spenden – im örtlichen Gewerbegebiet stand eine Fabrik für die »unsterblichen« Chemikalien.54
Vor allem Perfluoroctansäure (PFOA) hat weltweit eine große Bedeutung für die Industrie. DuPont nutzte sie etwa für die Herstellung von Teflon, intern war die Chemikalie bekannt als »C8«.55 PFOA gilt heute als gesundheitsschädlich. Es ist giftig für Tiere, kann die Entwicklung menschlicher Föten beeinträchtigen und Leberschäden hervorrufen. Die Hersteller DuPont und der Lieferant 3M mussten sich in der Vergangenheit immer wieder vor Gericht verantworten, weil die Chemikalien in die Natur gelangt waren, und Natur und Menschen schädigten. Meist einigten sich die Hersteller mit den Klägern. Die Summen, die DuPont und 3M in diesen Rechtsfällen zahlen mussten, gehen in die Milliarden.56, 57, 58 Die Staatsanwaltschaft des US-Bundesstaats Kalifornien hat die Hersteller mittlerweile angeklagt, weil sie mit ihren Chemikalien die Gesundheit der Menschen und der Natur wissentlich geschädigt haben sollen.59
PFOA steht seit 2019 auf der Liste der Chemikalien, die nach der Stockholmer Konvention als gefährlich angesehen werden und deren Herstellung weltweit gestoppt werden sollte. Doch teilweise ersetzen Industrie und Hersteller die verbotenen Substanzen nur durch ähnliche Chemikalien, die noch nicht so gut erforscht sind wie die nun verbotenen. Die Behörden kommen kaum hinterher, um all die Gesundheitsauswirkungen zu untersuchen, die die neuen Substanzen auf dem Markt haben könnten.60
Zugunsten eines modernen Lebensstils hat die Welt der Kunststoffe viele Materialien aus der Natur ersetzt. Wohlstand und Fortschritt der Gesellschaft hängen genauso wie die Gewinne von Ölindustrie und Chemiekonzernen von Plastik ab. Doch Kunststoffe und ihre Komponenten richten auch Schaden an. Nicht nur beim Verbrauch, sondern schon bei der Herstellung. Umweltstandards hin oder her, die Produktion von Kunststoffen fordert einen Tribut von Mensch und Natur. Sie verursacht hohe Kosten für Menschen wie Kawon Bunmi in Thailand.
Boiled Egg Communities – die Nachbarn der Plastikküchen
Irgendwann, nach fast einer Stunde im Auto, hat Kawon Bunmi das Industriegebiet in Rayong umrundet und parkt seinen Pick-up in seiner Einfahrt. Das Wachpersonal der Kunststoffküche war zuvor schon abgebogen. Sie haben offenbar nach halber Strecke erkannt, dass Bunmi nur eine Runde dreht. Man kennt seine Routen.





























