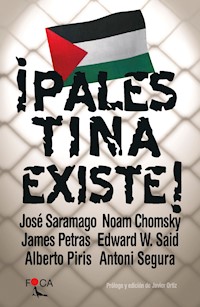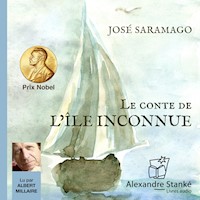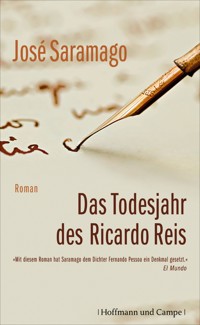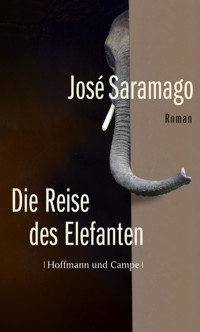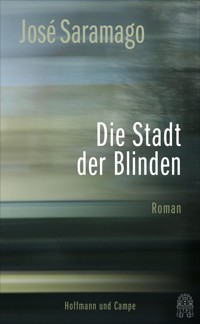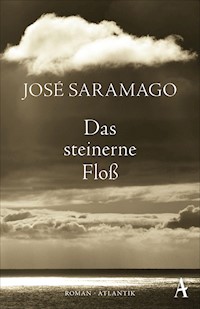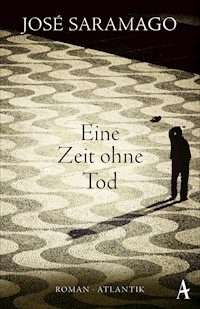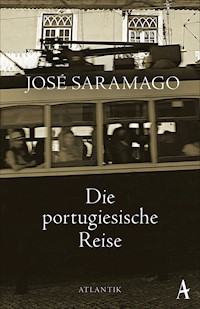
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
"Überlass deine Blumen jemandem, der damit umzugehen weiß, und fahr los." Saramago lädt ein zu einer literarischen und kulturellen Reise durch seine Heimat Portugal, die er in den 90er Jahren, nach längerer Abwesenheit, mit fremdem Blick ganz neu entdeckt. Seine gemächliche Fahrt in einem klapprigen Auto führt vom Norden Portugals über Hunderte von Kilometern hinweg bis zur Algarve. Geleitet von einer zerknitterten Landkarte und spontanen Eingebungen, lässt der Reisende sich durch die Landschaft treiben. Er macht Halt in kleinen Dörfern, besichtigt Kirchen, Klöster und Burgen oder erfreut sich an der Schönheit der Natur. Nicht zu vergessen, die wunderbaren Geschichten, die ihm an jeder Ecke begegnen. Saramago gibt Einblick in die unbekannten Seiten Portugals und legt gleichzeitig einen literarischen Bericht über die Kultur des Reisens vor, der so bereichernd wie beglückend ist. "Ein in jeder Hinsicht großartiges Buch!" Neue Zürcher Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 809
Ähnliche
José Saramago
Die portugiesische Reise
Aus dem Portugiesischen von Karin von Schweder-Schreiner und Nicolai von Schweder-Schreiner
Hoffmann und Campe
Denen, die mir Türen öffneten und Wege zeigten – und auch in Erinnerung an Almeida Garrett, den Meister der Reisenden
Einführung
Schlecht ist es um ein Werk bestellt, verlangt es nach einem Vorwort, das es erklärt, und schlecht um das Vorwort, will es dieses leisten. Einigen wir uns also darauf, dieses hier nicht als Vorwort anzusehen, sondern einfach als einen Hinweis oder eine Warnung, so wie jene letzte Nachricht, die der Reisende, bereits in der Tür, die Augen gen Horizont gerichtet, dem Versorger seiner Blumen hinterlässt. Der Unterschied, wenn es denn einen gibt, ist der, dass das hier nicht der letzte Hinweis ist, sondern der erste. Einen weiteren wird es nicht geben.
Der Leser möge sich also damit abfinden, über dieses Buch nicht wie über einen Reiseführer für die Handtasche oder einen Gesamtkatalog verfügen zu können. Die folgenden Seiten eignen sich nicht zum Durchblättern wie in einem Reisebüro oder bei der Touristeninformation: Der Autor will keine Tipps geben, obwohl er einiges zu sagen hätte. Natürlich hat bei den Landschaften und den Stätten der Kunst, also dem natürlichen und dem gestalteten Gesicht Portugals, eine Auswahl stattgefunden, aber es wird in keiner Weise eine Marschroute erstellt, nur weil das aus Gründen der Bequemlichkeit und der Gewohnheit heute üblich ist, wenn man sein Heim verlässt, um die Fremde kennenzulernen. Sicherlich, der Autor war dort, wo man immer hinfährt, aber er war auch dort, wo eigentlich nie jemand hinfährt.
Worin also besteht der Sinn dieses Buches, worin der Nutzen, der sich vielleicht nicht vom ersten Augenblick an erschließt? Diese portugiesische Reise ist eine Geschichte. Die Geschichte eines Reisenden innerhalb der Reise, die er gemacht hat, die Geschichte einer Reise, die einen Reisenden in sich trägt, die Geschichte einer Reise und eines Reisenden, vereint in einer bewussten Verschmelzung dessen, der sieht, und dessen, das gesehen wird, eine nicht immer friedliche Begegnung von Subjektivem und Objektivem. Also: Aufeinanderprallen und Übereinstimmung, Wiedererkennen und Entdeckung, Bestätigung und Überraschung. Der Reisende reist durch sein eigenes Land. Das bedeutet, er reist durch sich selbst, durch die Kultur, die ihn prägte und immer noch prägt, es bedeutet, dass er über viele Wochen ein Spiegel für von außen auf ihn einströmende Bilder war, ein durchsichtiges Fenster, durch das Lichter und Schatten zogen, eine Platine, die auf ihrer Reise Eindrücke und Stimmen, das endlose Murmeln eines Volkes in sich aufnahm.
Dieses will das Buch sein, und es vermutet, es bis zu einem gewissen Grad erreicht zu haben. Nehme der Leser die folgenden Seiten als Herausforderung und Einladung an. Reise nach deinem eigenen Plan und lass dich nicht von der Bequemlichkeit der üblichen Routen und ausgetretenen Pfade locken, auch auf die Gefahr hin, dich zu verirren und umkehren zu müssen, oder, ganz im Gegenteil, auf dem eingeschlagenen Pfad zu bleiben und dabei ungewohnte Wege in die Welt zu finden. Eine bessere Art zu reisen gibt es nicht. Und wenn es das eigene Wahrnehmungsvermögen erlaubt, schreib auf, was du gesehen und gefühlt, was du gesagt und gehört hast. Nimm also dieses Buch als Beispiel und nicht als Vorlage. Das Glück, dies möge der Leser wissen, hat viele Gesichter. Das Reisen ist wahrscheinlich eines davon.
Überlass deine Blumen jemandem, der damit umzugehen weiß, und fahr los. Oder fahr weiter. Denn keine Reise hat ein Ende.
Von Nordosten nach Nordwesten, Kargheit und Glanz
Predigt an die Fische
Der Grenzbeamte kann sich nicht erinnern, so etwas schon einmal erlebt zu haben. Dieses ist der erste Reisende, der mitten auf dem Weg den Wagen anhält, mit dem Motor schon in Portugal, aber dem Tank noch in Spanien, und auf genau dem Zentimeter aus dem Fenster sieht, auf dem die unsichtbare Grenze verläuft. Und nun hört man über den dunklen, tiefen Wassern, zwischen den hohen Felswänden, die das Echo hin und her werfen, die Stimme des Reisenden, der zu den Fischen im Fluss predigt:
»Kommt her, Fische, ihr vom rechten Ufer, die ihr aus dem Rio Douro stammt, und ihr vom linken Ufer aus dem Rio Duero, kommt alle her und sagt mir: Welche Sprache sprecht ihr, wenn ihr die Unterwassergrenzen kreuzt? Und habt auch ihr dort unten Pass und Stempel? Hier stehe ich und blicke von der Talsperre hier oben zu euch herab, und ihr hinauf zu mir, die ihr in diesen sich mischenden Wassern lebt und bald auf der einen, bald auf der anderen Seite seid, eine große Bruderschaft von Fischen, die einander fressen, weil sie hungrig sind, und nicht, weil es der Patriotismus verlangt. Erteilt mir, Fische, eine klare Lektion, auf dass ich sie nicht beim zweiten Schritt, den ich auf dieser meiner Reise nach Portugal tue, vergesse, denn ihr müsst wissen: Von Ort zu Ort will ich darauf achten, was gleich ist und was verschieden, mit der Einschränkung, die nur allzu menschlich und auch euch Fischen nicht fremd ist, dass auch der Reisende Vorlieben und Sympathien hat und nicht der universellen Liebe verpflichtet ist, welche das auch nicht von ihm verlangt. Von euch schließlich, Fische, möchte ich mich verabschieden, bis irgendwann einmal, lebt euer Leben, solange die Fischer nicht vorbeikommen, schwimmt glücklich umher und wünscht mir eine gute Reise, auf Wiedersehen, adieu.«
Ein schönes Wunder für den Anfang. Ein plötzlicher Lufthauch kräuselt die Wasseroberfläche, oder ist es womöglich das Gewimmel der herbeigeeilten Fische, und kaum ist der Reisende verstummt, ist nichts zu sehen als der Fluss und seine steilen Ufer und nichts zu hören als das schläfrige Brummen des Motors. Das ist das Problem mit den Wundern: Sie dauern nicht lange an. Aber der Reisende ist nicht von Beruf aus Wundertäter, sie geschehen ihm versehentlich, deswegen ist er bereits wieder gefasst, als er zum Wagen zurückkehrt. Er weiß, dass er ein Land betritt, das reich an Übernatürlichem ist, und gleich die erste Stadt in Portugal, in die er kommt und deren Name Miranda do Douro lautet, liefert dafür ein prächtiges Beispiel. Er wird gezwungen, hinter seinen eigenen Vorstellungen zurückzustehen und lernbereit zu sein. Für Wunder und für alles andere.
Es ist ein Nachmittag im Oktober. Der Reisende öffnet das Fenster des Zimmers, in dem er die Nacht verbringen wird, und erkennt auf den ersten Blick, dass er großes Glück hat. Das Fenster hätte auf eine Mauer, ein brachliegendes Stück Boden, einen Hinterhof mit hängender Wäsche hinausgehen können, und dann hätte er sich mit der Zweckmäßigkeit, der Dekadenz, dem schnöden Trockenplatz zufriedengeben müssen. Was er aber sieht, ist das steinige spanische Ufer des Rio Douro, von solch hartnäckiger Beschaffenheit, dass selbst das Gestrüpp kaum Wurzeln fasst, und weil das Glück nie allein kommt, steht die Sonne in einem Winkel, dass sich die Felswand in ein riesiges abstraktes Gemälde in verschiedensten Gelbtönen verwandelt und er diesen Ort nicht mehr verlassen will, solange das Licht da ist. In diesem Augenblick weiß der Reisende noch nicht, dass er ein paar Tage später in Bragança sein wird, im Museum des Abtes von Baçal, und auf denselben Fels und vielleicht dieselben Gelbtöne blicken wird, diesmal auf einem Gemälde von Dórdio Gomes. Und sicher wird er den Kopf schütteln und murmeln: »Wie klein die Welt doch ist …«
In Miranda do Douro zum Beispiel kann sich bestimmt niemand verlaufen. Wir gehen die Rua da Costanilha hinunter, mit ihren Häusern aus dem 15. Jahrhundert, und ehe wir es uns versehen, kommen wir durch ein Tor in der Mauer aus der Stadt hinaus und blicken auf die weiten Täler, die sich gen Westen erstrecken, und eine tiefe mittelalterliche Stille umgibt uns. Was ist das für eine Zeit, was sind das für Menschen, fragt man sich. An der einen Seite des Tores steht eine Gruppe von Frauen, die mit leiser Stimme sprechen, alle in Schwarz gekleidet. Keine von ihnen kann man als jung bezeichnen, und kaum eine von ihnen erinnert sich wahrscheinlich daran, es je gewesen zu sein. Der Reisende trägt um die Schulter, wie es sich gehört, den Fotoapparat, aber es ist ihm unangenehm; die Unverfrorenheit vieler Reisender ist ihm noch fremd, und daher gibt es kein Erinnerungsfoto von diesen geheimnisvollen Frauen, die dort seit Anbeginn der Welt stehen und reden. Der Reisende wird melancholisch; wenn eine Reise so beginnt, kann das nichts Gutes verheißen. Er verfällt ins Grübeln, zum Glück nur für kurze Zeit: Ganz in der Nähe, außerhalb der Mauern, brüllt der Motor einer Planierraupe auf, dort wird eine neue Straße gebaut, der Fortschritt vor den Toren des Mittelalters. – Er geht die Rua da Costanilha wieder hinauf, läuft durch stille, menschenleere Straßen, niemand steht an den Fenstern, apropos Fenster, in dem schönen alten Stein aus dem 15. Jahrhundert entdeckt er Anzeichen von vergangenem Groll gegen die Spanier, in Form von kleinen obszönen Schnitzereien. Er muss schmunzeln angesichts dieser befreienden Skatologie, die sich weder vor Kinderaugen noch verärgerten Moralhütern fürchtet. In fünfhundert Jahren hat niemand daran gedacht, diese Unverschämtheit zu entfernen, ein unverhoffter Beweis dafür, dass den Portugiesen der Humor doch nicht ganz fremd ist, auch wenn vielleicht nur in patriotischen Belangen. Von der Brüderlichkeit der Fische im Rio Douro hat man hier nichts gelernt, aber vielleicht gibt es dafür gute Gründe. Denn da eines Tages die himmlischen Mächte im Kampf gegen die Spanier auf Seiten der Portugiesen standen, wäre es doch merkwürdig gewesen, wenn die Menschen auf dieser Seite des Flusses sich darüber hinweggesetzt hätten. Der Fall ist schnell erzählt.
Die Restaurationskriege waren gerade in vollem Gange, es war also Mitte des 17. Jahrhunderts, und Miranda do Douro, am Ufer des Rio Douro, lag sozusagen nur einen Katzensprung von der Inangriffnahme durch den Feind entfernt. Es herrschte Belagerungszustand, der Hunger war groß, die Belagerten gaben alle Hoffnung auf, Miranda schien verloren. Und da taucht unversehens, so erzählt man sich, ein Knabe auf und ruft das müde Volk zu den Waffen, flößt ihm Mut und Kraft ein, wo diese schon verloren schienen, und mit einem Mal erheben sich all die Schwachen und Mutlosen, greifen zu den Waffen, nehmen, was immer sie finden, und folgen dem Kind gegen die Spanier, als gälte es, das frische Korn zu dreschen. Die Belagerer geschlagen, feiert Miranda do Douro seinen Sieg und schreibt ein neues Kapitel der Kriegsannalen. Aber wo ist der Anführer dieser Armee? Wo der edle Kämpfer, der den Kreisel gegen den Stab des Feldmarschalls eintauschte? Er ist weg, keiner kann ihn finden, niemand hat ihn mehr gesehen. Also war es ein Wunder, sagen die Bewohner Mirandas. Es muss das Jesuskind gewesen sein.
Der Reisende stimmt dem zu. Wenn er mit den Fischen sprechen kann und sie ihm zuhören, dann gibt es keinen Grund, den alten Kriegsberichten keinen Glauben zu schenken. Zumal er ja hier zu sehen ist, der Menino Jesus da Cartolinha, zwei Handbreit groß, am Gürtel das silberne Schwert, die rote Schärpe um Schulter und Hüfte, das weiße Tuch um den Hals und die Zylinderkappe oben auf dem runden Knabenkopf. Das ist nicht das Kriegsgewand, nur ein Teil seiner bequemen Alltagsgarderobe, die der Küster der Kathedrale dem Reisenden zeigt. Der Küster weiß um seine Aufgabe als Fremdenführer, und da er feststellt, dass der Reisende ein aufmerksamer Beobachter ist, führt er ihn zu einem Seitengebäude, wo einige Statuen zum Schutze vor Gaunern und Gelegenheitsdieben aufbewahrt werden. Hier erhärtet sich sein Verdacht. Eine kleine Tafel, in Hochrelief geschnitzt, überzeugt den Reisenden endlich, dass er in Sachen Wunder ein Anfänger ist. Da ist der heilige Antonius, der den Kniefall eines Schafes entgegennimmt, das damit seinem ungläubigen Hirten eine vorbildliche Glaubenslektion erteilt, denn dieser hatte sich über den Heiligen lustig gemacht, und auf dem Bild sieht man ihn voller Scham, also darf er vielleicht noch auf Erlösung hoffen. Der Küster erklärt, die Tafel wäre sehr bekannt, aber nur wenige hätten sie wirklich gesehen. Unnötig zu erwähnen, dass der Reisende außer sich vor Stolz ist. Er kommt von so weit her, ohne jede Empfehlung, und nur weil er wie ein ehrlicher Mensch aussieht, vertraut man ihm diese Geheimnisse an.
Die Reise steht noch ganz am Anfang, und gewissenhaft, wie er nun mal ist, überkommen den Reisenden bereits erste Zweifel. Was ist denn das für eine Art zu reisen? Mal eben durch dieses Städtchen Miranda do Douro laufen, die Kathedrale besuchen, den Küster, die Cartolinha und das Schaf, und, kaum ist das erledigt, ein Kreuz auf die Karte machen, sich auf den Weg begeben und wie der Barbier, der das Handtuch ausschüttelt, rufen: »Der Nächste bitte.« Reisen sollte anders, etwas anderes sein, es geht mehr darum, an einem Ort zu sein, als sich fortzubewegen. Vielleicht sollte man auch den Beruf des Reisenden einführen, aber das ist nur etwas für Menschen, die wirklich dazu berufen sind, wer meint, das sei eine Arbeit, die wenig Verantwortung erfordere, irrt gewaltig, jeder Kilometer zählt nicht weniger als ein Jahr im Leben. Während er sich mit diesen Betrachtungen abmüht, schläft der Reisende schließlich ein, und als er morgens aufwacht, ist da immer noch der gelbe Fels; das ist das Schicksal der Steine, sie bleiben stets am selben Ort, es sei denn, es kommt ein Maler und nimmt sie in seinem Herzen mit.
Als er Miranda do Douro verlässt, schärft der Reisende noch einmal den Blick, auf dass ihm ja nichts entgeht, und so bemerkt er einen kleinen Fluss, der dort verläuft. Nun haben Flüsse ja bekanntlich Namen, und wie heißt wohl dieser hier, der ganz in der Nähe in den üppigen Douro fließt? Wer es nicht weiß, der fragt nach, und wer nachfragt, bekommt manchmal eine Antwort: »Entschuldigen Sie, wie heißt dieser Fluss?« »Er heißt Fresno.« »Fresno?« »Ja, Fresno.« »Aber fresno ist doch ein spanisches Wort, auf Portugiesisch sagt man freixo (dt. Esche). Warum heißt er denn nicht Rio Freixo?« »Das kann ich Ihnen nicht sagen. Der heißt schon immer so.« Trotz all der Kämpfe gegen die Spanier, der Schmierereien an den Häuserwänden und der Unterstützung vom Jesuskind fließt hier also immer noch heimlich dieser Fresno zwischen seinen lieblichen Ufern entlang und lacht sich über den Patriotismus des Reisenden ins Fäustchen. Dieser erinnert sich an die Fische, an die Predigt, die er ihnen gehalten hat, bis ihm plötzlich kurz vor dem Dorf Malhadas eine Idee kommt: »Wer weiß, vielleicht ist fresno auch ein Wort aus dem Mirandés-Dialekt?« Er will später jemanden fragen, aber dann vergisst er es, und als es ihm irgendwann wieder in den Sinn kommt, beschließt er, der Angelegenheit keine Bedeutung mehr beizumessen. In seinem Sprachgebrauch ist fresno jedenfalls ab jetzt portugiesisch.
Malhadas liegt ein wenig abseits der Hauptstraße nach Bragança. Hier in der Nähe gibt es Überbleibsel einer römischen Straße, zu der der Reisende nicht fahren wird. Aber als er sie einem Bauer und seiner Bäuerin, die er auf dem Weg ins Dorf trifft, gegenüber erwähnt, entgegnen sie: »Ah, Sie meinen die maurische Straße.« Dann eben die maurische Straße. Was den Reisenden viel mehr interessiert, ist das Warum und Woher dieses Traktors, von dem der Bauer mit der Unbefangenheit eines Besitzers absteigt. »Ich habe nur wenig Land. Für mich allein käme er nicht in Frage. Aber ich verleihe ihn manchmal an die Nachbarn, und so kommen wir über die Runden.« Und so unterhalten sich die drei ein wenig, sprechen von den Schwierigkeiten, die Kinder zu ernähren, und es ist nicht zu übersehen, dass ein weiteres auf dem Weg ist. Als der Reisende sagt, er sei auf dem Weg nach Vimioso und wolle auf dem Rückweg wieder hier vorbeikommen, lädt die Bäuerin ihn ein, ohne ihren Mann um Erlaubnis bitten zu müssen: »Wir wohnen in dem Haus da vorne, essen Sie doch mit uns.« Man merkt, dass es von Herzen kommt, dass, egal wie viel im Topf ist, ungleich geteilt würde und der Reisende mit Sicherheit den größten und besten Teil auf seinem Teller hätte. Der Reisende bedankt sich herzlich und sagt, er werde ein andermal darauf zurückkommen. Der Traktor entfernt sich, die Frau kehrt ins Haus zurück. »Sind alles arme Hütten«, hatte sie noch gesagt, und der Reisende kommt kaum dazu, sich ein wenig im Dorf umzusehen, weil plötzlich eine gigantische schwarze Schildkröte vor ihm auftaucht, die Kirche des Ortes, mit unglaublich dicken Mauern und weit auslaufenden Widerlagern, den Füßen des Tieres. Im 13. Jahrhundert, und speziell hier in Trásos-Montes, wusste man anscheinend nicht viel über die Beschaffenheit von Baumaterialien, oder aber der Erbauer hatte kein großes Vertrauen in die Gesetze dieser Welt und beschloss, für die Ewigkeit zu bauen. Der Reisende geht hinein und lässt den Blick umherschweifen, vom Glockenturm zum Dach und dann weiter in die Ferne, ein wenig enttäuscht darüber, dass die Landschaft hier in Trás-os-Montes nicht in steile Abgründe und tiefe Täler fällt, wie es seiner Vorstellung nach hätte sein müssen. Aber alles zu seiner Zeit, dieses hier ist schließlich eine Hochebene, und der Reisende sollte seine Phantasie nicht schelten, zumal sie ihm bereits gut von Nutzen war, als sie aus der Kirche eine Schildkröte machte: Nur wer selbst dort gewesen ist, weiß, wie gerechtfertigt und passend der Vergleich ist. Zwei Wegstunden entfernt liegt Caçarelhos. Hier wurde Camilo zufolge seine Figur Calisto Elói de Silos e Benevides de Barbuda geboren, Agra de Freimas ältester Sohn und komisch-dümmlicher Held aus Queda Dum Anjo, einem äußerst amüsanten und gelegentlich etwas melancholischen Roman. Besagtem Camilo könnte dieselbe scharfe Kritik zuteilwerden wie Francisco Manuel do Nascimento, dem man vorwarf, sich über Samardã lustig gemacht zu haben, wie zuvor schon andere Dichter über die Dörfer Maçãs de Dona Maria, Ranhados oder Cucujães gespottet hatten. Indem Elói mit Caçarelhos in Verbindung gebracht wurde, gab man den Ort der Lächerlichkeit preis. Oder sollte es vielleicht ein Denkfehler sein, wenn wir meinen, die Schuld dem Ort geben zu können und nicht denen, die dort geboren sind. Der Apfel ist madig, weil der Baum krank ist, und nicht, weil der Boden vergiftet ist. Es sei also gesagt, dass dieses Dorf von keinem anderen Übel befallen ist als dem, am Ende der Welt zu liegen, und auch sein Name hat wahrscheinlich nicht das Geringste damit zu tun, was man im Minho sagt, nämlich dass ein caçarelho ein Schwätzer ist, der kein Geheimnis für sich behalten kann. Caçarelhos wird seine Geheimnisse haben: Dem Reisenden jedoch hat sie niemand erzählt, als er über den Marktplatz ging, wo heute Vieh verkauft wird, wunderbare honigfarbene Rinder, Augen wie Rettungsbojen der Zärtlichkeit und Lippen, weiß wie Schnee, die friedlich und gelassen wiederkäuen, während ihnen ein Sabberfaden aus dem Maul läuft, das Ganze unter einem Wald von Leiern, ihrem Hornwerk, dem natürlichen Resonanzkörper für das Gebrüll, das hin und wieder aus der Menge aufsteigt. Sicherlich birgt dies Geheimnisse, aber keine, die sich mit Worten erzählen ließen. Einfacher ist es, das Geld zu zählen, soundso viel für den Ochsen, nimm mit, das Tier, das ist ein guter Kauf.
Die Kastanienbäume sind bedeckt mit kleinen stachligen Früchten, sie erinnern an Horden von Grünfinken, die auf den Ästen rasten, um Kraft für den langen Flug in den Süden zu sammeln. Der Reisende ist ein sentimentaler Mensch. Er hält an, reißt eine stachlige Kastanie ab und behält sie mehrere Monate lang als Souvenir, bis sie vertrocknet ist. Er muss sie nur in die Hand nehmen, und schon sieht er den großen Kastanienbaum am Straßenrand vor sich und spürt die lebendige Morgenluft. Eine Kastanie kann so viel verheißen.
Die Straße führt in Kurven hinab nach Vimioso, der Reisende ist glücklich und murmelt: »Was für ein schöner Tag.« Am Himmel ziehen vereinzelte weiße, flockige Wolken vorbei, die ihre Schatten über die Felder gleiten lassen, ein leichter Wind weht, es scheint, als habe die Welt gerade erst angefangen zu existieren. Vimioso liegt an einem flachen Hang, ein ruhiger kleiner Ort, jedenfalls erscheint es dem Durchreisenden so, der nicht lange bleiben will, nur so lange, um von einer Frau ein paar Informationen zu bekommen. Hier wird er zum ersten Mal enttäuscht. So hilfsbereit war seine Informantin, fast hätte sie ihm alle Sehenswürdigkeiten des Städtchens gezeigt, und in Wirklichkeit wollte sie ihm nur ihre selbstgenähten Handtücher verkaufen. Das kann man ihr nicht übelnehmen, aber der Reisende ist noch nicht lange unterwegs, er denkt, die Welt hätte nichts anderes zu tun, als ihm weiterzuhelfen. Er geht eine Straße hinunter, und dort wird er entschädigt. Natürlich gewinnt in seinen Augen, die die sakrale Architektur auf dem Land nicht gewohnt sind, alles schnell den besonderen Reiz des Wunderbaren, aber es bereitet tatsächlich große Freude, die Kontraste zu entdecken zwischen einer Fassade aus dem 17. Jahrhundert, robust, aber mit ersten Zeichen einer gewissen barocken Kälte, und dem Inneren des Kirchenschiffs, weitläufig und niedrig, mit einer Atmosphäre von Romanik, die von keinem architektonischen Element belegt wird. Aber die eigentliche Belohnung ist die Geschichte, die der Reisende draußen im Schatten der Bäume, auf den Stufen, die in den Kirchhof führen, über den Bau dieser Kirche zu hören bekommt. Unter der Bedingung, eine eigene Kapelle zu erhalten, stellte eine Familie ein Ochsengespann für den Transport der Steine zur Errichtung der Kirche zur Verfügung. Die Tiere brauchten zwei Jahre dafür, und der Weg vom Steinbruch bis zu den Unterständen der Maurer war so exakt bemessen, dass man bald nur noch den Wagen beladen und »Ho!« rufen musste, worauf sie ohne Gespannführer unter dem Ächzen der ungeschmierten Räder durch die Einöde jagten und dabei lange Gespräche über den Hochmut von Menschen und Familien führten. Der Reisende will wissen, was für eine Kapelle das war und ob es noch irgendwelche Nachkommen gab, die das Nutzungsrecht hatten. Das konnte man ihm nicht sagen. Es gab keine besonderen Anzeichen dafür, aber sie mochten durchaus existieren. Was bleibt, ist die Geschichte einer Familie, die nichts von sich hergab außer einem Ochsenpaar, das ihnen, unter großen Mühen, die Straße ins Paradies ebnen sollte.
Der Reisende fährt denselben Weg zurück, den er gekommen ist, und in Malhadas gerät er in Versuchung, der Einladung zum Essen nachzukommen, aber er traut sich nicht, auch wenn er weiß, dass er das später bereuen wird. In Duas Igrejas leben die Stocktänzer, die sogenannten pauliteiros. Er erfährt rein gar nichts über sie; aber es ist auch nicht die richtige Uhrzeit, um Tänzer mit ihren Stöcken durch die Gegend laufen zu sehen. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass der Reisende ein Recht auf seine Phantasien hat, und der Gedanke, wie viel schöner und aufregender doch dieser Tanz wäre, kreuzten die Männer statt ihrer Stöckchen Säbel oder Dolche, existiert nicht erst seit gestern. Dann hätte auch unser Menino Jesus da Cartolinha einen guten Grund, einen militärischen nämlich, dieser Armee bestickter Westen und Halstücher einen Besuch abzustatten. Das ist das Problem mit dem Reisenden: Das Gute ist ihm nie genug. Die pauliteiros mögen es ihm verzeihen.
Als er nach Sendim kommt, ist Mittagszeit. Was und wo soll er essen? Jemand sagt zu ihm: »Gehen Sie die Straße dort bis zum Ende. Sie kommen auf einen Platz, und da gehen Sie ins Restaurante Gabriela. Fragen Sie nach Senhora Alice.« Diese Vertrautheit gefällt dem Reisenden. Die Kellnerin sagt, Senhora Alice sei in der Küche. Der Reisende späht durch die Tür, großartige Essensdüfte liegen in der Luft, in einem Kessel köchelt Gemüse, und von der anderen Seite des großen Tisches, der in der Mitte des Raumes steht, fragt ihn Senhora Alice, was er essen wolle. Der Reisende ist es gewohnt, eine Speisekarte zu bekommen und daraus misstrauisch etwas auszuwählen, und jetzt muss er fragen, was es gibt, und Senhora Alice empfiehlt ihm das Kalbsfilet à la Mirandesa. Der Reisende ist einverstanden, setzt sich an seinen Tisch, und als Appetithappen bringt man ihm eine deftige Gemüsesuppe, Wein und Brot. Was ist das für ein Kalbsfilet? Und warum überhaupt Filet? In was für einem Land bin ich hier eigentlich, fragt der Reisende seinen Wein im Glas, der nicht antwortet, sich aber gütigerweise trinken lässt. Zum Fragen ist kaum Zeit. Auf einer Platte kommt das riesige Kalbsfilet; es schwimmt in einer Essigsoße und muss in der Mitte durchgeschnitten werden, damit es auf den Teller passt, sonst würde es auf das Tischtuch tropfen. Der Reisende glaubt zu träumen. Butterweiches Fleisch, genau richtig gebraten, und diese Soße, die die Wangenknochen schimmern lässt, der fleischliche Beweis dafür, dass der Körper Glück empfinden kann. Der Reisende isst in Portugal, vor seinem Auge sieht er vergangene und zukünftige Landschaften vorbeiziehen, während er Senhora Alice aus der Küche rufen hört und das Serviermädchen lacht und die Zöpfe schüttelt.
Ein Himmelbett und schlechte Straßen
Der Reisende stammt aus einer flachen Gegend, weit unten im Süden, und da er nicht viel über die Berge weiß, hatte er sie sich größer vorgestellt. Das wurde bereits gesagt und soll hier noch einmal erwähnt werden. Sicherlich mangelt es nicht an Erhöhungen, aber es sind doch alles Hügel in einem einheitlichen Bild, wirklich hoch nur in Relation zum Meeresspiegel, sonst Schulter an Schulter ordentlich im Profil nebeneinander aufgereiht. Erst wenn der eine oder andere sich ein wenig höher hinauswagt, bekommt der Reisende einen Eindruck von Größe, was aber eher für einen voluminösen Gebirgszug in der Ferne gilt als für das, was direkt vor ihm steht. Kommt er dann näher, ist der Unterschied doch nicht mehr so groß, aber einen kurzen Augenblick lang war es immerhin eine Verheißung.
Die Eisenbahnlinie, die die Straße entlangführt, sieht aus wie eine Spielzeugbahn oder ein Überbleibsel aus einer vergangenen Zeit. Der Reisende, dessen Kindheitstraum es war, Lokführer zu sein, kann sich nicht vorstellen, dass Lokomotive und Waggons von heute sind, sie wirken eher wie Museumsobjekte, denen der Wind, der aus den Bergen kommt, die Spinnweben nicht zu entreißen vermag. Die Linie heißt Sabor, benannt nach dem Fluss, der sich auf dem Weg zum Douro hin und her schlängelt, aber worin der Reiz dieser alten Wagen liegt, das kann der Reisende nicht sagen.
Ohne zu bemerken, dass er das Gebirge jetzt hinter sich gelassen hat, kommt der Reisende nach Mogadouro. Der Nachmittag geht zu Ende, es ist noch hell, und oben von der Burg kann man die Männer und Frauen des Ortes bei der Arbeit beobachten. Alle Hänge ringsum sind bebaut, ein Puzzle aus Feldern und Wiesen, einige riesige und andere ganz kleine, die nur die Lücken zwischen den großen zu füllen scheinen. Der Blick ruht sich aus, der Reisende wäre vollends glücklich, hätte er nicht ein schlechtes Gewissen, weil er ein Liebespaar beim Turteln aus dem Schutz der Mauern vertrieben hat. Hier in Mogadouro zeigt sich wieder einmal der alte Konflikt zwischen Absicht und Wirkung.
In Azinhoso, einem kleinen Dorf in der Nähe, keimt schließlich die Leidenschaft des Reisenden für die ländliche Romanik des Nordens auf. Der Schnitt der winzigen Kirchen ist nie zu kühn, er ist ein altes Rezept, das von weit her kommt und nur zum Ruhme des jeweiligen Bauherrn leicht variiert wird; aber wer meint, hätte man eine gesehen, hätte man alle gesehen, der irrt gewaltig. Man muss sich genau umschauen, ganz still sein und warten, dass die Steine mit einem sprechen, und wenn man Geduld hat, so wird man schließlich nur ungern gehen. Man wird es bedauern, nicht länger bleiben zu können, denn es genügt nicht, eine Viertelstunde in einem Gebäude zu verweilen, das siebenhundert Jahre alt ist, so wie hier in Azinhoso. Vor allem, wenn dann Menschen kommen, die sich mit dem Reisenden unterhalten wollen, Menschen, denen man zuhören sollte, weil sie die Erben dieser sieben Jahrhunderte sind. Der kleine Kirchhof ist mit Gras bedeckt, der Reisende stellt seine schweren Stiefel ab und fühlt sich, ohne zu wissen, warum, rehabilitiert. Je länger er darüber nachdenkt, desto sicherer ist er sich, dass dieses genau das richtige Wort ist, dieses und kein anderes, und er kann es nicht erklären.
Bald wird es Abend sein, im Oktober ist es früh Abend, und der Himmel ist bedeckt mit dunklen Wolken, vielleicht regnet es morgen. In Castelo Branco, fünfzehn Kilometer Richtung Süden, ist die Luft wie durch ein Sieb gefiltert, einzigartig in der Farbe, so rein, dass sich selbst die Lungen wundern. Am Straßenrand steht im hellen Sonnenlicht die Fassade eines stattlichen Hauses mit großen Zinnen. Gäbe es in Portugal Gespenster, dann wäre das der richtige Ort, um Reisenden einen Schrecken einzujagen: Licht hinter zerbrochenen Fensterscheiben und klappernde Zähne und Ketten. Aber vielleicht ist dieser Verfall bei Tageslicht ja weniger deprimierend.
Als der Reisende nach Torre de Moncorvo kommt, ist es schon spät am Abend. Er hält es für unhöflich, um diese Zeit in einen Ort zu kommen. Orte sind wie Menschen, wir müssen uns ihnen langsam nähern, ganz allmählich, nicht einfach plötzlich unter dem Mantel der Dunkelheit eindringen wie maskierte Straßenräuber. Gut, dass sie sich zu wehren wissen. Sie bringen Hausnummern und Straßennamen, wenn überhaupt, in unerreichbarer Höhe an, lassen einen Platz wie den anderen aussehen und setzen uns nach Belieben, um den Verkehr zum Erliegen zu bringen, einen grinsenden Politiker auf Stimmenfang samt Anhängerschaft vor die Nase. So war es in Torre de Moncorvo. Das Schlimmste ist, dass der Reisende auf dem Weg zu einem Landgut ist, das hinter der Stadt im Vale da Vilariça liegt, und die Nacht ist so schwarz, dass man nicht weiß, ob der steile Hang an der Straße nach oben oder nach unten geht. Der Reisende befindet sich in einem Tintenfass, nicht einmal die Sterne helfen, der ganze Himmel ist eine einzige dunkle Wolke. Schließlich gelangt er nach einigen Irrwegen ans Ziel, wo ihn unverschämte Hunde anbellen, bevor er im Haus mit einem Lächeln und offenen Armen empfangen wird. Hohe, ungeheure Eukalyptusbäume machen die Nacht draußen noch dunkler, aber es dauert nicht lange, und das Essen steht auf dem Tisch und nach dem Essen ein Glas Portwein, solange noch nicht Schlafenszeit ist, und als es so weit ist, zeigt man ihm das Zimmer, ein Himmelbett, so hoch, dass der Reisende, nur weil er selbst groß ist, auf den kleinen Tritt davor, verzichten kann. Welch eine tiefe Stille hier im Vilariçatal herrscht, wie tröstlich die Freundschaft, der Reisende ist kurz davor, einzuschlafen. Wer weiß, vielleicht hat schon Seine Majestät der König in diesem Himmelbett geschlafen, oder, was noch besser wäre, Ihre Hoheit, die Prinzessin.
Am nächsten Morgen wacht er früh auf. Das Bett ist nicht nur hoch, sondern auch enorm groß. An den Wänden hängen Bilder von Menschen aus vergangenen Zeiten, die den Eindringling streng ins Visier nehmen. Er hört Lärm. Der Reisende steht auf, öffnet das Fenster und sieht einen Hirten mit seinen Schafen, die Zeiten haben sich geändert, dieser Hirte benimmt sich gar nicht wie in einer dieser idyllischen Geschichten, er hebt nicht den Kopf, nimmt seinen Hut nicht ab und sagt auch nicht: »Gott schütze Sie, mein Herr.« Wäre er nicht so beschäftigt, würde er dem Reisenden wenigstens einen »Guten Tag« wünschen, und etwas Besseres, als dass er gut wird, kann man sich von einem Tag doch nicht wünschen.
Der Reisende verabschiedet sich und bedankt sich für die Übernachtung, und bevor er sich wieder auf den Weg macht, fährt er noch einmal zurück nach Torre de Moncorvo. Er will das Städtchen nicht in schlechter Erinnerung behalten, das hat es nicht verdient. Jetzt, wo es hell ist, wenn auch bewölkt, braucht er keine Straßenschilder mehr. Da vorn ist die Kirche, mit ihrem Renaissance-Portal und dem hohen Glockenturm, der ihr das Aussehen einer Festung verleiht, ein Eindruck, der durch die langen Mauern, die sie umgeben, noch verstärkt wird. Das dreischiffige Innere weist dicke zylindrische Säulen auf. Wenn während militärischer Unruhen das Tor verschlossen war, hätten die Feinde ordentlich graben und kratzen müssen, um ihre eigenen Messen abhalten zu können. Aber die Ruhe, mit der der Reisende hier umhergeht, lässt ihn Gefallen finden an dem holzgeschnitzten Triptychon, das Szenen aus dem Leben der heiligen Anna und dem des heiligen Joachim zeigt, und auch an anderen nicht weniger wertvollen Exponaten. Ebenfalls aus der Renaissance zu stammen scheint die Kirche Igreja da Misericórdia, und allein die Kanzel aus Granit mit ihrem Figurenrelief lohnt einen Besuch in Torre de Moncorvo.
Doch nun führt den Reisenden seine Route weg von der Kunst. Gleich hinter der Brücke über den Vilariça hat er einen schlechten Weg eingeschlagen, der ihn immer weiter eine scheinbar endlose Straße hinaufführt, sodass der Reisende angesichts der kahlen Berge, die von beiden Seiten hinunter ins Tal fallen, fürchtet, ein Windstoß könnte ihn in die Luft heben, eine andere Art der Fortbewegung, deren Ziel sehr viel unangenehmer wäre. Jedenfalls fühlt er sich angesichts dieser Weite der Landschaft, als hätte er Flügel. Die nächsten Monate über ist hier alles voller blühender Mandelbäume. Der Reisende gibt sich seiner Phantasie hin, aus der Erinnerung sucht er zwei Bilder von blühenden Bäumen aus, die besten, einen rosa und einen weißen, und multipliziert beide mit tausend oder mit zehntausend. Ein Bild blendender Schönheit. Nicht weniger schön ist dieses überaus fruchtbare Tal, sehr viel besser dran als die Felder im Ribatejo, die statt mit nahrhaftem Schlick mit Sandboden geschlagen sind. Hier fließt das Wasser des Flusses mit dem Rio Sabor zusammen und wird dann vom reißenden Strom des Douro abgedrängt, woraufhin es sich über das ganze Tal verteilt und den Boden mit Nährstoffen versorgt. Das ist die rebofa, sagen die Leute hier, für die der Winter, solange er nicht über die Stränge schlägt, eine gesegnete Jahreszeit ist.
Diese Straße führt nach Estevais, dann nach Cardanha und Adeganha. Der Reisende kann nicht überall anhalten, an jede Tür klopfen und Fragen stellen und sich in das Leben der Leute einmischen. Aber da er sich nun mal von seinen Neigungen nicht frei machen kann und es auch gar nicht will und ihn fasziniert, was die Menschen mit ihren Händen geschaffen haben, fährt er bis Adeganha, wo es eine besonders schöne kleine romanische Kirche geben soll. Bevor er sich danach erkundigt, bestaunt er die große, einzigartige Granitfläche inmitten des Ortes, die als Platz, Tenne und Bett für das Mondlicht dient. Rundherum stehen Häuser, wie sie sonst nur in den entlegensten Ecken von Trás-os-Montes zu finden sind, Stein auf Stein gebaut, den Türsturz direkt unterm Dach, im oberen Stockwerk die Menschen, unten die Tiere. Das Land des gemeinsamen Schlafes. Hier könnte man den Satz zu hören bekommen: »Ich und mein Ochse schlafen unter einem Dach.« Jedes Mal, wenn der Reisende mit solchen Lebensformen konfrontiert wird, macht es ihn verlegen. Wird er sich morgen, wenn er in die Stadt kommt, noch daran erinnern? Und wenn, wie wird er sich daran erinnern? Glücklich? Oder unglücklich? Oder beides? Ja, ja, es ist schön und gut, von der Brüderlichkeit der Fische zu predigen. Aber was ist mit der der Menschen?
Hier ist nun die Kirche. Man hat nicht übertrieben, als man sie ihm beschrieb. In diesen Höhen, von Winden umtost, unter der Geißel von Kälte und Sonnenglut, trotzt der kleine Tempel heldenhaft dem Lauf der Jahrhunderte. Die Kanten sind abgebrochen, die Figuren auf dem Mauervorsprung ringsum haben ihre Form verloren, aber nur schwerlich wird man auf größere Reinheit und verklärtere Schönheit stoßen. Diese Kirche, die Igreja de Adeganha, ist etwas, das man im Herzen trägt, wie der gelbe Fels von Miranda.
Der Reisende fährt eine Straße entlang, die in noch schlimmerem Zustand ist. Die Aufhängung des Wagens knarrt und protestiert, und es ist eine Erlösung, als inmitten all dieses Sumpfes und Schlammes endlich Junqueira auftaucht. Der Ort hat keine besondere Bedeutung. Aber da der Reisende in der Lage ist, sich seine eigenen Kunstwerke zu erfinden, betrachtet er die Fassade einer barocken Kapelle ohne Dach, in der ein üppiger Feigenbaum wächst, der bereits die Giebelhöhe überragt. Durch ein rundes Dachfenster, das Ochsenauge, würde man an die Feigen gelangen, wäre es nicht ein wilder Feigenbaum. Die Begeisterung des Reisenden für diese Dinge sorgt im Ort für Verwunderung. Oberhalb der Mauer erscheint der Kopf eines Mädchens, dann noch einer, schließlich die Mutter der beiden. Der Reisende stellt irgendeine Frage, sie antworten ihm mit ruhiger transmontanischer Stimme, und als die Unterhaltung ihren Gang nimmt, weiß der Reisende bald einiges über die Familie, zum Beispiel die schreckliche Geschichte von verzauberten Prinzessinnen, die in hohen Türmen gefangen gehalten werden, aus der hervorgeht, dass die beiden Mädchen diesen Ort nie verlassen haben, nicht einmal um nach Torre de Moncorvo zu fahren, das nur dreizehn Kilometer entfernt ist. Der Vater lässt sie nicht weg, mit jungen Mädchen ist das so eine Sache, da muss man aufpassen, Sie wissen ja, wie das ist. Der Reisende hat davon gehört, ja, also beschließt er, nicht weiter darauf einzugehen: »Und, wie lebt es sich sonst so hier?« »Mühsam«, antwortet die Frau.
Nach Unterhaltungen dieser Art hat der Reisende immer schlechte Laune. Deswegen hat er kaum Augen für Vila Flor, wo er den Regenschirm aufspannen musste, einem Bekannten eine Nachricht übermittelte und sich den heiligen Michael über dem Kirchenportal ansah. Dem Reisenden ist aufgefallen, dass dem Erzengel in dieser Gegend besondere Verehrung entgegengebracht wird. Schon in Mogadouro hat er ihn gesehen, auf dem Altar der Heiligen Seelen, und auch anderswo, überall sind die Menschen beunruhigt von der Aussicht auf das Fegefeuer. Der Reisende beschließt, statt wie geplant seinen Weg fortzusetzen, dem Portikus dieser Kirche aus dem 17. Jahrhundert größere Aufmerksamkeit zu widmen, was viel Zeit in Anspruch nimmt: Die gewundenen Säulen, die Pflanzenmotive, die geometrischen Formen ergeben ein Ganzes, das ihm in Erinnerung bleiben wird. Ebenfalls in Erinnerung bleibt leider ein Kachelbild, auf dem ein gewisser Trigo de Morais seinen Kindern gute Ratschläge gibt. Die Ratschläge sind nicht schlecht, aber die Idee selbst ist schlimm. Und wie wichtig nimmt sich der Mann, an einem öffentlichen Ort Dinge zu behandeln, die doch hinter verschlossene Türen gehören. Auf dieser Reise durch Portugal begegnet man anscheinend so ziemlich allem.
Es regnet wieder. Auf dem Platz, den der Reisende erreicht, als er um die letzte Ecke biegt, ist niemand zu sehen. Aber beim Überqueren spürt er, dass man ihn durch die Fensterscheiben der Läden hindurch misstrauisch beobachtet. Als der Reisende weiterfährt, hat er das Gefühl, auf seinen Schultern alle Schuld von Vila Flor oder der ganzen Welt zu tragen. Wahrscheinlich ist es auch so.
Rechter Hand in Richtung Norden führen auf- und absteigende Straßen nach Mirandela. Für den Reisenden nur eine Durchgangsstation, dennoch macht er sich bereits auf dem Weg nach Bragança Gedanken über die bisher nicht beachtete Tatsache, dass die Bögen der Brücke, die über den Rio Tua führt, alle verschieden sind, und ob diese Originalität noch von den Römern, den ursprünglichen Erbauern, stammt oder eine Verschönerung aus dem 16. Jahrhundert darstellt, als die Brücke wiederaufgebaut wurde. Es missfällt dem Reisenden zutiefst, die Gründe für eine so einfache Sache nicht zu kennen, dass nämlich eine Brücke zwanzig Bögen hat, von denen keiner dem anderen gleicht. Aber er wird sich damit abfinden müssen: Wie sähe es auch aus, wenn er die stummen Steine danach fragte, während das Wasser unter ihnen hindurchrauscht.
In dieser Gegend gibt es Ortschaften, die man »verschönerte Dörfer« nennt. Es sind dies Vilaverdinho, Aldeia do Couço und Romeu. Aufgrund der Einzigartigkeit des Namens und auch, weil ein großes Schild ein Kuriositätenmuseum ankündigt, entscheidet sich der Reisende für einen Aufenthalt in Romeu. Allerdings war es in Vilaverdinho, wo er erfuhr, dass die Idee für die Verschönerungen von einem ehemaligen Minister für Städtebau stammt, und auch, dass man sich dabei eines »humanen Gedankens« rühmt, worauf in angemessener Inschrift mit umrandeten Buchstaben auf einem riesigen Felsblock am Straßenrand hingewiesen wird, auf dem steht, dass die »Bewohner niemals vergessen werden«, wie zur Einweihung im August 1964 der und der Präsident anwesend war. Solche Inschriften sind immer zweifelhaft, man stelle sich nur zukünftige Historiker und Epigraphiker vor, die diese Steine sehen und glauben, was darauf steht. Vor den Namen des Präsidenten hat jemand »Verbrecher« geschrieben, ein verstörendes Wort, das in künftigen Zeiten vielleicht gar nicht mehr existiert.
In Romeu dann das Museum. Dort gibt es alles nur Erdenkliche zu sehen: Automobile von Dona Elvira, Karren und Pferdegeschirr, Fernsprecher und Bleisulfidradioempfänger, Zithern, Musikboxen, Pianolas, verschiedenste Uhren, einige der ersten Telefone, die es hier gab, Trachten, Fotografien, kurz, ein Sammelsurium an kleinen Schätzen, die einen zum Schmunzeln bringen. Dieses sind die kruden Vorfahren der neuen Technologien, die uns zu ihren Sklaven und zu Ignoranten machen. Der Reisende verlässt das Museum mit einem Achselzucken, dankt aber der Familie Meneres, deren Empfehlung es gewesen war. Man lernt nie aus.
Es nieselt. Der Reisende stellt den Scheibenwischer an und wieder aus, sodass er die Landschaft sehen kann und sie gleich darauf verschwimmt, wie in einem bewegten Aquarium. Linker Hand die Serra da Nogueira, ein ansehnliches Gebirge mit seinen dreizehnhundert Metern Höhe. Ein weiterer Spaß ist das Passieren der Bahnübergänge, die auf seiner Durchreise glücklicherweise alle geöffnet sind. Auf dreißig Kilometern sind es allein fünf: Rossas, Remisquedo, Rebordãos, Mosca und noch einer, dessen Namen er vergessen hat.
Von dieser Anhöhe kann man endlich Bragança sehen. Der Nachmittag geht rasch dem Ende entgegen, der Reisende wird müde. Eine Unruhe, die jeden Reisenden befällt, der Unterschlupf sucht, überkommt ihn. Er muss ein Hotel finden, einen Ort, wo er essen und schlafen kann. Da erscheint ein orangefarbenes Schild: Pousada. Zufrieden biegt er ab, fährt den Hügel hoch und erblickt eine wunderschöne Landschaft in der Dämmerung, bis er zu einem Gebäude kommt, einem Haus, Bauwerk, wie immer man es nennen mag, hier zu nächtigen dürfte jedenfalls niemandem in den Sinn kommen. An dieser Stelle sollte man sich den Meister aller Reisenden, Almeida Garrett, in Erinnerung rufen, der, als er nach Azambuja kommt, mit seinen Worten sagt: »Man eilt, in einem eleganten Haus abzusteigen, das die drei Bereiche Hotel, Restaurant und Café in sich vereint. Heiliger Himmel! Welch eine Hexe an der Tür! Welch ein Loch! Da fällt einem ja die Feder aus der Hand.« Dem Reisenden fällt nicht die Feder aus der Hand, weil er keine benutzt. Auch steht keine alte Frau vor der Tür. Aber ein Loch ist es. Der Reisende flieht, er flieht, bis er ein Hotel findet, das zwar nicht ganz seinen Vorstellungen entspricht, aber nicht schlecht aussieht. Dort bleibt er, dort isst er, und dort schläft er.
Ein Schnaps in Rio de Onor
Manchmal beginnt man mit dem, was am weitesten entfernt liegt. Normalerweise würde man, wenn man nach Bragança kommt, sich erst einmal in der Stadt umsehen und dann das Umland inspizieren, die Felsen, die Landschaft, eben der natürlichen Hierarchie nach. Aber der Reisende hat eine fixe Idee: Er will unbedingt nach Rio de Onor. Nicht dass er sich großartige Wunder davon verspräche, schließlich ist Rio de Onor nichts weiter als ein kleines Dörfchen, in dem weder Goten noch Mauren ihre Spuren hinterlassen haben, aber wenn ein Mann in Büchern blättert, dann behält er Namen, Fakten und Eindrücke in Erinnerung, und all das entwickelt und verkompliziert sich, bis es, wie in diesem Fall, zum Mythos wird. Der Reisende ist weder Ethnologe noch Soziologe, und niemand erwartet außergewöhnliche oder überhaupt irgendwelche Entdeckungen von ihm. Er hat lediglich den berechtigten und nur allzu menschlichen Wunsch, zu sehen, was andere vor ihm sahen, in die Fußstapfen anderer zu treten. Rio de Onor ist für den Reisenden wie ein Wallfahrtsort: Jemand hat ihm einmal von dort ein Buch mitgebracht, das, obwohl es eine wissenschaftliche Arbeit ist, zum Bewegendsten gehört, was je in Portugal geschrieben wurde. Diesen Ort will der Reisende mit eigenen Augen sehen. Sonst nichts.
Dorthin sind es dreißig Kilometer. Gleich hinter Bragança liegt das dunkle und stille Dorf Sacoias. Dort hat man das Gefühl, in eine andere Welt zu kommen. Wenn hinter einer Kurve die ersten Häuser auftauchen, möchte man anhalten und rufen: »Ist da jemand? Darf ich hereinkommen?« Tatsächlich weiß der Reisende bis heute nicht, ob Sacoias bewohnt ist. Die Erinnerung, die er an diesen Ort hat, ist die einer Einöde, genauer gesagt die der Unbewohntheit. Und dieser Eindruck bleibt auch bestehen, wenn er von einem anderen Bild überschattet wird, dem dreier Frauen, die, als der Reisende sich bereits auf dem Rückweg befand, auf theatralische Weise auf den Stufen einer Treppe saßen und zuhörten, was, unhörbar für den Reisenden, eine vierte zu ihnen sagte, während diese die Hand über eine Blumenvase hielt. Dieses glich so sehr einem Traum, dass der Reisende sich nicht sicher ist, je in Sacoias gewesen zu sein.
Die Strecke nach Rio de Onor ist eine Wüste. Auf dem Weg liegen ein paar Dörfer, Baçal, Varge, Aveleda, aber sonst herrscht ursprünglichste Einöde. Sicherlich gibt es Anzeichen von Zivilisation, dies ist weder Dschungel noch raue Felsenlandschaft, aber wo in anderen Gegenden hin und wieder auftauchende Häuser den Reisenden begleiten, ist jetzt kein einziges zu sehen. Hier lässt sich der Beginn aller Dinge erahnen.
Der Reisende wirft einen Blick auf die Straßenkarte: Sollte diese Höhenkurve stimmen, müsste es hier wieder bergab gehen. Rechter Hand liegt ein weites Tal, weiter unten stehen ein paar Bienenkörbe, und durch den Nebel sieht man in der Ferne undeutlich Männer arbeiten. Die Felder sind grün und die Baumreihen schwarz. Eine Kuhherde kommt die Straße hinauf und versperrt den Weg. Der Reisende hält an, lässt das Vieh vorbeiziehen und wünscht dem Hirten, einem ruhigen jungen Mann, einen guten Tag. Er scheint sich keine große Mühe bei seiner Aufgabe zu geben, was ein Zeichen seines Könnens sein muss, denn die Kühe benehmen sich, als wären sie von einer ganzen Legion von Hütern umgeben.
Nun zu Rio de Onor. Hinter einer Kurve leuchtet zwischen den Bäumen das Wasser auf, man kann hören, wie es über die Felsen fließt, und ein Stück weiter kommt eine Steinbrücke. Der Fluss heißt pflichtgemäß Onor. Die Dächer der Häuser sind fast alle aus Schiefer, und durch die Feuchtigkeit glänzen sie und wirken noch dunkler als ihr eigentliches Bleigrau. Es regnet nicht, es hat noch gar nicht geregnet heute, aber die ganze Landschaft ist von Feuchtigkeit durchtränkt, als befände man sich auf dem Grund eines Unterwassertals. Der Reisende sieht sich ausgiebig um und fährt dann auf die andere Seite. Er ist unzufrieden. Endlich ist er in Rio de Onor, sehnlichst hatte er auf diesen Tag gewartet, und jetzt kann er sich gar nicht richtig freuen. Manchmal wünschen wir uns etwas sehr, und wenn wir es dann haben, wissen wir nichts damit anzufangen. Nur so lässt es sich erklären, dass der Reisende nach dem Weg nach Guadramil fragt, wohin er aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse allerdings nicht fahren kann. So sagt man ihm jedenfalls. Der Reisende beschließt also, sich den Umständen anzupassen. Er geht eine Straße entlang, die einem Sumpfgelände ähnelt, springt von einem Fuß auf den anderen und konzentriert sich dabei so sehr, dass er erst im letzten Moment bemerkt, dass er nicht allein ist. Er wünscht gute Tage (nie hat er sich an den Gruß in der Stadt gewöhnt, der die guten Wünsche auf jeweils einen Tag begrenzt), und so antworten sie ihm auch, ein Mann und eine Frau, die dort sitzen, sie mit einem großen Brot im Schoß, das sie kurz darauf bricht und mit dem Reisenden teilt. Hinter den beiden steht ein riesiger Destillierkessel aus Kupfer, dem die Feuchtigkeit nichts auszumachen scheint, was kein Wunder ist, bei dem Feuer, das unter ihm brennt. Der Reisende sagt, was er immer sagt: »Ich sehe mir die Gegend an. Es ist sehr schön hier.« Der Mann geht nicht darauf ein. Er lächelt und fragt: »Wollen Sie unseren Schnaps probieren?« Nun ist der Reisende kein Trinker, er trinkt gern mal einen Weiß- oder Rotwein, aber harte Spirituosen verträgt sein Organismus nicht. Doch in Rio de Onor kann man einen Schnaps schlecht ablehnen, auch wenn es noch lange vor Mittag ist. Zwei Sekunden später hält er ein kleines dickes Glas in der Hand, und der noch heiße Schnaps fließt aus dem Hahn und dann die Kehle hinunter. Das Zeug ist scharf wie ein Hobel. Es gibt eine Explosion im Magen, der Reisende lächelt heldenhaft und wiederholt die Prozedur. Vielleicht um den Schaden wiedergutzumachen, drückt die Frau das Brot gegen die Brust, eine Geste voller Liebe, schneidet den Rand und eine Scheibe ab, und ihr Blick fragt: »Wollen Sie ein Stück?« Der Reisende hatte um nichts gebeten, und man gab ihm. Ein schöneres Geben kann es nicht geben.
Die nächste halbe Stunde verbringt der Reisende im Gespräch mit Daniel São Romão und seiner Frau, während sie an der milden Wärme des Feuers sitzen. Andere Leute kommen vorbei, bleiben stehen und gehen weiter, und ein jeder sagt, was er zu sagen hat. Das Leben in Rio de Onor ist schwer. Zahnschmerzen werden hier mit Schnaps kuriert. Nach ein paar Gläsern weiß der Patient nicht, ob der Schmerz weg ist oder ob er einfach nur betrunken ist. Darüber kann man ja noch lachen, aber nicht über die Geschichte einer Frau, die mit Zwillingen schwanger war und die, nachdem der erste geboren war, nicht wusste, dass es noch einen zweiten auf die Welt zu holen galt, und so litt sie vierundzwanzig Stunden, ohne zu wissen, woran, und als zur großen Verwunderung aller schließlich das zweite Kind kam, war es tot. Der Reisende ist nicht auf Reisen gegangen, um Geschichten wie diese zu hören. Das mit dem Schnaps ist eine großartige und pittoreske Idee, jawohl, den guten Daniel São Romão hier hinzusetzen und ihn den Touristen Schnaps anbieten zu lassen, aber mit solchen Geschichten muss man vorsichtig sein, man muss die Bewohner vor allzu vertraulichen Mitteilungen warnen, was sollen die Fremden denken.
Daniel São Romão erklärt, wie der Schnaps gemacht wird. Er steht auf und fordert den Reisenden auf mitzukommen, und das tut er, immer noch auf seinem Stück Brot herumkauend, dieses hier ist der Rohstoff, der Trester der Trauben, ein ganzer Speicher voll. »Aber der Schnaps ist nicht besonders gut«, sagt der Hersteller, und der Reisende ist erstaunt über seine Ehrlichkeit.
Seit seinem Gebet an die Fische und der Episode mit dem Jesuskind beschäftigt den Reisenden das Thema der Grenze: »Wie ist das bei Ihnen? Verstehen Sie sich gut mit den Spaniern?« Antworten tut ihm eine sehr alte Frau, die nie woanders gewesen ist und deswegen weiß, wovon sie spricht: »Ja. Wir haben sogar Land drüben.« Diese unübersichtlichen Besitzverhältnisse verwirren den Reisenden, umso mehr, als eine andere alte, wenn auch nicht ganz so alte Frau hinzufügt: »Und sie haben auch Land hier.« Der Reisende wirft einen Blick auf seine Knöpfe und bittet sie um Aufklärung, aber sie antworten ihm nicht. Wo ist denn jetzt die Grenze? Und wie heißt dieses Land hier? Ist das noch Portugal? Oder schon Spanien? Oder ist es einfach Rio de Onor und sonst nichts?
Hier herrschen andere Regeln. Zum Beispiel bringt der Junge, der die Kuhherde führte, das Vieh vom ganzen Dorf auf die gemeinsame Weide. Vom gemeinschaftlichen Leben von früher ist insgesamt nicht viel übrig geblieben, aber Rio de Onor leistet Widerstand: Den Fremden wird Brot und Schnaps angeboten, und wenn es regnet und kalt wird, brennt auf der Straße ein Feuer. Und wenn Daniel São Romão in Hemdsärmeln dasteht, sollen sich die Reisenden nicht wundern: Er ist es gewohnt, und es macht ihm nichts aus.
Der Reisende überquert die Brücke. Es ist Zeit zu gehen. Er hört eine Frau ihre Söhne rufen: »Telmo! Moisés!«, und behält den Klang dieser Namen, die man heute so selten hört, in Erinnerung, aber auch einen anderen, den er gar nicht gehört hat, die Schreie der Frau, der ein Kind gestorben war, von dem sie gar nicht wusste, dass es in ihr war.
Die Geschichte vom Soldaten José Jorge
Kurz vor Bragança fängt es an zu regnen. Am Himmel ziehen große dunkle Wolken auf, es scheint, als wollte die Welt sich, genau wie die Dörfer, ein Dach aus Schiefer bauen, aber es ist ihr nicht gut gelungen, denn der Regen fällt durch die Löcher, und der Reisende flüchtet ins Museu do Abade de Baçal. Der Abt, nach dem das Museum benannt wurde, war Pater Francisco Manuel Alves, der 1865 in Baçal geboren wurde. Er war Archäologe und Forscher, er gab sich nicht mit seinen priesterlichen Verpflichtungen zufrieden und hinterließ ein bedeutendes und weit reichendes Werk. Es ist daher nur gerecht, wenn sein Name weiter Erwähnung findet und dieses wunderbare, im alten Bischofspalast eingerichtete Museum ihn trägt. Der Reisende ist nicht unbedingt leicht zu verblüffen, er hat Reisen durch Europa unternommen, wo es wahrhaft Beeindruckendes zu sehen gibt, aber wenn er jetzt einen Blick auf sein Gefühlsbarometer wirft, kommt er zu dem Schluss, dass er verhext worden sein muss. Wie sonst ließe sich die Erregung erklären, die er auf seinem Gang durch die Räume des Museums verspürt, so weit entfernt von der Hauptstadt, wohl wissend, dass dieses hier nur ein kleines Provinzmuseum ist, ohne irgendwelche Meisterwerke, es sei denn das der Liebe, mit der die Objekte zusammengetragen und ausgestellt sind. Steine, Möbelstücke, Gemälde und Skulpturen, Ethnographisches, Altarschmuck – alles ordentlich und sinnvoll angeordnet. Hier »Der Gelbe Fels« von Dórdio Gomes, da die vortrefflichen Arbeiten von Abel Salazar, den einige Kritiker verächtlich einen Amateur nennen. Nur ungern verlässt der Reisende diesen Ort. Er geht, obwohl es noch regnet, in den Garten, wandert zwischen den Grabsteinen umher, atmet den Geruch von nassen Pflanzen und betrachtet schließlich versunken die »Granitsäue«, die so genannten berrões, phantastische Tiere, die, solange sie leben, hemmungslos fruchtbar Ferkelchen werfen, vierzehn Stück auf einmal, und sich, wenn sie tot sind, zu Schinken, Lenden, Rippchen, Schweinsohren, -füßen und -leder verarbeiten lassen, freigebig bis zum Schluss. Die unbehauenen Steine stammen ursprünglich angeblich aus prähistorischer Zeit. Das glaubt der Reisende gern. Für die Höhlenmenschen dürfte das Schwein das Meisterwerk der Schöpfung dargestellt haben. Vor allem die Sau, aus den oben genannten Gründen. Auch als man im Mittelalter in den Städten Pranger aufstellte, stellte man sie auf ein Schwein, ein Tier, das als Beschützer, Sinnbild und manchmal auch Wächter galt. Nicht immer sind die Menschen undankbar.
Der Reisende geht hinaus in den Regen. Er will das Gesehene nicht vergessen, die Deckenmalereien, die typischen Trachten von Miranda, die Metallarbeiten, all diese Dinge, aber er weiß, dass sie bald von anderen Erinnerungen verdrängt sein werden, das ist das traurige Los eines jeden Reisenden. Woran er sich jedoch sein Leben lang erinnern wird, ist diese gotische Skulptur aus dem 16. Jahrhundert, eine Jungfrau mit Kind, mit einem Gewand, das eine reine Pracht ist, auf der Hüfte durchzogen von einer gewundenen Linie, die sich in dem ovalen, flämisch anmutenden Gesicht fortsetzt. Und da der Reisende einen besonderen Blick für Kontraste und Widersprüche hat, vergleicht er, während er durch den Regen geht, in Gedanken das Gemälde von Roeland Jacobsz, das Orpheus zeigt, wie er mit der Musik seiner Harfe die wilden Bestien bändigt, mit dem eines anonymen Malers aus dem 16. Jahrhundert, auf dem der heilige Ignatius von den Löwen verschlungen wird. Die Musik hat geschafft, wozu der Glaube nicht in der Lage war. Dass es ein goldenes Zeitalter gab, daran besteht kein Zweifel, denkt er.
Der Reisende ist so vertieft in seine Gedanken, dass er gar nicht bemerkt hat, dass es nicht mehr regnet. Er muss ein merkwürdiges Bild abgegeben haben mit seinem aufgespannten Regenschirm; das passiert jedem mal, und dann schmunzelt man darüber. Der Reisende geht zur Burg, die schmalen, nach alter Tradition gepflasterten, kleinen Straßen hinauf, sieht sich den pelourinho an, oben das Kreuz und unten das Schwein, und geht einmal um den Domus Municipalis herum, der eigentlich geöffnet sein sollte, es aber nicht ist. Auf Fotografien würde man ihn für rechteckig halten, und so ist der Reisende überrascht, fünf verschieden lange Seiten zu sehen, so hätte ihn nicht einmal ein Kind gezeichnet. Welche Gründe zu diesem Umriss führten, ist nicht bekannt, jedenfalls dem Reisenden nicht. Sehr viel mehr als die Frage, ob das Bauwerk römischer oder griechischer Herkunft ist oder ob es vielleicht doch nur aus dem Mittelalter stammt, beschäftigt den Reisenden dieses krumme Fünfeck, für das er einfach keine Erklärung findet.
Von der Kirche Santa Maria do Castelo braucht der Reisende nur das Portal zu sehen, und da er keinen großen Sinn für die Üppigkeit des Barock hat, verschwendet er mehr Aufmerksamkeit an die Körnung des Granits als an die Trauben und Blätter, die sich an den gewundenen Säulen entlangschlängeln. Später wird er das Gesagte zurücknehmen und die besonderen Verdienste des Barock anerkennen müssen, aber bis dahin hat er noch ein langes Stück Weg vor sich. Auch die anderen Kirchen in Bragança sind nicht weiter von Belang, außer, aufgrund einer kurzen Zeitspanne in der Geschichte, die Igreja de São Vincente, wo der Überlieferung nach Dom Pedro und Inês de Castro heimlich getraut wurden. Das mag sein, aber von den Steinen und Mauern von damals ist nichts übrig geblieben, und man kann nicht sagen, dass man irgendetwas von dieser großen und politisch wichtigen Liebe spüren würde.
Kennt er Bragança jetzt? Nein, das nicht, aber man möge den Reisenden verschonen, denn es gibt andere Orte zu besichtigen, die wie dieser imstande sind, einen Mann für den Rest seines Lebens festzuhalten, nicht aufgrund besonderer Verdienste, sondern weil diese Versuchung jedem Ort innewohnt. Und wenn es heißt, für den Rest des Lebens, dann bedeutet das auch darüber hinaus, wie im Falle des Soldaten José Jorge, von dem hier die Rede sein soll.
Zuerst einmal sollte zum besseren Verständnis erwähnt werden, dass der Reisende eine besondere Vorliebe hat, die einige Menschen, die sich selbst für normal halten, wahrscheinlich morbide finden und die darin besteht, dass er gelegentlich gern Friedhöfe besucht und sich an der Inszenierung der Verstorbenen in Gestalt von Gedenktafeln, Statuen, Grabsteinen und anderen Formen des Gedenkens erfreut und aus alldem den Schluss zieht, dass der Mensch sogar dann noch eitel ist, wenn er gar keinen Grund mehr dazu hat. Der Tag scheint günstig für derlei Betrachtungen, und der Zufall will es, dass seine ziellosen Schritte den Reisenden an den Ort führen, wo sie am ehesten berechtigt sind. Nachdem er den Friedhof mit seinen frischgekehrten Wegen einmal ganz umrundet und die von Flechten bedeckten und von der Witterung angegriffenen Inschriften gelesen hat, stößt er auf ein kahles Grab, das abseits des Pompes dieser Versammlung Verstorbener liegt, von einem Gitter umgeben, und auf dem sich eine Inschrift befindet: »Hier ruht José Jorge, zum Tode verurteilt am 3. April 1843.« Ein interessanter Fall. Wer war dieser Tote, der seit fast hundertvierzig Jahren seinen festen Platz hier an der Mauer hatte, dessen Grab aber nicht verwahrlost war, wie man an den frischgemalten Buchstaben, dem klaren Weiß auf nachgefärbtem Schwarz, erkennen konnte? Er musste jemanden danach fragen. Gleich nebenan war die Hütte des Totengräbers und er selbst darin. Der Reisende sagt: »Guten Tag. Können Sie mir eine Frage beantworten?« Der Totengräber, der sich, mit jenem sanften transmontanischen Akzent, mit einer Frau unterhalten hatte, erhebt sich von seiner Bank und steht zu Diensten: »Wenn ich kann.« Das sollte er, es ist immerhin eine Frage, die seine Arbeit betrifft: »Dieser José Jorge, wer war das?« Der Totengräber zuckt mit den Schultern und lächelt: »Ah, das ist eine uralte Geschichte.« Mag sein, für den Reisenden ist das keine Neuigkeit, er hat schließlich das Todesdatum gesehen. Der Totengräber fährt in ungefähr dieser Art fort: »Man sagt, er war ein Soldat, der zu jener Zeit lebte. Eines Tages bat ihn ein Freund, ihm seine Uniform zu leihen, ohne ihm zu sagen, wofür, aber sie waren ja Freunde, und der Soldat fragte nicht weiter nach. Nun war es so, dass später ein Mädchen tot aufgefunden wurde und alle behaupteten, ein Soldat hätte es ermordet, und dieser Soldat sei José Jorge. Die Uniform war offenbar voller Blut, und José Jorge konnte das nicht erklären oder wollte es nicht, weil er die Uniform verliehen hatte.« »Aber wenn er gesagt hätte, dass er sie verliehen hatte, dann hätte er doch sein Leben gerettet«, sagt der Reisende, der sich für einen logisch denkenden Menschen hält. Der Totengräber antwortet: »Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, was man mir erzählt hat, ich habe die Geschichte von meinem Großvater, und der hat sie von seinem. José Jorge schwieg, sein Freund hat sich nicht gemeldet, ein schöner Freund im Übrigen, und so wurde José Jorge gehenkt und danach an diesem Ort hier begraben. Vor vielen Jahren wollten sie mal das Grab ausheben, aber als sie sahen, dass die Leiche in perfektem Zustand war, haben sie es wieder zugemacht und nie wieder angerührt.« Der Reisende fragt: »Und wer malt die Buchstaben so schön nach?« »Ich«, antwortet der Totengräber.