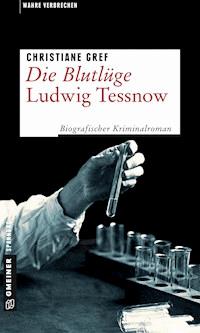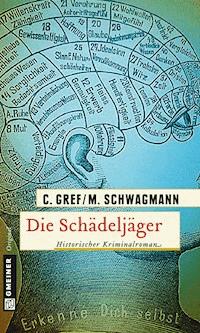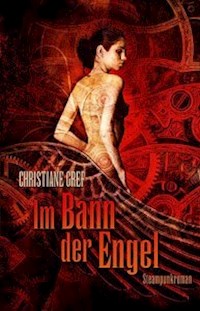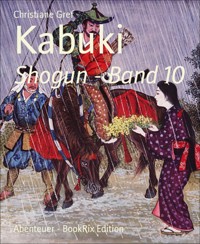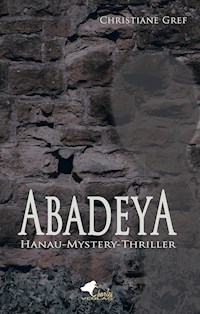Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Halle 1805: Julius Weiland, der jüngere Bruder von Unterinspektor Weiland, beginnt ein Medizinstudium an der Friedrichs-Universität zu Halle. Doch an der Lehranstalt geschehen merkwürdige Dinge… Betreibt Erasmus Brackhagen, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Nervenkrankheiten, ein geheimes Forschungslabor und experimentiert an den „Irren“, wie die Geisteskranken genannt werden? Ausgerechnet Brackhagen, der widerliche Frischvermählte von Eleonore - der Frau, die Julius um alles in der Welt liebt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
C. Gref / M. Schwagmann
Die Seelenwärter
Historischer Roman
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rathaus_und_Waage_in_Halle_%28Saale%29.pdf und http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Characters_and_Caricaturas_by_William_Hogarth.jpg
ISBN 978-3-8392-4440-1
Altes Hallenser Fuchsenlied – undatiert
Das Füchslein dachte zwar,
Es ist doch sonnenklar,
Kommst du nach Halle rein,
Ach so solide über alle Maßen.
Doch ob ihm das gelingt,
Das ist ein ander Ding,
Da ziehn wir lieber
Den Schleier drüber
Prolog
Die Kammer seinestoten Dieners Lambrecht war karg möbliert. Das Ausräumen dauerte weniger als eine Stunde. Adrian Dennfelder hatte es sich – mit Unterstützung seiner Frau Elsa Luise – nicht nehmen lassen, selbst Hand anzulegen. Gerade sah er die Korrespondenz seines alten Freundes durch, als ihm ein privater Brief in die Hände fiel. Oder vielmehr der Entwurf eines Briefes, denn er war nicht unterzeichnet.
Werte Frau Kremer,
ich flehe Sie nun demütigst an, meine liebe Margot nicht allein zu lassen. Mit diesem Schreiben werde ich eine größere Geldsumme anweisen, die in Bälde bei Ihnen eintreffen und Sie großzügig für alle Unannehmlichkeiten entlohnen wird …
Lambrecht hatte außerdem über Herzprobleme und zwielichtige Geschäfte geschrieben. Der Brief wirkte sehr gefühlvoll. Eine Seite an Lambrecht, die Dennfelder nicht gekannt hatte. Adressiert war das Schreiben an eine Trude Kremer im Haus Nummer 967 im Kleinen Schlamm. Die Straße lag im Halle’schen Nicolaiviertel.
In was hatte sich der stets pflichtbewusste Lambrecht da nur wieder verrannt? Und wer war diese Margot? Handelte es sich womöglich um eine Angehörige? Warum sonst sollte er eine größere Geldsumme für sie zur Verfügung stellen? War sie gar seine Tochter? Die Inspektoren Niemer und Weiland waren die Letzten gewesen, mit denen Lambrecht intensiven Kontakt gepflegt hatte, während Dennfelder selbst sich wie ein gejagtes Tier hatte verstecken müssen.
Dennfelder faltete den Brief säuberlich und steckte ihn ein. Es behagte ihm gar nicht, die alten Wunden wieder aufzureißen, jetzt, da sich alles zum Guten gefügt hatte.
Doch es half nichts. Wenn er Antworten haben wollte, dann musste er den Inspektoren der hiesigen Hauptwache einen Besuch abstatten. Er entschied sich für Weiland, da er sich ein Gespräch mit dem verbitterten Niemer als weitaus anstrengender ausmalte. Er rief sein Dienstmädchen und wies es an, die Möbel im Keller einzulagern und die wenigen Kleidungsstücke in einer Kiste zu verstauen.
Das Mädchen zog die Augenbrauen kraus. »Wollen Sie die Kleidung nicht spenden?«
»Lambrecht hatte, wie es scheint, Verwandtschaft in Halle«, gab Dennfelder zerstreut zurück. Er versuchte, sich jene Margot vor seinem geistigen Auge vorzustellen. Es gelang ihm nicht.
Der Brief beschäftigte ihn die ganze Nacht. Am Morgen entschied er, auf dem Weg zur Weinhandlung einen Umweg über die Hauptwache zu machen. Ein mulmiges Gefühl schlich sich in seine Magengrube, als er vor dem Gebäude stand.
Der Fall ist geklärt, sprach er sich in Gedenken an die noch keinen Monat zurückliegenden Erlebnisse Mut zu. Ich bin unschuldig und alle wissen das.
Er öffnete resolut die Tür und trat ein. Das »Guten Morgen« blieb ihm im Hals stecken, als er Niemer an Weilands Schreibtisch erblickte, während Laurenz Weiland selbst durch Abwesenheit glänzte. Dennfelder fasste sich und holte den Gruß nach. Niemer sah mürrisch auf und fuhr mit seiner Beschäftigung fort, das Tintenfass von links nach rechts und wieder zurück zu schieben, bis er es auf die Spitze trieb. Es fiel von der Tischkante und landete auf dem Boden, wo es zwar nicht zerbrach, jedoch eine große blaue Pfütze auf die Dielen entließ.
Niemer ließ das Fass, wo es war, und sprach Dennfelder endlich an. »Sie hätte ich als Letzten hier erwartet. Was gibt es?«
»Nun, ich wünsche Herrn Weiland zu sprechen.«
Niemer lachte rau auf. Die Falten in seinem Gesicht vertieften sich. »Da müssen Sie an die Ostsee fahren. Oder warten.«
In Ermangelung des Tintenglases, mit dem er seine Hände beschäftigen konnte, faltete Niemer nun aus einem beschrifteten Stück Papier ein kleines Boot.
Dennfelder wippte auf den Fußballen. »Und wann erwarten Sie Herrn Weiland zurück?«
»In einer Woche ist er wieder da.«
Dennfelder runzelte die Stirn, und als nichts mehr kam, verabschiedete er sich. Niemer erwiderte den Gruß nicht und ließ stattdessen das Boot über die Tischplatte fahren. Kopfschüttelnd verließ Dennfelder die Hauptwache.
Teil I
Kapitel 1
Julius Weiland saßim Gästezimmer vor dem Spiegel und kämpfte mit dem Knoten des Halstuchs. Er mochte den Druck nicht, den er auf seinen Kehlkopf ausübte. Lautstark verfluchte er sich selbst dafür, nicht mehr Geld ausgegeben zu haben. Nun, es ließ sich für den Moment nicht ändern. Julius erhob sich, fuhr ein letztes Mal mit gespreizten Fingern durch sein dichtes Haar und schickte sich an, die Geborgenheit seines Zimmers zu verlassen, um sich den vielen Gästen zu stellen, die sein väterlicher Freund, Gottlieb Lehnau, eingeladen hatte.
»Fräulein Lehnau, wie hübsch Sie heute aussehen«, äußerte sich eine beleibte Dame und tätschelte der Angesprochenen die Wange. Julius, der gerade die Treppe herabgekommen war, gab der Dame insgeheim recht. Der zarte Gelbton des Kleides passte ausgezeichnet zu Eleonores Haaren, die wie dunkler Honig glänzten. Doch selbst wenn sie in Sackleinen gekleidet vor ihm stünde, so könnte er dennoch nicht Herr über seinen rasenden Herzschlag werden. Als hätte sie seine Gedanken erraten, wandte sich ihm Eleonore zu. In ihren grünen Augen lag ein aufgewecktes Funkeln.
»Na, aufgeregt?«
Julius brachte lediglich ein kärgliches Nicken zustande.
»Es wird schon nicht so schlimm werden.« Verschwörerisch drückte sie seine Hand.
Julius’ Hals war mit einem Mal wie ausgedörrt. Mühsam räusperte er sich.
»Vergiss nicht«, fuhr sie fort, »mein Onkel setzt sich für dich ein. Es muss einfach gut gehen.«
»Du hältst mich sicherlich für einen furchtbaren Gesellschafter«, sagte Julius leise und schickte ein Seufzen hinterher, das nicht annähernd seine Verfassung wiedergab.
Vier Jahre verzehrte er sich nun schon nach Eleonore. Stets hatte er sich einzureden versucht, dass aus dem hübschen Entlein mit Sicherheit ein hässlicher Schwan geworden war. Gestern Nachmittag hatte er sie wiedergesehen. Ganz plötzlich war sie im Salon aufgetaucht, als die Lehnaus und Julius gerade ihren Tee nahmen. Als Julius vor Erstaunen das heiße Getränk über die Hand schwappte, blieb er gefasst, obgleich der Schmerz jäh und scharf war. Er war sich wohl bewusst, wie unhöflich es anmutete, Eleonore derart unverhohlen anzustarren. Er hoffte im Nachhinein, dass er es wenigstens nicht mit offenem Mund getan hatte.
»Lieber Julius, meine Nichte Eleonore kennst du sicherlich noch aus euren Kindertagen. Eleonore, der Ziehsohn meines besten Freundes Jean Nortius aus Weimar, Julius Weiland.«
Unsicher erhob sich Julius und hauchte einen zarten Kuss auf den Handschuh.
»Juls.« Mehr sagte sie nicht. Nur dieses eine Wort, das sie mit einer hochgezogenen Augenbraue äußerte. Die Nennung des Spitznamens von früher brachte seine Wangen zum Glühen.
Juls. Dieses Wort erinnerte ihn an die zahllosen Nächte, in denen er seiner Angebeteten Brief um Brief geschrieben hatte. Stets unterzeichnete er mit »In Liebe, der immer Deine, Juls.« Anschließend verstaute er das Geschriebene sorgfältig in einer Mappe. Nicht eine Zeile jener Liebesschwüre hatte jemals die Adressatin erreicht.
»Du musst ja ersticken. Komm, ich helfe dir.« Eleonore nestelte an seinem Halstuch und hätte es ihm wohl gänzlich abgenommen, wenn er nicht geistesgegenwärtig ihre Handgelenke festgehalten und geraunt hätte: »Nicht hier, vor allen Leuten.«
Eleonore wies ihn zum kleinen Salon, in dem sich gerade niemand aufhielt. Julius unterdrückte ein Erschauern, als Eleonores Finger an seinem Hals entlangglitten, ehe sie das Tuch zu fassen bekamen. Eleonore indes schien nichts von seiner Aufregung zu ahnen. Fachkundig schlang sie ihm das störrische Tuch um den Hals, verknotete es, zupfte es ein letztes Mal in FaÇon.
»Du machst das großartig, Leo.« Gleich darauf biss sich Julius von innen in die Wange. Was redete er da bloß?
»Mein Vater kann sich seit einigen Monaten nicht mehr selbst das Tuch binden. Er zittert zu sehr. Daher die Routine.«
»Ist es schlimmer geworden?«
Betrübt nickte Eleonore. Für einen Augenblick verzogen sich ihre Mundwinkel vor Bitterkeit. »Die Anfälle häufen sich. Auch heute wäre er zu gern dabei gewesen, aber …« Eleonore stockte.
»Wenn ich erst Arzt bin, werde ich ein Heilmittel finden«, versprach er voller Inbrunst.
»Ach, Juls, so viele Ärzte haben sich bereits um ihn bemüht. So viele Versuche hat es schon gegeben, sein unablässiges Beben zu kurieren.«
»Ich werde es trotzdem tun.«
»Doch zuerst musst du an der Universität angenommen werden«, überspielte sie die Situation und schob ihn in Richtung der Tür.
»Was soll das werden?«, blaffte Gottlieb Lehnau, der die beiden aus dem leeren Salon kommen sah.
Eleonore strahlte ihn an. »Nichts, Onkel, ich habe lediglich die Grundvoraussetzung geschaffen, dass unser Juls einen guten Eindruck bei den Herren Doktoren hinterlässt.«
Keinesfalls beruhigt umgriff Lehnau den Arm seiner Nichte und zog sie mit sich fort.
Was hat er nur?, fragte sich Julius. Ist er mir plötzlich nicht mehr gewogen?
Verunsichert hielt er sich am Rande des Geschehens auf. Er musterte die Gäste und wurde eines älteren Mannes gewahr, der ebenfalls abseits stand, offenbar aus freien Stücken. Er war nicht darauf angewiesen, jemandem vorgestellt zu werden. Man schien ihn allenthalben zu kennen. Immer wieder machte ein Gast vor ihm Halt. Ehrerbietig verneigten sich jüngere Herren vor ihm, respektvoll knicksten deren Begleiterinnen. Dabei wirkte der Hofierte nicht wie ein Regent. Im Gegenteil, die Aufmerksamkeit schien ihm lästig. Kalt blickte er den Menschen ins Gesicht. Kein Lächeln war den blutarmen Lippen zu entlocken. Unheimlich, wie karg außerdem seine Gesten ausfielen, wie fade sein Äußeres anmutete. Der Mann erinnerte Julius an einen Mönch, der Werte in anderen Dingen als Kleidung und Frohsinn sah.
Julius hielt einen Diener auf. »Wer ist das?«, wollte er wissen und deutete hinüber.
»Das ist Doktor Brackhagen, seines Zeichens der stellvertretende Leiter der medizinischen Fakultät der Friedrichsuniversität in Halle, die rechte Hand von Doktor Reil.«
»Unmöglich. Das kann doch nicht der Brackhagen sein. Der berühmte Arzt.«
Der Diener lächelte indigniert. Die peinliche Stille und die auf ihn gerichteten Augenpaare zeigten Julius an, dass seine Stimme vor Enthusiasmus laut geworden sein musste.
Was blieb ihm anderes übrig, als sich in die Schar der Defilierenden einzureihen? Er verneigte sich tief vor Brackhagen und stammelte eine Entschuldigung.
»Und Sie sind?«, verlangte der Arzt zu wissen.
Brackhagens Stimme war heiser und zerfaserte wie ein marodes Seil zum Ende der Wortsilben. Es lag eine nervöse Spannung darin, der Julius nur schwer standhielt.
»Julius Weiland, zu Ihren Diensten.«
»Sagen Sie nichts, was Sie nicht auch so meinen.«
»Wie bitte?«
Brackhagen wendete sich gelangweilt von ihm ab.
Julius versah sich selbst im Geiste mit Schimpfnamen, die einen Kesselflicker hätten erröten lassen. Seine Berufung an die Friedrichsuniversität konnte er nun getrost vergessen. Es stimmte, was Laurenz stets sagte. Ich sollte meine Zunge festbinden lassen, dachte er. Julius entschied, nur noch zu sprechen, wenn er sich zuvor seine Worte sorgfältig zurechtgelegt hatte.
Lehnau riss ihn aus seiner Selbstkasteiung. »Hier bist du. Komm, ich muss dich jemandem vorstellen.«
Der Nachmittag ging in den Abend über. Allmählich vergaß Julius seinen Fauxpas. Er lernte gut ein Dutzend Ärzte kennen, die er allesamt für sich zu gewinnen vermochte. Als der Aperitif gereicht wurde, erklärte sich ein Bekannter von Lehnau einverstanden, Julius bei der Aufnahme in die Studentenschaft der medizinischen Fakultät zu unterstützen.
»Jetzt hast du es fast geschafft, mein Junge.« Stolz kredenzte Lehnau Champagner. Julius prostete ihm selig vor Glück zu.
»Du sagst ›fast‹. Wer muss denn noch entscheiden?«, wollte Julius wissen.
»Doktor Erasmus Brackhagen.«
Plötzlich schmeckte der Champagner bitter.
Julius verbrachte die nächste Viertelstunde damit, um Brackhagen herumzuschleichen. Die Hürde, ihn erneut anzusprechen, schien ihm unüberwindlich, und sie wuchs mit jeder Minute, die er es hinauszögerte. Gerade als er sich ein Herz fassen wollte, rauschte Lehnau geschäftig an ihm vorbei, direkt auf Brackhagen zu. Julius beobachtete, wie er ihm vertraulich etwas ins Ohr flüsterte. Brackhagen nickte, über seine Lippen huschte ein Lächeln, dann räusperte er sich. Schließlich erstarrten seine Gesichtszüge wieder in der gewohnt gestrengen Mimik. Lehnau klopfte Brackhagen noch einmal freundschaftlich auf die Schulter, dann drehte er sich um und ging Richtung Großer Saal. Als sein Blick dabei auf Julius fiel, winkte er ihn herbei.
»Komm, Julius, komm. Es gibt Neuigkeiten, und die wollen wir niemandem vorenthalten.«
Ehe Julius wusste, wie ihm geschah, spürte er den Druck von Lehnaus Handballen in seinem Rücken und wurde durch die weit geöffneten Türflügel aus dem Salon in den benachbarten Saal geschoben, direkt auf das kleine Orchester zu. Dort angekommen zögerte Lehnau nicht, dem Dirigenten in den Taktstock zu greifen. Ein Musiker nach dem anderen setzte verwundert sein Instrument ab, bis nur noch der Tubist mit aufgeblasenen Backen in sein Horn stieß. Als letztlich auch dessen Instrument ruhte, klatschte Lehnau zweimal in die Hände.
»Meine Damen und Herren!«, rief er mit seiner durchdringenden Bassstimme, während er sein Kinn reckte und sein Blick suchend durch die Reihen der neugierig blickenden Gäste fuhr. »Kommen Sie, kommen Sie ruhig näher. Und schicken Sie meine liebreizende Nichte zu mir, sollte sie sich zwischen Ihnen verbergen.«
Eleonore trat augenblicklich aus der Gästeschar hervor. Lächelnd und mit geröteten Wangen strebte sie ihrem Oheim entgegen. Als ihr Blick auf Julius fiel, zwinkerte sie ihm verschwörerisch zu.
Julius atmete tief ein. Nun stand er also bevor, der große Moment, auf den er seit seiner Ankunft auf Lehnaus Gut gewartet hatte. Seine Aufnahme an der Friedericiana. Davon hatte er schon geträumt, seit er mit elf Jahren das erste Mal etwas über den Blutkreislauf gehört hatte. Damals, an einem stürmischen Oktobertag, hatte er ernsthaft gedacht, er müsste sterben, als ihn in Jean Nortius’ Scheune in Weimar ein herabstürzendes Brett am Kopf getroffen hatte. Als er an die schmerzende Stelle gegriffen hatte, hatte sie sich warm und feucht angefühlt. Ungläubig hatte er auf das Rot gestarrt, das wie Honig an seinen Händen geklebt hatte und zäh zwischen seinen Fingern hindurch auf die Schuhe getropft war. Dann war er in Ohnmacht gefallen.
Als er wieder zu sich gekommen war, blickte er zuerst in die spöttischen Augen seines Bruders, des Polizei-Offizianten Laurenz Weiland, dann in die besorgten seines Vormunds Jean Nortius und schließlich in die belustigten von Doktor Gottfried Lehnau aus Halle.
Julius hatte aufspringen wollen, doch als würde ihn das Brett erneut mit voller Wucht treffen, fiel er einfach wieder zurück in den Sessel, auf den man ihn zwischenzeitlich getragen hatte.
»Na, na, du wirst uns doch nicht noch einmal entfliehen?« Doktor Lehnau, ein Freund von Pflegevater Jean, griff nach Julius’ Hand und drehte die Handfläche nach oben. Mit Daumen und Zeigefinger erforschte er sein Handgelenk.
»Laurenz, hol bitte meine Frau«, wandte sich Nortius an Julius’ Bruder. »Sie soll unserem Draufgänger etwas zu trinken bringen. Und wir brauchen das Fläschchen mit dem Karmeliterwasser.« Laurenz schlug die Hacken zusammen, während er grinsend salutierte und schließlich verschwand. Julius hatte die Blutflecken auf Laurenz’ Hemd gesehen, er musste ihn ins Haus getragen haben.
»Muss ich sterben?«, hatte Julius damals kläglich gefragt. Seine Angst vor der Antwort hatte er dabei nicht verbergen können.
»Junge!«, stieß Nortius erschrocken aus, während Gottfried Lehnau in dröhnendes Gelächter ausbrach.
»Niemand stirbt hier! Und schon gar nicht während meiner Anwesenheit.« Lehnaus Stimme klang so zuversichtlich, dass er jeglichen Zweifel aus dem kleinen Weimarer Wohnzimmer des Apothekers Jean Nortius mit einem Schlag vertrieb.
Doktor Lehnau war damals schon kein Unbekannter mehr für Julius gewesen. Julius hatte bereits zwei Sommer auf Lehnaus Landgut in Amendorf südlich von Halle verbringen dürfen. Eigentlich sollte er dort die Gepflogenheiten der besseren Kreise kennenlernen, doch Julius liebte es vielmehr, den alten Obstgarten, der sich im hinteren Teil des Gutshofes hinter einer alten Mauer befand, mitsamt seinen zahlreichen Verstecken zu erkunden. Als Doktor Lehnau jedoch an jenem schicksalhaften Tag nach Weimar gekommen war, um Julius abzuholen, erschien es ihm, als sehe er den Doktor zum ersten Mal. Wie souverän er mit der Situation umgegangen war – als hätte sich Julius lediglich das Knie aufgeschlagen. Selbst Mutter und Vater Nortius folgten getreu all seinen ruhig erteilten Anweisungen. Deshalb hatte es fortan nur noch einen Wunsch für Julius gegeben: So zu werden wie er. Und als Julius ein paar Tage später wieder einmal neben ihm in der Kutsche auf dem Weg nach Amendorf saß, konnte er gar nicht genug über das Leben eines Arztes erfahren. Wenn Gottlieb Lehnau sprach, lauschte Julius still und andächtig, um nichts zu verpassen. Besonders neugierig zeigte er sich, wenn Lehnau vom Blut und dessen Kreislauf durch den menschlichen Körper erzählte. Nun verstand er, warum viele es ›den Lebenssaft‹ nannten. Seine neue Leidenschaft bekamen auch die Bewohner des Hofguts zu spüren: Wann immer er in diesem Sommer die Gelegenheit dazu bekommen hatte, hatte er die Arme der Angestellten ergriffen. Es gab nichts, was ihn mehr faszinierte als die blassblauen Linien unter der Haut, die, so wusste er jetzt, das Leben ausmachten. Und wenn Eleonore zu Besuch kam, mussten auch ihre Arme zu Untersuchungszwecken herhalten. Sie protestierte zwar, ließ ihn aber zumeist gewähren. Nur manchmal, wenn Julius es mit der Blutstauung mal wieder übertrieb, flüchtete sie vor ihm und schlug ihm laut schimpfend die Zimmertür vor der Nase zu. Enttäuscht musste er dann ein anderes Opfer suchen, um sich selbst wieder und wieder von dem Wunder des zirkulierenden Blutes zu überzeugen. In diesem Sommer hatte Julius noch nicht an die Liebe gedacht. In diesem Sommer hatte Julius Weiland beschlossen, Arzt zu werden.
Als Julius nun zehn Jahre später neben Gottfried Lehnau und Eleonore im Salon stand, rauschte ihm der so geliebte segensreiche Saft dermaßen in den Ohren, dass er nicht eines von Lehnaus Worten verstand. Warum nur schien sich die Blutmenge bei Aufregung zu vervielfachen? Wie lange konnte man das aushalten? Würde man bei anhaltendem Erregungszustand irgendwann einfach platzen? Julius hob die Hand zum Mund, als müsste er sich räuspern, dabei wischte er sich unauffällig die kitzelnden Schweißperlen von der Oberlippe.
Auf einmal kam Brackhagen mit ausgestreckter Hand auf ihn zu und hieb ihm kräftig auf die Schulter. Julius taumelte unbeholfen nach vorn.
»Was zögerst du denn, mein Junge? Reich deinem zukünftigen Lehrmeister die Hand«, forderte ihn Lehnau verwundert auf.
Julius fing sich. Hölzern streckte er Brackhagen seine Hand entgegen. Die Gäste im Saal applaudierten.
»Herzlichen Glückwunsch, Herr Weiland. Ich freue mich, Sie alsbald an der ehrwürdigen Fridericiana Hallensis begrüßen zu dürfen. Wann werden Sie in Halle eintreffen?«
»Ich … äh …«, krächzte Julius, dessen Mund so trocken war, als habe er zuvor auf Kreide gekaut.
»In einer Woche werden Sie ihn bekommen, werter Herr Kollege«, half ihm Lehnau aus der Patsche. »Bis dahin soll er mir noch ein wenig Gesellschaft leisten. Ich will es gern noch ein Weilchen genießen, dass er mir jedes Wort glaubt, was ich über die Heilkunst zu berichten weiß. Schon bald wird er mit mir diskutieren wollen und alles besser wissen, bis mir nur noch die Rolle des ewig Gestrigen bleibt.«
»Nein, ich … niemals«, versuchte sich Julius zu verteidigen.
Für Lehnau schien die Angelegenheit damit erledigt. Er umfasste Julius’ Schultern und zwang ihn, mit ihm einen Schritt zurückzutreten. Dann ergriff er die Hand der wartenden Eleonore. »Und nun zu dir, mein Kind!«
Julius schaute Lehnau irritiert an. Was sollte das heißen, was war mit Eleonore?
Als wäre er einer der Gäste, sah er sich an der einen und Eleonore an der anderen Hand Lehnaus stehen.
Was sollte das werden? Er wird doch nicht etwa …? Aber er hatte sie doch noch gar nicht gefragt. Er wollte sie doch erst fragen, wenn er sein Studium … Hatte sie etwa ihren Onkel …? Oder hat Lehnau selbst …? Die Gedanken flogen auf ihn zu wie ein Wespenschwarm im Angriffsflug. Er schluckte. Haltung bewahren, Julius!, versuchte er, sich selbst zu beruhigen. Was auch passieren würde, es würde alles gut werden.
»Meine Damen und Herren«, rief nun Lehnau. »Darf ich Sie erneut um Ihre Aufmerksamkeit bitten?«
Die Gäste, die gerade damit begonnen hatten, die Aufnahme von Lehnaus Günstling an die Friedrichsuniversität mit ihren Nachbarn zu diskutieren, hielten verwundert inne.
»Ich freue mich, Ihnen heute nicht nur eine, sondern zwei Neuigkeiten eröffnen zu können.«
Ein Raunen ging durch die Gästeschar.
Lehnau ließ Julius’ Hand los. Gleichzeitig zog er Eleonore ein Stück nach vorn.
»Sie wissen ja, dass ich leidenschaftlicher Sammler schöner Kunstgegenstände bin«, setzte er an. Ein paar Gäste ließen sich zu einer zustimmenden Äußerung hinreißen, die Lehnau mit einem wohlwollenden Nicken quittierte. »Ja, es stimmt, ich bin in diesem Punkt tatsächlich sehr ehrgeizig. Wenn ich einmal etwas haben will, so ist mir keine Mühe zu groß und kein Weg zu weit, um es endlich mein eigen zu nennen. Und wenn ich es einmal besitze, so setze ich mich darauf wie eine Glucke und hacke jedem die Hand ab, der danach greifen will.«
Ein paar Lacher aus den Reihen der Zuhörer gaben auch dieser Beschreibung recht. »Heute werde ich mich jedoch über meine Grenzen hinauswagen, denn ich werde mich von meinem kostbarsten Juwel trennen. Obwohl – ich muss mich korrigieren, denn ich besitze es gar nicht und werde es leider auch niemals tun. Mir gebührt nur die Ehre, dieses Schmuckstück weiterreichen zu dürfen.«
Julius sah gebannt auf Eleonore, die sich stolz von Lehnau in eine Drehung führen ließ.
»Ist sie nicht wunderschön?« rief Lehnau aus.
Die Gäste applaudierten höflich.
»Doch ich bin nicht der Einzige, der ihre Schönheit zu schätzen weiß. Es gibt einen Verehrer, der schon lange darauf gewartet hat, dass meine Nichte endlich zur Frau gereift ist.«
Lehnau zwinkerte Julius zu, der stocksteif neben Brackhagen stand. »Meine Damen und Herren, im Namen meines Bruders, der diese Aufgabe aus gesundheitlichen Gründen leider nicht selbst übernehmen kann, habe ich die Ehre, Ihnen Folgendes mitzuteilen.« Lehnaus Hand reckte sich in Julius Richtung. Doch Julius, der sein Glück nicht fassen konnte, stand einfach nur wie erstarrt da. Und noch ehe er überhaupt ein Lächeln zustande gebracht hatte, war auf einmal Brackhagen an ihm vorbeigetreten. Julius hörte, wie Lehnau lautstark verkündete: »Hiermit, meine Damen und Herren, gebe ich die Verlobung meiner Nichte Eleonore Lehnau mit Doktor Erasmus Brackhagen bekannt.«
Kapitel 2
»Ich verstehe nicht, warum du uns so plötzlich verlassen möchtest«, sagte Gottlieb Lehnau müde und bedeutete dem Mädchen mit einem knappen Nicken, Kaffee nachzuschenken. Bleich war er, die lange Festnacht hatte ihm augenscheinlich schwer zugesetzt. Und doch wirkte er auf eine eigentümliche Art glücklich. Als wäre die Verlobung ein langwieriger Plan gewesen, den er endlich in die Tat umgesetzt hatte. Für Julius war sie aus heiterem Himmel gekommen.
Julius kniff die Lippen zusammen und schluckte schwer. Wie sollte er seinem Ziehonkel nur begreiflich machen, wie sehr es ihn vom Ort der Demütigung fortzog? Am liebsten wäre er schnurstracks aus dem Hause gelaufen und dann weiter, bis sein Verstand endlich Frieden gab und sein Herz sich nicht mehr schmerzvoll zusammenzog. Stattdessen schwieg er verbittert den Mann an, der ihm den ersehnten Studienplatz in Halle vermittelt hatte, über den er sich so gar nicht mehr freuen konnte.
»Ich begreife es immer noch nicht. Du hast mir versprochen, noch eine Woche hier zu verweilen. Du redest kaum und siehst aus, als wärst du dem Leibhaftigen begegnet.« Lehnau seufzte und warf Julius einen fragenden Blick zu.
»Wenn dem so ist, dann kann ich das Kompliment bezüglich des Aussehens nur erwidern«, gab Julius zurück und ein zaghaftes Lächeln stahl sich auf sein Gesicht.
»Diese Jugend. Alles gleich und alles sofort. Nun denn, ich will deiner Ungeduld wegen eines schnell dahingesagten Versprechens nicht im Wege stehen«, spöttelte Lehnau.
Mühsam erhob er sich und schloss Julius kurz und kräftig in die Arme. »Halle mitsamt seiner Universität und all den wundersamen Gepflogenheiten ist ein Ort, der dich mit Haut und Haaren zu fressen vermag. Solltest du in Schwierigkeiten kommen, dann schäme dich nicht, mich um Hilfe zu bitten.«
Julius hielt ihm wortlos die Rechte entgegen. Lehnau schlug ein.
Auf dem Weg in sein Zimmer hoffte er, Eleonore nicht zu begegnen. Seit der Verkündung am Abend zuvor hatte er sich von ihr ferngehalten. Sie kannte ihn, sie hätte gewusst, warum er allein beim Gartenpavillon gestanden und wie ein Schlosshund geheult hatte.
Packen musste Julius nicht, das hatte er bereits in der Nacht erledigt. Mehr schlecht als recht, denn die Schließen seines Koffers ließen sich wohl nur unter Gewaltanwendung wieder öffnen. Dem Zimmer, das er nie wiederzusehen gedachte, schenkte er einen letzten Blick, dann zog er die Tür hinter sich zu. Niemand winkte ihm nach, als er in die Kutsche stieg.
Mit einem lauten Seufzen sank er ins Polster und nahm sich fest vor, die Fahrt, trotz seines Liebeskummers, zu genießen. Es blieb allerdings bei dem Vorhaben, denn schon die Äcker und Gärten, die am Fenster vorbeizogen, erinnerten ihn an die Nachmittage, die er hier mit Eleonore verbracht hatte. Der Apfelbaum, auf den sie, trotz zahlreicher Ermahnungen, immer wieder hinaufgeklettert waren. Das unfreiwillige Bad im kleinen Bächlein, das mitten durch einen der Gärten floss. Und Frederic, der Junge, den sie gemeinsam kopfüber in den Komposthaufen befördert hatten. Julius schloss die Augen. Er war froh, als die Straßen nach der Passage des Galgthors belebter wurden. Die Galgstraße hinunter zum Markt kamen sie nur langsam voran. Julius verstieg sich in die Betrachtung der Passanten. Eine Weile später rollte das Gefährt auf den Marktplatz und hielt vor der Rathswage. Der Kutscher öffnete Julius die Tür und reichte ihm seinen Koffer.
»Was bekommen Sie?«, fragte Julius.
»Hat schon der Herr Lehnau im Voraus gezahlt«, ließ sich der Kutscher vernehmen, lupfte seinen Hut und stieg wieder auf den Sitz.
Julius blickte sich fasziniert um. Der Marktplatz war riesig und voller Menschen. Mittendrin stand ein großer Turm, der von etlichen Verkaufsständen umringt war, um die sich wiederum allerlei Volk drängte, das die schönste Ware für den besten Preis zu ergattern versuchte. In derselben Flucht stachen vier weitere Türme in den spätsommerlichen Himmel, sie gehörten zu einer großen Kirche, die den Marktplatz nach Westen hin abschloss. Das waren sie also, die fünf Türme von Halle, dachte Julius, der Rote Turm und die zwei Turmpaare der Marienkirche. Noch ganz in die Geschichte darüber versunken, wie die Marktkirche zu ihren vier Türmen kam – Lehnau fand, dass Julius als angehender Student in Halle wissen sollte, dass die zwei Turmpaare einst zu zwei verschiedenen Kirchen gehört hatten –, wurde sein Blick auf eine Gruppe gut betuchter Herren gelenkt, die eifrig schwatzend an ihm Richtung Rathaus vorbeizogen. Nur wenige Schritte weiter wurden sie jedoch von einem Burschen aufgehalten, der mit seinem störrischen Rindvieh geradewegs ihren Weg kreuzte. Dies zog große Empörung seitens der Herren nach sich und die Ohren des Burschen glühten schon bald wie die Pfingstrosen in Mutter Nortius’ Arzneigarten. Während Julius seinen Blick nicht von der wütenden Gruppe ehrwürdiger Herren wenden konnte, wurde er selbst von einem Jungen angerempelt, der versuchte, einen kleinen weißen Hund einzufangen. Julius lächelte. Er fühlte sich nach der Isolation in der Kutsche und trotz des Lärms, der Hitze und dem Potpourri an Gerüchen wie ein Vogel, der zum ersten Mal seine Flügel ausbreitet und feststellt, dass er fliegen kann. Mit hoch erhobenem Haupt steuerte er auf die mehrgeschossige Rathswage zu, dem Sitz der Hallenser Universität. Während Julius überlegte, welchen der vielen Eingänge er nun nehmen sollte, entdeckte er einen Mann, der mit einem hölzernen Schreibbrett unter dem Arm in Träumereien versunken vor dem rechten Eingang stand. Sein Rock war an den Ellenbogen abgewetzt und die Stiefel waren, angesichts der brütenden Hitze, unangemessen dick gefüttert. Der Pelzbesatz an den Krempen sah aus, als wären schon Generationen von Motten darüber hergefallen. Dennoch strahlte der Mann, den Julius so alt wie sich selbst schätzte, Würde aus.
»Entschuldigen Sie bitte, werter Herr. Können Sie mir sagen, welchen Eingang zur Friedrichsuniversität ich nehmen muss? Ich bin medizinischer Student.« Letzteres hatte er mit nicht geringem Stolz kundgetan.
»Pardon. Je ne comprends pas.« Mehr noch als die französische Antwort überraschte Julius die hohe Tonlage des Mannes. Er hörte sich wie ein Mädchen an.
Julius wiederholte sein Anliegen auf Französisch. Sofort stahl sich ein belustigtes Glitzern in die dunkelbraunen Augen seines Gegenübers. Er stellte sich Julius als Gerôme Lombard vor. Dann ging ein Wortschwall auf Julius hernieder, den dieser mit einem ratlosen Schulterzucken quittierte. Gerôme begann erneut, langsamer diesmal. Es schien ihm nichts auszumachen, ständig von Vorbeieilenden angerempelt, teilweise gar beschimpft zu werden. Julius nahm seinen Koffer hoch und bat Gerôme, mit ihm ein Stück zur Seite zu gehen. Abwesend folgte ihm der Franzose. Julius erhaschte einen Blick auf das Klemmbrett, das Gerôme in der Hand trug. Darauf waren mit einer Metallklammer Bilder befestigt, deren Anblick Julius die Hitze in die Wangen trieb. Es handelte sich ausnahmslos um nackte Frauen in allen erdenklichen Posen.
»Das ist für die Unterrischt«, beeilte sich Gerôme zu erklären, der Julius’ Blick gefolgt war.
Julius sah sich erschrocken um. Dabei fielen ihm zwei kräftig aussehende Männer auf, die direkt auf sie zuhielten. Gerôme schien die grimmig dreinschauenden Gestalten nicht zu bemerken, oder sie waren ihm schlichtweg gleichgültig. Julius rückte von ihm ab, als die beiden ihm signalisierten, sich ein Stück zu entfernen. Plötzlich rannten sie los, warfen sich auf Gerôme, der – niedergerungen – in wildes Kichern ausbrach. Die Menschen in der Nähe verharrten kurz, gafften, dann strömten sie weiter und teilten sich wie Wasser um ein Riff, als die Männer den unglückseligen Gerôme davonschleiften.
Julius merkte erst jetzt, wie wild sein Herz klopfte, wie sehr ihn dieser Zwischenfall aufregte.
»Geht es Ihnen gut? Sie sind ganz bleich«, sagte ein Mann, der sich aus der Menge gelöst hatte und ihm prüfend ins Gesicht schaute.
»Ich … Es … es geht schon wieder, haben Sie vielen Dank.«
Der Blick des Mannes fiel auf Julius’ Koffer. »Sie sind gerade erst in Halle angekommen?«
»Sind Sie Arzt?«, brach es aus Julius hervor.
»Das bin ich tatsächlich. Doktor der Medizin, Arthur Tamm«, ging der Angesprochene über Julius’ Schnitzer hinweg, nicht auf seine Frage geantwortet zu haben, wie Julius dankbar feststellte.
»Ich bin Student, das heißt, ich möchte gerne hier studieren. Gestern hat Doktor Brackhagen zugestimmt.«
»Kommen Sie erst einmal mit ins Gebäude. Dann unterhalten wir uns in Ruhe. Der Marktplatz ist, scheint mir, ein denkbar schlechter Ort.«
Julius merkte sich den Eingang. Ein breites Treppenhaus führte sie zu den oberen Etagen. Doktor Tamm blieb vor einer Tür am Ende des langen Ganges in der ersten Etage stehen. Er öffnete sie und vollführte eine einladende Geste. Auf dem Tisch, der in der Mitte des Zimmers stand, stapelten sich Berge von Papier. Obenauf thronte ein Hörrohr aus Metall. Ehrfürchtig ließ Julius seinen Blick schweifen. Er verspürte großen Respekt vor dem Künstler, als er die akribisch gezeichneten Körperstudien sah, die an den Wänden hingen. Ein Skelett in einer Ecke ließ ihn erschauern.
»Bitte, junger Herr, nehmen Sie Platz.«
Julius unterbrach seine Inspektion und setzte sich auf einen gepolsterten Stuhl vor den imposanten Schreibtisch. Tamm betrachtete ihn geraume Weile. Seine Miene wusste Julius nicht zu deuten. Endlich erlöste er Julius und brach das gespannte Schweigen zwischen ihnen.
»Warum möchten Sie Arzt werden, Herr …?
»Julius Weiland mein Name. Verzeihen Sie, ich habe mich Ihnen noch gar nicht vorgestellt.« Linkisch erhob sich Julius und machte eine Verbeugung, die angesichts des knapp bemessenen Platzes kärglich ausfiel. Dann setzte er sich wieder und überlegte. Warum wollte er Arzt werden?
»Helfen möchte ich. Es gibt unzählige Krankheiten, die es zu heilen gilt. Der Mensch an sich interessierte mich schon, seitdem ich ein Knabe war.«
»Und Sie denken, das genügt, um das überaus harte Studium der Medizin auf sich zu nehmen?«
»Wird nicht jeder Erfolg zunächst aus einem Wunsch geboren?«, platzte es aus Julius heraus.
»Ich stelle fest, Sie verfügen über ein starkes Temperament. Das wird Sie möglicherweise vor dem Trübsinn bewahren, den jeden früher oder später befällt. Das Ereignis eben, was ging da in Ihrem Kopf vor?«
Julius räusperte sich. »Es erschreckte mich. Der junge Herr, er wirkte so ›normal‹. Verstehen Sie?«
Tamm nickte ernst und sah an Julius vorbei zum Fenster. »Nun, Sie werden sich frisch machen wollen. Sie sagten, Doktor Brackhagen hätte sich Ihrer bereits angenommen?«
Julius machte eine abwehrende Geste. »Nein, nicht direkt. Eine schriftliche Referenz liegt mir nicht vor. Er erteilte mir gestern eine mündliche Zusage.«
Ein Glockenschlag, der die halbe Stunde ankündigte, ließ Doktor Tamm auffahren. »Es tut mir leid, Herr Lehnau. Es fehlt mir an Zeit, mich weiter um Sie zu kümmern. Kommen Sie, ich werde Sie jemandem vorstellen.«
Julius folgte Tamm einmal mehr durch die Flure der Universität. Niemals hätte er vermutet, dass der Mann, den Tamm ihm dann vorstellte, ein Arzt war. Seine äußere Erscheinung war beinahe filigran zu nennen. Die Gesichtszüge waren so ebenmäßig, dass Julius zweifelte, ein menschliches Wesen vor sich zu haben. Der Arbeitskittel des Mannes war sauber und die Frisur à la mode. Graue Augen blickten ihm aus einem faltenlosen Gesicht entgegen.
»Werter Kollege, dürfte ich Sie um einen Gefallen bitten?«, sprach Tamm ihn an.
Zur Antwort hob der Schönling lediglich eine Augenbraue. Tamm schien dies zu genügen.
»Dies hier ist Julius Weiland. Ein neuer Student. Doktor Brackhagen hat ihn in unsere Reihen aufgenommen. Nun gilt es, eine Unterkunft für ihn zu finden und ihm alles Notwendige zu erläutern. Er soll ja so bald wie möglich seine Studien aufnehmen.«
Der Tonfall Tamms klang hart und seine Miene erschien Julius feindselig. In der Vergangenheit musste es einen Zwist zwischen den beiden gegeben haben, mutmaßte er.
»So, so«, sagte der Schönling mit ebenso viel Kälte in der Stimme. »Dann kommen Sie mit, Herr Weiland.«
Wortlos folgte Julius. Der Koffer, den er die ganze Zeit mit sich trug, fühlte sich immer schwerer an und Julius hatte auf einmal das Bedürfnis, sich frisch zu machen.
Sie überquerten den Marktplatz. Auf einer Bank unter einem Kastanienbaum saßen zwei schwangere Frauen und genossen die frische Luft. Die Kulisse hätte friedlich wirken können, wenn nicht ein Galgen in unmittelbarer Nähe gestanden hätte. Zeit für längere Betrachtungen blieb Julius indes nicht. Der Arzt, der ihm voranging, legte ein flottes Tempo vor.
Es wurde schlagartig kalt, als sie in eine enge Gasse, eingerahmt von mehrgeschossigen Häusern, traten. Die Mauern sonderten einen modrigen Geruch ab, zwischen den Fugen wuchsen Moos und Flechten. Offenbar erreichte diese Gasse selten Sonnenlicht, dachte Julius.
Kurz nickte der Schönling einem jungen Mann zu, der eines der Häuser soeben verließ. Offenbar hatten sie ihr Ziel erreicht, denn der Schönling strebte auf den nächstgelegenen Eingang zu. Einen Moment später war er auch schon durch die Tür verschwunden, und zwar bevor Julius sie erreichte. Er unterdrückte einen Fluch, weil er sich mit seinem ganzen Gewicht gegen das schwere Holz stemmen musste, um sich und den Koffer durch die Öffnung zu bekommen. Er hätte die Tür ruhig für mich aufhalten können, dachte Julius gereizt.
»Kommen Sie schon«, drängte der Arzt. Julius keuchte hinter ihm die Treppe in die erste Etage hoch.
»Hier finden Sie die Quartiere der Studenten«, sagte der Beau kurz angebunden. »Zwei oder drei teilen sich jeweils ein Zimmer. Ich weiß allerdings nicht, ob derzeit etwas frei ist.«
»Aber Doktor Brackhagen hat …«
Auf der Stirn des Schönlings zeigte sich plötzlich eine Falte, Julius stockte mitten im Satz.
»… Ihnen bereits mitgeteilt, wo Sie unterkommen können? Ausgezeichnet, dann finden Sie ja selbst zurecht.« Damit ließ er Julius stehen.
Verdattert stand Julius im Flur des Gebäudes. Vehement hielt er sich am Griff seines Koffers fest, weil er das Einzige war, das ihm im Augenblick Sicherheit gab.
Schritte polterten irgendwo im Gebäude, Gelächter erscholl. Kurze Zeit später sah Julius zwei Studenten, die im Laufschritt die Treppe heruntergeeilt kamen und nur knapp vor ihm stehen blieben.
»Guten Tag«, sagte Julius scheu.
Die beiden erwiderten den Gruß nicht.
Sie starren mich an, als wäre ich faules Gemüse an einem Marktstand, dachte Julius.
»Ich bin ein neuer Student«, stammelte er hilflos.
Die beiden warfen sich einen langen Blick zu, dann sahen sie auf den Koffer.
Der Größere schnaubte missbilligend und sagte an den etwas untersetzen Studenten gewandt: »Machst du das?«
Der nickte ergeben und bedeutete Julius mit einer knappen Geste, ihm zu folgen.
Hätte ich nur zuvor mit Gottlieb gesprochen. Er hätte mir alles erklärt und ich hätte mich großartig selbst zurechtgefunden, dachte Julius eingeschüchtert.
»Hier können Sie fürs Erste Ihren Koffer abstellen«, sagte der Untersetzte und deutete auf einen Alkoven, der vom restlichen Raum durch einen Vorhang abgetrennt war.
»Ist das Ihr Zimmer?«, wollte Julius wissen.
»Ja«, sagte der andere.
Und nachdem er weiterhin schwieg, fasste sich Julius ein Herz, schon allein, weil er die Feindseligkeit nicht länger ertrug. »Werden Neuankömmlinge immer so kalt begrüßt?«
Der Untersetzte trat ganz dicht vor Julius und sah mit halb zusammengekniffenen Augen zu ihm hoch. »Wir sind keine Freunde, verstehen Sie? Nur etwa die Hälfte von uns besteht die Prüfungen. Die Plätze für Ärzte sind begrenzt.«
»Ich dachte, es werden viele Ärzte benötigt.«
Der Untersetzte lachte durch die Nase. Ein unangenehmes Geräusch.
»Wer ist eigentlich dieser Arzt mit dem makellosen Gesicht?«, lenkte Julius ab.
»Doktor Hellenthal«, gab der Untersetzte zurück. »Der Meister in Sachen Chirurgie.«
»Und Doktor Tamm?«
»Bei dem liegen die Dinge anders. Ein netter Kerl mit etwas zu ausgeprägter Hilfsbereitschaft. Meiner Meinung nach ist das der Grund dafür, dass er es nie zu Ruhm bringen wird. Außerdem treibt er sich für meinen Geschmack etwas zu viel in den Irrenhäusern herum.«
Julius wagte einen letzten Vorstoß, freundlich zu sein, und reichte dem Untersetzten die Hand. »Ich bin übrigens Julius Weiland.«
Sein Gegenüber zögerte kurz, dann schlug er ein. Seine Hand war verschwitzt. »Hans Nachter.«
Julius wagte ein Lächeln. Verlegen wendete sich Nachter ab und machte eine vage Geste, die das Zimmer einschloss. »Bescheiden zwar, aber die Öfen ziehen gut und man friert nicht im Winter.«
Julius nickte. »Mir ist aufgefallen, dass es allenthalben sehr sauber ist.«
»Oh ja, das ist das Erste, was man hier lernt. Anfänglich ist man eigentlich nur am Putzen, sodass man sich durchaus fragen könnte, ob man versehentlich das falsche Berufsbild gewählt hat.«
Humor hat er wenigstens, dachte Julius erleichtert.
»Der erste Tag ist zur freien Verfügung, danach gehören Sie ganz der Fridericiana«, fuhr Nachter fort.
»Wo kann ich denn heute Nacht schlafen?«
»Oh, Sie haben noch kein Zimmer? Am besten melden Sie sich dafür beim Schreiber in der Rathswage. Er wird Ihnen dabei behilflich sein.«