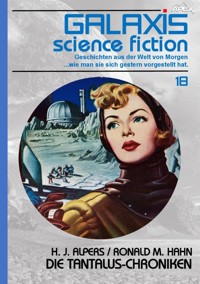Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Thalon verliebt sich ausgerechnet in Alina, die Tochter der mächtigen Kauffrau Murenbreker. Als die beiden fliehen, haben sie nicht nur die Häscher des Despoten von Ghurenia, sondern auch den Murenbreker-Klan auf dem Hals. Der zweite Roman über die Piraten des Südmeeres schildert Thalons verzweifelten Kampf um Liebe und ein eigenbestimmtes Leben in einer Welt, die ihm beides nicht zubilligen will.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Hans Joachim Alpers
Flucht aus Ghurenia
Die Piraten des SüdmeersTeil 2
Neunzehnter Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Impressum
Ulisses SpieleBand 19
Kartenentwurf: Ralf HlawatschE-Book-Gestaltung: Michael Mingers
Copyright ©2012 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE, MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Significant GbR.Alle Rechte von Ulisses Spiele GmbH vorbehalten.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt. Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Print-ISBN: 3-453-10975-9 (vergriffen)E-Book-ISBN: 978-3-86889-632-9
1. Kapitel
Da war ein Raunen wie aus weiter Ferne, ein Name, der ausgesprochen und weiter davongetragen wurde, als es in der Absicht desjenigen lag, dessen Lippen ihn geformt hatten. Ein Name, den der Mann, den sie Cassim nannten, nicht einmal richtig verstanden und kurz darauf schon wieder vergessen hatte. Aber dieser Name, dieses Geräusch, diese vielleicht nur zufällige Aneinanderreihung von Lauten, die sich in eine der wenigen Pausen im Hämmern und Klopfen gedrängt hatte, schien tief in seinem Inneren etwas berührt zu haben.
Cassim kam, was ihm nur selten geschah, aus dem Takt. Zum Glück hatte der Aufseher es nicht bemerkt. Cassim schaute sich um, aber er vermochte nicht zu entscheiden, wer von den mehr als zwanzig Sklaven in nächster Nähe den Namen, das Geräusch, den sonderbar vertrauten, sonderbar bedrohlichen Klang über die Lippen gebracht hatte.
Der Aufseher hieß Achak und war ein Tulamide. Sein Gesicht war dunkel, breit und mit unzähligen Narben bedeckt.
Eine mächtige gebogene Nase stach daraus hervor, und unter schmalen Augenbrauen glänzten kohlschwarze Augen, denen kaum etwas entging. Obwohl das Haar genauso vom grauweißen Steinstaub bedeckt war wie der muskulöse nackte Oberkörper, der Lendenschurz und die Riemensandalen, schimmerte unter dem Staub fettiges Schwarz. Das Haar war straff nach hinten gekämmt und endete als Zopf.
Scheinbar versunken saß Achak auf einem Felsbrocken und stützte die Hände, derbe Pranken mit kurzgliedrigen Fingern, auf die glahb mit den drei verknoteten Lederschnüren. Er sah aus wie ein erloschenes Feuer mit ein paar Stücken Fettkohle in der Asche, aber in Wahrheit war er ein Vulkan.
Unberechenbar und stets einen Wimpernschlag vor dem nächsten Ausbruch.
Achak war bei seinem Herrn gut gelitten. Er verstand sich nicht nur darauf, die ihm anvertrauten Sklaven erbarmungslos anzutreiben. Er beherrschte auch die Kunst, sie so zu peitschen, daß sie sich vor Schmerzen krümmten, ohne sie jedoch für die Arbeit zu verderben. Selten schlug er so oft und so fest, daß ihm ein Sklave vollständig verdarb. Sklaven waren teuer. Achak wußte dies und handelte danach. Allerdings war er nicht der Meinung, daß ein Sklave Grund haben sollte, sich seines Lebens zu erfreuen. Er hatte seine besondere Methode entwickelt, die Anforderungen seines Herrn mit seinen eigenen Leidenschaften auf vorteilhafte Art zu verknüpfen.
Cassim beobachtete den Aufseher aus den Augenwinkeln, während er mit seinem zweieinhalb Stein schweren und einen Spann langen Dolerithammer den Steinquader zurechtschlug.
Er wußte, daß Achak nur aufspringen und zwei Schritte tun mußte, um Cassim die Schnüre der dreischwänzigen glahb über die Hüfte zu ziehen. Und ihm war klar, daß er es früher oder später auch tun würde. Sobald Cassim es wagte, eine Pause einzulegen. Oder ohne besonderen Grund. Vielleicht nur deshalb, um Cassim daran zu erinnern, daß er ein Sklave und Achak ein Aufseher war.
Cassim versuchte sich den Klang des Namens, der ihn beunruhigt hatte, in Erinnerung zu rufen. Es wollte ihm nicht gelingen. Aber sein Körper schien sich zu erinnern. Tief in seinem Inneren ballte sich machtvoll ein Gefühl zusammen und drohte ihn zu übermannen.
Angst!
Nackte, kreatürliche Angst, an der Cassim zu ersticken drohte. Angst, die keinen Namen hatte. Für ihn hatte sie keinen Namen. Und doch war die Angst durch einen Namen ausgelöst worden, den er bewußt nicht einmal wahrgenommen hatte. Ein Name, der etwas in ihm berührt hatte. Etwas Altes.
Angst, Angst, Angst.
Angst, die mit diesem Namen in Verbindung stehen mußte.
Angst, deren Ursache er vergessen hatte. Wie er alles vergessen hatte. Aber die Angst hatte nichts vergessen. Cassim fühlte eine Bedrohung. Am liebsten wäre er aufgesprungen und davongerannt. Aber er wußte ja nicht einmal, wovor er flüchtete.
Er kämpfte die Panik nieder, indem er wie besessen mit seinem Hammer auf den Stein einschlug. Allmählich spürte er, daß die Angst zurückwich.
Als Achak plötzlich aufsprang und seine glahb schwang, traf sie nicht Cassim, sondern einen anderen. Die Lederschnüre fraßen sich in den schmalen Rücken des alten Zobo, brachen Borke über alten Wunden auf und ließen Blutstropfen aus den Rändern der frischen Striemen perlen. Zobo war zusammengezuckt und biß sich auf die Unterlippe, um keinen Schrei auszustoßen. Aber er hörte nicht damit auf, mit seiner Doleritscheibe, Bimsmehl und Knochenöl den grauen Marmor zu glätten.
»Alter Bock, du bist hier nicht im alveranischen Paradies, verstanden!« brüllte der Aufseher. »Aber ich sorge auf der Stelle dafür, daß du dorthin gelangst, wenn du nicht sofort einen Zahn zulegst! Was habe ich getan, daß Boron mich mit Greisen straft, die ihre Pisse nicht mehr halten können?«
Achak legte eine Pause zum Luftholen ein. Erneut schlug er den Alten, dem der Schmerz das Wasser in die Augen trieb und der trotzdem wie ein Besessener seine Polierscheibe kreisen ließ, um den Peiniger zu befriedigen. »Mit alten Scheißern, denen schon die Würmer im Fleisch herumkriechen? Mit alten Furzern, deren runzliges Arschloch wie ein Frosch quakt, wenn sie ihren halbverfaulten Darm lüften?«
Cassim verstand nur die Hälfte von Achaks Tiraden, aber genug, um zu wissen, worum es ging und was für gewöhnlich folgte. Er duckte sich, aber das konnte ihn auch nicht retten. Im nächsten Moment stachen ihm die Lederschnüre in die Hüfte.
Er krümmte sich.
»Oder mit Blöden wie dem da!« schickte Achak dem Hieb der glahb einen Gruß hinterher. »Die sich das bißchen Hirn, das sie hatten, weggevögelt haben. Die von den Göttern für ihr Saufen und Huren bestraft wurden. Habe ich recht,
Schwachkopf?« Ein neuer Hieb. »Ich rede mit dir, Abschaum!«
Die Bedeutung des Wortes Abschaum war Cassim bekannt.
Er setzte ein einfältiges Grinsen auf. »Abschaum, ja. Cassim sein Abschaum, ja. Danke, ja. Meister viel klug, ja.«
Achak schwankte zwischen Zufriedenheit und Mißtrauen.
Vorsichtshalber ließ er die glahb noch einmal Cassims Körper küssen, diesmal die Oberschenkel. »Manchmal habe ich den Eindruck, daß du schlauer bist, als du tust«, knurrte er. »Wenn ich jemals herauskriegen sollte, daß du mich verarschst, schneide ich dir die Eier ab, Blödian! Und anschließend den Schlund! Und wenn mich mein Herr mit einem halben Jahressalär dafür zahlen läßt!«
»Ja, Meister. Danke, Meister, ja.« Cassim nickte mehrmals, vergaß jedoch nicht, weiter den Dolerithammer zu schwingen.
Eine Weile starrte ihn der Aufseher noch an. Dann machte er eine abfällige Handbewegung und drehte sich um. Er schlenderte durch die Reihen der Steinmetzen, Steinpolierer, Steinsäger und Steinbohrer, die zu Füßen der Berge arbeiteten.
Hin und wieder holte er mit der glahb aus und ließ sie spielerisch auf einen der nackten Rücken hinabsausen. Der graue Staub, der jeden einzelnen dieser Rücken bedeckte und kaum noch die natürliche Hautfarbe zeigte, wirbelte auf und tanzte in der hitzeflirrenden Luft. Die Frauen, die knochentrockene Holzpflöcke in die Bohrlöcher steckten und dann mit Wasser übergossen, damit das quellende Holz den Stein sprengte, bedachte er besonders üppig mit Schlägen. Nur Eliamet, eine großbrüstige, langmähnige Frau, die derzeit sein Lager teilte, wurde verschont und mußte statt dessen einen derben Griff zwischen die Schenkel erdulden.
Das Hämmern und das Sägen erfüllten das Tal und klangen bis auf die Bucht hinaus, wo die Schiffe aus Ghurenia im Wasser dümpelten. Auf Rollen und Holzschlitten zogen einige Sklaven Marmorquader zum Strand hinab, während nackte Kinder Fischtran in die Gleitbahnen rieben, um den Transport zu erleichtern. Sie mußten aufpassen, nicht überrollt zu werden, wie es einem der Blagen am vergangenen Windstag passiert war. Man hatte die Reste aus dem Fels kratzen müssen, und der riesige Blutfleck war noch immer gut zu erkennen. Als hätte der Felsen selbst geblutet. Blagenblut oder Felsenblut, das kümmerte hier keinen, nicht einmal die Sklaven. Selbst die Mutter des Kindes schaute inzwischen nur noch apathisch drein. Sie war Zeugin des Unglücks gewesen und schreiend herbeigelaufen. Als sie nicht aufhörte zu schreien, hatte der Transportaufseher drei Sklaven aufgeboten, um sie zu fesseln, zu knebeln und zu den Höhlen zu schleppen.
Die drei hatten offenbar die günstige Gelegenheit genutzt, die Wehrlose zu besteigen. Zumindest brüsteten sie sich mit dieser Tat. Der Mann, der am lautesten davon geredet hatte, lebte nicht mehr. Er lag am nächsten Morgen mit durchschnittener Kehle in seinem Blut. Die Frau stritt ab, etwas damit zu tun zu haben. Vielleicht sagte sie die Wahrheit, und ein Gerechter unter den Sklaven hatte sich ihrer Sache angenommen. Die überlebenden Schänder schwiegen seither, umklammerten oft ihre Steindolche und wachten des Nachts im Wechsel, während der andere schlief.
An einem Einschnitt der Bucht schoben Sklaven, begleitet von zwei pöbelnden Aufsehern, einige Marmorquader auf ein Treidelboot, das mit Tauen an eine der Potten herangezogen wurde, wo weitere Sklaven die Quader an Deck hievten. Arbeit gab es reichlich auf Minlo.
Endlich kam der von allen herbeigesehnte Moment. Auf ein Zeichen der Oberaufseherin blies einer der anderen Aufseher die urfhana, ein Bronzehorn mit zwei Trichtern. Der dumpfe, aber durchdringende Ton drang bis in die fernsten Winkel des Talkessels und überlagerte alles Hämmern, Sägen und Klopfen. Auf der Stelle ließen die Sklaven ihre Werkzeuge fallen. Einige sanken erschöpft zu Boden, aber die meisten strebten bereits den Zelten und Hütten am Strand entgegen, wo das Essen verteilt wurde.
Die Insel war auch ohne Mauern und Zäune ein Gefängnis, dem so leicht niemand entrinnen konnte. Im Westen, Norden und Osten versperrten unzugängliche Felsmassive den Zugang zum Meer. Suchte ein Flüchtling trotzdem sein Heil darin, in diese Wände zu steigen, war er stundenlang den Blicken aller im Tal Zurückgebliebenen ausgesetzt, vor allem denen der Söldner. Die Söldlinge besaßen Armbrüste und Langbogen, mit denen sie jeden herunterschießen konnten, den sie dort entdeckten. Und wenn deren Reichweite nicht ausreichte, fiel gewiß ihrer Tiermeisterin etwas ein. Es hieß, die Frau, die Adler und Falken dressierte und die Vögel dazu bringen konnte, im Fels hängende Menschen anzugreifen, habe Zauberkräfte. Und eine Flucht im Schutze der Nacht hatte noch niemand gewagt. Selbst nicht gesehen zu werden, bedeutete auch, selbst nichts sehen zu können. Angesichts der tückischen Steilwände eine Entscheidung für den Tod. Dann konnte man sich auch gleich in das Schwert eines Söldners stürzen.
Blieb die Südseite der Insel, die Bucht, in der die Schiffe ankerten. Tatsächlich boten die Schiffe die einzige Möglichkeit, Minlo lebend zu entkommen. Die nächste Insel lag zu weit entfernt, als daß ein Schwimmer darauf hoffen konnte, sie zu erreichen. Aber zwischen dem Talkessel und den Schiffen befand sich das Dorf der Söldner und Aufseher.
Es mochten ihrer siebzig sein, gut bewaffnet und stets auf der Hut. Hätten sich alle achthundert Sklaven zu einem Aufstand verschworen, hätten sie die Soldaten mit ihren Schwertern, Degen und Lanzen – sogar die Torsionsgeschütze – vielleicht überwinden können. Aber damit wären sie immer noch nicht an Bord der Schiffe gewesen. Bei Gefechtslärm hätten die Besatzungen die Segel gesetzt, und die nie nachlassende Brise aus Nordost, die die Berghänge herabfiel und zur offenen Seite der Insel drückte, hätte es ihnen leicht gemacht, rasch das Meer zu erreichen. Wenn es wider Erwarten doch gelungen wäre, eines der Schiffe zu kapern, wäre den Flüchtlingen kaum eine Zufluchtsstätte geblieben. Nur die Piraten hätten sie aufgenommen. Das hätte für viele Sklaven bedeutet – selbst für jene, die immer wieder geschlagen und geschunden wurden –, vom Regen in die Traufe zu gelangen. Hinzu kam, daß die meisten von ihren Besitzern nur auf Zeit zur Bestrafung in den Steinbruch geschickt worden waren. Ein massenhafter Sklavenaufstand war hier nicht zu erwarten.
Cassim bewegte sich in der langen Reihe seiner Leidensgefährten zu den Zelten und Hütten der Aufseher am Strand. Heute hatte die urfhana mehr als das übliche Signal am Ende des Arbeitstages verkündet. Heute war Markttag, morgen Borontag. Selbst den Sklaven wurde der Borontag als Ruhetag zugestanden. Beim Gedanken an die Stunden der Ruhe kamen Gespräche und hier und da sogar ein Lachen auf. Einige der Sklaven schienen vor Aufregung auf der Stelle zu tanzen, aber Cassim wußte es besser. Wer nach der Schinderei noch so munter die Beine bewegte, tat es aus zwingendem Grund. Die Tanzenden waren Sklaven, die keine Sandalen besaßen und denen der heiße Sand die Fußsohlen zu verbrennen drohte.
Je näher sie den Hütten kamen, desto mehr mischte sich in den Staubgeruch des Windes von den Bergen der Geruch von Salz und Teer, Rauch und frischgebackenem Hirsebrot, saurem Wein und schalem Bier. Vor den Backhütten türmten sich Hunderte von Fladenbroten. Amphoren und Schläuche mit Bier und verwässertem Wein lagerten vor einer der anderen Hütten, bewacht von den Küchensklaven, die mit verschränkten Armen einen Ring um die Schätze bildeten. Die grimmigen Mienen sollten eher die eigene Wichtigkeit betonen als abschrecken. Die Sklaven wußten, daß für alle genug vorhanden war. Man tat ihnen auf der Insel alles mögliche an, aber verhungert oder verdurstet war noch keiner. Die Herren wußten, daß ihnen die teuer bezahlte Menschenware verdarb, wenn die Bäuche nicht gefüllt wurden.
Einige der Ankömmlinge bauten sich vor den Verteilstellen auf, andere stürzten sich in das klare Wasser der Bucht, um den geschundenen Körper abzukühlen und den Staub loszuwerden. Sie wußten, daß ihnen die Brote und Weinschläuche nicht davonlaufen würden.
Auch Cassim wandte sich dem Wasser zu, aber eine magere Hand griff von hinten nach ihm und hielt ihn am Arm fest.
Cassim runzelte die Stirn und sah sich um. Er starrte in die fiebrigen Augen von Munro, einem schmalen Mann Anfang Dreißig, den alle wegen seiner Schwächeanfälle längst abgeschrieben hatten, der aber zäh am Leben blieb. Cassim brachte dem dünnen Mann manchmal Wasser, wenn dieser im Fieber schrie, und Munro versuchte im Gegenzug, dem Wohltäter auf die eine oder andere Weise seine Schuld zurückzuzahlen. Die Wörter, die Cassim kannte, hatte er fast alle von Munro gelernt. Und Munro war es auch gewesen, der ihm geholfen hatte, sich in die täglichen Abläufe auf der Insel einzufügen. Er hatte ihm sogar beigebracht, sich mit einem Steinmesser zu rasieren.
»Geh nicht ins Wasser, Cassim«, sagte Munro. »Fremde Leute sind eingetroffen.«
Er zeigte hinaus auf die Bucht. Tatsächlich sah Cassim neben den vier plumpen Potten ein kleineres und viel schlankeres Schiff, das ihm bisher noch nicht aufgefallen war.
»Sie suchen nach einem Gelbhaarigen«, fuhr Munro fort. »Es gibt hier nicht viele davon unter den Sklaven. Ungewaschen bist du für sie einer von vielen Grauhaarigen. Und ich glaube nicht, daß dich einer von uns verraten wird.«
»Was Leute wollen von Gelbhaar?« fragte Cassim zurück.
»Was sein das für Leute?«
»Sie wollen bestimmt nichts Gutes. Und was das für Leute sind? Es heißt, Malurdhin hat sie geschickt. Aber mit dem Namen wirst du nichts anfangen…«
»Malurdhin!« stieß Cassim hervor. Das war der Name gewesen, den er im Steinbruch gehört hatte. Der Name, der die Angst wieder in ihm aufsteigen ließ.
»So kann man sich täuschen! Und ich dachte, der Name würde dir nichts sagen. Woher kennst du ihn? Warst du Malurdhin-Besitz und bist ihm weggelaufen?« Er musterte das Sklavenmal auf Cassims Oberarm. »Schon möglich, daß es sein Zeichen ist. Aber ich kenne mich mit den seltenen Zeichen nicht so gut aus, und es ist ungewöhnlich, daß ein Händler seine Ware selbst brennt.«
Cassim horchte in sich hinein und schüttelte dann den Kopf.
»Nicht wissen. Glauben nein. Aber Name machen angst. Irgendwoher kennen. Vielleicht von früher.«
Munro seufzte. »Nicht wissen, nicht wissen. Immer das gleiche mit dir. Malurdhin ist ein berüchtigter Sklavenhändler und obendrein ein Vertrauter des Praefos von Ghurenia. Wenn dir sein Name Angst einjagt, mußt du ihm schon mal in die Quere gekommen sein. Ein Grund mehr, dich zu verstecken.
Geh hinauf zu den Höhlen. Ich gebe dir später etwas von meinem Essen ab.«
Cassim schüttelte den Kopf. »Nicht waschen, gut. Aber davonlaufen, das schlecht. Lieber kämpfen. Lieber sterben.«
»Cassim, du bist wirklich ein Schwachkopf, aber du mußt selbst wissen, was du tust.« Munro wandte sich verärgert ab.
Cassim hatte seine Worte ernstgemeint, obwohl er nicht wußte, was ihn dazu brachte, den gutgemeinten Rat in den Wind zu schlagen. Irgend etwas in seinem leeren, dummen Kopf schien eine törichte Entscheidung gefällt zu haben.
Cassims Gedächtnis reichte von der Stunde, in der er mit bohrenden Kopfschmerzen auf der Insel erwacht und sofort an die Arbeit geprügelt worden war, bis zum heutigen Tag. Sein ganzes bewußtes Leben bestand aus etwas mehr als drei und einem halben Mond, obwohl man sagte, er müsse seinem Aussehen nach etwa zwanzig Jahre alt sein. Jahre… Er hatte nur eine undeutliche Vorstellung von einer derart langen Aneinanderreihung von Tagen, die außerhalb seiner Erfahrung lag.
Man hatte ihm fast jeden Schritt und jeden Handgriff beibringen müssen, obwohl er manchmal seine Lehrmeister verblüffte, wenn ganz unvermutet Fertigkeiten aus seinem früheren Leben durchbrachen. Aber Cassims Kopf blieb leer, so verzweifelt er auch in sich hineinhorchte. Da gab es nur die Tage und Stunden auf dieser verfluchten Insel, die begierig aufgesaugten Erzählungen anderer Sklaven, soweit seine immer noch unzureichenden Sprachkenntnisse ausreichten, sie zu verstehen. Aus all dem war ein Bild von der Welt jenseits des Wassers und erst recht vom Reich der Zwölfgötter
entstanden, das so verworren war, daß es ihm selbst höchst merkwürdig vorkam. Die Plackerei im Steinbruch empfand er als endlose Qual, aber die Welt dort draußen machte ihm angst.
Dazu bedurfte es nicht einmal irgendwelcher Namen wie Malurdhin. Aber daß ein Malurdhin zu dieser Draußenwelt gehörte, bestärkte Cassim in seinem Wunsch, lieber auf der Insel bleiben zu wollen.
In meinem früheren Leben muß ich Dinge getan haben, diemutig waren. Was sonst bringt mich dazu, Munro zuwidersprechen? Lieber kämpfen, lieber sterben? Was weiß ichdenn vom Kämpfen? War ich ein Söldner wie jene dort an denZelten? War ich am Ende gar selbst dieser Malurdhin odereiner seinesgleichen? Ein Sklavenhändler? Habe ich Angst,wieder zu dem zu werden, vor dem ich – vielleicht – geflohenbin?
Am Strand, wo sich die marmornen Blöcke und Platten auftürmten, stand Nossa, die Oberaufseherin, und überragte die sie umgebenden Aufseher und Söldner. Sie schien einen Scherz gemacht zu haben und erntete wieherndes Gelächter ihrer Paladine. Die Frau mit der schwärenden, sonnenverbrannten Haut und den grauen Haaren, dünn und verfilzt wie übereinandergeschichtete, verstaubte Knäuel von Spinnweben, setzte ihre stämmigen Waden zu einem schaukelnden Gang in Bewegung. Unter der Leinentunika wabbelte die Dreieinigkeit von gewaltigem Bauch und prallen, herabhängenden Brüsten, die ihr den Spitznamen ›Geschwür‹ eingebracht hatten. Sie wirkte alt und schwerfällig, konnte aber noch immer blitzartig und mit enormer Wucht zuschlagen.
Wer sie für harmlos hielt, wurde schnell eines Besseren belehrt. Sie war so wenig harmlos wie die Großmutter aller Kaimane, und ihr Appetit auf Grausamkeiten ließ so wenig nach wie der auf gutes Essen und Trinken. Auf Minlo fühlte sie sich als eine Art Gouverneur, der nur dem Besitzer der Insel, einem reichen Kaufherren aus Brabak, verpflichtet war.
Nicht einmal die Sklavenhändler der Inseln, die ihre Sklaven nach Minlo ausgeliehen hatten, wurden von ihr ernstgenommen.
Erst jetzt, als sich Nossa und ihr Gefolge in Bewegung setzten, wurde deutlich, daß sich Neuankömmlinge auf der Insel befanden. Links neben der Oberaufseherin schlenderten ein Glatzkopf mit Bart sowie eine einäugige Frau mit Hakennase und einer häßlichen Wangennarbe dahin. Beide trugen schmutzigweiße Hemden, die mit einem Stehbund am Hals geschlossen waren und lange Ärmel besaßen, als wollten die beiden ihre Körper weder den Blicken anderer noch der Sonne aussetzen. Dabei konnte der fließende Stoff kaum die muskulösen Körper verbergen, und was an Haut zu sehen war, erwies sich als wettergegerbt und braun. Beide trugen lange Messer im Gürtel, deren Scheiden beim Gehen gegen die Oberschenkel schlugen.
Nossas Aufmerksamkeit galt jedoch nicht diesen beiden, sondern jemandem zu ihrer Rechten, die von Söldnern verdeckt wurde. Die Gruppe bog zu den Verpflegungshütten ab, und endlich gelang es Cassim, einen Blick auf die Person zu werfen, mit der sich Nossa unterhielt. Es handelte sich um eine untersetzte Zwergin mit einem breiten Gesicht und dicken roten Zöpfen. Auch sie trug ein langärmeliges Hemd und bewegte sich darin so steif, als sei dies eine gänzlich ungewohnte Hülle. Im Gürtel steckten zwei Messer, und eine zweischneidige Streitaxt war mit Ledergurten auf dem Rücken befestigt.
Cassim starrte die Frau an. Die anderen Sklaven hatten von Zwergen erzählt, aber er selbst sah zum erstenmal eine Vertreterin dieses Volkes. Er wunderte sich. Keiner der anderen Besucher auf der Insel war derartig gerüstet erschienen. Seeleute trugen oft Messer oder Dolche, die Offiziere manchmal einen Säbel, um ihren Rang zu unterstreichen. Die Zwergin schien eine mißtrauische Person zu sein. Oder gehörte es zu den Eigenarten von Zwergen, mit einer Vielzahl von Waffen die geringe Körpergröße auszugleichen? Diese Zwergin mit ihrem breiten Kreuz und ihren üppigen Muskeln schien eigentlich keinen Grund zu haben, die Körperkraft größerer Gegner fürchten zu müssen.
Während die Zwergin einsilbig auf Fragen von Nossa antwortete, schaute sie sich wachsam um. Sie hatte flinke Augen, und ihre Blicke schienen alles abzutasten und zu bewerten, was sie erspähen konnte, wenn sich zwischen den Körpern um sie herum eine Lücke auftat.
Der Blick der Zwergin glitt über einige Sklaven und blieb auf Cassim hängen. Ihre Augenbrauen schnellten hoch. Als ihr einer der Söldner das Blickfeld versperrte, schob sie ihn so derb beiseite, daß er ins Stolpern geriet.
Cassim, der sich gerade abwenden wollte, um zu einer der Verpflegungsstellen zu gehen, erschrak und senkte die Augen.
Malurdhin suchte einen blonden Sklaven, und er zweifelte nicht daran, daß die Zwergin ihn als den Gesuchten erkannt oder zumindest in die engere Wahl genommen hatte.
Ist Malurdhin eine Frau? Ist diese Zwergin Malurdhin?
Cassim horchte in sich hinein. Nichts… Das Gesicht der Zwergin wirkte eher… vertraut… seltsam freundlich… Er vermochte es nicht mit der Angst zu verbinden, die er mit dem Namen Malurdhin verband. Aber das hatte nicht viel zu bedeuten. Malurdhin konnte die Zwergin geschickt haben, um Cassim von der Insel zu holen.
Aus den Augenwinkeln sah Cassim, daß die Zwergin etwas zu Nossa sagte und in seine Richtung deutete. Die Oberaufseherin reckte sich, ragte noch höher aus dem Pulk ihrer Begleiter heraus.
»He, du!« rief sie. »Strohkopf, ich rede mit dir. Bleib stehen!
Wo ist dein Aufseher?«
Wie aus dem Nichts war Achak neben Cassim aufgetaucht, ließ die Schnüre seiner glahb sich wie Schlangenleiber um die Beine des Sklaven ringeln und zog mit einem wilden Ruck daran. Cassim wurden die Füße weggerissen, und er fiel in den heißen Sand. Seine nackten Beine begannen sofort zu brennen.
Er wälzte sich hin und her und versuchte wieder auf die Füße zu kommen.
Im nächsten Moment standen Nossa und die Zwergin neben Achak, der den Schaft seiner glahb drehte und dabei wild mit den Augen rollte.
»Gut gemacht!« lobte Nossa und wandte sich an ihre Begleiter. »Bindet ihn!«
Bevor Cassim wußte, was mit ihm geschah, waren mehrere Aufseher bei ihm, warfen sich auf ihn, preßten ihn in den Sand, drehten ihn auf den Bauch, zwangen ihm die Arme auf den Rücken und banden ihm die Handgelenke mit einer Lederschnur zusammen.
Wolltest du nicht kämpfen, Blöder? Wolltest du nicht sterben,Blöder? verhöhnte Cassim sich selbst.
Es war alles zu schnell gegangen. Er versuchte zu strampeln und um sich zu treten, als sie ihm auch die Füße binden wollten. Das brachte ihm von irgendwoher weitere Hiebe mit der glahb ein, und er krümmte sich. Die Hiebe wären nicht nötig gewesen. Er hatte ohnehin keine Möglichkeit, sich zu wehren. Sie drückten ihm die Beine zusammen, fesselten die Fußgelenke, schlangen eine weitere Schnur um Fuß- und Handfesseln und zogen sie zusammen.
»Genug«, sagte die Zwergin, als die Aufseher Cassim weitere Fesseln anlegen wollten. Sie wandte sich dem Glatzkopf und der Frau mit der Narbe zu. »Bringt ihn zum Boot und wartet auf mich. Ich denke, daß ich mit Nossa schnell handelseinig werde.«
Die beiden packten den Sklaven an den Schultern und den Beinen und schleppten ihn zum Strand.
»Sklaven sollten Freie tragen und nicht umgekehrt«, beschwerte sich die Frau. »Und bei den Zwölfen, der Bursche hat ein stolzes Gewicht. He, Nossa, gebt Ihr Euren Sklaven den Schotter aus dem Steinbruch zu fressen?«
Nossa verzog das Gesicht. »Wäre keine schlechte Idee. Die Faulpelze fressen uns nämlich die Haare vom Kopf. Aber leider bringt man uns nur Naschkatzen auf die Insel, die keine harte Kost gewohnt sind.«
»Die Fürze der Faulpelze sind auch so kaum zu ertragen«, mischte sich Achak ein. »Wenn die als Sandwinde aus dem Arsch kämen, würden wir völlig eingenebelt und könnten die Praiosscheibe nicht mehr erkennen.«
Einige der anderen Aufseher lachten. Nossa sah zu, wie die Begleiter der Zwergin den Sklaven wegtrugen. Die anderen Aufseher schlenderten zu den Hütten und Zelten, um die Ausgabe des Essens zu überwachen.
Cassims Bewacher hoben ihn in das Boot, mit dem sie von der Lorcha zum Strand gerudert waren, und warteten dort auf die Zwergin. Zu seiner Überraschung behandelten sie ihn freundlich, beinahe rücksichtsvoll.
»Geht’s dir gut?« fragte die Frau mit der Narbe leise. »Wir nehmen dir die Fesseln ab, sobald wir an Bord sind.«
Cassim nickte. Man nannte ihn einen Dummkopf, weil er sich nicht an sein früheres Leben erinnern konnte, aber Malurdhins Leute schienen noch um einiges dümmer zu sein. Wenn sie ihm wirklich die Fesseln abnähmen, spränge er über Bord, sobald er unbeobachtet wäre. Er hörte die Stimmen der Zwergin und der Oberaufseherin in einiger Ferne, verstand aber nicht, was geredet wurde.
Die Oberaufseherin führte die Zwergin zu einem Zelt, das abseits von den anderen stand, und hieß sie, mit ihr im Schatten des Vordaches auf einem Teppich Platz zu nehmen.
»Von Zwergen sagt man, daß sie gern in den Bergen hausen«, sagte die Oberaufseherin. »Ihr seid die erste seefahrende Zwergin, die mir begegnet ist.«
»Ich unterscheide mich in manchem von meinen Brüdern und Schwestern«, erklärte die Zwergin, während sie sich setzte.
»Aber es bedurfte schon besonderer Umstände, um meine Zurückhaltung gegenüber dem Meer aufzugeben und sie in Leidenschaft zu verwandeln.«
»Ich verstehe, Ihr wollt nicht darüber sprechen.«
»Nicht hier und jetzt. Ich möchte so bald wie möglich auf mein Schiff zurück.«
»Warum so eilig? Freßt und sauft mit uns, bis es uns zu Nase und Ohren herauskommt. Wir haben reichlich von allem. Raschtulswaller und Aranischen Schlauchwein, Trollzacker und sogar ein Fäßchen dunkles Waskir-Bier. Fragt mich nicht, wie es von Thorwal hierher gelangt ist, aber wir haben es. Das haut den stärksten Ochsen um, glaubt es mir. Es ist durch den Seetransport gut gerüttelt und nachgegärt.«
»Hört sich an, als würd man davon schneller ‘nen flinken Difar als ‘nen Rausch bekommen«, erwiderte die Zwergin.
»Aber das würd ich glatt riskieren. Doch wir wollen die Gunst Efferds nutzen und sofort nach Ghurenia zurückkehren. Nicht einmal Zwergenbier könnte mich davon abhalten.«
»Was seid Ihr für eine Zwergin, Garletta, wenn Ihr für eine zünftige Sauferei keine Zeit habt? Schiebt die Verspätung auf widrige Winde, falls Ihr sie mit Eurer schnellen Lorcha nicht aufholen könnt. Steht Euch der Sinn nach anderen Genüssen?
Wir haben unter den Dienersklaven ein paar Böcke, die immer können und bestimmt scharf darauf sind, mal einer Zwergin zu Diensten zu sein.«
Die Zwergin hob den Kopf und faßte Nossa fest ins Auge.
»Ich danke Euch für den guten Willen, aber die Antwort bleibt nein. Malurdhin will den Sklaven sofort, aus Gründen, die nur er kennt, die ihm aber furchtbar wichtig sind. Er hat es mir mehr als einmal eingeschärft. Und wenn Ihr es genau wissen wollt: Ich erhalte einen Bonus, wenn ich vor dem nächsten Markttag zurück bin, und das wird selbst mit meiner Seewolf knapp.«
»Na schön.« Nossa zuckte die Achseln. »Ich sehe ein, daß ich Euch unter diesen Umständen nicht überreden kann. Bringen wir also den Handel hinter uns. Cassim ist jung und kräftig.
Obwohl er blöd ist, kann man ihn gut einsetzen. Im Namen von Kaufherr Kaskor, dem diese Insel und dem dieser Sklave gehört, verlange ich sechshundert Dukaten für ihn.«
»Sechshundert? Dafür bekommt man ja ein Lowanger Streitroß!« empörte sich Garletta.
Nossa lachte. »Wenn Ihr es stehlt, bekommt Ihr es sogar umsonst. Nach allem, was ich weiß, müßt Ihr für ein gut ausgebildetes Roß mindestens siebenhundert hinlegen. Da sollte Euch ein so prächtig gebauter Sklave doch leicht sechshundert Dukaten wert sein.«
»Wenn es mein Geld wäre, würde ich Euch sogar tausend zahlen«, gab Garletta zurück. »Aber ihr kennt Malurdhin. Er zahlt nur das, was auf dem Markt üblich ist. Also dreihundert und keinen Heller mehr. Ich darf Euch daran erinnern, daß Malurdhin Kaskor eben diesen Sklaven für ganze zweihundert Goldstücke verkauft hat.«
»Davon weiß ich nichts. Und wenn schon. Als er auf die Insel kam, war er keine fünfzig Dukaten wert. Er konnte nicht mal allein pissen. Wieso will Malurdhin ihn denn plötzlich zurückhaben?«
»Ich sagte bereits, das geht weder Euch noch mich etwas an.
Ich führe nur einen Auftrag aus. Es bleibt dabei: dreihundert und nicht mehr!«
»Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist«, seufzte Nossa.
»Wahrscheinlich dauert mich Euer Leid, daß Ihr nicht die Muße habt, dem Waskir-Bier zuzusprechen und mit Sklaven zu vögeln. Also gut, weil Ihr es seid und weil Ihr einem Geizkragen wie Malurdhin dient: Ich lasse Euch den Sklaven für fünfhundert Dukaten.«
»Malurdhin schnitte mir den Schlund ab, wenn ich darauf einginge.« Garletta schüttelte so wild den Kopf, daß die Zöpfe flogen. »Aber ich sagte schon, ich hab es eilig. Und nur deshalb – seid gewiß, ich werde Blut und Wasser schwitzen, wenn ich Malurdhin meinen Leichtsinn gestehen muß – bin ich bereit, Euch vierhundert zu bieten.«
Nossa machte ein bekümmertes Gesicht. »Das hat man nun davon, wenn man aus Mitleid nachgibt. Man wird für dumm gehalten und bekommt einen Spottpreis geboten. Aber Ihr weist darauf hin, daß Ihr in Eile seid, und ich bringe es nicht über das Herz, daraus meinen Vorteil zu ziehen. Kaufherr Kaskor wird mir die Aufsicht entziehen, wenn er von dem unvorteilhaften Handel erfährt, obwohl oder gerade weil er, wie Ihr wohl wißt, ein Freund von Malurdhin ist. Na schön, erzählt es nur überall herum, daß die sonst so beinharte Nossa von einem Zwergenweib bezwungen wurde. Ich will heute leiden. Deshalb kriegt Ihr den Sklaven für vierhundertfünfzig.
Mein allerletztes Wort. Schlagt ein oder verlaßt die Insel!«
Garletta streckte die Rechte aus. »Einverstanden.
Vierhundertfünfzig. Ich denke, damit können wir beide gut leben.«
Nossa klatschte ihre Hand auf die der Zwergin. »Ihr seid eine lausige Händlerin, Garletta, und viel zu hoch eingestiegen.
Und Ihr habt keine Ausdauer. Ihr habt ja überhaupt nicht versucht zu feilschen! Dabei hätte ich Euch den Strohkopf zur Not für zweihundertfünfzig gelassen.«
Die Zwergin lachte. »Und ich hatte Vollmacht, bis siebenhundert zu gehen.«
»Siebenhundert? Was ist an diesem blöden Sklaven, daß Malurdhin ihn unbedingt zurückhaben will? Ihr wißt es wirklich nicht? Will er mit ihm vielleicht Blödiane züchten?«
Nossa schüttelte den Kopf.
»Was ich nicht weiß, kann ich Euch nicht verraten«, sagte die Zwergin. »Was kümmern uns die Narreteien der Geldsäcke?
Laßt ein Papier über den Handel anfertigen, damit Kaufherr Kaskor sein Geld von Malurdhin fordern kann.«
»Ihr habt es nicht dabei?« Die Oberaufseherin zog die Augenbrauen hoch.
»Wie Ihr wißt, treiben Piraten in diesen Gewässern ihr Unwesen. Malurdhin sagte, er werde mit Kaskor abrechnen, sobald dieser von seiner Reise nach Minlo zurück sei. Es gebe viele Posten gegeneinander aufzurechnen.«
Die Oberaufseherin überlegte eine Weile, nickte dann und rief einen schreibkundigen Sklaven aus dem Zelt. Kaufverträge dieser Art schienen für diesen nichts Neues zu sein. Er kehrte schon nach kurzer Zeit zurück.
Offenbar hatte er nur die Namen und die Summe in ein bereits fertiges Dokument eingesetzt.
Nossa malte mit einem Federkiel ein verschlungenes Symbol unter den Vertrag, während Garletta ein Kreuz machte. Der Sklave nahm den Vertrag, streute feinen Sand über die Signaturen, ließ ihn kurz antrocknen und schüttelte ihn ab.
Dann nahm er den Vertrag, Federkiel, die Streusanddose sowie das Bronzegefäß mit der Tinte und verschwand wieder im Zelt.
Die Zwergin erhob sich, aber Nossa bedeutete ihr, sich wieder zu setzen.
»Haltet mich nicht für mißtrauisch«, sagte die Oberaufseherin, »aber da Ihr zum erstenmal für Malurdhin auf Minlo seid, benötige ich von Euch eine Legitimation, bevor Ihr mit dem Sklaven die Insel verlassen dürft. Bisher habe ich nur Euer Wort, daß Malurdhin Euch schickt. Ich zweifle keinesfalls daran, versteht mich recht, aber Kaufherr Kaskor ist ein strenger Herr, der keinerlei Nachlässigkeit durchgehen läßt.«
»Ich verstehe Euch gut«, erwiderte Garletta. »Tatsächlich hat mir Malurdhin ein Dokument mit auf den Weg gegeben, das von ihm eigenhändig signiert und gesiegelt wurde.«
»Das ist sehr gut. Würde es Euch etwas ausmachen, es mir zu zeigen?«
»Durchaus nicht, denn schließlich ist es genau für diesen Zweck gedacht. Ihr müßt Euch allerdings an Bord meiner Seewolf bemühen. Ich bewahre es an einem sicheren Ort auf, damit es nicht den Piraten in die Hände fällt. Es könnte sonst mißbraucht werden.«
»Eine kluge Entscheidung, Garletta«, lobte Nossa. »Könnte ich Euch trotzdem überreden, mir dieses Dokument zu bringen? Ich nehme doch an, es handelt sich um ein Stück Pergament und nicht um eine Schiffsbohle.«
»Verzeiht meine Grobheit.« Die Zwergin erhob sich. »Ich lasse mich zur Seewolf rudern und bin schneller als der Wind zurück.«
»Soll mir recht sein.« Nossa griff nach einem weingefüllten Becher, den einer der Küchensklaven neben ihr auf einem Kupfertablett abgestellt hatte. »Überlegt Euch in der Zwischenzeit, ob Ihr nicht doch noch etwas Zeit für einen Umtrunk habt.«
Garletta grinste nur und eilte mit kurzen, schnellen Schritten davon.
»Laßt den Sklaven solange am Strand zurück, hört Ihr!« rief Nossa der Zwergin hinterher.
»Seid unbesorgt, ich hatte nichts anderes vor«, antwortete Garletta über die Schulter zurück.
Cassim sah im Liegen nur ein Stück Himmel, das abgewetzte, beinahe blanke Holz der Ruderbänke, klobige Holme auf geschmiedeten Gabeln, gehalten von brüchigen Lederschlaufen, und die stämmigen Gestalten seiner Bewacher, die auf der Bootswand saßen und die Beine ins Wasser baumeln ließen. Cassims Augen nahmen vor allem breite Hintern und stämmige Schultern wahr. Wenn sich die beiden unterhielten, sah er auch etwas von den Gesichtern. Aus Cassims Blickwinkel wirkten die Nasen der beiden riesig. Er roch den sauren Schweiß ihrer Achselhöhlen. Ihre Kleidung stank nach Pisse, ranzigem Fett und Teer. Cassim spürte etwas Feuchtes an den Beinen und dachte schon, er habe sich in die Hosen gemacht. Aber dann sah er, daß die Kielbretter Wasser zogen.
»Wir müssen Malurdhins Dokument von der Seewolf holen«, erklärte die Zwergin, als sie das Boot erreicht hatte.
»Außerdem wünscht Nossa, daß wir den Sklaven wieder ausladen und erst mitnehmen, wenn die Sache mit dem Dokument erledigt ist. Was haltet ihr davon?«
Der Mann spuckte aus. »Gar nichts, kulko.«
Die Frau zog eine Grimasse. »Was mich angeht, so können mich die Landratten mitsamt ihrer verschissenen Insel mal kreuzweise. Wüßte auch nicht, welches Papier wir denen zeigen sollten.«
Die Zwergin lachte. »Dann sind wir uns ja einig.« Sie kletterte ins Boot, bewegte sich an Cassim vorbei zum Heck.
»Schiebt uns ins Wasser, ihr verdammten Piraten! Und dann will ich euch pullen sehen, was das Zeug hält!«
Wortlos sprangen die beiden an den Strand, stemmten sich gegen das Boot und drückten, bis der Sand den Kiel freigab.
Die beiden wateten hinterher, kletterten nacheinander über den Bug ins Boot und hatten im nächsten Moment schon die Ruderblätter im Wasser. Das Boot drehte den Bug hinaus in die Bucht.
Die Zwergin stand im Heck und gab Zeichen, die für die Lorcha bestimmt waren. Sie bekam Antwort, und im Nu setzte auf dem Schiff ein hastiges Treiben ein. Seeleute enterten die Wanten und kletterten auf die Rahen, andere drehten die beiden Spills. Beinahe dreieckig geschnittene Drachenflügelsegel wurden hochgezogen, und wenig später bewegte sich die Ankerkette. Offensichtlich hatte man an Bord bereits auf das Kommando der Zwergin gewartet.
Als die Zwergin sah, daß die Seewolf segelfertig gemacht wurde und das Boot bereits ein gutes Stück von der Küste entfernt war, wandte sie sich zurück. Nossa stand vor ihrem Zelt und brüllte Befehle. Mehrere Söldner rannten zum Strand und stießen einen Sklaven von dem einzigen Treidelboot, das dort lag. Das mit Steinquadern beladene Boot lag tief im Wasser. Damit würden sie die Flüchtlinge im Leben nicht einholen. Mit einem raschen Blick schätzte die Zwergin die Lage auf den anderen Schiffen ab, die in der Bucht ankerten.
Dort war man noch nicht aufmerksam geworden. Und was wollte man tun? Die Seewolf lag abseits der anderen Schiffe auf Reede und war dem Ausgang der Bucht näher. Wenn nicht in Windeseile Boote zu Wasser gelassen würden, um den Flüchtlingen noch den Weg abzuschneiden, könnte kaum noch etwas mißlingen.
»He, Nossa, du fette Schnecke!« schrie die Zwergin. »Das Handeln mit dir hat Spaß gemacht, aber den Vertrag kannst du dir in die Ritze schieben. Und erzähl deinem Herrn bloß nichts von einer Garletta! Ich heiße Cedira und bin die rechte Hand von Eiserne Maske. Wir sind der Schrecken des Südmeers. Sag’s deinem Herrn. Er wird unsere Namen kennen. Und grüß mir auch das Arschloch Malurdhin!«
Cassim hatte die Ereignisse mit ungläubigem Staunen verfolgt. Er verstand nicht, was in die Zwergin gefahren war.
Am meisten wunderte er sich darüber, daß dieses Täuschungsmanöver offenbar einzig und allein dem Zweck diente, ihn von der Insel zu holen. Cassim wußte nur das wenige über die Zwölfgötter, was andere Sklaven gelegentlich geäußert hatten. Aber er hatte das dumpfe Gefühl, nur sie könnten die Zwergin – diese Cedira, wie sie sich jetzt nannte – zu ihrem Tun veranlaßt haben. Eines allerdings hatte er klar und deutlich und mit allergrößter Befreiung zur Kenntnis genommen: Cedira hatte nur zur Tarnung behauptet, im Auftrag von Malurdhin zu handeln. In Wahrheit hatte sie nichts mit ihm zu tun. Die Angst fiel von Cassim ab wie ein nasses Wringtuch, das ihm den Hals eingeschnürt hatte.
»Weiter so, versautes Piratenpack!« feuerte Cedira die Ruderer an, die sich mächtig ins Zeug legten.
Sehnen und Muskeln zuckten im Takt der Ruderbewegungen, und das Boot bewegte sich in zügiger Fahrt auf die Lorcha zu.
Die Linie der an Lee liegenden Potten war bereits passiert.
Von dort drohte keine Gefahr mehr. Söldner rannten am Strand hin und her, reckten Fäuste und Waffen, schickten
Schmähungen zu den Flüchtlingen hinüber. Cedira lachte. Sie ließ die Beinlinge hinunter und zeigte den Zurückgebliebenen den blanken Hintern. Die Ruderer grunzten beifällig. Der verwirrte Cassim starrte auf die Stelle zwischen den stämmigen Beinen, wo ein dichtes Gestrüpp aus rotem Schamhaar zu sehen war.
»Glotz nicht so, Thalon«, sagte die Zwergin und grinste, während sie die Beinlinge wieder hochzog. »Außerdem wünsche ich mir etwas mehr Begeisterung über deine Befreiung. Du könntest dich wenigstens mal bei uns bedanken, oder?«
Sie beugte sich mit dem Messer in der Hand zu ihm herab und säbelte an den Lederschnüren herum. Es dauerte nicht lange, dann hatte sie ihn davon befreit.
»Danke.« Cassim richtete sich auf, rieb sich erst die Hände und massierte sich die Fußgelenke. »Wie du mich genannt? Talom? Ich Cassim.«
»Blödsinn, du bist Thalon. Hör zu, mein Spatz, du kannst jetzt mit dem Scheiß aufhören. War auf der Insel vielleicht nützlich, aber das hast du zum Glück hinter dir. Und red nicht so bescheuert, klar?«
»Ich Cassim.«
Cedira sah ihn aufmerksam an. Dann trat ein beinahe mütterlich wirkendes Gefühl von Mitleid und Traurigkeit in ihre Augen. »Es ist also doch wahr«, sagte sie leise. »Haya hatte recht. Sie müssen irgendwas mit dir angestellt haben. Ich wollte es einfach nicht glauben. Aber der Kerl, der Haya verraten hat, wo wir dich finden können, erzählte was in der Richtung. Du kannst dich an nichts mehr erinnern, wie? Du erkennst nicht mal die alte Cedira wieder? Verdammte Scheiße noch mal!«
Immer näher schob sich das Boot an die Lorcha heran. Das Schanzkleid war vom Deck bis knapp oberhalb der Wasserlinie in gelben, blauen und roten Wellenlinien bemalt. Gegenüber den schmutzigbraunen Lastseglern wirkte sie wie ein bunter Papagei. Das etwa dreißig Schritt lange Schiff schien auf den ersten Blick aus einem Stück gefertigt zu sein. Erst aus nächster Nähe erkannte man die winzigen Fugen zwischen den Bohlen aus glattem Zedernholz. Gleichzeitig sah man, daß die Farbschichten brüchig waren und an einigen Stellen schon abblätterten.
Der Glatzkopf ruderte verhaltener, während die Frau mit der Narbe mit ihrem Ruderblatt gegensteuerte. Langsam drehte sich das Boot der Bordwand zu. Auf dem Mitteldeck stand eine dunkelhäutige Frau mit krausen Haaren, die wie eine Löwenmähne abstanden, und mit je zwei dicken Silberringen in jedem Nasenflügel. Sie grinste und warf Cedira eine Leine zu.
»Warum habt ihr die falon noch nicht gesetzt, Shanka?« schnauzte die Zwergin, während sie die Leine festmachte.
»Der Mummenschanz hat ein Ende. Wir sind jetzt wieder Piraten!«
»Falon hissen!« brüllte Shanka über das Deck. Sie zog eine Peitsche aus dem Gürtel und ließ die Lederschnur laut schnalzend durch die Luft gleiten. Offenbar wollte sie damit ihre Befehlsgewalt unterstreichen.
»Laß den Quatsch«, rügte Cedira. »Gib uns ein Tau! Oder hältst du mich für eine Katze, die am Schanzkleid hochklettert?«
Die Beschwerde war unnötig. Ein Mann, dessen Gesicht mit Pusteln übersät war und dessen schwarze Haare zu einer Hahnenkammfrisur ausrasiert waren, warf ihnen bereits ein Tau zu und befestigte das andere Ende an einem Belegnagel.
»Du zuerst!« bestimmte die Zwergin und drückte Cassim das Tauende in die Hand.
Das Boot dümpelte leicht auf den Wellen, und Cassim fühlte sich unsicher. Er wußte nicht, wie er es anstellen sollte, auf das Deck zu gelangen, obwohl der obere Rand des Rumpfes nur zwei Schritt über ihm lag.
»Verdammte Scheiße, hast du denn alles vergessen, Spatz?« schimpfte Cedira. »Ich hab dich schon wie ein Wiesel durch die Wanten turnen sehen, und jetzt kannst du nicht mal eine Spuckweite nach oben klettern? Aber das werden wir gleich haben!«
Sie tauchte unter ihn, bohrte ihren Kopf zwischen seine Schenkel, umklammerte sie gleichzeitig mit den Armen und richtete sich auf. Im nächsten Moment fühlte sich Cassim nach oben gestemmt. Verzweifelt hielt er sich an dem Tauende fest.
»Zieht ihn hoch!« schrie Cedira.
Shanka beugte sich über das Schanzkleid, packte Cassims Arme und zog ihn an Deck. Dann schlug sie ihm das Tauende, das er immer noch umklammert hielt, aus den Händen und warf es wieder zum Boot hinab.
Scheinbar mühelos kletterte die Zwergin an Bord, wo Cassim gerade wieder auf die Beine kam. »Du bist um einiges schwerer geworden, Spatz«, stellte sie fest. »Und kräftiger. Ich hätte dich beinah nicht wiedererkannt. Ist ja auch kein Wunder. Vier Jahre sind eine lange Zeit. Du bist jetzt ein Mann, was? Brauchst ‘nen größeren Klötenhalter als auf der SchwarzeRose, wie? Ich hab’s gespürt.«
Sie lachte, und Shanka fiel in das Gelächter ein. »Komm nachher mit mir in den Lastraum, Spatz, und zeig mir, was du in der Hose hast«, sagte die Schwarze und rollte mit den Augen.
»Zunächst mal nennst du ihn nicht Spatz, sondern Thalon«, wurde sie von Cedira zurechtgewiesen. »Und ansonsten läßt du ihn gefälligst in Ruhe. Wir müssen aus diesem tumben Sklaven erst wieder einen Piraten machen. Wenn er weiß, wer er früher mal war, kannst du dein Angebot wiederholen. Bin gespannt, ob er Lust hat, es dir zu besorgen. Ich an seiner Stelle würde dankend verzichten. Im übrigen habe ich an ihm die älteren Rechte, klar? Und jetzt Schluß damit.«
Cedira wandte sich dem Oberdeck zu und rief: »Wird der Kahn nun endlich gesegelt, oder was ist hier los? Piratenpack, ich mach euch Beine!«
Ein Johlen war die Antwort, aber vielleicht galt es auch dem dreieckigen Wimpel, der gerade von einer Frau nach oben gezogen wurde, die in einem Korb hoch oben am Mast saß.
Vor dem schwarzen Hintergrund des Wimpels waren in Weiß ein Totenschädel und gekreuzte Knochen zu sehen. Was dieses Symbol zu bedeuten hatte, konnte sich sogar Cassim gut vorstellen.
Die Frau mit der Narbe kletterte an Bord, dichtauf gefolgt von dem Glatzkopf. Der Mann mit dem Hahnenkamm zog das Tau hoch, während Shanka das Boot an der Leine zum Heck zog. Dort ließ sie ein Stück Leine nach, bis das Boot weit genug vom Rumpf entfernt war, um nicht dagegenzuschlagen.
Dann befestigte sie die Leine mit einem kunstvoll geschlungenen Knoten an einem Belegnagel. Offenbar sollte es von der Lorcha im Schlepp mitgezogen werden. An Bord der Seewolf schien es ohnehin keinen Platz für das große Beiboot zu geben.
Cedira und Shanka brüllten Befehle. Ein halbes Dutzend Männer und Frauen rannte an Deck herum und verrichtete fieberhaft irgendwelche Arbeiten, deren Sinn Cassim nicht verstand. Vier weitere stemmten sich gegen lange Holzholme und drehten auf diese Weise eine Trommel, um die ein Tau geschlungen war. Da sich gleichzeitig die Segel schräg in den Wind stellten, hielt Cassim das Rad für den Teil einer geheimnisvollen Apparatur, deren wichtigste Teile sich wohl unter Deck befanden.
Verwirrt blickte er sich an Deck um. Was immer Cedira behauptete, er konnte sich nicht erinnern, jemals an Bord eines Schiffes gestanden zu haben. Alles war ihm neu und unbekannt. Er sah drei Masten, an denen mehrere kleine sowie zwei großflächige Segel befestigt waren. Die Großsegel schienen Rippen zu haben, aber dann erkannte Cassim, daß sie durch Holzlatten versteift wurden. Sie sahen aus wie braungelbe Drachenflügel. Cassim sah ein Gewirr von Leinen, Stangen und Strickleitern, in dem er keinen Sinn entdecken konnte. Staunend betrachtete er einen Apparat, der mitten auf dem Deck stand. Es schien sich um eine riesige Schleuder zu handeln. Daneben lagen dicke Steine, die wohl als Munition dienten.
Cassim begab sich zögernd zum Hinterdeck, wo er Cedira in der Nähe eines senkrecht angebrachten großen Rades sah. Sie war im Moment seine einzige Stütze, um sich in der ungewohnten Umgebung zurechtzufinden. Er bemühte sich, den herumrennenden Seeleuten nicht in die Quere zu kommen, und hielt sich auch so weit wie möglich von den weit
ausladenden Segeln fern.
Die Seewolf nahm Fahrt auf.
»Rasho, du übernimmst das Schiff!« sagte Cedira, als sie Cassim die Leiter zum Oberdeck hinaufsteigen sah. Sie nahm ihn beim Arm und zog ihn ein Stück vom Ruder weg, wo Shanka und ein Mann mit einer dreieckigen blauen Kappe, der das große Rad drehte, Platz benötigten. Shanka brüllte jetzt die Befehle. Offenbar war rasho eine Art Titel.
Cedira schüttelte den Kopf, als sie Cassims staunende Blicke sah. »Ich werde dich wieder bei der Hand nehmen und dir alles erklären müssen«, sagte sie leise. »Weißt du, daß wir das gleiche Spiel schon vor vier Jahren gespielt haben? Nein, das weißt du natürlich nicht. Verdammte Kacke! Wenn ich nur wüßte, was mit dir los ist.«
Cassim antwortete nicht. Was sollte er auch antworten? Was auch immer die Zwergin sagte, es rief kein Echo in ihm hervor.
Aber er begann die Frau zu mögen. Trotz ihrer manchmal derben Art schien sie ein freundliches Wesen zu besitzen.
Die Seewolf hielt Kurs auf die Mitte der Buchtöffnung.
Cedira sah zum Land zurück und lachte. Einige Söldner rannten um die Bucht, um den Strand an der schmalsten Stelle zu erreichen. »Diese dämlichen Landratten! Viel zu langsam.
Und selbst wenn sie’s schaffen würden, könnten sie nichts ausrichten. Sie können dem Schiff nichts anhaben.«
Die Söldner schienen die Fruchtlosigkeit ihres Tuns einzusehen. Sie blieben stehen und reckten hilflos die Waffen.
»Armselige Tröpfe!« Cedira wandte sich Cassim zu. »Komm mit in meine taba. Da wirst du jetzt wohnen. Ich will mit dir reden, dir von den alten Zeiten erzählen. Vielleicht gibt es doch irgendwas, woran du dich erinnerst.«
Cassim nickte und folgte ihr, als sie die Treppe zum Niedergang hinabstieg. »Wohin wir fahren?« fragte er.
»Ein Schiff fährt nicht, sondern es segelt«, erklärte die Zwergin. »Wir treffen uns mit Eiserne Maske. Er wird staunen, daß ich dich bringe. Er weiß nämlich nichts davon und hält dich für tot. Abgesoffen beim Kampf mit den Praefos-Schiffen.
Er wollte dich noch rausfischen, konnte dich aber nicht mehr zu fassen kriegen. Keine Ahnung, wer oder was dich gerettet hat. Auf jeden Fall wird er sich freuen, dich wiederzusehen.«
Eiserne Maske schien der Name eines Mannes zu sein. In Cassim weckte er keine Erinnerung. So wenig wie alles andere. Er zweifelte daran, daß er wirklich jener Thalon war, für den die Zwergin ihn hielt. Vielleicht sah er diesem Thalon nur ähnlich.
An Deck wurde wieder laut gejohlt. Die Seewolf hatte die Ausfahrt der Bucht passiert und segelte hinaus in die offene See.
2. Kapitel
Cedira ließ gedörrtes Hammelfleisch, Schiffszwieback, Datteln sowie einen Schlauch Bitterwein kommen. Eine blutjunge bronzehäutige Piratin tischte auf. Cassim konnte nicht vermeiden, sie immer wieder anzustarren. Sie besaß einen schlanken, geschmeidigen Körper. Unter dem geflickten, aber sauberen roten Seidenhemd zeichneten sich wohlgeformte Brüste ab. Cassim sah allerdings nicht auf die Brüste, sondern auf ihr Gesicht. Die eine Hälfte war ebenmäßig und anmutig, die andere Hälfte hoffnungslos zerstört. Die Nase war gebrochen und vernarbt. Ein Auge wurde von einer schwarzen Klappe verdeckt. Zwei breite Narben zogen sich auf dieser Seite von der Stirn über die Wangen bis zum Hals. Wenn das dichte schwarze Haar zurückfiel, waren weitere Narben zu sehen. Das Mädchen sprach kein Wort und huschte wieder hinaus, als die Speisen und Getränke auf dem Tisch der taba standen.
Cassims Blicke waren der Zwergin nicht verborgen geblieben. »Sie heißt Mishia und ist stumm«, erklärte Cedira, als das Mädchen gegangen war. »Ihr Bruder war ebenfalls ein Pirat, bevor er zu den Fischen geschickt wurde, und der Hurensohn Gorm, der stinkende Praefos von Ghurenia, wußte davon. Er hat Mishia foltern lassen, um unser Versteck herauszubekommen, und ihr dabei höchstpersönlich ein Auge ausgestochen. Sie hat ihm nichts verraten. Daraufhin hat Gorm seine Folterknechte angewiesen, ihr die Zunge abzuschneiden und die eine Hälfte des Gesichts aufzuschlitzen. Er hat sich scheckig dabei gelacht, als sie Salz in die Wunden rieben.
Anschließend ist sie zu uns gekommen. Und nun iß den Zwieback, bevor die Maden rauskommen und dich nach dem Weg fragen.«
Cassim schluckte, aber dann forderte der Körper sein Recht.
Er hatte einen Tag lang nichts mehr gegessen und fiel über die Speisen her. Die Zwergin sah ihm beifällig zu und schnitt sich selbst nur ein Stück von dem Dörrfleisch ab. Sie kaute darauf herum, während sie sich selbst und Cassim von dem weißen Wein einschenkte. Sie schob ihm einen randvollen Zinnbecher hinüber.
»Der Wein schmeckt scheußlich, ist aber immer noch besser als unser brackiges Wasser.« Unbekümmert trank sie ihren Becher auf einen Zug leer und goß sich sofort wieder neu ein.
Sie rülpste. »Eine wahre Pißbrühe. Es war ein Fehler, Nossas Angebot auszuschlagen. Ich hätte dich noch ein paar Stunden zappeln lassen und ihr den guten Raschtulswaller wegsaufen sollen. Oder besser noch die Biervorräte. Na egal, bitter macht auch lustig.«
Sie nahm wieder einen vollen Zug, während Cassim an dem Wein nur nippte. Er schmeckte tatsächlich bitter und obendrein nach Holz.