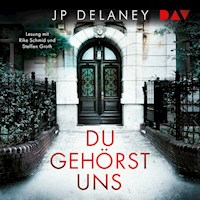9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Sie haben dein Kind. Doch du hast ihres.
Es ist der Albtraum aller Eltern: Als Pete Riley eines Morgens die Tür öffnet, steht vor ihm ein Mann, der seinem zweijährigen Sohn Theo wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Was Miles Lambert ihm offenbart, bringt Petes Welt ins Wanken: Die Söhne der beiden Familien sind nach der Geburt vertauscht worden, Miles und seine Frau sind Theos biologische Eltern. Nach dem ersten Schock beschließen die beiden Paare, die Kinder nicht aus ihren Familien zu reißen. Sie wollen gemeinsam einen Weg finden, am Leben ihres jeweils leiblichen Sohnes teilzuhaben. Doch schnell stellt sich heraus, dass die Familien unterschiedlicher nicht sein könnten. Pete traut der heilen Welt im Hause Lambert immer weniger. Dann bringt eine Klage gegen das Krankenhaus, in dem der Fehler passiert ist, Verstörendes ans Tageslicht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Ähnliche
Sie haben dein Kind. Doch du hast ihres.
Es ist der Albtraum aller Eltern: Als Pete Riley eines Morgens die Tür öffnet, steht vor ihm ein Mann, der seinem zweijährigen Sohn Theo wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Was Miles Lambert ihm offenbart, bringt Petes Welt ins Wanken: Die Söhne der beiden Familien sind nach der Geburt vertauscht worden, Miles und seine Frau sind Theos biologische Eltern. Nach dem ersten Schock beschließen die beiden Paare, die Kinder nicht aus ihren Familien zu reißen. Sie wollen gemeinsam einen Weg finden, am Leben ihres jeweils leiblichen Sohnes teilzuhaben. Doch schnell stellt sich heraus, dass die Familien unterschiedlicher nicht sein könnten. Pete traut der heilen Welt im Hause Lambert immer weniger. Dann bringt eine Klage gegen das Krankenhaus, in dem der Fehler passiert ist, Verstörendes ans Tageslicht …
JP DELANEY wurde mit seinem ersten Thriller »The Girl Before« weltweit zum Star: Der Roman erschien in 45 Ländern und stand an der Spitze der internationalen Bestsellerlisten. Seitdem setzt JP Delaney mit seinen genialen Ideen und rasanten Romanen neue Standards im Thriller-Genre.
»Ein Albtraum, packend in Szene gesetzt in diesem psychologischen Thriller von JP Delaney. Mit völlig unerwarteten Wendungen, die beweisen, wie weit man als Eltern für das eigene Kind gehen würde.« Publishers Weekly
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook
JP DELANEY
DU GEHÖRST UNS
THRILLER
Aus dem Englischen von Sibylle Schmidt
Die Originalausgabe erschien 2020
unter dem Titel Playing Nice
bei Ballantine Books, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by JP Delaney
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
This translation is published by arrangement with Ballantine Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC
Redaktion: Ulla Mothes
Covergestaltung: Bürosüd
Covermotiv: Getty Images/TommL
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-27353-8V001
www.penguin-verlag.de
Da nun sagte die Mutter des lebenden Kindes dem König – es regte sich nämlich in ihr die mütterliche Liebe zu ihrem Kind: Bitte, Herr, gebt ihr das lebende Kind und tötet es nicht! Doch die andere rief: Es soll weder mir noch dir gehören. Zerteilt es!
1. Buch der Könige, 3,26
1
PETE
Es war ein ganz normaler Tag.
In einer Reportage oder einem Feature, wie ich sie früher täglich schrieb, hätte mir die Chefredakteurin diesen ersten Satz um die Ohren gehauen. Der Einstieg muss die Leute catchen, Pete, hätte sie gesagt und mir den Text auf den Schreibtisch gefeuert. Ein Bild muss vor Augen entstehen, eine Szene. Sei dramatisch! Vor allem beim Reisejournalismus muss man sich fühlen, als sei man vor Ort.
Also: Es war ein ganz normaler Tag in Willesden Green im Norden von London.
Und bis es an der Haustür klingelte, war der Tag wirklich ganz normal gewesen, vom herrlichen Wetter abgesehen. Strahlender Sonnenschein, die Luft wunderbar frisch. An manchen Stellen lag noch ein bisschen Schnee, aber er sah schon so matschig aus, dass nicht mal die Kinder, die in der Acol Road in den Kindergarten strömten, daraus noch Schneebälle machen wollten.
Nur eine Sache war merkwürdig an diesem Morgen. Als ich Theo in den Kindergarten brachte – oder vielmehr ihm folgte, weil er auf dem dreirädrigen Roller fuhr, den er von uns zum zweiten Geburtstag bekommen hatte –, fielen mir auf der anderen Straßenseite zwei Männer und eine Frau auf, die uns beobachteten. Der eine Mann war wie ich etwa um die dreißig, der andere sicher über fünfzig. Beide trugen dunkle Anzüge und dunkle Wollmäntel. Die Frau, eine Blondine im Alter des jüngeren Mannes, war in einen Kunstfellparka gehüllt, der in ein Nobel-Skigebiet gepasst hätte. Auf den ersten Blick wirkten die drei zu elegant für diesen Stadtteil von London. Doch dann bemerkte ich den Aktenkoffer in der Hand des älteren Mannes und folgerte: ein Immobilienmakler, der künftigen Kunden den Kindergarten zeigen wollte. Die Jubilee Line fährt von unserer U-Bahn-Station bis Canary Wharf, und heutzutage können sich nicht mal mehr die Banker West Hampstead leisten.
An dem Paar kam mir etwas vage bekannt vor. Aber dann wurde ich von Jane Tigman abgelenkt, deren Sohn Zack in ihren Armen zappelte und schrie, weil er nicht abgesetzt werden wollte. Jane hatte immer noch nicht kapiert, dass ein Kind lieber selbstständig in den Kindergarten aufbrechen sollte. Wenn man es trägt, erschwert man nur den Moment der Trennung.
Dann entdeckte ich ein neues Plakat an der Tür, zum Welttag des Buches – oh Gott, schon wieder ein Kostüm besorgen! Anschließend musste ich Theo von Helm und Jacke befreien und die Handschuhe so tief in die Taschen stopfen, dass die Fäustlinge nicht rausfielen, in die ich immer noch keine Namensschilder genäht hatte. Dann beim Jacke aufhängen helfen und Ansprache halten. Ich ging vor Theo in die Hocke und sagte:
»Okay, mein Großer. Und heute bist du ganz lieb zu den anderen?«
Er nickte und sah mich treuherzig an. »Ja, Dad.«
»Also nichts wegnehmen. Und immer schön abwechseln mit dem Spielzeug. Das ist ganz doll wichtig. So wie wir jetzt beim Lunch immer abwechseln. Heute bist du dran, morgen ich. Was magst du heute zum Lunch?«
»Baubär-Muvie«, verkündete Theo nach kurzem Überlegen.
»Blaubeer-Smoothie also«, wiederholte ich korrekt. »Geht klar. Ich wünsch dir viel Spaß, ja?«
Ich gab ihm ein Küsschen, und er spazierte quietschvergnügt davon.
»Mr. Riley?«
Ich drehte mich um. Susy, die Kindergartenleiterin. Sie hatte offenbar abgewartet, bis Theo weg war. »Können wir kurz sprechen?«, fragte sie.
»Ach herrje.« Ich schnipste mit den Fingern. »Der Trinklernbecher. Tut mir leid, ich kauf heute einen neuen …«
»Nein, darum geht es nicht«, unterbrach sie mich. »Kommen Sie, gehen wir in mein Büro.«
»Sie müssen sich keine Sorgen machen«, sagte Susy, als wir uns setzten, womit natürlich klar war, dass sehr wohl Grund zur Sorge bestand. »Es gab aber gestern einen weiteren Vorfall. Theo hat wieder ein Kind geschlagen.«
»Ah«, erwiderte ich. Das kam zum dritten Mal in diesem Monat vor. »Also, wir arbeiten zu Hause daran. Ich habe auch im Internet recherchiert. Das kommt wohl in diesem Alter manchmal vor, wenn die motorische Entwicklung weiter ist als die Sprachentwicklung.« Ich lächelte bedauernd, um zu zeigen, dass ich nicht jedes pädagogische Konzept blindlings schluckte, aber ein Vater war, der nicht alles dem Kindergarten überließ, sondern sich selbst engagierte. Und dass ich selbstverständlich nicht zu den Eltern gehörte, die ihre kleinen Lieblinge für makellos hielten. »Und ja, in der Sprachentwicklung liegt er etwas zurück, aber ich bin jederzeit dankbar für Anregungen.«
Susy schien sich zu entspannen. »Ja, wie Sie schon sagen, sind das Themen, die bei Zweijährigen häufiger auftreten. Es ist Ihnen bestimmt klar, aber es hilft, wenn Sie ihm mit Ihrem Verhalten ein Vorbild geben. Wenn Theo Sie wütend oder aggressiv erlebt, hält er das automatisch für die richtige Reaktion in Konflikten. Wie sind denn seine Fernsehgewohnheiten? Ich fürchte, für dieses Alter wäre nicht mal Tom und Jerry angebracht, zumindest bis die Hau-Phase vorbei ist. Und falls Sie selbst gewalttätige Videospiele …«
»Ich spiele so etwas überhaupt nicht«, sagte ich entschieden. »Mal ganz abgesehen von allen anderen Gründen, habe ich für so etwas gar keine Zeit.«
»Natürlich. Es ist nur so, dass wir uns manchmal über Folgen einfach keine Gedanken machen.« Susy lächelte, aber ich konnte mir lebhaft vorstellen, was sie dachte: Stay-at-Home-Dad heißt automatisch aggressives Kind. Susy hätte garantiert nicht Jane Tigman gefragt, ob sie Call of Duty spielte.
»Und wir üben auch das Teilen«, fügte ich hinzu. »Jeder darf abwechselnd sagen, was es zum Lunch gibt und so.«
»Das hört sich sehr gut an, Sie haben bestimmt alles im Griff.« Susy stand auf, das Gespräch war beendet. »Wir behalten Theo genau im Auge, und dann hoffen wir, dass sich das Thema bald erledigt.«
Es lag nahe, dass ich nicht mehr an das teuer gekleidete Paar und den Immobilienmakler dachte, als ich aus dem Kindergarten kam. Ich grübelte darüber nach, warum es Theo so schwerfiel, sich mit den anderen Kindern gut zu vertragen. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, bin ich auch sicher, dass die drei gar nicht mehr da waren.
2
Fall Nr. 12 675/PU78B65. BEEIDETE AUSSAGE von D. Maguire
Ich, Donald Joseph Maguire, sage unter Eid das Folgende aus:
1. Ich bin Besitzer und Hauptermittler von Maguire Missing Persons, einer in London ansässigen Detektei, die pro Jahr im Auftrag unserer Klientel über zweihundert vermisste Personen aufspürt. Wir werben nicht für uns, sondern bekommen unsere Aufträge ausschließlich über persönliche Empfehlungen.
2. Vor Eröffnung meiner Detektei war ich Senior Detective bei der Metropolitan Police. Diese Stellung hatte ich dreizehn Jahre inne, zuletzt im Rang eines Detective Inspector.
3. Im letzten August wurde ich von Mr. Miles und Mrs. Lucy Lambert kontaktiert, wohnhaft 17 Haydon Gardens, Highgate N19 3JZ. Das Ehepaar beauftragte mich mit der Suche nach ihrem Sohn.
3
PETE
Zu Hause stellte ich die Kaffeemaschine an und klappte meinen Laptop auf. Mein Kaffeevollautomat ist von Jura, der Laptop ein erstklassiges MacBook. Diese zwei Geräte waren Voraussetzung, als Maddie und ich die schwierigen Gespräche führten, wer von uns beiden zu Hause bleiben und für Theo sorgen sollte, nachdem ihre Elternzeit vorbei war. Wir einigten uns, dass ich Teilzeit zu Hause arbeiten sollte, sobald Theo im Kindergarten war. Ein exzellenter Computer und ein Kaffeeautomat mit Mahlwerk gaben mir das Gefühl, als Stay-at-Home-Dad auf der Karriereleiter nach oben gestiegen zu sein, anstatt mich verschlechtert zu haben.
Ich kann den Ausdruck an sich nicht leiden. Hört sich so negativ an, als fehle etwas. Keiner nennt eine Frau in meiner Position eine Stay-at-Home-Mum, oder? Das ist dann eine Fulltime-Mum, was sofort positiver klingt, nach engagierter Mama. Bei Stay-at-home-Dad denken doch die meisten vermutlich, der Mann sei zu faul oder zu ängstlich, um sich einen Job zu suchen. Bei mir vermuten das auch einige Leute insgeheim. Oder sogar ganz offen, wie Maddies Eltern zum Beispiel. Ihr Vater, ein australischer Geschäftsmann mit politischen Ansichten rechts von Dschingis Khan, ist der Meinung, ich ließe mich von seiner Tochter durchfüttern. Verdammter Schnorrer, der Bursche, würde das wahrscheinlich im O-Ton lauten.
Der Frühstückstisch musste sauber gemacht, der Müll sortiert und Spielsachen weggeräumt werden, aber während die Jura Bohnen mahlte und Milch aufschäumte, setzte ich eine Wäsche auf und loggte mich dann bei DadStuffein.
Grade ein Plakat für den Welttag des Buches im Kindergarten gesehen. 7. März. Aargh! Hat jemand eine Idee? Will kein fertiges Kostüm kaufen, Mütter machen mich sonst noch mehr fertig.
Binnen Sekunden kam eine Antwort. Es gibt einen harten Kern von etwa hundert Vätern, die fast immer online sind und zwischen den Pflichten chatten. Nachdem ich mich an die ganzen Abkürzungen gewöhnt hatte – TT bedeutet zum Beispiel »Tolle Tochter«, TS »Toller Sohn« –, war es mir eine große Hilfe, Fragen stellen und andere Meinungen hören zu können.
Die Maus aus dem Grüffelo. Braunes Hemd, weiße Weste, Ohren auf Haarreif.
Das war Wirrfuß6. Ich schrieb:
Öhm, Haarreif? Ist was für deine TT, wir haben nicht mal einen.
Greg87 schrieb:
Wie wär Peter Hase? Blaues Jäckchen, Papierohren auf Basecap, Schnurrbart aufmalen.
Greg dachte praktisch, wie immer. Klasse, antwortete ich, während ich schon überlegte, ob Peter Hase irgendwo aggressives Verhalten an den Tag gelegt hatte, das Susy missfallen könnte. Bei Beatrix Potter war Vorsicht geboten.
Dann klingelte es an der Tür, ich stellte meinen Cappuccino ab und machte auf.
Vor der Tür stand die Gruppe, die ich am Kindergarten gesehen hatte. Mein erster Gedanke war, dass ein Irrtum vorlag, denn unser Haus stand nicht zum Verkauf. Aber dann merkte ich, dass die Frau nicht mehr dabei war, also warben die Männer vielleicht für eine Partei – oder waren gar Journalisten. Und mein dritter Gedanke, der sofort alle anderen verdrängte, war, dass der jüngere Mann Theo frappierend ähnlich sah.
Die Haare des Mannes waren dunkel, eine Strähne fiel ihm, geformt wie ein Komma, in die Stirn. Er hatte ein markantes Kinn und tief liegende blaue Augen und strahlte eine Jungenhaftigkeit aus, die bei Theo liebenswert wirkte, bei diesem Mann aber latent bedrohlich, obwohl ich nicht erklären konnte, warum. Er war über eins achtzig, wuchtig, breitschultrig. Sportlerfigur. Es gibt ein Foto des Dichters Ted Hughes als junger Mann, wo er finster in die Kamera blickt und genau diese Frisur hat. Daran musste ich denken, als ich dem Mann gegenüberstand. Ein scharf umrissenes, kantiges Gesicht, aber nicht unfreundlich.
»Hallo«, sagte er. »Könnten wir mal reinkommen?«
»Warum?«, fragte ich verblüfft.
»Es geht um Ihren Sohn«, sagte er ruhig. »Das sollte man lieber im Haus besprechen.«
»Okay.« Er wirkte so entschieden und bestimmend, dass ich beiseitetrat und dabei sofort dachte: Hat Theo sein Kind geschlagen? Werde ich jetzt gleich angebrüllt?
»Ähm – Kaffee?«, fragte ich, als ich vorausging ins Wohnzimmer, das bei uns direkt hinter der Haustür beginnt. Wie viele Leute in unserer Straße hatten wir im Erdgeschoss Wände rausreißen lassen, um einen schönen großen Raum zu bekommen. Der ältere Mann schüttelte den Kopf, aber ich sah, dass der jüngere einen Blick auf meinen Cappuccino warf. »Frisch gemahlen«, fügte ich hinzu, weil ich mir dachte, dass Kaffee einen Konflikt vielleicht abmildern könnte.
»Ja, okay.« Es entstand ein unbehagliches Schweigen, während ich Milch aufschäumte.
»Ich bin übrigens Miles Lambert«, fügte der Jüngere hinzu. »Dieser Herr hier ist Don Maguire.« Lambert nahm die Tasse entgegen. »Danke. Wollen wir uns setzen?«
Ich nahm den einzigen Sessel, Lambert ließ sich auf der Couch nieder, nachdem er behutsam Spielsachen beiseitegeräumt hatte. Maguire setzte sich auf meinen Drehstuhl am Schreibtisch und warf einen bewundernden Blick auf mein MacBook.
»Es gibt keine angenehme Methode für das, was jetzt gleich kommt.« Lambert beugte sich vor und legte die Fingerspitzen aneinander. »Schauen Sie, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde ich wollen, dass man mir klipp und klar die Wahrheit sagt. Das werde ich jetzt tun. Aber Sie sollten auf einen Schock gefasst sein.« Er holte tief Luft. »Ich bedaure, Ihnen sagen zu müssen, dass Theo nicht Ihr Sohn ist, sondern meiner.«
Ich starrte Lambert fassungslos an, und wirre Gedanken schossen mir durch den Kopf. Das kann nicht sein. Dann: Deshalb sieht der Typ aus wie Theo. Entsetzen, Ungläubigkeit, Grauen brachen über mich herein, und ich war wie gelähmt. Leider bin ich in Krisen langsam; Maddie ist die Schnelldenkerin.
Maddie. Oh Gott. Wollte dieser Mann mir gerade mitteilen, dass die beiden eine Affäre hatten? Ist es das? Will er mir sagen, dass ich »gehörnt« wurde? Dieses sonderbar altertümliche Wort kam mir plötzlich in den Sinn. Maddie und ich hatten schon unsere Probleme, wie vermutlich jedes Paar, und im letzten Jahr hatte ich manchmal das Gefühl gehabt, dass sie sich von mir entfernte. Aber das hatte ich immer für eine Folge der traumatischen Umstände von Theos Geburt gehalten …
Theos Geburt. Konzentrier dich, Pete. Theo war vor gut zwei Jahren auf die Welt gekommen. Dann hätte Maddie neun Monate vorher die Affäre haben müssen, und das war quasi ausgeschlossen. Vor drei Jahren waren wir gerade aus Australien zurückgekommen, wo wir uns kennengelernt hatten.
Ich merkte, dass Lambert und Maguire mich abwartend ansahen. Bisher hatte ich kein einziges Wort geäußert. »Was wollen Sie mir sagen?«, fragte ich benommen.
Lambert wiederholte lediglich: »Theo ist mein Sohn, nicht Ihrer.« Die blauen Augen betrachteten mich besorgt. »Es tut mir leid. Ich weiß, das ist ein schlimmer Schock. Lassen Sie sich Zeit, das zu verarbeiten.«
Maguire hüstelte und sagte: »Ihr Kind und der Sohn der Lamberts sind ja laut meinen Informationen beide zu früh geboren. Beide Kinder wurden auf die Neonatal-Intensivstation ins St. Alexander’s gebracht und waren dabei kurzzeitig von ihren Müttern getrennt. Es ist vorstellbar, dass die falschen Babys während dieses Vorgangs mit dem falschen Identifikationsband ausgestattet wurden. Das ist jedenfalls unsere Arbeitstheorie.«
Doppelte Verneinung, hörte ich meine Redakteurin zetern. Ein »falsch« zu viel, Blödmann. Woran man sieht, dass man in Krisensituationen auf die bizarrsten Gedanken kommen kann.
4
PETE
»Sie glauben also, dass Sie unseren Sohn haben. Unseren leiblichen Sohn.« Das war der einzige halbwegs klare Gedanke, den ich in dem ganzen Chaos fassen konnte.
Lambert nickte. »David. Wir haben ihn David genannt.«
»Und was …« Was soll jetzt passieren, wollte ich fragen, aber mein Gehirn weigerte sich. »Woher wissen Sie das? Dass die Babys vertauscht wurden, meine ich?«
Lambert deutete auf Maguire. »Dieser Mann ist Privatdetektiv, spezialisiert auf vermisste Personen.«
»Aber trotzdem: Wie können Sie sicher sein?«, beharrte ich.
»Ich war so frei, einen Gegenstand mit Theos DNA aus seinem Kindergarten mitzunehmen«, sagte Maguire etwas betreten. »Es tut mir leid, dass ich das tun musste. Aber wir wollten Sie nicht diesem Stress aussetzen, solange wir nicht hundertprozentige Sicherheit hatten.« Während er sprach, nahm er etwas aus einem wattierten Umschlag. Es war Theos verschwundener Trinklernbecher.
»Gestern kamen die Testergebnisse«, fügte Lambert hinzu. »Es gibt nicht den geringsten Zweifel.«
Maguire stellte die Plastiktasse so behutsam auf meinen Schreibtisch, als sei sie aus zerbrechlichem Porzellan.
»Herrgott, das kann doch nicht wahr sein! Sie haben ohne meine Erlaubnis die DNA meines Sohnes …«
»Strikt genommen, meines Sohnes«, sagte Lambert. »Aber ja, und wir entschuldigen uns dafür, dass das nötig war.«
Meines Sohnes. Die Worte dröhnten in meinem Kopf.
»Hier ist eine Kopie der Testergebnisse für Sie«, erklärte Maguire, zog einen Umschlag aus einer Aktenmappe und legte ihn neben den Becher. »Wie Mr. Lambert schon sagte: Es gibt keinerlei Zweifel. Theo ist sein biologischer Sohn.«
Theo. Unvorstellbar, was das für ihn bedeuten würde. Ich stützte verzweifelt den Kopf in die Hände.
»Und was schlagen Sie jetzt vor?«, brachte ich mühsam hervor. »Was wollen Sie tun?«
Wieder antwortete Maguire. »Bitte verstehen Sie, Mr. Riley, dass wir keine konkreten Vorschläge machen wollen. So etwas kommt so selten vor, dass es kaum Präzedenzfälle gibt – rechtliche, meine ich. Es gibt gewiss keinen Anlass, ein Familiengericht einzuschalten. Am besten wäre es, wenn beide Elternpaare selbst eine Lösung erarbeiten.«
»Eine Lösung?«
»Ob Sie die Kinder tauschen wollen oder nicht«, antwortete Maguire.
Die Worte hingen in der Luft, schlicht und brutal.
»Wie gesagt: Ich weiß, dass es ein Schock ist«, fügte Lambert in entschuldigendem Tonfall hinzu. »Das war es für mich und Lucy natürlich auch, aber wir hatten bereits mehr Zeit, um ihn zu verarbeiten. Sie müssen jetzt auch gar nichts weiter sagen. Und Sie sollten sich natürlich professionellen Rat holen.«
Ich starrte ihn an. Aus seinem Tonfall schloss ich, dass er bereits Anwälte eingeschaltet hatte.
»Wir verklagen das Krankenhaus«, setzte er hinzu. »Nicht St. Alexander’s, sondern die Privatklinik, in der Lucy geboren hat. Vielleicht wollen Sie es uns gleichtun, aber … wie gesagt, das können wir alles in Ruhe erörtern. Es hat keine Eile.«
Mein Blick fiel auf rote Duplo-Steine neben Lamberts Fuß. Theo hatte sie zu einer Maschinenpistole zusammengesteckt, die prompt beim Versuch, mich abzuballern, weil ich ihm die Zähne putzen wollte, auseinandergebrochen war. Eine Welle der Liebe für den Kleinen erfasste mich. Und Grauen vor dem Abgrund, der sich gerade vor uns aufgetan hatte.
»Möchten Sie ein Bild von David sehen?«, fragte Lambert.
Wortlos nickte ich. Er zog aus der Innentasche seiner Jacke ein Foto hervor und reichte es mir. Ein kleiner Junge in einem Kinderstuhl war darauf zu sehen. Er hatte ein zartes Gesicht, blonde Haare, hellbraune Augen. Und sah Maddie enorm ähnlich.
»Wenn Sie wollen, können Sie das Bild behalten«, sagte Lambert. »Vielleicht haben Sie auch … eines für mich, von Theo …«
»Ja, natürlich«, hörte ich mich mechanisch sagen. Ich schaute mich um, aber meine Fotos waren alle auf dem Handy. Bis auf ein Bild, das jemand nach einer Geburtstagsfeier geschickt hatte. Ich hatte es mit einem Magnet am Kühlschrank befestigt. Theo als Pirat, mit Augenklappe, Dreispitz und Pappsäbel, den er verschmitzt grinsend Richtung Kamera schwang. Ich nahm das Bild ab und gab es Lambert.
»Danke.« Er betrachtete es einen Moment gerührt. »Und das bin ich«, sagte er dann rasch und reichte mir eine Visitenkarte. »Handynummer und E-Mail-Adresse. Melden Sie sich, wenn Sie den Schock etwas verdaut haben, ja? Und wenn Sie sich mit Madelyn besprechen konnten natürlich. Kein Druck, aber – ich bin da. Wir beide.« Er warf einen Blick auf Don Maguire und fügte hinzu: »Ich und Lucy, meine ich. Don brauchen wir wohl ab jetzt nicht mehr.«
Ich schaute auf die Karte. Miles Lambert, Chief Executive Officer, Burton Investments. Eine Büroadresse in der Innenstadt.
Miles bückte sich, hob einen Schaumstoff-Fußball vom Boden auf und drückte ihn prüfend. »Ist Theo sportlich?«, fragte er. »Kann er den hier schon fangen?«
»Meist ja. Er ist körperlich sehr weit entwickelt. In mancher Hinsicht etwas zu weit.«
Lambert zog fragend die Augenbrauen hoch, und ich erklärte: »Er wird manchmal handgreiflich mit anderen Kindern. Wir arbeiten daran.«
»Ach ja? Deshalb würde ich mir an Ihrer Stelle keine Sorgen machen. Ich war in seinem Alter genauso. War später beim Rugby-Spielen von Vorteil. Damals hat sich keiner beklagt.« Sein Tonfall hatte etwas Vertrautes, Familiäres, und mir wurde schlagartig bewusst, dass ich mit dem Vater meines Sohnes sprach. Dem echten Vater. Meine Welt war auf den Kopf gestellt worden, nichts würde mehr wie vorher sein.
»Sie sollten mal beide zu uns kommen«, sagte Lambert. »Damit wir uns besser kennenlernen. Wenn Sie das alles verarbeitet haben.«
Ich versuchte etwas zu erwidern, brachte aber kein Wort hervor. Einen furchtbaren Moment lang hatte ich das Gefühl, als würde ich gleich in Tränen ausbrechen. Lambert überspielte die Situation und hielt das Foto von Theo hoch. »Jedenfalls vielen Dank dafür. Lucy wird begeistert sein. Endlich etwas Konkretes.«
Er steckte das Foto in die Innentasche seines Jacketts und streckte mir die Hand hin. Sein Händedruck war energisch. »Und versuchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Wir sind doch alle vernünftige Menschen. Es ist natürlich furchtbar, dass das überhaupt passiert ist, aber jetzt ist ausschlaggebend, wie wir alle damit umgehen. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam den besten Weg finden werden. Und jetzt lassen wir Sie erst mal in Ruhe.«
Maguire schüttelte mir auch die Hand, dann verschwanden die beiden. Lambert hatte seinen Cappuccino nicht angerührt, ich schüttete ihn in den Ausguss. Die Waschmaschine piepte, ich machte sie auf, zog wie in Trance die nassen Sachen heraus. Ganz oben auf dem Wäscheberg landete Theos senfgelbes T-Shirt mit der Aufschrift ICH BIN ZWEI. WAS IST DEINE AUSREDE? Einen Moment lang spürte ich fast seinen erhitzten Körper an den Händen, das vertraute Gezappel, wenn ich ihn mir auf die Schulter lud. Tränen brannten in meinen Augen, und meine Kehle wurde eng. Aber ich durfte jetzt nicht kollabieren, noch nicht. Zuerst musste ich Maddie anrufen.
5
Fall Nr. 12 675/PU78B65, BEEIDETE AUSSAGE von D. Maguire, Fortsetzung
4. Gemeinsam mit meinem Klienten, Mr. Miles Lambert, suchte ich Mr. Riley zu Hause auf. Dort setzten wir ihn darüber in Kenntnis, dass das Kind, das er für seinen Sohn hielt, in Wahrheit der Sohn meines Klienten ist, und dass entsprechend das Kind, das meine Klienten großzogen, wohl der Sohn von Mr. Riley ist.
5. Mr. Riley war erwartungsgemäß erschüttert über diese Information. Während des anschließenden Gesprächs brach er mehrfach in Tränen aus.
6. Während er um Fassung rang, nutzte ich die Gelegenheit, mir einen Eindruck vom Haus zu verschaffen. Dies wurde erleichtert durch die Tatsache, dass der kleine Raum gleichzeitig als Wohnzimmer, Spielzimmer, Küche und Esszimmer genutzt wird.
7.EsgabdiverseAnzeichendafür,dassMr.RileySchwierigkeitenhattemitderAusübungseinerhäuslichenPflichten.AufdemEsstischtürmtensichschmutzigesGeschirrundanderesKüchenzubehör.UngewascheneKleidungsstückehingenüberMöbelstücken,aufdemBodenimKüchenbereichstandenzweileereWeinflaschen.AufMr.RileysLaptopsahich,dasseroffenbargeradeineinemInternetforumfürVäterRatsuchte.(NachfolgendeErmittlungenergaben,dassMr.RileyunterdemForennamenHomeDad85indiesemForumbereitsüber1200PostsähnlicherArtgemachthatte.)EinandererTabwarbeieinemVideospielgeöffnet,dasangehaltenwordenwar.ObwohlMr.RileybeiLinkedIneinProfilalsfreiberuflicherJournalisthat,wiesinseinerhäuslichenUmgebungnichtsaufeinederartigeTätigkeithin.
8. Mein Klient wiederholte mehrfach, seine Frau und er wünschten, diese Situation mit sachlichen Gesprächen in gutem Einvernehmen zu bewältigen. Mr. Riley zeigte sich nicht empfänglich gegenüber diesen Vorschlägen. Als sein Verhalten feindselig wurde, brachen mein Klient und ich auf.
6
MADDIE
Ich bin gerade in einer Sitzung, bespreche mit dem Kunden Casting-Aufnahmen für einen Doritos-Spot, als mein Handy aufleuchtet. Wir sind mitten in einer hitzigen Diskussion – der Regisseur will die Teenager bockig, rebellisch, unabhängig, der Kunde will sie strahlend und natürlich, eine Debatte, die ich mir bestimmt schon hundertmal anhören musste. Wir sehen gerade endlich Land, weil der Regisseur sich mit der dritten Wahl zufriedengibt, die immerhin die zweite des Kunden ist, als der Anruf kommt. Ich schaue aufs Display. Pete. Oder vielmehr: PETER RILEY. Als wir uns vor vier Jahren zum ersten Mal begegnet waren, speicherte ich ihn mit vollem Namen in meinen Kontakten, und aus irgendwelchen Gründen habe ich das seither nicht geändert.
Das Handy ist stumm gestellt, die Nachricht geht auf Mailbox. Aber Pete ruft sofort wieder an. Das ist unser Zeichen für etwas Dringendes, deshalb entschuldige ich mich, eile raus und rufe an.
»Was ist los?«
»Nichts Schlimmes. Theo geht es gut, er ist im Kindergarten. Aber …« Stockende Atemzüge. »Gerade eben war hier ein Mann mit einem Privatdetektiv. Der Mann behauptet, unsere Babys seien in der Intensivstation verwechselt worden. Deshalb glaubt er, dass sein kleiner Sohn unserer ist, und Theo … Theo …«
Es dauert einen Moment, bevor ich das erfasst habe. »Das kann man doch mit einem DNA-Test abklären«, sage ich.
»Ist schon passiert. Die haben uns eine Kopie dagelassen. Mads, dieser Typ sieht genau wie Theo aus.« Schweigen. »Ich glaube, der Mann sagt die Wahrheit.«
Ich bleibe stumm, kann das eigentlich nicht glauben. So etwas kommt doch gar nicht vor. Es muss irgendeine andere Erklärung geben. Aber Pete ist eindeutig völlig fertig und braucht mich. Ich treffe schnell eine Entscheidung. »Ich komme sofort nach Hause.«
Durch die Glaswand des Konferenzraums sehe ich auf dem Bildschirm eine rotwangige Vierzehnjährige, die sich angesichts einer Tüte Tortilla-Chips übertrieben begeistert aufführt. An sich müsste ich wieder reingehen, mich entschuldigen und dem Kunden erklären, dass ich wegen einer familiären Krise wegmuss; nein, nichts Lebensbedrohliches, aber ich sollte mich doch lieber kümmern. Doch das tue ich nicht. Fast ohne zu überlegen, entscheide ich, was wichtiger ist. Ich schreibe einem Kollegen eine Nachricht, bitte ihn, für mich einzuspringen, und breche auf.
Bevor ich schwanger wurde, war ich fest davon ausgegangen, dass hauptsächlich ich für unseren Lebensunterhalt sorgen würde. Die Schwangerschaft war nicht geplant, das Timing in jeder Hinsicht schlecht. Wir erwogen sogar einen Abbruch, aber Pete war nicht wohl bei der Vorstellung, und mir ging es letztlich genauso; ich bin nicht immer so sachlich und nüchtern, wie meine Freunde vermuten. Die internationale Werbeagentur, bei der ich unter Vertrag war, hatte alle Umzugskosten von Sydney nach London finanziert. Mit im Paket war eine einjährige private Krankenversicherung, die auch Geburtskosten abdeckte. Statt eines überbelegten staatlichen Krankenhauses konnte ich mir den Luxus einer Privatklinik in der Harley Street leisten, mitsamt persönlicher Hebamme, Kaiserschnitt auf Wunsch, ärztlicher Betreuung rund um die Uhr und Nachsorge. Eigentlich ist die Vorstellung einer Geburt unter luxuriösen Bedingungen kein akzeptabler Grund, um ein Kind zu bekommen. Aber da es sich nun mal eingefunden hatte – warum nicht?
Im Rückblick denke ich, dass ich in Wirklichkeit längst beschlossen hatte, das Kind behalten zu wollen, und nur nach einer Rechtfertigung suchte. Es der Agentur mitzuteilen, war ziemlich unangenehm – ich hatte vor vier Monaten erst angefangen und würde jetzt für ein Jahr ausfallen. Aber da die Leitung ohnehin keine andere Wahl hatte, war man professionell genug, freundlich zu sein und mir zu versichern, dass man meine Stelle selbstverständlich freihalten würde.
Es sah also alles erstaunlich rosig aus. Doch das Leben hatte andere Pläne.
Ich war in der siebenundzwanzigsten Schwangerschaftswoche, als Pete und ich an der Hochzeitsfeier unserer Freunde Andy und Keith teilnahmen. Und wenn man bei einer schwulen Party nicht heftig feiert, wann dann? Später machte ich mir schreckliche Vorwürfe. War es das Glas Champagner gewesen, das ich mir während der Reden genehmigt hatte? Oder das wilde Tanzen zu Aretha Franklin und Madonna in der Menschenmenge? (Ich zucke heute noch zusammen, wenn ich irgendwo Respect höre.) Oder dass ich auf dem Weg zur Toilette im Dunkeln über das Seil des Festzelts stolperte und ins Taumeln geriet? Der Arzt meinte, das alles sei vermutlich nicht die Ursache gewesen. Aber da er mir den wirklichen Grund nicht nennen konnte – wer weiß?
Am nächsten Morgen hatte ich schreckliche Kopfschmerzen, was ich auch auf das Glas Champagner zurückführte, denn ansonsten trank ich keinen Alkohol mehr. Aber mir fiel auch auf, dass ich schon länger keine Kindsbewegung gespürt hatte, und als ich mich erbrach, fühlte sich das anders an als die Morgenübelkeit der ersten drei Monate. Es war Sonntag, aber da uns in der Klinik jederzeit erfahrene Hebammen zur Verfügung standen, schlug Pete vor, wir sollten einen Check machen lassen und danach an der Marylebone High Street brunchen gehen.
Wie sich dann zeigte, rettete dieser Plan unserem Baby das Leben.
Aus »wir machen rasch einen Ultraschall« wurde »ich hol mal schnell den Arzt«, und dann wurde rasant ein Teil des Raumes abgesperrt, und ich war umringt von Menschen. Jemand rief »Action vorbereiten«, und man bombardierte mich mit Fragen, während man mir meinen Schmuck abnahm (mein vietnamesisches Armband sah ich nie wieder) und einen Katheter legte. Jemand maß meine Beine für Kompressionsstrümpfe aus, als gäbe es nichts Wichtigeres, und Pete wies man an, sich die Hände zu waschen und einen Kittel überzuziehen, wegen Präeklampsie müsse ein Notkaiserschnitt gemacht werden. Man gab mir eine Spritze für die Lungenfunktion des Babys und eine Infusion für irgendetwas anderes, was ich nicht mitbekam. Dann erschien der Chirurg, warf einen einzigen Blick auf die Werte und sagte nur ein Wort: »Sofort.« Danach habe ich nur noch ein Wirrwarr aus Fluren, Gesichtern, hastigen Erklärungen in Erinnerung. Es bliebe keine Zeit für eine Periduralanästhesie, sagte mir eine Ärztin. Sekunden später war ich bewusstlos.
Im Aufwachraum kam ich wieder zu mir. Stille, kein schreiendes Baby, kein Pete, nur das Piepen einer Maschine. Und ein Arzt, der auf mich herunterschaute.
»Ihr Baby lebt«, sagte er. »Ein Junge.«
Gott sei Dank. »Kann ich ihn sehen?«, krächzte ich.
Der Arzt – dessen Gesicht ich nicht sehen konnte, nur die Augen über der Maske – schüttelte den Kopf. »Er ist mit einem Spezialtransport sofort auf die NICU gebracht worden. Er ist sehr klein und schwach.«
Der Begriff NICU sagte mir damals nichts, aber kurz darauf war ich nur allzu vertraut mit den verschiedenen Leveln der Frühgeborenenbetreuung. NICU, Neonatal Intensive Care Unit oder auch Neonatalintensivpflege, war das höchste Level.
»Schwach? Inwiefern?«
»Babys, die so früh auf die Welt kommen, haben Atemprobleme. Er wird vermutlich ein Beatmungsgerät brauchen. Es ist möglich, dass es eine Sauerstoffunterversorgung gibt.«
»Was bedeutet das? Ist das tödlich? Wird er leben?«
Von diesem Mann, den ich nie zuvor gesehen hatte und auch nie mehr wiedersehen würde, habe ich nur seine mitfühlenden braunen Augen in Erinnerung, obwohl er dann seine Maske abnahm, bevor er behutsam sagte: »Es bedeutet, dass das Gehirn des Babys nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Aber die NICU vom St. Alexander’s ist ganz nah, und Ihr Baby ist dort gut aufgehoben. Wenn irgendwer helfen kann, dann die Ärzte dort.«
Ich starrte ihn voller Grauen an. Mir wurde schlagartig klar, dass diese luxuriöse hotelartige Klinik durchaus kein idealer Ort war, um ein Kind zu gebären. Denn sie war nicht für Notfälle ausgerüstet.
Alles war schiefgegangen, und ich wurde von dem Gefühl überwältigt, mein Kind im Stich gelassen zu haben. Ich hätte meinen kleinen Jungen noch für weitere dreizehn Wochen im Bauch versorgen müssen, um Himmels willen. Stattdessen hatte mein Körper ihn abgestoßen und in eine Welt hinausgeworfen, für die er noch nicht bereit war.
»Wo ist Pete?«, krächzte ich.
»Ihr Mann ist mitgefahren. Tut mir leid, es blieb keine Zeit für Abschied.«
Ich brauche mich nicht von Pete zu verabschieden, wollte ich sagen, und wir sind übrigens auch nicht verheiratet. Doch dann wurde mir etwas klar. Der Arzt meinte den Abschied von meinem Kind. Wenn ich meinen Sohn zum ersten Mal sah, würde er leblos und kalt sein.
Ich begann zu weinen, Tränen strömten mir übers Gesicht, während der Arzt meinen Unterleib untersuchte; Tränen des Zorns und der Reue und Trauer um diesen winzigen Menschen, der in mir gewesen war und nun sterben würde, bevor seine Mutter ihn auch nur ein einziges Mal im Arm gehalten hatte.
7
MADDIE
Als ich aus der U-Bahn-Station Willesden Green komme, schießen mir so viele Fragen durch den Kopf, dass ich Pete anrufe, obwohl ich gleich zu Hause bin.
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf der NICU zwei Babys vertauscht wurden«, sage ich. »Theo lag die ganze Zeit im Inkubator, an all diese Schläuche angeschlossen. Und er hatte das elektronische Identifikationsband am Bein. Da kann so was doch gar nicht passieren.«
»Dieser Lambert sagte, er verklagt nicht das St. Alexander’s, sondern die Privatklinik, in der seine Frau war. Vielleicht ist das die Erklärung.«
Das war wahrscheinlicher. Wenn zwei Babys gleichzeitig im St. Alexander’s ankamen, konnten sie vertauscht worden sein, bevor man die Identifikationsbänder angebracht hatte. Das war denkbar. »Aber warst du denn nicht die ganze Zeit bei ihm? Ich bin übrigens schon an der Haustür.«
Pete macht mir auf und lässt das Handy sinken. »Nicht die ganze Zeit. Da waren so viele Leute, die sich um ihn gekümmert haben … Blutproben, die Schläuche … Und später haben sie mir einen Raum gezeigt, in dem ich schlafen konnte. Ich hab nicht gesehen, wann man das Band angebracht hat.«
Er nagt an seiner Unterlippe, sieht völlig verstört aus. Ich weiß, was er denkt.
»Du musstest doch irgendwann schlafen, Pete.«
»Aber ich frag mich trotzdem – wieso habe ich das nicht mitbekommen? Wie kann unser Kind mit einem anderen vertauscht worden sein, ohne dass ich es bemerkt habe?«
»Weil sie alle nicht wie Babys aussahen«, sage ich nüchtern.
Pete starrt mich an. An meine spätere Reaktion auf die NICU will er noch immer nicht erinnert werden.
»Aber du hast es gespürt, Mads«, sagt er leise. »Du hast keine Muttergefühle für Theo empfunden. Und sogar mal geäußert, ob er überhaupt unser Kind ist. Auf irgendeiner Ebene hast du es gespürt.«
Ich zögere, schüttle dann den Kopf. »Ich hatte nicht deshalb Probleme, eine Bindung zu ihm aufzubauen, weil er nicht unser Kind war. Sondern weil er keinerlei Ähnlichkeit mit dem Baby hatte, das ich mir vorgestellt hatte. Die ganzen Frühchen nicht. Das wäre mir mit allen anderen dort genauso gegangen. Ich fand sie so abstoßend.«
Das hatte ich mir jedenfalls immer selbst gesagt. Genauso wie Du bist eine unfähige Mutter und Irgendwas ist falsch mit dir. Aber obwohl ich gerade zu Pete das Gegenteil gesagt habe, frage ich mich jetzt unwillkürlich: Habe ich vielleicht doch von Anfang an gespürt, dass etwas anderes nicht stimmte?
Das erste Bild von meinem Kind war ein unscharfes Foto, das Pete mir aufs Handy schickte, als ich noch im Aufwachraum lag. Offenbar war das Foto über die Schulter vom Klinikpersonal aufgenommen worden. In einem Inkubator lag eine winzige blasse Gestalt, verkabelt mit Schläuchen und Sonden. Auf der Brust war etwas zu sehen, das wie Luftpolsterfolie aussah, aus der weitere Schläuche herausragten. Später erfuhr ich, dass die Ärzte eine vorsätzliche Unterkühlung herbeigeführt hatten, um Schwellungen im Gehirn zu verhindern. Auch aus der Nase ragten Schläuche. Das Baby sah abgemagert, krank und kaum menschlich aus.
Als ich neun Jahre alt war, bekam unsere Labradorhündin Maya Junge. Fünf wurden gesund und lebendig geboren, aber dann entstand eine lange Pause. Wir glaubten, das sei der gesamte Wurf, aber Maya schien noch zu kämpfen. Schließlich flutschte ein letzter Welpe heraus – ein winziges haarloses Würmchen. Es zeigte sich bald, dass es zu kraftlos war, um sich zwischen seinen Geschwistern zu behaupten und an die Zitzen zu kommen. Und Maya half auch nicht nach, so wie sie es bei den anderen machte. Ich zog immer wieder andere Welpen von den besten Zitzen und legte den Kümmerling an, aber er schaffte es nicht zu saugen. Zwei Tage später starb er.
Als ich dieses Foto sah, war ich endgültig überzeugt davon, dass unser Kind tot sein würde, wenn ich auf der Intensivstation ankam. Die Worte des Arztes gingen mir wieder durch den Kopf. »Er ist sehr schwach.«
Ich starrte immer noch auf das Bild, als Pete anrief. »Ich bin kurz rausgegangen, auf der Station darf man nicht telefonieren«, sagte er atemlos. »Wollte nur hören, ob du das Foto bekommen hast.«
»Ja. Hab ich.«
»Alles okay mit dir?«
»Er wird sterben, oder?«, sagte ich dumpf. Es fühlte sich surreal an, das auszusprechen. Vor vierundzwanzig Stunden hatten wir mit unseren Freunden Hochzeit gefeiert, das Kind hätte erst in drei Monaten kommen sollen, und jetzt war ich plötzlich Mutter eines Sohnes auf seinem Sterbebett.
Pete klang ruhig, aber ich merkte, wie viel Kraft ihn das kostete. »Das muss nicht sein, Mads. Hier sind Kinder, die noch kleiner sind als er. Die Ärzte sagen, die nächsten drei Tage seien entscheidend. Wenn er die übersteht, sind die Chancen wohl nicht schlecht.« Langes Schweigen. »Möchtest du, dass ich zu dir komme?«
»Nein. Bleib dort. Einer von uns sollte bei ihm sein.«
»Okay. Aber sie wollen ihm Vormilch von dir geben. Ich komme in ein paar Stunden mit einer Milchpumpe vorbei.«
»Oh Gott.« An Stilltechnik hatte ich in dieser Lage noch keinen Gedanken verschwendet, aber Pete schien im Bilde zu sein.
»Man wird die Milch erst mal einfrieren, er wird bisher über eine Magensonde ernährt.« Wieder Schweigen. »Sie möchten wissen, wie er heißen soll.«
Ein Name für einen Grabstein. Der Gedanke tauchte auf, ich konnte ihn nicht abwehren. Plötzlich fühlten sich alle Namen, die wir uns überlegt hatten – kraftvolle witzige Jungennamen wie Jack, Sam und Ed – falsch an. Ich konnte sie mir nicht mit einem Todesdatum vorstellen. »Wie wäre Theo?«
»Aber Theo wolltest du doch nicht.«
»Aber dir gefiel der Name, oder?«
»Ja.«
»Dann Theo.« Weil ich einem Kind, das sterben wird, keinen Namen geben möchte, den ich mag.
Ich stand natürlich noch unter Schock. Und wie sich dann herausstellte, starb Theo nicht. Als Tag für Tag verging und immer mehr Schläuche entfernt werden konnten, erlaubten wir uns ein bisschen mehr Hoffnung. Und nach fünf Tagen machten die Ärzte einen Gehirnscan und verkündeten, sie seien vorsichtig optimistisch.
Das hieß aber noch lange nicht, dass der Rest ein Spaziergang gewesen wäre. Wenn Pete mich besuchte, brachte er jede Menge fremde Wörter mit. Sauerstoffentsättigung: zu wenig Sauerstoff im Blut, weil die Lunge von Frühgeborenen noch nicht selbstständig arbeitet. Apnoesyndrom: Atempausen, weil Theo trotz des Beatmungsgeräts, das Luft in seine Nase blies, vergaß einzuatmen. Bradykardie: ein gefährlicher Abfall der Herzfrequenz, bei dem plötzlich das Herz zu schlagen aufhörte. Kam das vor, kraulten die Schwestern Theo behutsam am Fuß oder rieben seine Schulter, um den Herzschlag anzuregen. Es sei wie Zauberei, berichtete Pete mit großen Augen, wenn sie ihn durch diese kleinen Berührungen wiederbelebten.
Sie zögern doch nur das Unvermeidliche hinaus, dachte ich immer noch, trotz der besseren Prognosen.
Erst nach einer Woche konnte ich zu den beiden kommen. Der Kaiserschnitt war nur langsam verheilt, und ich hatte einen Virus, der erst verschwunden sein musste, bevor ich die NICU betreten durfte. Aber schließlich wurde ich in einen Rollstuhl gesetzt und per Taxi ins St. Alexander’s verfrachtet. Es war, als wolle mich die teure Privatklinik so schnell an das staatliche Krankenhaus loswerden, wie man Hundekot von seiner Schuhsohle kratzt.
Ich hatte geglaubt, auf die NICU innerlich vorbereitet zu sein. Pete hatte sie mir immerhin beschrieben, und ich hatte Fotos gesehen. Dennoch hatte ich mir die Inkubatoren nicht wie Kapseln voller Elektronik vorgestellt. Ich musste an Science-Fiction-Filme denken, in denen Leute in solchen Kapseln durchs Weltall flogen. Aber die sahen wenigstens interessant futuristisch aus, wohingegen diese Plexiglasboxen hier mit einer Unzahl von Kabeln und anderem Zubehör versehen waren. Es war so warm und feucht in dem Raum wie in der Umkleidekabine eines Schwimmbads. Tageslicht gab es nicht, einige Inkubatoren waren mit violettem UV-Licht angestrahlt. Diese Babys hatten Gelbsucht, erklärte Pete mir später. Doch am schlimmsten waren für mich die Geräusche. Frühchen können nicht schreien, bestenfalls wimmern, und die meisten hatten ohnehin Schläuche in der Nase, die jeden Laut verhinderten. Stattdessen hörte man ein Wirrwarr aus Piepen, dumpfem Dröhnen und Klingeltönen. Erst später wurde mir klar, dass es sich nicht um Alarmtöne handelte, sondern um die normalen Laute der Geräte, die unterschiedliche Funktionen hatten. Wie Mutterschafe, die das Rufen ihres Lamms inmitten einer großen Herde identifizieren können, kannten die Schwestern die jeweiligen Töne von Geräten, die für ihre kleinen Patienten zuständig waren, und konnten sofort reagieren, wenn sich etwas veränderte.
Ich hatte keine Ahnung, wo ich nach meinem Baby suchen sollte, doch dann entdeckte ich Pete in einer Ecke und ließ mich dorthin bringen. Die meisten Inkubatoren waren durchsichtig und hatten seitlich Öffnungen zum Hineingreifen, aber Pete stand neben einer Kapsel ohne Deckel und steckte gerade eine Kanüle, die mit etwas Weißem – meiner Milch vielleicht – gefüllt war, in das Ende eines Schlauchs.
Als ich bei ihm war, blickte Pete auf und warf mir ein liebevolles Lächeln zu, unterbrach aber seine Tätigkeit nicht. »Mummy ist da«, sagte er zu dem durchsichtigen Kasten. Ich spähte hinein und sah Theo zum ersten Mal.
Es hätte ein ergreifender Moment sein sollen. Mutterliebe soll ja angeblich dieses berauschende Gefühl von überwältigender Liebe für das kleine Wesen sein, das man hervorgebracht hat. Wenn man das nicht empfindet, stimmt etwas nicht mit einem. Das war wohl bei mir der Fall, denn ich schreckte zurück. Wegen Petes positiver Nachrichten hatte ich erwartet, dass Theo inzwischen wie ein echtes Baby aussehen würde. Aber er war so schrumpelig und runzlig wie ein Hundertjähriger. Dunkler Haarflaum bedeckte seine Schultern, was an ein Äffchen erinnerte. Er trug eine winzige Windel und lag in einer Art Nest aus Decken. Elektroden klebten auf seiner Brust, und ein Ring an seinem linken Fuß leuchtete rot – das war die Anzeige für den Sauerstoffsensor, erfuhr ich später. Theos Arme und Beine waren so dünn wie Stöckchen, er sah aus wie kurz vorm Hungertod.
Ein durchsichtiger Plastikschlauch führte in ein Nasenloch, und in diesen Schlauch spritzte Pete gerade behutsam meine Milch. »Sollte das nicht lieber eine Schwester machen?«, fragte ich beunruhigt.
»Die sind gerade zu beschäftigt. Und ich tu das auch gerne für ihn. Gibt mir das Gefühl, mich nützlich zu machen.«
»Hast du den pH-Wert überprüft, Pete?«, hörte ich eine Frauenstimme mit irischem Akzent. Ich blickte auf. Eine dunkelhaarige und sehr hübsche Schwester stand an einem Inkubator in der Nähe.
»Zwei Komma fünf.«
»Guter Mann«, sagte die Schwester lobend. »Und du bist die Mummy?«, fragte sie dann.
Ich fand es viel zu vertraulich, dass sie mich auf Anhieb duzte, wollte aber nicht kleinlich sein. »Ja. Maddie.«
»Willkommen auf der NICU, Maddie. Ich weiß, erst mal ist es immer schlimm, aber der kleine Theo macht sich prächtig. Und dein Pete ist ein richtiger Goldschatz. Wenn nur alle Ehemänner so gut mit der Ernährungssonde umgehen könnten.«
»Wir sind nicht verheiratet«, sagte ich automatisch.
»Entschuldigung, das wusste ich nicht. Also: alle Partner. Aber den solltest du nicht entwischen lassen. Das ist ein echter Glücksfall.«
Mir war eigentlich klar, dass es nur freundliches Geplauder war, das mich entspannen sollte. Aber irgendetwas daran ärgerte mich. Vielleicht weil ich mich als Versagerin fühlte, da ich Theo zu früh geboren hatte. Außerdem wurde mir plötzlich klar, dass Pete sich in diesem brutalen Ambiente nicht nur wacker geschlagen, sondern offenbar Herausragendes geleistet hatte, während ich in einer Privatklinik verhätschelt worden war. An sich ist Pete in Krisen nicht unbedingt ein Held. Aber in Situationen wie dieser, in denen Durchhaltevermögen und Entschlossenheit gefragt sind, läuft er zur Hochform auf. Ich hätte dankbar und stolz sein können. Stattdessen fühlte ich mich nur noch schlechter.
Pete bemerkte, wie ich auf die Monitore starrte. »Irgendwann versteht man sie«, sagte er.
Das hatte ich gar nicht beabsichtigt. »Inwiefern?«
Er deutete auf einen. »Die Wellenlinie ist der Herzschlag, die große Zahl die Herzschläge pro Minute. Alles unter hundertzwanzig ist eine Herzrhythmusstörung – wenn das passiert, solltest du Theo durch Tätscheln oder Streicheln anregen. Am häufigsten meldet sich der Sauerstoffsensor. Wenn diese Zahl sinkt, schau nach, ob der Stift aus der Nase gerutscht ist, das passiert manchmal. Dann kannst du ihn selbst wieder reinstecken. Aber wenn das nicht der Fall ist: gleich die Schwester holen.«
Ich konnte mir nicht vorstellen, überhaupt irgendetwas von alldem zu machen. »Hast du ihn schon mal im Arm gehalten?«, fragte ich.
Pete nickte. »Einmal, heute Morgen, vorher war seine Körpertemperatur nicht stabil genug. Es ist ein überwältigendes Gefühl, Mads. Man muss natürlich aufpassen wegen der ganzen Schläuche und allem. Aber als er auf meiner nackten Brust lag und die Augen aufschlug, kamen mir die Tränen.«
»Das ging uns wohl allen so.« Die irische Schwester schaute lächelnd herüber. »Das ist der schönste Teil meiner Arbeit – zu sehen, wie das Baby zum ersten Mal Körperkontakt mit den Eltern kriegt.«
Wieder spürte ich einen kleinen unwürdigen Anflug von Ärger bei der Vorstellung eines halb nackten weinenden Pete, neben dem diese hübsche dunkelhaarige Schwester kniete, auch zu Tränen gerührt. Aber ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen. Es war enorm wichtig, gut mit dem Personal zurechtzukommen. Deshalb sagte ich nur: »Ich kann es kaum erwarten.«
8
PETE
Während Maddie auf dem Heimweg war, hatte ich eine schnelle Internetrecherche gemacht. Einen Moment lang war ich versucht, im Väterforum zu fragen, ob jemand sich mit so einer Situation auskannte, ließ es dann aber bleiben. Ich googelte Miles Lambert, Burton Investments. Er hatte ein Profil bei LinkedIn, was aber nicht viel hergab. Ich erfuhr nur, dass er drei Jahre älter war als ich, an der Durham University studiert hatte und am Berkeley Square arbeitete. Seine Leistungen waren von sechzehn anderen Nutzern als exzellent bewertet worden. Aber zumindest bestätigte mir die Seite, dass es sich nicht um einen grausamen Scherz handelte. Der DNA-Test schien auch echt zu sein. Jede Menge Zahlen und Fachausdrücke und am Ende die Aussage: Wahrscheinlichkeit der Vaterschaft 98 %.
Als Nächstes recherchierte ich nachGeburtvertauscht. Das kam offenbar sehr selten vor – oder wurde zumindest sehr selten aufgedeckt. Falls eineiige Zwillinge vertauscht wurden, war die Wahrscheinlichkeit, dass es auffiel, natürlich höher. 1992 erkannte ein Kanadier, Brent Tremblay, an der Uni seinen Zwilling, der nun George Holmes hieß. Auf den Kanarischen Inseln passierte das Gleiche2001, und 2015 wurden in Bogotá zwei Paar eineiige Zwillinge wiedervereint. Anhand dieser Fälle und der statistischen Häufigkeit eineiiger Zwillinge hatte jemand errechnet, dass die Rate weniger leicht zu identifizierender Babys bei eins zu tausend lag, nicht häufiger als das Downsyndrom.
Einige Fälle wurden bemerkt, als Paare sich trennten und Gentests machen ließen. Bei einer Familie in Charlottesville, Virginia, waren die Kinder bereits drei Jahre alt, und die Sorgerechtsprozesse zogen sich über viele Jahre hin.
2006 wurden zwei neugeborene Mädchen in Tschechien vertauscht, was man ein Jahr später bemerkte. Alle vier Elternteile waren sich einig, und die Mädchen wurden peu à peu mit ihren leiblichen Eltern vertraut gemacht, um zu ihnen zurückzukehren.
Der Sohn eines britischen Staatsbürgers wurde 2015 in einer Klinik in El Salvador vertauscht und konnte nach einem Jahr zu seinen biologischen Eltern zurückkehren.
In manchen Ländern führten solche Fälle zu einem öffentlichen Aufschrei und strengeren Vorsichtsmaßnahmen, wie Kennzeichnung von Neugeborenen mit zwei Bändchen. Das galt nicht für Großbritannien, aber da es Fälle von Babyentführungen gegeben hatte, waren die Security-Maßnahmen in den staatlichen Krankenhäusern des NHS, des National Health Service, verschärft worden.
Von britischen Privatkliniken war nirgendwo die Rede.
Ich recherchierte weiter und stellte fest, dass die Frage, ob die Kinder zu ihren biologischen Eltern zurückkehrten, häufig vom Alter abhing. In den meisten Fällen lief es so: Waren die Kinder über drei, blieben sie oftmals bei ihren bisherigen Familien. Waren sie ein Jahr alt oder jünger, wurden sie üblicherweise zurückgegeben.
Aber was war mit Zweijährigen? Einem Kind, das zwei Jahre und zwei Wochen alt war? Für dieses Alter schien es eine bedrohliche Grauzone zu geben.
Maguires Bemerkung fiel mir wieder ein. Es gibt gewiss keinen Anlass, ein Familiengericht einzuschalten. Am besten wäre es, wenn beide Elternpaare selbst eine Lösung erarbeiten.
Wenn es uns nicht gelang, eine Lösung zu finden, würde also ein Gericht entscheiden? Ein knöcherner Bürokrat würde Theos Schicksal bestimmen? Allein beim Gedanken daran gefror mir das Blut in den Adern.
Mit alldem platzte ich heraus, als Maddie zur Tür hereinkam.
»Aber was schlägt dieser Mann vor?«, fragte sie, pragmatisch wie immer. »Will er wirklich, dass die Kinder zurückgetauscht werden?«
»Hat er nicht gesagt. Aber das Gegenteil auch nicht.« Als ich an das Gespräch zurückdachte, fiel mir auf, dass Lambert überhaupt nicht viel gesagt hatte. »Hat sich nicht konkret geäußert.«
»Vielleicht wollte er dir einfach keinen zusätzlichen Stress machen«, mutmaßte Maddie. »Wie ist der denn so?«
»Schon okay, glaube ich. Sofern man das beurteilen kann, wenn man so was zu hören kriegt. Hat gesagt, er wisse, was für ein furchtbarer Schock das sei, ihm sei es genauso gegangen.«
»Immerhin ganz einfühlsam. Aber wie ist er überhaupt darauf gekommen? Ich meine, wie kam er auf die Idee zu denken, dass sein Kind nicht sein Kind ist?«
Ich überlegte. »Dazu hat er sich nicht geäußert.«
»Und er hat überhaupt nicht durchblicken lassen, was sie vorhaben?«
Ich schüttelte den Kopf. Der Schock saß mir noch immer in den Knochen. »Aber er hat ein Foto von Theo mitgenommen, um es seiner Frau zu zeigen. Und hat uns eines von David dagelassen.«
»Wo ist es?«
Ich reichte es Maddie. Zuerst sah sie überrascht aus, dann trat ein gerührter Ausdruck in ihre Augen.
»Er ähnelt dir sehr, oder?«, fragte ich behutsam.
»Schon, ja. Und er sieht genau aus wie Robin in diesem Alter.« Maddies Brüder lebten alle in Australien, aber ich wusste, dass sie Robin, den jüngsten, am meisten vermisste. Maddie holte tief Luft. »Wow. Ist wohl schon was dran, wie?«
Mein Laptop piepte, und ich schaute auf den Bildschirm. Miles Lambert möchte mit sich mit Ihnen auf LinkedIn vernetzen.
»Schau mal, soll ich annehmen?«, fragte ich Maddie.
»Warum nicht? Wir müssen ja ohnehin in Kontakt bleiben, wie das jetzt auch weitergeht.«
Ich setzte mich an den Schreibtisch und klickte auf ANNEHMEN. Ein paar Sekunden später hatte ich eine Nachricht.
Pete,
danke, dass Sie mich heute empfangen haben. Und noch mal Entschuldigung, dass ich mit dieser sicher verstörenden Nachricht so in Ihr Leben geplatzt bin. Sie wollen bestimmt alles mit Madelyn besprechen, bevor Sie beide Entscheidungen treffen. Aber meine Frau Lucy und ich haben uns überlegt, ob Sie beide uns nicht besuchen wollen, damit wir uns alle vier kennenlernen – und Sie auch David treffen können. Wir überlassen es ganz und gar Ihnen, ob Sie Theo mitbringen, würden uns aber natürlich sehr darüber freuen.
Es ist eine schwierige und schreckliche Situation, mit der wir alle nicht gerechnet haben. Aber wir hoffen, dass wir Lösungen finden, die für alle Beteiligten – vor allem für unsere Kinder – das Beste sind.
Herzliche Grüße
Miles
»Das ist eine gute E-Mail«, sagte Maddie, die mir über die Schulter geschaut hatte. Ich hörte die Erleichterung in ihrer Stimme. »Scheint wirklich so, als wollten sie uns nicht zu irgendetwas drängen.«
»Ja«, sagte ich, aber mir war dennoch mulmig. Trotz des freundlichen Tons der Mail hatte ich das Gefühl, dass die Ereignisse bereits ins Rollen gerieten und ich keinerlei Einfluss darauf hatte. Wenn wir David erst kennengelernt hatten und die Lamberts Theo, würde alles viel komplizierter werden. Der Zug fuhr schon aus dem Bahnhof, und ich war nicht der Lokführer.
9
MADDIE
Erst nachdem ich die E-Mail von Miles gelesen habe, in der seine Frau Lucy erwähnt wurde, löst der Name Lambert eine Erinnerung aus. Auf der NICU hatte es damals einundzwanzig Inkubatoren gegeben. Einundzwanzig Elternpaare mit winzigen unterentwickelten oder kranken Babys. Einige waren ein paar Tage dort, andere – vor allem die Frühchen – monatelang. Von den meisten Erwachsenen habe ich nur ihre erschöpften verzweifelten Mienen in Erinnerung. Ins Gespräch kam man höchstens, wenn jemand an den Inkubatoren in der Nähe stand oder neben mir auftauchte, wenn ich an den Waschbecken meine Milchpumpe säuberte. Beim Sprechen konnten wir Anspannung abbauen, den permanenten Kloß im Hals ein wenig lindern.
Nach einer Weile gewöhnte ich mich an die Situation. Ich fühlte mich zwar immer noch wie eine Versagerin, aber hier waren noch andere Menschen in der gleichen Lage – anders als in der Privatklinik, in der überall kräftiges Babygeschrei zu hören war. Die Babys hier schrien nicht, auch nicht die größeren, die keinen Schlauch im Hals hatten. Wenn es ihnen nicht gut ging, zuckten sie mit den Gliedern, krümmten den Rücken oder niesten einfach nur. Auf diese Zeichen war man geeicht, weil sie auf den Beginn einer »Episode« hinwiesen – der verklärende Ausdruck der Schwestern für Todesgefahr, wenn der Alarm anging und Theos Herz oder Atmung angeregt werden musste.
Dass ich meinen Sohn ständig so genau beobachtete, änderte mein Verhältnis zu ihm. Ich empfand zwar nicht Liebe, das sicher nicht, aber ein überwältigendes schmerzhaftes Verantwortungsgefühl. Ich hatte ihn schon einmal im Stich gelassen, das durfte kein zweites Mal passieren.
Der Hautkontakt – die sogenannte Kängurumethode – war auch eine Hilfe. Als Bronagh, die irische Schwester – die ich dann doch gar nicht so übel fand, nachdem ich mich an ihre saloppe Art gewöhnt hatte –, das zum ersten Mal vorschlug, war ich skeptisch. Es schien mir Irrsinn zu sein, dieses winzige verletzliche Wesen der schützenden Kapsel zu entreißen und auf denselben Bauch zu legen, der es schon einmal im Stich gelassen hatte. Aber Bronagh blieb hartnäckig. Während Pete rundum die Vorhänge schloss, zog ich meine Bluse aus, und Bronagh legte Theo mitsamt all den Schläuchen auf meine Brust.
»Wenn du magst, kannst du ihn mal zum Stillen anlegen«, schlug die Schwester dann vor.
Stillen? Im Ernst? Ich wagte es ja kaum, ihn im Arm zu halten. Er war so klein – nicht einmal anderthalb Kilo bei seiner Geburt und drei Wochen später keine zweieinhalb. Ich wusste, wie ein Baby sich anfühlen musste – proper und mit Pölsterchen. Theo dagegen kam mir so leicht wie ein ausgeblasenes Ei vor. Aber ich schob gehorsam meinen BH beiseite und bewegte Theos Köpfchen vorsichtig an meine Brustwarze. Zahnlose Kiefer, weich wie ein Fischmäulchen, berührten meine Haut. Und dann, ganz plötzlich, saugten sie sich fest, und ich wurde von einem Glücksgefühl überflutet. Theo verschluckte sich einmal, keuchte, saugte dann weiter.
»Schau nur«, hauchte Pete. Dann: »Aber die Anzeige …«
Ich schaute auf den Monitor. Die Herzfrequenz sank. »Ist er okay?«, fragte ich ängstlich.
»Okay?«, wiederholte Bronagh. »Er kuschelt sich gerade an, um schön zu trinken und dann ein Schläfchen zu machen. Willkommen an deinem neuen Lieblingsort, Theo.«
In diesem Moment hatte ich zum ersten Mal den Gedanken, dass der Arzt in der anderen Klinik sich geirrt haben könnte. Dieses Kind schien leben zu wollen.