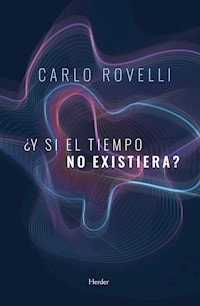Es gibt Orte auf der Welt, an denen Regeln weniger wichtig sind als Freundlichkeit E-Book
Carlo Rovelli
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Newton und sein schwieriges Verhältnis zur Alchemie, Dantes Kosmologie und unser modernes Weltbild, der Schmetterlings-Forscher Nabokov und Lolita sowie die Zweifel des gar nicht so unfehlbaren Genies Einstein: Neben seinen Büchern, die ihn als Physiker zu Weltruhm aufsteigen ließen, hat Carlo Rovelli eine ganze Reihe kurzer Essays geschrieben, in denen er ungewöhnlichen Beziehungen der Wissenschaft zu Literatur, Geschichte, Philosophie, Politik nachgeht. Und immer geht es dabei auch um Humanität. Hier sind sie zum ersten Mal auf Deutsch zu lesen. Elegant geschrieben, abwechslungsreich, interessant und anregend, verschaffen sie seinen Leserinnen und Lesern einen Eindruck davon, was den wachen Geist des Physik-Stars bewegt. «Rovelli hat einen neuen Weg gefunden, über Wissenschaft zu sprechen, einfach und erhellend.» Paolo Giordano
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Ähnliche
Carlo Rovelli
Es gibt Orte auf der Welt, an denen Regeln weniger wichtig sind als Freundlichkeit
Essays
Über dieses Buch
Newton und sein schwieriges Verhältnis zur Alchemie, Dantes Kosmologie und unser modernes Weltbild, der Schmetterlings-Forscher Nabokov und Lolita sowie die Zweifel des gar nicht so unfehlbaren Genies Einstein: Neben seinen Büchern, die ihn als Physiker zu Weltruhm aufsteigen ließen, hat Carlo Rovelli eine ganze Reihe kurzer Essays geschrieben, in denen er ungewöhnlichen Beziehungen der Wissenschaft zu Literatur, Geschichte, Philosophie, Politik nachgeht. Und immer geht es dabei auch um Humanität. Hier sind sie zum ersten Mal auf Deutsch zu lesen. Elegant geschrieben, abwechslungsreich, interessant und anregend, verschaffen sie seinen Leserinnen und Lesern einen Eindruck davon, was den wachen Geist des Physik-Stars bewegt.
«Rovelli hat einen neuen Weg gefunden, über Wissenschaft zu sprechen, einfach und erhellend.» Paolo Giordano
Vita
Carlo Rovelli, geboren 1956 in Verona, ist seit 2000 Professor für Physik an der Universität Marseille. Zuvor forschte und lehrte er unter anderem am Imperial College London, der Universität Rom, der Yale University, an der Universita dell’Aquila und an der University of Pittsburgh. 1998/99 war er Forschungsdirektor am Zentrum für Theoretische Physik (CPT) in Luminy. Er hat die italienische und die amerikanische Staatsbürgerschaft. Zusammen mit Lee Smolin entwickelte er die Theorie der Schleifenquantengravitation, die international als verheißungsvollste Theorie zur Vereinigung von Einsteins Gravitationstheorie und der Quantentheorie gilt.
Monika Niehaus, Diplom in Biologie, Promotion in Neuro- und Sinnesphysiologie, freiberuflich als Autorin (SF, Krimi, Sachbücher), Journalistin und naturwissenschaftliche Übersetzerin (englisch/französisch) tätig. Mag Katzen, kocht und isst gern in geselliger Runde.
Inhaltsübersicht
Vorwort
Aristoteles, der Naturwissenschaftler
Lolita und der Hauhechel-Bläuling
Newton, der Alchemist
Kopernikus und Bologna
Mein 1977 und das meiner Freunde
Literatur und Naturwissenschaften: ein ständiger Dialog
Dante, Einstein und die 3-Sphäre
Zwischen Sicherheit und Unsicherheit: ein kostbarer Zwischenraum
Bruno de Finetti: Unsicherheit ist nicht unser Feind
Brauchen die Naturwissenschaften die Philosophie?
Der Geist eines Oktopus
Ideen fallen nicht vom Himmel
Einsteins zahlreiche Irrtümer
Manche glauben, oh König Hieron, dass sich Sandkörner nicht zählen lassen
Warum gibt es Ungleichheit?
Dramatische Echos uralter Kriege
Vier Fragen an die Politik
Nationale Identität ist toxisch
Charles Darwin
Marie Curie
Der Meister
Welche Wissenschaft steht dem Glauben näher?
Leopardi und die Astronomie
De rerum natura
Können Esel tatsächlich fliegen? David Lewis meint ja
Wir sind natürliche Geschöpfe in einer natürlichen Welt
Leere ist leer: Nāgārjuna
Mein Kampf
Schwarze Löcher I: Die tödliche Anziehungskraft von Sternen
Schwarze Löcher II: Die Wärme des Nichts
Schwarze Löcher III: Das Geheimnis des Zentrums
Kip und die Gravitationswellen
Danke, Stephen
Roger Penrose
Liebes Jesuskind
Glauben, Wissen und der Klimawandel
Churchill und die Naturwissenschaften
Traditionelle Medizin und die UNESCO
Die unendliche Teilbarkeit des Raumes
Ramon Llull: Ars magna
Sind wir wirklich frei?
Eine tolle Geschichte
Warum ich Atheist bin
Hadza
Ein Tag in Afrika
Die Festtage sind vorbei
Dieses kurze Leben fühlt sich wunderbar an, heute mehr als je zuvor
Textnachweis
Vorwort
Ein Artikel in einer Zeitschrift ist so etwas wie ein japanisches Kōan oder ein europäisches Sonett: In Umfang und Form begrenzt, kann es wenig mehr als eine einzige Information übermitteln, ein Argument, eine einzige Überlegung, ein Gefühl. Und dennoch kann es über alles und jedes sprechen.
Die hier vorliegenden Essays, die im Lauf von zehn Jahren in verschiedenen Zeitungen erschienen sind, handeln von Dichtern, Wissenschaftlern und Philosophen, die mich in verschiedener Hinsicht beeinflusst haben, von Reisen, von meiner Generation, von Atheismus, von Schwarzen Löchern, Teleskopen, psychedelischen Erfahrungen, intellektuellen Überraschungen – und von noch viel mehr. Sie ähneln kurzen Tagebucheintragungen, die die intellektuellen Abenteuer eines Physikers festhalten, der sich für vieles interessiert und stets auf der Suche nach neuen Ideen – und nach einer breiten, aber kohärenten Perspektive – ist.
Die Wendung, die zum Titel wurde, stammt aus einem der Artikel: ein Satz, der vielleicht etwas von dem Geist ausdrückt, der diesen Essays gemeinsam ist. Aber vielleicht enthüllt er auch nur den Geist der Art von Welt, in der ich gerne leben würde …
Aristoteles, der Naturwissenschaftler
Fallen Gegenstände unterschiedlichen Gewichts mit derselben Geschwindigkeit? In der Schule haben wir gelernt, wie Galileo Galilei Kugeln vom Schiefen Turm von Pisa fallen ließ und dadurch zeigte, dass die richtige Antwort «ja» lautet. Andererseits hatten die Menschen diese Tatsache über zwei vorangegangene Jahrtausende hinweg offenbar übersehen, geblendet vom Dogma des Aristoteles, dem zufolge ein Objekt desto rascher fällt, je schwerer es ist. In dieser Lesart der Geschichte ist seltsamerweise nie jemand auf die Idee gekommen zu testen, ob diese Behauptung tatsächlich stimmt oder nicht, bevor Francis Bacon und seine Zeitgenossen begannen, die Natur zu beobachten und sich von der Zwangsjacke des aristotelischen Dogmatismus zu befreien …
Das ist eine gute Geschichte, doch es gibt ein Problem damit. Werfen Sie doch einmal versuchsweise eine Glasmurmel und einen Pappbecher von einem Balkon. Im Gegensatz zu dieser schönen Legende ist es keineswegs so, dass beide Objekte zur selben Zeit auf dem Boden auftreffen: Genau wie Aristoteles sagt, fällt die schwerere Murmel viel rascher.
Zweifellos wird an diesem Punkt jemand einwerfen, dies liege am Luftwiderstand, dem Medium, das die Dinge beim Fallen durchqueren. Das stimmt, doch bei Aristoteles steht nicht, dass Objekte mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten fallen würden, wenn wir die gesamte Luft entfernten. Er schrieb, dass Objekte in unserer Welt, in der es Luft gibt, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten fallen. Er behauptete nichts Falsches. Er beobachtete die Natur aufmerksam, besser als Generationen von Lehrern und Studenten, die dazu neigen, Behauptungen zu vertrauen, ohne sie selbst zu testen.
Die aristotelische Physik hatte eine ziemlich schlechte Presse. Sie wurde so dargestellt, als basiere sie auf A-priori-Annahmen, ohne sich um Beobachtungen zu scheren, sei schlicht und einfach starrköpfig. Das ist zum großen Teil ungerecht. Die aristotelische Physik blieb nicht etwa deshalb so lange ein Orientierungspunkt für die mediterrane Zivilisation, weil sie dogmatisch war, sondern weil sie tatsächlich funktionierte. Sie liefert eine gute Beschreibung der Wirklichkeit und einen so effektiven konzeptuellen Rahmen, dass rund zweitausend Jahre lang niemand etwas Besseres vorschlagen konnte.
Im Mittelpunkt der Theorie steht die Idee, dass sich jedes Objekt ohne äußere Einflüsse auf seinen «natürlichen Ort» zubewegt: weiter unten auf die Erde, etwas höher auf das Wasser, noch ein wenig höher auf die Luft und noch höher auf das Feuer; die Geschwindigkeit der «natürlichen Bewegung» steigt mit dem Gewicht und sinkt mit der Dichte des Mediums, in dem sich das Objekt bewegt. Es ist eine einfache, umfassende Darstellung einer Vielfalt von Phänomenen – beispielsweise, warum Rauch aufsteigt und warum ein Stück Holz in Luft zu Boden fällt, im Wasser aber nach oben steigt. Als Theorie ist sie offensichtlich nicht perfekt, doch wir sollten uns daran erinnern, dass in den modernen Naturwissenschaften ebenfalls nichts perfekt ist.
Der schlechte Ruf der aristotelischen Physik ist teilweise Galileis Schuld, der in seinen Schriften einen vernichtenden Rundumschlag gegen die aristotelische Theorie führte und ihre Anhänger als dumm und einfältig darstellte. Das tat er aus rhetorischen Gründen. Die schlechte Reputation der aristotelischen Physik geht aber auch auf die unsinnige Kluft zurück, welche sich zwischen naturwissenschaftlicher Kultur und humanistisch-philosophischem Diskurs aufgetan hat. Diejenigen, die sich mit Aristoteles beschäftigen, wissen in der Regel kaum etwas über Physik, und diejenigen, die Physik studieren, interessieren sich kaum für Aristoteles. Die wissenschaftliche Brillanz von Abhandlungen wie Über den Himmel oder Physik – das Werk, von dem sich der Name dieser Disziplin ableitet –, wird daher allzu leicht übersehen.
Es gibt noch einen weiteren wichtigeren Faktor, der unsere Blindheit für seine wissenschaftliche Brillanz erklärt: die Vorstellung, es sei unmöglich, Gedanken, die das Produkt von kulturell so unterschiedlichen Universen wie dem des Aristoteles und dem der modernen Physik sind, miteinander zu vergleichen, und dass wir es daher gar nicht erst versuchen sollten. Viele der heute lebenden Historiker zeigen sich entsetzt von der Idee, in der aristotelischen Physik eine Approximation der Newton’schen Physik zu sehen. Um den originären Aristoteles zu verstehen, argumentieren die Verfechter dieser Ansicht, müssen wir ihn im Lichte seines Kontextes untersuchen und nicht im konzeptuellen Rahmen späterer Jahrhunderte.
Das mag der Fall sein, wenn wir Aristoteles besser verstehen wollen, aber wenn wir das heutige Wissen verstehen wollen und uns dafür interessieren, wie es sich aus der Vergangenheit herauskristallisierte, sind es gerade die Beziehungen zu entlegenen Welten, die uns interessieren.
Philosophen und Historiker wie Karl Popper und Thomas Kuhn, die starken Einfluss auf das zeitgenössische Denken hatten, haben die Bedeutung von Brüchen im Lauf unserer Wissensentwicklung betont. Beispiele für solche «wissenschaftlichen Revolutionen», in denen eine alte Theorie aufgegeben wird, sind der Wechsel von Aristoteles zu Newton und von Newton zu Einstein. Nach Kuhn kommt es im Verlauf eines solchen Übergangs zu einer radikalen Restrukturierung des Denkens, und zwar in einem solchen Maße, dass die früheren Ideen irrelevant, ja unverständlich werden. Sie sind mit der Folgetheorie «unvereinbar», so Kuhn.
Popper und Kuhn gebührt das Verdienst, den Fokus auf diesen revolutionären Aspekt der Wissenschaft und die Bedeutung von Brüchen gerichtet zu haben, doch ihr Einfluss hat zu einer absurden Entwertung der kumulativen Aspekte des Wissens geführt. Noch schlimmer ist das Versäumnis, die logischen und historischen Beziehungen zwischen Theorien vor und nach jedem bedeutenden Fortschritt zu erkennen. Newtons Physik lässt sich problemlos als Approximation an Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie erkennen. Aristoteles’ Physik lässt sich ohne Probleme als Approximation innerhalb der Newton’schen Theorie erkennen.
Das ist noch nicht alles, denn innerhalb der Newton’schen Theorie kann man Merkmale der aristotelischen Physik wiederfinden. Die großartige Idee, beispielsweise, die «natürliche» Bewegung eines Körpers von derjenigen zu unterscheiden, die «erzwungen» wurde, bleibt in der Newton’schen Physik erhalten, ebenso später in Einsteins Theorie. Was sich verändert, ist die Rolle der Schwerkraft; die Gravitation ist eine Ursache für erzwungene Bewegungen in Newtons Physik (in der die natürliche Bewegung immer gleichförmig geradlinig ist), während sie bei Aristoteles ein Aspekt der natürlichen Bewegung ist, wie auch seltsamerweise erneut bei Einstein (wo die natürliche Bewegung, die als «geodätisch» bezeichnet wird, wieder wie bei Aristoteles zur Bewegung eines Objekts im freien Fall zurückkehrt).
Der wissenschaftliche Fortschritt entsteht weder allein durch eine Anhäufung von Wissen noch durch absolute Revolutionen, bei denen alles Alte entsorgt wird und wir wieder ganz von vorn beginnen. Wissenschaftler sind vielmehr, wie es Otto Neurath in einer wunderbaren Analogie formulierte, «wie Schiffer …, die ihr Schiff auf offener See umbauen müssen, ohne es jemals in einem Dock zerlegen und aus besten Bestandteilen neu errichten zu können. Wo ein Träger fortgenommen wird, muss er sofort durch einen neuen ersetzt werden, und dafür wird der Rest des Schiffes als Stütze verwendet. Auf diese Weise können wir das Schiff nach und nach ersetzen, das wir aber nie von Grund auf neu errichten können.»
In dem großen Schiff der modernen Physik können wir noch immer seine alten Strukturen erkennen – so wie die Unterscheidung zwischen natürlichen und erzwungenen Bewegungen –, die zuerst im alten Schiff des aristotelischen Denkens aufgekommen ist.
Lassen Sie uns zu den Körpern zurückkehren, die durch Luft bzw. Wasser fallen, und schauen, was tatsächlich passiert. Weder erfolgt der Fall eines Objekts mit konstanter Geschwindigkeit und hängt vom Gewicht ab, wie Aristoteles behauptete, noch erfolgt er mit konstanter Beschleunigung und unabhängig vom Gewicht, wie Galilei argumentierte (auch dann nicht, wenn wir die Reibung vernachlässigen). Wenn ein Objekt fällt, beschleunigt sich seine Bewegung in der Anfangsphase, stabilisiert sich dann, und das Objekt fällt mit einer konstanten Geschwindigkeit weiter, die für schwerere Körper höher ist. Diese zweite Phase wird von Aristoteles gut beschrieben. Die erste Phase ist hingegen gewöhnlich sehr kurz und schwierig zu beobachten; daher ist sie ihm nicht aufgefallen. Die Existenz dieses Initialstadiums ist aber bereits in der Antike bemerkt worden: So stellte Strato von Lampsacus bereits 300 v. Chr. fest, dass sich ein fallender Wasserstrahl in Tropfen aufteilt, was darauf hindeutet, dass sich die Tropfen beim Fallen beschleunigen, genauso, wie sich eine Autoschlange auseinanderzieht, wenn die Fahrzeuge beschleunigen.
Um diese Initialphase zu untersuchen, was ziemlich schwierig ist, weil alles so schnell geschieht, entwickelt Galilei eine brillante Strategie. Statt fallende Körper zu beobachten, studiert er Kugeln, die eine leicht geneigte Ebene hinunterrollen. Seine Intuition, die wohlfundiert, aber damals schwierig zu belegen war, sagt ihm, dass der «rollende Fall» der Kugeln die Bewegung von frei fallenden Körpern reproduziert. Auf diese Weise gelingt es Galilei festzustellen, dass es die Beschleunigung ist, die zu Anfang eines Falls konstant bleibt, nicht die Geschwindigkeit. Galilei deckte dieses für unsere Sinne kaum wahrnehmbare Detail auf, während die aristotelische Physik hier versagt. Das erinnert an die Beobachtung, die Einstein zu Beginn des 20. Jahrhunderts benutzte, um über Newton hinauszugehen: Wenn man genau hinschaut, stellt man fest, dass die Bewegung des Planeten Merkur nicht exakt den von Newton berechneten Umlaufbahnen folgt. In beiden Fällen steckt der Teufel im Detail.
Einstein macht mit Newton das, was Newton mit Aristoteles machte: Er zeigt, dass Newtons Physik bei aller Effizienz nur als erste Näherung dienen kann. Heute wissen wir, dass selbst Einsteins Physik nicht perfekt ist: Sie versagt, wenn die Quantenphysik Einzug in die Gleichungen hält. Auch Einsteins Physik bedarf der Verbesserung. Wir wissen nur noch nicht, wie.
Galilei baute seine neue Physik nicht darauf auf, gegen ein Dogma zu rebellieren oder Aristoteles zu vergessen. Ganz im Gegenteil hatte er viel von ihm gelernt und machte sich nun daran herauszufinden, wie sich gewisse Aspekte des aristotelischen Konzepts modifizieren ließen: Zwischen ihm und Aristoteles gab es keine Funkstille, sondern einen Dialog.
Meiner Ansicht nach ist dies auch an den Grenzen zwischen unterschiedlichen Kulturen, Individuen und Völkern der Fall. Es ist nicht wahr, dass verschiedene kulturelle Welten gegenseitig undurchdringlich und unübersetzbar sind, wie wir heutzutage ständig hören. Genau das Gegenteil ist richtig: Die Grenzen zwischen Theorien, Disziplinen, Zeitaltern, Kulturen, Völkern und Individuen sind bemerkenswert durchlässig, und unser Wissen profitiert vom Dialog über dieses ganze, höchst permeable Spektrum hinweg. Unser Wissen ist das Ergebnis einer kontinuierlichen Entwicklung dieses engmaschigen Netzes von Austauschprozessen. Was uns am meisten interessiert, ist gerade dieser Austausch: Erfahrungen zu vergleichen, Ideen zu vermitteln, aus Unterschieden zu lernen und auf dem Gelernten aufzubauen. Zu mischen, statt die Dinge getrennt zu halten.
Die Distanz zwischen dem Athen im 4. Jahrhundert v. Chr. und dem Florenz im 17. Jahrhundert ist nicht gering. Doch es gibt keinen radikalen Bruch und kein Missverständnis. Weil Galilei weiß, wie er mit Aristoteles in Dialog treten und zum Zentrum seiner Physik vordringen kann, findet er den kaum sichtbaren Zugang, durch den diese Physik korrigiert und verbessert werden kann. Er formuliert dies in einem Brief später im Leben auf wunderbare Weise: «Gewiss würde mich Aristoteles, sollte er auf die Erde zurückkehren, unter seine Anhänger aufnehmen, habe ich doch nur sehr wenige Punkte seiner Doktrin widerlegt.»
Lolita und der Hauhechel-Bläuling
Ich schlenderte durch das Naturkundemuseum in Mailand und stieß darin auf einen alten Schrank, der eine Sammlung blauer Schmetterlinge enthielt – und einen Namen, den ich in diesem Zusammenhang nicht erwartet hätte: Vladimir Nabokov.
Derselbe Nabokov, der der Autor von so überwältigenden Romanen wie Lolita war:
Lo-li-ta: die Zungenspitze macht drei Sprünge den Gaumen hinab und tippt bei Drei gegen die Zähne. Lo. Li. Ta. Sie war Lo, einfach Lo am Morgen, wenn sie vier Fuß zehn groß in einem Söckchen dastand. Sie war Lola in Hosen. Sie war Dolly in der Schule. Sie war Dolores auf amtlichen Formularen. In meinen Armen aber war sie immer Lolita.
Er ist vielleicht einer der größten Romanautoren des 20. Jahrhunderts. Wie ein Artikel in der literarischen Beilage der New York Times uns neulich erinnerte, wird «Nabokov in akademischen Kreisen zunehmend neben Namen wie Proust und Joyce gestellt».
Und dennoch suchte Nabokov, wie er selbst sagte, eine ganz andere Art von Ruhm. Eines seiner Gedichte, «On Discovering a Butterfly» («Beim Entdecken eines Schmetterlings»), beginnt so: «I found it and I named it, being versed / in taxonomic Latin; thus became / godfather to an insect and its first / describer – and I want no other fame.» (In der Übersetzung von Hans Wolf: Ich fand ihn und benannte ihn im Latein / der Taxonomiker und wurd zum Paten / des Schmetterlings und war als erster sein / Beschreiber – andrem Ruhm kann ich entraten.)
Schmetterlinge waren seine Leidenschaft. Lolita wurde während einer der Kurzreisen nach Westen geschrieben, die er jedes Jahr in den Vereinigten Staaten unternahm, um voller Begeisterung Schmetterlinge zu fangen.
In jenem abgeklärt-heiteren Pantheon, in dem die Seelen großer Schriftsteller weilen, kann ich Nabokov vor meinen inneren Augen lächeln sehen: Einige Jahre zuvor wurde in den Proceedings of the Royal Society of London, einer der angesehensten wissenschaftlichen Fachzeitschriften, ein Artikel veröffentlicht, der seine kühnste wissenschaftliche Theorie bestätigte, und sein Name wird damit für immer in den Annalen der Wissenschaft verewigt sein: Nabokov war der Erste, der die Wanderung des Hauhechel-Bläulings (Polyommatus icarus) aufklärte, dieses charmanten blauen Schmetterlings, den man im Mailänder Museum bewundern kann. Dies war die Art von Ruhm, nach der er sich sehnte: der «Pate eines Insekts» zu sein.
In Nabokovs Theorie ging es um den Migrationsmodus dieser Schmetterlinge auf dem amerikanischen Kontinent. Im Jahr 1945 veröffentlichte er seine Hypothese, nach der sie sich in Asien entwickelt haben und im Lauf von zehn Millionen Jahren in fünf aufeinander folgenden Wellen über die Beringstraße nach Nordamerika einwanderten. Niemand nahm ihn ernst. Man konnte sich nur schwer vorstellen, dass Schmetterlinge, die an ein warmes Klima angepasst waren, so weit nach Norden vordringen würden. Doch Nabokov hatte recht: Moderne DNA-Analysen erlaubten es, die Genealogie der Art zu rekonstruieren und seine Hypothese vollumfänglich zu bestätigen. Darüber hinaus hat die Rekonstruktion von Klimaveränderungen im Lauf der Zeit ergeben, dass es in der Region der Beringstraße Phasen mit ausreichend warmem Klima gab, in denen eine Passage dieser Wanderfalter durchaus möglich gewesen wäre – und das genau in den Zeitfenstern, die Nabokov vorgeschlagen hatte.
Nabokov war der Kurator der Schmetterlingssammlung im Zoologischen Museum der Harvard University und veröffentlichte detaillierte Beschreibungen von vielen hundert Spezies. Er stammte aus einer außerordentlich reichen russischen Aristokratenfamilie und sammelte Schmetterlinge seit seiner Kindheit. Als er acht Jahre alt war, wurde sein Vater aus politischen Gründen inhaftiert, und der junge Nabokov brachte ihm einen Schmetterling in die Zelle. Nach dem Verlust des Familienvermögens infolge der Russischen Revolution floh die Familie nach Europa, wo er schließlich das Honorar für seinen zweiten Roman zur Finanzierung einer Schmetterlingsexkursion in die Pyrenäen benutzte.
Nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren, musste er auch aus Europa fliehen, und so kultivierte er seine Passion für Schmetterlinge in den Vereinigten Staaten. Er galt als kundiger Amateur, der in der Lage war, die verschiedenen Schmetterlingsarten wissenschaftlich exakt zu beschreiben. Indessen verkörperte er selbst einen Typus, der zum Aussterben verurteilt war: Er war eines der letzten Exemplare des Aristokraten aus dem 19. Jahrhundert, das Schmetterlinge zum Zeitvertreib sammelte.
Doch ein Jahrzehnt nach seinem Tod im Jahr 1977 begannen verschiedene Entolomogen, seine wissenschaftliche Arbeit ernst zu nehmen. Seine Klassifikationen stellten sich als präzise heraus. Einer der von ihm beschriebenen Schmetterlinge erhielt zu seinen Ehren den Namen Nabokovia cuzquenhan. Ein 1999 veröffentlichtes Buch, Nabokov’s Blues, erzählt die Geschichte der Wiederentdeckung von Nabokovs Klassifikationen. Es sollten jedoch weitere zehn Jahre vergehen, bis seine Hypothese über die Schmetterlingspassage via Beringstraße auf spektakuläre Weise bewiesen wurde und ihm endlich die verdiente Anerkennung als seriöser Wissenschaftler zuteilwurde.
Gibt es eine Verbindung zwischen Nabokovs wissenschaftlicher Arbeit und seinem literarischen Werk? Es ist schwer, der Versuchung zu widerstehen, Lolita mit Schmetterlingen in Verbindung zu bringen, vor allem jene Lolita, wie sie durch die Augen von Humbert Humberts verzweifelter Liebe erscheint. Aber das ist wahrscheinlich zu einfach. Stephen Jay Gould diskutiert dieses Thema in einem Essay mit dem suggestiven Titel «Es gibt keine Wissenschaft ohne Phantasie und es gibt keine Kunst ohne Tatsachen: Die Schmetterlinge des Vladimir Nabokov». Er argumentiert, dass Nabokovs intensiver Fokus, sein fast besessenes Interesse an Beobachtung und Detailgenauigkeit, die Basis für seinen Erfolg als Schmetterlingssammler und seine Technik als Schriftsteller bildet, was vermutlich richtig ist. Nabokov selbst meinte einmal: «Ein Schriftsteller sollte die Präzision eines Poeten und die Vorstellungskraft eines Wissenschaftlers haben.»
Mir scheint das noch nicht alles zu sein. Im Jahr 1948 schreibt Nabokov in Erinnerung, sprich, einer der berühmtesten literarischen Autobiografien des 20. Jahrhunderts, in seinem üppigen, detailreichen Stil:
Besonders faszinierten mich die Geheimnisse der Mimikry. Ihre Erscheinungen waren von einer künstlerischen Vollkommenheit, wie man sie gewöhnlich nur mit Gebilden von Menschenhand in Zusammenhang bringt. Hierher gehörte die Nachahmung heraussickernden Giftes durch bläschenartige Makeln auf den Flügeln (einschließlich scheinbarer Brechungseffekte) oder durch glänzende gelbe Knötchen auf der Puppe («Friss mich nicht – man hat mich bereits ausgequetscht, probiert und verschmäht»). Hierher gehörten die Tricks einer akrobatischen Raupe (der des Buchenspinners …), die in der Kindheit wie Vogelkot aussieht, nach der Häutung jedoch krabbelige hymenopteroide Ansatzgebilde und barocke Eigenheiten entwickelt, die es diesem Könner erlauben, zwei Rollen auf einmal zu spielen (wie der Schauspieler in orientalischen Shows, der zu einem Paar verschlungener Ringer wird): die einer sich krümmenden Larve und die einer großen Ameise, welche ihr scheinbar zusetzt. Wenn ein bestimmter Nachtfalter in Form und Farbe einer bestimmten Wespe gleicht, so bewegt er auch seine Beine und Fühler in Wespenmanier und nicht wie ein Nachtfalter. Wenn ein Schmetterling wie ein Blatt aussehen muss, so sind nicht nur alle Einzelheiten eines Blattes wunderschön nachgemacht, es sind großzügig auch noch Markierungen hinzugefügt, die Raupenfraß vortäuschen. «Natürliche Auslese» im Darwin’schen Sinn konnte die wunderbare Übereinstimmung von imitiertem Verhalten und imitiertem Aussehen nicht erklären, noch konnte man sich auf die Theorie des «Kampfes ums Dasein» berufen, wenn eine Schutzmaßnahme bis zu einem Grad der Feinheit, der Extravaganz, der Aufwendigkeit getrieben war, der das Unterscheidungsvermögen des Fressfeindes bei weitem überforderte. In der Natur entdeckte ich die zweckfreien Wonnen, die ich in der Kunst suchte. Beide waren eine Form der Magie, beide waren ein Spiel intrikater Bezauberung und Täuschung.
Darin steckt viel mehr als nur die Fähigkeit, Details mit geradezu besessener Aufmerksamkeit wahrzunehmen. Darin steckt nicht zuletzt die Fähigkeit, Schönheit zu erkennen.
Selbst wenn unsere Aufmerksamkeit momentan von etwas gefesselt wird und dann davongleitet. Von den Flügeln eines Schmetterlings. Oder vom Klang – ‹Lo–li–ta› – eines unvergesslichen Namens.
Newton, der Alchemist
Im Jahr 1936 versteigert Sotheby’s auf einer Auktion eine Sammlung unveröffentlichter Schriften von Sir Isaac Newton. Der Preis ist niedrig, 9000 englische Pfund; nicht viel jedenfalls im Vergleich zum Verkaufserlös eines Rubens und eines Rembrandt in derselben Saison, die 140000£ erbrachten. Zu den Käufern gehörte John Maynard Keynes, der weltberühmte Wirtschaftswissenschaftler, der ein großer Bewunderer Newtons war. Schon bald bemerkte Keynes, dass sich ein großer Teil des Manuskripts mit einem Thema beschäftigte, von dem nur wenige erwartet hätten, dass es Newton interessieren würde. Alchemie nämlich. Er machte sich daran, sämtliche unveröffentlichten Schriften Newtons zu diesem Thema zu erwerben, und erkannte bald, dass Alchemie kein Thema war, das die Neugier des großen Wissenschaftlers nur nebenbei oder kurzzeitig erregt hätte: Sein Interesse daran währte sein ganzes Leben lang. «Newton war nicht der erste Aufklärer», schloss Keynes, «er war der letzte Magier.»
Im Jahr 1946 schenkte Keynes Newtons unveröffentlichte Werke der University of Cambridge. Den meisten Historikern kam Newton im Gewand eines Alchemisten, das so gar nicht zu seinem traditionellen Image als Vater der Naturwissenschaften passte, so seltsam vor, dass sie einen weiten Bogen um das Thema machten. Erst in neuerer Zeit ist das Interesse an seiner Leidenschaft für Alchemie gewachsen. Inzwischen ist ein beträchtlicher Teil von Newtons alchemistischen Texten von Forschern der University of Indiana online gestellt worden und so nun für jedermann zugänglich.[1]
Diese Texte sind noch immer in der Lage, Diskussionen zu provozieren und ein irritierendes Licht auf sein Vermächtnis zu werfen.
Newton ist für die modernen Naturwissenschaften eine zentrale Figur. Diese herausragende Stellung gebührt ihm wegen seiner außerordentlich wichtigen wissenschaftlichen Leistungen: in der Mechanik seine Gravitationstheorie, in der Optik seine Entdeckung, dass weißes Licht eine Mischung von farbigem Licht darstellt, seine Infinitesimalrechnung. Selbst heute noch arbeiten Ingenieure, Physiker, Astronomen und Chemiker mit von ihm formulierten Gleichungen und benutzen von ihm eingeführte Konzepte. Aber wichtiger als all dies ist, dass Newton die Methode begründete, mit der wir nach jenem Wissen suchen, das wir heute als moderne Naturwissenschaften bezeichnen. Er setzte dabei auf den Werken und Ideen anderer wie Descartes, Galilei und Kepler auf und baute eine Tradition aus, die bis in die Antike zurückreicht; es waren seine Bücher, in denen das, was wir nun die «wissenschaftliche Methode» nennen, ihre moderne Form fand und sofort eine Fülle außergewöhnlicher Ergebnisse erbrachte. Man übertreibt nicht, wenn man in Newton den Vater der modernen Naturwissenschaften sieht. Also was in aller Welt hat Alchemie mit all dem zu tun?
Es gibt Experten, die in diesen ungewöhnlichen alchemistischen Aktivitäten Zeichen für eine geistige Instabilität aufgrund vorzeitiger Alterserscheinungen sehen. Und es gibt andere, die aus eigenen Interessen versucht haben, den großen Engländer als Kritiker der Beschränktheit wissenschaftlicher Rationalität zu vereinnahmen.
Meines Erachtens liegen die Dinge viel einfacher.
Der Schlüssel ist, dass Newton niemals irgendetwas über Alchemie veröffentlichte. Die Zahl der Aufsätze, die sein Interesse an dem Thema zeigen, ist umfänglich, doch sie alle wurden nie publiziert. Diese Tatsache wurde damit erklärt, dass Alchemie in England bereits seit dem 14. Jahrhundert illegal war. Das Gesetz, das Alchemie verbot, wurde jedoch 1686 aufgehoben. Und Newton wäre zudem nicht Newton gewesen, wenn er sich so sehr darum bemüht hätte, nicht gegen Gesetze und Konventionen zu verstoßen. Manche haben ihn als eine Art dämonischer Persönlichkeit dargestellt, die versuchte, außergewöhnliches und ultimatives Wissen zu sammeln, um es für sich zu behalten und so die eigene Macht zu vergrößern. Doch Newton hat wirklich bedeutende Entdeckungen gemacht und nicht versucht, sie geheim zu halten: Er veröffentlichte sie in seinen großartigen Büchern, darunter die Principia, und die darin formulierten Gleichungen der Mechanik werden noch heute von Ingenieuren benutzt, um Flugzeuge zu bauen und Gebäude zu errichten. Zeit seines Erwachsenenlebens war Newton berühmt und hoch angesehen; er war Präsident der Royal Society, der weltweit führenden wissenschaftlichen Gesellschaft. Die intellektuelle Welt war höchst gespannt auf seine Erkenntnisse. Warum veröffentlichte er also nichts über seine alchemistischen Aktivitäten?
Die Antwort ist sehr einfach, und ich glaube, sie löst das ganze Rätsel in Luft auf: Er veröffentlichte niemals etwas zu diesem Thema, weil er niemals zu irgendwelchen Ergebnissen kam, die er überzeugend fand. Heutzutage ist es einfach, sich auf das wohlabgewogene historische Urteil zu stützen, dass die theoretischen und empirischen Grundlagen der Alchemie viel zu schwach waren. Im 17. Jahrhundert war es hingegen nicht ganz so naheliegend, zu diesem Schluss zu kommen. Alchemie war weit verbreitet und wurde von vielen praktiziert, und Newton bemühte sich ehrlich darum herauszufinden, ob sie eine fundierte Form des Wissens enthielt. Hätte er in der Alchemie etwas gefunden, das der Methode rationaler und empirischer Untersuchung standhielt, die er selbst propagierte, so hätte Newton seine Ergebnisse zweifellos veröffentlicht. Wenn es ihm gelungen wäre, aus dem desorganisierten Morast der alchemistischen Welt etwas zu gewinnen, das zu echter Wissenschaft hätte werden können, dann gäbe es heute sicher ein von Newton verfasstes Buch zu diesem Thema, neben den von ihm verfassten Büchern über Optik, Mechanik und universelle Gravitation. Dies gelang ihm nicht, und so veröffentlichte er konsequenterweise auch nichts zu diesem Thema.
War sein Unterfangen von vorneherein zum Scheitern verurteilt? War es ein Projekt, das hätte aufgegeben werden sollen, noch bevor es in Angriff genommen wurde? Ganz im Gegenteil: Viele der Schlüsselprobleme, die die Alchemie aufwarf, und eine ganze Reihe der Methoden, die sie entwickelte – vor allem, was die Umwandlung von einer chemischen Substanz in eine andere betraf –, sind eben jene Probleme, die bald darauf die neue Disziplin der Chemie entstehen ließen. Newton gelingt es nicht, den entscheidenden Schritt zwischen Alchemie und Chemie zu tun. Das sollte Wissenschaftlern der nächsten Generation, wie Lavoisier, vorbehalten bleiben.
Die von der University of Indiana ins Netz gestellten Texte zeigen dies ganz klar. Zwar stimmt es, dass ihre Sprache voller typischer alchemistischer Metaphern und Anspielungen ist, voller verschleierter Wendungen und seltsamer Symbole. Viele der beschriebenen Verfahren sind jedoch nichts anderes als einfache chemische Prozesse. So beschreibt er die Herstellung von «Vitriolöl» (Schwefelsäure), aqua fortis (Salpetersäure) und «Salzgeist» (Salzsäure). Mithilfe der von Newton gegebenen Anweisungen lassen sich diese Substanzen synthetisieren. Der Name, den Newton für seine Versuche wählte, ist suggestiv: «chymistry». Die späte Alchemie der Nachrenaissance legte großen Wert auf die experimentelle Bestätigung von Ideen. Sie begann sich allmählich in Richtung moderne Chemie zu bewegen. Newton versteht, dass irgendwo in diesem verwirrenden Durcheinander alchemistischer Rezepte eine moderne Wissenschaft (im «Newton’schen» Sinne) verborgen liegt, und er versucht, sie herauszuarbeiten. Er verbringt viel Zeit mit ihrem Studium, doch es gelingt ihm nicht, den Faden zu finden, der ihm helfen würde, das Knäuel zu entwirren; also veröffentlicht er nichts.
Alchemie war nicht Newtons einzige seltsame Beschäftigung und Leidenschaft. Aus seinen Schriften lässt sich eine weitere Passion herauslesen, die vielleicht noch faszinierender ist: Newton investierte große Mühe darin, die Chronologie der Bibel zu rekonstruieren, und versuchte, den in dem heiligen Buch beschriebenen Ereignissen genaue Daten zuzuordnen. Aus seinen Schriften lässt sich ablesen, dass seine Erfolge auch auf diesem Gebiet zu wünschen übrig ließen: Der Vater der Naturwissenschaften schätzte das Alter der Welt auf einige tausend Jahre. Warum verlor sich Newton an ein derartiges Unterfangen? Geschichtsforschung ist ein altes Gebiet. In Milet von Hekataios begründet, ist sie bereits bei Herodot und Thukydides voll ausgereift. Zwischen dem Werk von zeitgenössischen und antiken Historikern herrscht Kontinuität: Es geht zuvorderst um den kritischen Geist, der notwendig ist, wenn man die Spuren der Vergangenheit sammeln und bewerten will. (Hekataios’ Buch beginnt daher so: «Ich schreibe, was ich für wahr halte; denn die Geschichten der Griechen sind vielfältig und erscheinen mir lächerlich.») Die zeitgenössische Historiographie hat jedoch einen quantitativen Aspekt, für den es entscheidend wichtig ist, vergangene Ereignisse präzise zu datieren. Darüber hinaus muss das kritische Werk moderner Historiker sämtliche Quellen berücksichtigen, ihre Zuverlässigkeit bewerten und die Relevanz der Information gewichten, die sie beisteuern. Aus dieser Praxis der Bewertung und der gewichteten Integration der Quellen schält sich schließlich die plausibelste Rekonstruktion heraus. Nun, diese quantitative Weise, Geschichte darzustellen, nimmt ihren Anfang mit Newtons Arbeit zur Chronologie der Bibel. Auch in diesem Fall ist Newton etwas tiefgreifend Modernem auf der Spur: eine Methode zu finden, um die Daten der antiken Geschichte anhand zahlreicher unvollständiger und unterschiedlich zuverlässiger Quellen rational zu rekonstruieren. Newton führte als Erster Konzepte und Methoden ein, die später wichtig werden sollten, doch er konnte keine zufriedenstellenden Ergebnisse vorlegen, und wieder veröffentlichte er also nichts zu dem Thema.
In beiden Fällen gibt es keinen Grund dafür, von unserer traditionellen Sicht des rationalen Newton abzuweichen. Ganz im Gegenteil kämpft der große Wissenschaftler mit realen wissenschaftlichen Problemen. Keine Spur von einem Newton, der gute Wissenschaft mit Magie oder ungeprüfter Tradition oder Autorität verwechselt. Das genaue Gegenteil trifft zu; er ist der vorausschauende moderne Wissenschaftler, der klarsichtig neue Felder wissenschaftlicher Forschung anpackt, seine Untersuchungen veröffentlicht, wenn er zu klaren und wichtigen Ergebnissen kommt, und sie nicht veröffentlicht, wenn er solche Resultate nicht vorlegen kann. Er war brillant, sogar außerordentlich brillant – aber wie jeder hatte er seine Grenzen.
Meiner Ansicht nach liegt das Genie Newtons genau darin, sich dieser Grenzen bewusst zu sein: nicht alles wissen zu können. Und das ist die Grundlage der Wissenschaft, die er zu erschaffen half.
Kopernikus und Bologna
Am 6. Januar 1497 schrieb sich ein junger Pole an der Universität von Bologna ein, zahlte für dieses Privileg neun Grossetti und unterschrieb mit «Dominus Nicolaus Kopperlingk de Thorn». Nach sechs Jahren Studium in Italien – in Bologna, Padua, Rom und Ferrara – kehrte Kopernikus (unter diesem Namen sollte er bekannt werden) nach Polen zurück und widmete den Rest seines Lebens dem Ziel, ein neues Modell des Universums zu schaffen. Er verfasste ein Buch, in dem er dieses neue Konzept erklärte – Über die Umlaufbahnen der Himmelssphären (De revolutionibus orbium coelestium) –, eines der wichtigsten Werke in der Geschichte der Menschheit. Dank seines Buches erkannte diese Spezies kleiner Geschöpfe, die auf einem unbedeutenden Planeten eines Sterns am Rande einer von Milliarden Galaxien im Kosmos lebten, zum ersten Mal und zu ihrem größten Erstaunen, dass sie nicht den Mittelpunkt des Universums bildet.
Welche Rolle spielten dabei die Jahre, die Kopernikus an italienischen Universitäten verbrachte, um ihn auf diese fundamentale Veränderung für unsere Zivilisation vorzubereiten?
Meiner Ansicht nach gibt es darauf eine doppelte Antwort. In Italien entdeckte Kopernikus zwei Schätze. Als Erstes die Bücher, die wie in einem Schatzkästchen das von der Menschheit angesammelte Wissen enthielten. Er fand Ptolemäus’ Almagestund Euklids Elemente, Werke, die das wichtigste astronomische und mathematische Wissen der Antike zusammenfassten. Er traf italienische Astronomen wie Domenico Maria Novara, mit dem er sich eng befreundete. Novara wusste, wie diese Texte zu verstehen waren, und führte ihn darin ein. Kopernikus lernte Griechisch und gewann damit Zugang zu antiken Texten, in denen er wahrscheinlich auf Aristarchs heliozentrisches Weltbild stieß, und zu arabischen Manuskripten, in denen er jene Versuche studieren konnte, das astronomische System des Ptolemäus nachzubessern, das eigentlich auf Jahrtausende ausgelegt war.
Dieses reiche kulturelle Vermächtnis war jedoch schon seit vielen Jahrhunderten verfügbar. Es stand indischen, persischen, arabischen und byzantinischen Astronomen zur Verfügung. Doch keiner von ihnen wusste dieses Vermächtnis so zu nutzen, um den entscheidenden Punkt zu verstehen: dass wir nicht im Mittelpunkt des Universums leben. Aber Kopernikus muss darüber hinaus noch Zugang zu etwas anderem, etwas Zusätzlichem, gehabt haben, das ihm diesen großen Sprung erlaubte. Was könnte das gewesen sein?
In die Zeit, die Kopernikus in Italien verbringt, fallen auch die Jahre, in denen der 23-jährige Michelangelo seine Pietà schafft, in der Leonardo da Vinci seine Flugmaschinen testet und sein Letztes Abendmahl malt. Die neue, lichtdurchflutete Leidenschaft des italienischen Humanismus, die in die Renaissance führen sollte, rüttelte auch die italienischen Universitäten und Höfe wie den von Lorenzo de’ Medici wach, wo Stimmen zu hören waren, die noch kurze Zeit zuvor undenkbar gewesen wären: «Wie wunderbar ist doch die Jugend, und wie flüchtig ist sie auch! Möge jeder, der nach Glück sucht, sich an ihr erfreuen, denn das Morgen bringt nichts als Ungewissheit …»
Das Studium antiker Texte und die Wiederentdeckung des Wissens der Vergangenheit – die Leidenschaft der Humanisten – wurden von dem brennenden Wunsch getrieben, eine neue Zukunft zu schaffen, die sich völlig von der gegenwärtigen unterschied.
Petrarca hatte das vorangegangene Jahrhundert so begonnen: «Die Werke der Vergangenheit sind wie Blumen, von denen Bienen Nektar sammeln, um Honig zu machen.»
Und um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert begann dieser Honig in Italien wirklich zu fließen. Der Zeitgeist erzeugte eine grundsätzliche Offenheit für radikal neue Ideen, wie sich an der Kunst der Zeit ablesen lässt. Es war nichts weniger als der Glaube an eine alternative Welt, die ganz anders aussah als das strukturierte und hierarchische Universum des Mittelalters. Geistige Freiheit, der Mut, eigene Ideen zu entwickeln und zu verfolgen, Auflehnung gegen das große, rigide Gebäude mittelalterlichen Denkens: Dieser Geist der Neuerung, diese tiefverwurzelte Revolte gegen das Gegebene ist die zweite große intellektuelle Quelle, aus der Kopernikus schöpfen sollte, als er seine neun Grossetti zahlte und sich an der Universität von Bologna einschrieb. Er findet in Italien nicht nur Euklid, Ptolemäus und Aristoteles, sondern er trifft auch auf den Gedanken, dass ihr großes Wissen revolutioniert werden kann.
Diese zweifache Erfahrung ist es meiner Meinung nach, die eine große Universität uns allen bieten kann.
Was mich betrifft, so entdeckte ich während meiner Zeit in Bologna außerordentliche Ideen und Texte, beispielsweise in den Werken von Albert Einstein oder in Paul Diracs Monografie The Principles of Quantum Mechanics, dem grundlegenden Lehrbuch zu diesem Thema. Ich stieß auf dieses Buch,