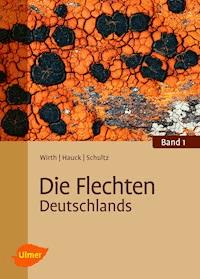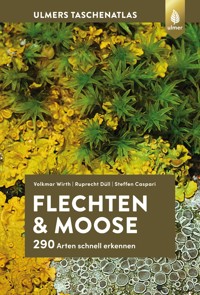
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Eugen Ulmer
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Viele Lebensräume werden sowohl von Flechten als auch Moosen bewohnt. Dieses Buch ermöglicht einen Einstieg in die Kenntnis beider Gruppen und berücksichtigt dabei häufige wie auch markante Arten. In brillanten Farbfotos und ausführlichen Texten werden etwa 160 Flechten- und 130 Moosarten samt ihrer Verwechslungsarten in aktualisierter Systematik vorgestellt. Zwei einfache Bestimmungsschlüssel erleichtern die Zuordnung zu den Artengruppen. Die Gliederung nach eindeutigen Kriterien wie Wuchsform und Substrat sowie Icons für den Schnellzugriff sichern die Bestimmung zusätzlich. Angaben zu interessanten Eigenschaften, Verwendungsweisen oder Namensherkunft runden das Bild ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Ähnliche
Volkmar Wirth, Ruprecht Düll, Steffen Caspari
Ulmers Taschenatlas Flechten und Moose
290 Arten schnell erkennen
320 Fotos
7 Zeichnungen
Inhalt
Flechten
Einführung
Vorkommen und Sammeln von Flechten
Untersuchen und Bestimmen der Flechten
Allgemeines
Bestimmungsmerkmale von Flechten
Hinweise zum Bildteil mit Bestimmungshilfe
Kurzschlüssel
Bildteil mit Beschreibungen
Moose
Einführung
Die systematische Gliederung der Moose
Bestimmungshilfe
Bildteil mit Beschreibungen
Begriffserklärungen
Literatur
Bildquellen
Vorwort
Viele, die Interesse an Blütenpflanzen haben oder in jener Gruppe bereits sehr gute Kenntnisse vorweisen können, haben den Wunsch, im wahrsten Sinne des Wortes tiefer in die „niedere“ Organismenwelt einzudringen und Gruppen kennenzulernen, die weniger auffallen, ja fast ein Dasein im Verborgenen fristen. Der vorliegende Taschenatlas soll die Schwellenangst vor dem Einstieg in die Gruppe der Moose und Flechten mindern, und zwar zunächst auf visuellem Weg, über die Ansprache durch das Foto. Da ein einzelnes Foto nie die ganzen Variationsmöglichkeiten einer Art erahnen lässt, wird mit Hilfe einer ausführlichen Beschreibung der betreffenden Art die Möglichkeit einer Überprüfung der Bestimmung gegeben. Dabei wird auf die Erwähnung von Verwechslungsmöglichkeiten besonderer Wert gelegt. Sofern möglich, wird bei den Arten auch auf biologische Besonderheiten oder interessante Phänomene hingewiesen. Ein sehr einfacher, kurzer Bestimmungsschlüssel soll helfen, eine Vorauswahl infrage kommender Arten zu treffen, damit nicht alle Bilder durchgeblättert werden müssen. Zwar wird man in zahlreichen Fällen eine Art schon mit bloßem Auge ansprechen können, doch ist in der Regel eine gute Lupe vorteilhaft, wenn nicht unerlässlich. Mit ihr erschließt sich eine neue, vielen verborgen gebliebene Welt.
Die Auswahl der Moose und Flechten ist für uns ein Kompromiss zwischen den Kriterien „die Art soll häufig sein“ und „die Art sollte gut kenntlich sein“. Es ist angesichts der begrenzten Zahl der behandelten Arten nur natürlich, wenn der Benutzer die eine oder andere vermisst. Deutsche Namen gibt es zwar für diese Organismen, aber es sind fast immer Namen, die nicht im Volksmund gewachsen oder seit längerer Zeit eingebürgert, sondern neu geschaffen bzw. aus den lateinischen Namen abgeleitet sind. Zur sicheren Verständigung sind letztere unentbehrlich.
Wir wünschen den Benutzern dieser 2. Auflage viel Freude beim Aufspüren der Arten und beim Erkennen und Benennen schon lange in der Natur bemerkter Organismen. Viel Erfolg bei der Bestimmung der Flechten und Moose!
Wir danken allen, die uns geholfen haben, insbesondere für Fotos oder für Hinweise auf fotogene Vorkommen, so dem Ehepaar Dr. Kurt und Helga Rasbach, Frau Dr. F. Lo-Kockel, den Herren W. Glöckner, Prof. Dr. H. M. Jahns, Prof. Dr. U. Kirschbaum, H. Payerl, Dr. M. Schultz, Dr. F. Schumm, Dr. G. Schwab, U. Schwarz und Dr. S. Woike. Dankbar sind wir auch Frau I. Düll für die freundliche Kooperation und dem Ulmer-Verlag für die angenehme Zusammenarbeit.
Stuttgart, im Sommer 2018
Vorwort zur 3. Auflage
Der anhaltende Erfolg des Werks machte eine Neuauflage nötig. Für die 3. Auflage wurde der Text geprüft und wo erforderlich durch neues Wissen zu Systematik und Nomenklatur ergänzt. Wir wünschen viel Freude mit dem Buch!
Stuttgart, im Sommer 2023
Einführung
Flechten begegnen uns auf Bäumen, Felsen, Mauern und auf mageren Böden. Es sind meist grau oder grünlichgrau, gelblich oder braun gefärbte Lebewesen, die recht unterschiedlich gestaltet sein können. Sie bilden krustenartige Überzüge, lappig gegliederte oder verzweigte, strauchige Gebilde. Mit den gleichnamigen Hautkrankheiten haben sie nichts gemein. Und sie sind auch keine Schmarotzer auf Bäumen, wie oft fälschlich angenommen.
Eine Flechte erscheint uns auf den ersten Blick als einheitlicher Organismus. Der Aufbau ist jedoch recht komplex. Das Grundprinzip ist eine Lebensgemeinschaft aus jeweils einer Pilz- und einer Algenart. Die Eigengestalt dieser Partner zeigt sich jedoch äußerlich nicht. Vielmehr bilden Pilz und Alge ein neues, einheitliches, aber komplexeres System, das Flechtenlager. Es ist nicht nur im Aussehen etwas anderes, sondern auch von den physiologischen und ökologischen Leistungen her. Die grüne Komponente (sog. Photobiont) sorgt über die Photosynthese für den Erwerb von Kohlenhydraten und gewährleistet auch die energetische Versorgung der Pilzkomponente, die den Großteil des Flechtenlagers aufbaut, in das die Algen eingeschlossen sind.
Warum gibt es überhaupt Flechten? Was ist der Selektionsvorteil dieser Organisation, dass sie sich so erfolgreich in den Ökosystemen der Erde etabliert hat? Mindestens 25 000 Arten dürften weltweit vorkommen. Die Erklärung liegt zu einem guten Teil in den ökologischen Fähigkeiten der Flechtensymbiose. Mit ihrer Hilfe sind die beteiligten Pilze und Algen oder Cyanobakterien in der Lage, Standorte zu besiedeln, die sie allein nicht erfolgreich besiedeln könnten – dies ist ein lange Zeit übersehener Aspekt und wesentliche Triebfeder der Flechtenevolution.
Zu den bemerkenswerten Leistungen der Flechtensymbiose gehört die Besiedlung von nacktem Fels. Auch das Überleben an überhängenden Felswänden oder tief in Borkenrissen, wohin nie oder nur ausnahmsweise Regenwasser gelangt, ist erstaunlich. Diese Arten haben die Fähigkeit, ihren Wasserhaushalt allein über den Wasserdampf in der Luft zu bestreiten, fast einzigartig in unserer heimischen Organismenwelt.
Von den Pilzen unterscheiden sich Flechten in der Regel durch die Existenz eines dauernd sichtbaren „Körpers“, des Lagers (Thallus), und durch die Langlebigkeit der Fruchtkörper. Moose weichen habituell meist durch ihre frische, grüne Färbung ab, anatomischmorphologisch unter anderem durch die Bildung von Sporenkapseln und echten Geweben aus Zellen.
Vorkommen und Sammeln von Flechten
Flechten werden gewöhnlich viele Jahre, Jahrzehnte, ja Jahrhunderte alt. Sie wachsen langsam und haben daher auf dem Erdboden überall dort, wo die konkurrenzkräftigen Blütenpflanzen eine Vegetationsdecke bilden, kaum eine Chance, sich zu behaupten. Lediglich Rentierflechten, Isländisch Moos und einige andere Strauch- und Laubflechten kommen in nahezu geschlossenen Magerrasen oder Zwergstrauchheiden auf. Ansonsten sind bodenbewohnende Flechten auf Vegetationslücken, offene Wegränder und Böschungen oder felsige Stellen beschränkt. Die meisten Arten wachsen nicht auf dem Boden, sondern auf Gestein und auf Baumrinde, etliche auch auf Holz oder über Moosen, also in ökologischen Nischen, die den vitaleren Blütenpflanzen in unserem Klima fast ganz verwehrt sind. Artenreich und üppig sind Flechten vor allem in den Gebirgen entwickelt. Optisch auffallende Flechtenrasen können aber auch in sandigen, nährstoffarmen Habitaten im Flachland vorkommen.
Viele Arten kann man schon im Gelände bestimmen. Dabei ist oft die Benutzung einer Lupe vorteilhaft (Vergrößerung 10 x). Sie ermöglicht es, wichtige Merkmale zu erkennen, aber auch, kleine Arten überhaupt erst aufzufinden. Oft ist es allerdings kaum zu umgehen, dass man Flechtenproben zur genaueren Untersuchung und Bestimmung mitnimmt. Zum Sammeln benötigt man bei Rinden-, Holz- und Erdflechten ein Messer zum Entfernen der „Proben“, bei Felsflechten Hammer und Meißel. Beim Abschneiden der Rindenstücke sollte man darauf achten, dass kein oder möglichst wenig lebendes (helles, saftführendes) Rindengewebe verletzt wird.
Die Flechtenproben steckt man in Papiertüten, die man mit den notwendigen Daten zu Lokalität und Standortverhältnissen versieht. Plastiktüten eignen sich nur zum kurzfristigen Transport, da die Proben in ihnen leicht schimmeln. Noch feuchtes Frischmaterial legt man vor der weiteren Aufbewahrung zum Trocknen aus oder „presst“ es leicht zwischen Zeitungen.
Möchte man sich eine kleine Vergleichssammlung schaffen, so legt man die Proben in aus Papier gefaltete „Kapseln“ oder Tüten, in die man am besten noch eine Unterlage aus Karton zur Stabilisierung einfügt. Krustenflechten klebt man mit ihrer Unterlage auf dem Karton fest, nicht jedoch Laub- und Strauchflechten, da sonst wichtige Merkmale der Unterseite der Flechte nicht mehr erkennbar wären. Eine besondere Präparation der Flechten ist nicht nötig. Zur Vermeidung von Schädlingsbefall sollten sie in trockenen Räumen aufbewahrt werden. Ein ordentlich beschriftetes Etikett (mit Fundort, Höhe über NN, Substrat, Datum und Sammlername) darf auf der Kapsel nicht fehlen.
Viele Flechtenarten sind selten und vom Aussterben bedroht. Daher sollte man immer nur wenig sammeln, eine spärlich vorhandene Art ganz schonen und lieber ein Foto machen. Manch eine im außeralpinen Raum seltene und gefährdete Art ist in den Alpen keine Rarität und kann dort gesammelt werden. Naturschutzgebiete müssen aber tabu sein.
Untersuchen und Bestimmen der Flechten
Allgemeines
Dieses Buch arbeitet in erster Linie mit dem Bild als Bestimmungseinstieg. Um die im Gelände gefundenen Flechten rasch zuordnen zu können, sind die Arten nach Wuchsformen und Vorkommen auf Gestein, Erdboden oder Rinde in Gruppen geordnet. Der sehr einfach gehaltene Übersichtsschlüssel geht auf diese Wuchsform- und Substratmerkmale ein und führt zu den entsprechenden Bildergruppen. Da besonders bei häufigen Laubflechten gelegentlich auch Substratwechsel (besonders von Rinde auf Gestein) vorkommen, sollte man bei diesen Arten – wenn man nicht zum Ziel kommt – vorsichtshalber auch bei anderen Substratgruppen nachschlagen. Icons zum Substrat ermöglichen eine rasche Orientierung. Der rein optische Vergleich von Bild mit Objekt in der Natur muss durch den Text überprüft werden, der alle wichtigen Erkennungsmerkmale behandelt. Dabei wird nur in seltenen Fällen auf mikroskopische Merkmale – und dann nur auf einfach ermittelbare – verwiesen. Stets wird auf Verwechslungsmöglichkeiten eingegangen.
Man muss sich über zwei Aspekte im Klaren sein: 1., dass nicht jede Art, die man im Gelände entdeckt, auch im Buch enthalten sein kann; bei der Auswahl wurde dafür gesorgt, dass häufige und zugleich auffallende sowie die meisten markanten selteneren Flechten aufgenommen wurden. – 2., dass ein Bild nur einen Ausschnitt der Variabilität einer Art zeigen kann.
Die meisten Laub- und Strauchflechten (siehe unten) lassen sich mit Hilfe einer Lupe, nicht wenige sogar ohne optische Hilfsmittel bestimmen. Wichtige Merkmale sind Form und Färbung des Lagers und der Fruchtkörper. Für die Bestimmung von Krustenflechten ist in der Regel ein Mikroskop notwendig, um die Sporenform und -größe oder den Bau des Fruchtkörpers analysieren zu können. Allerdings sind fast alle hier behandelten Krustenflechten auch ohne mikroskopische Untersuchung zu erkennen.
Eine wichtige Bestimmungshilfe bieten Farbreaktionen der Flechtenlager mit bestimmten Chemikalien (siehe unten).
Bestimmungsmerkmale von Flechten
Aussehen des Lagers und seiner Organe
Farbe
Flechten sind zum großen Teil weißgrau bis bläulichgrau, grünlichgrau, gelbgrünlich, seltener braun, gelb oder orange gefärbt. Obwohl die Färbung des Lagers ein wichtiges Merkmal ist, ist die Angabe der Lagerfarbe nicht unproblematisch, weil die Flechtenfarben oft schwer zu beschreiben sind. Erst die Praxis zeigt dem Benutzer eines Schlüssels allmählich, was unter manchen Farbangaben zu verstehen ist. Hier helfen Farbfotos über die Mängel unserer Sprache hinweg. So dokumentiert ein Bild der Caperatflechte oder einer typischen Bartflechte (Usnea), was unter blassgrünlich bis gelbgrünlich bei Flechten verstanden wird, während die bloße Farbangabe ohne Bilddokumentation immer wieder zu Missverständnissen führt.
Abb. 1 Isidien. a und b: Zylindrische Isidien auf dem gabelteiligen Lager von Pseudevernia furfuracea (3 × bzw. 50 ×). c: Schuppige, aufsteigende Isidien an Rissen des Lagers von Peltigera praetextata (12 ×). d: Knopfartige Isidien von Parmelina pastillifera (56 ×). e: Spatelförmige bis keulige Isidien (Melanohalea exasperatula). f: Zylindrische bis korallenartig verzweigte Isidien (M. elegantula). g: Zylindrische, einfache bis verzweigte Isidien (Melanelixia glabratula).
Wuchsformen
Nach der Wuchsform des Lagers werden drei Haupttypen unterschieden: krustiges Lager, blättriges Lager und strauchiges Lager. Der Vielfalt der Formen bei den Flechten kann man mit dieser groben Einteilung nicht gerecht werden. Für eine erste Ansprache ist sie jedoch sehr nützlich.
Als Krustenflechten bezeichnet man Arten, die mit ihrer ganzen Fläche krustenartig mit der Unterlage verwachsen und an diese angeschmiegt sind. Sie haben keine besonders vorgebildete Lagerunterseite. Sie können unverletzt nur zusammen mit dem Substrat abgenommen werden. Die Lager können eine zusammenhängende Fläche bilden, rissig gegliedert oder in ± getrennte Areolen (Felder) oder Schuppen unterteilt sein; sie können auch aus dicht gedrängten bis zerstreuten Körnchen bestehen oder mitunter völlig mehlig aufgelöst sein.
Laub- oder Blattflechten sind ± deutlich in Lappen gegliederte, im Wesentlichen flächig wachsende Flechten, die mit einiger Vorsicht in größeren Stücken oder ganz von der Unterlage abgelöst werden können. Unter Lappen versteht man dabei ± abgeflachte Lagerabschnitte jeglicher Form, bandförmig gestreckte bis breit gelappte. Sie besitzen eine deutlich erkennbare und vorgebildete Unterseite. Meistens sind sie an zahlreichen Stellen, oft mit besonderen Haftorganen, mit der Unterlage verbunden. Nabelflechten sind Laubflechten, die nur an einer einzigen, ± zentralen Stelle (sog. „Nabel“) festgewachsen sind.
Unter Strauchflechten fasst man alle Arten zusammen, die durch bevorzugtes Längenwachstum der Lagerabschnitte gekennzeichnet sind und mehr räumlich als flächig wachsen. Zu dieser Gruppe gehören die Bartflechten, die durch bartartig hängende bis buschig abstehende Lager mit fädigen, im Querschnitt rundlichen Strängen ausgezeichnet sind. Bei den ähnlich aussehenden Bandflechten sind die Lagerabschnitte verflacht, bandartig, so dass hier das Lager derber aussieht als bei den Bartflechten. Die Strauchflechten im engen Sinn wachsen mehr oder minder aufrecht und können sehr verschieden gestaltet sein, reich buschig verzweigt (wie die Rentierflechten) bis einfach stift-, horn- oder spießförmig oder trompetenartig. Etliche Strauchflechten haben außer diesem aufrecht wachsenden, vielgestaltigen Lager ein auf dem Substrat ausgebreitetes Lager aus kleinen Blättchen oder Schüppchen (Basallager).
Unter Gallertflechten versteht man Flechten mit einer gallertigen Konsistenz (trocken spröde, feucht weich, gequollen); die Arten sind meist schwärzlich, die Wuchsformen unterschiedlich.
Sorale, Soredien und Isidien
Zu den für die Bestimmung wichtigsten Bildungen des Flechtenlagers gehören die Sorale und die Isidien. Diese Organe dienen der vegetativen Fortpflanzung. Vorkommen und Form der Sorale und Isidien sind artspezifische Merkmale.
Die Isidien sind meist stift- oder keulenförmige bis korallenartig verzweigte oder auch fast kugelige Auswüchse der Oberseite (Abb. 1), die leicht abbrechen und zu jungen Flechten auswachsen können. Sie sind gewöhnlich ähnlich wie das Lager gefärbt und auch anatomisch nicht grundsätzlich anders gebaut als die Thalluspartie, aus der sie hervorgegangen sind.
Bei den Soralen handelt es sich um „mehlige“, meist weißliche bis grünlichgraue Aufbrüche des Lagers, die aus einer Ansammlung von winzigen, ± kugeligen Fortpflanzungskörperchen, den Soredien, bestehen. Die Soredien werden im Bereich der Algenschicht angelegt. Lage und Gestalt der Sorale sind von Art zu Art unterschiedlich. Sie können auf der Fläche, am Rand oder an den Enden der Lappen sitzen, einen langgestreckt-linealischen oder rundlichen Umriss haben und konkav bis stark gewölbt oder fast lippenförmig gestaltet sein. Eine Übersicht verschiedener Formen gibt Abb. 2.
Rhizinen, Borsten, Pseudocyphellen
Rhizinen oder Haftfasern finden sich auf der Unterseite von Laubflechten und dienen der Anheftung des Lagers an das Substrat. Die Haftfasern können einfach, verzweigt oder pinsel- oder flaschenputzerartig aufgefasert sein (Abb. 3). Bei einigen wenigen heimischen Arten von Laub- und Strauchflechten sind die Lappenränder oder Lappenenden mit charakteristischen borstenförmigen Fortsätzen (auch Zilien genannt) besetzt (Abb. 4). Bedeutende diagnostische Strukturen sind auch die Pseudocyphellen. Dies sind sehr zarte, punkt- oder linienartige, weißliche Durchbrechungen oder Lücken in der Rinde, vor allem von Laub- und Strauchflechten. Mitunter sind die Linien vernetzt und sitzen auf sehr schwach erhabenen Leisten (Abb. Seite 72 und 73).
Abb. 2 Sorale. a: Bortensorale. b: strichförmige Sorale. c: Lippensoral. d: Kugelsorale, e: Kopfsorale.
Abb. 3 Rhizinen. a: rechtwinklig („flaschenputzerartig“) auffasernde Rhizinen von Physconia distorta, b: einfache Rhizinen von Ph. grisea (aus SMITH et al. 2009).
Fruchtkörper
Die überwiegende Zahl der heimischen Laub- und Strauchflechten pflanzt sich vegetativ mit Hilfe von Soredien, Isidien oder Bruchstücken des Flechtenlagers fort. Diese Arten entwickeln gewöhnlich keine Fruchtkörper. Umgekehrt bilden regelmäßig fruchtende Arten in der Regel keine vegetativen Fortpflanzungsorgane aus. Bei den Cladonia-Arten (Becher-, Stiftflechten) sitzen die Fruchtkörper nicht auf dem kleinblättrigen Basallager, sondern auf vertikal wachsenden „Fruchtträgern“ (Stämmchen, Podetien).
Die Fruchtkörper der Flechte werden vom Pilzpartner gebildet. Da fast alle Flechtenpilze zu den Ascomycota (Schlauchpilzen) gehören, sind die Fruchtkörper sogenannte Ascocarpien. Man unterscheidet bei diesen Fruchtkörpern Perithecien und Apothecien.
Perithecien sind kugelig bis birnenförmig gestaltet. Ihr unterer Teil (manchmal auch der gesamte Fruchtkörper) ist ins Lager eingesenkt, der obere Teil ragt meist mäßig gewölbt bis halbkugelig über das Lager. Sie öffnen sich nur durch eine Pore (Abb. 7 sowie S. 136 und 159); das sporenerzeugende Gewebe (Hymenium) ist bei ihnen völlig von einer Wandung bzw. dem Flechtenlager umschlossen. Ein deutlich abgesetzter Rand ist bei den Perithecien nicht entwickelt. Bei fast allen heimischen Arten sind die Perithecien schwarz.
Abb. 4 Zilien (Borsten, Wimpern) an den Lappenrändern von Physcia tenella.
Bei den Apothecien liegt die Oberfläche des in der Regel scheibenförmigen Hymeniums frei zutage (Abb. 5). Apothecien sind gewöhnlich vom Lager scharf abgesetzte, im Umriss annähernd rundliche, scheiben- bis schüsselförmige oder halbkugelige Gebilde, die verschieden gefärbt sein können und oft deutlich berandet sind. Ist der Rand wie der übrige Teil, die sogenannte Scheibe, gefärbt, spricht man von Eigenrand; hat er die Farbe des Lagers und enthält er, entsprechend dem Aufbau des Lagers, Algen, handelt es sich um einen Lagerrand. Für die Bestimmung spielen folgende Fruchtkörpermerkmale eine Rolle:
Größe: Bezug genommen wird auf die Breite (Durchmesser), selten (bei „stecknadelförmigen“ Fruchtkörpern) auf die Höhe (ohne aus dem Rahmen fallende Werte).
Gestalt: Die Fruchtkörper sind in Aufsicht meist ± rundlich, selten oval bis langgestreckt oder verzweigt; sie können (erhaben) aufsitzen, partiell (±) oder völlig eingesenkt sein (auf gleicher Höhe wie die Lageroberfläche). Die Scheibe kann konkav, flach oder gewölbt, von einem Rand umgeben oder unberandet sein.
Berandung: Als Rand wird eine äußerlich sichtbare Berandung der Apothecienscheibe bezeichnet. Oft ändern sich Wölbung der Scheibe und Ausprägung des Randes mit zunehmendem Alter des Apotheciums: Jung ist die Scheibe flach, der Rand deutlich entwickelt, im Alter wölbt sich die Scheibe zusehends und der Rand schwindet mehr und mehr. Ein Lagerrand (siehe oben) ist gewöhnlich lagerfarben, ein Eigenrand ist gewöhnlich wie die Scheibe gefärbt.
Abb. 5 Apothecium mit Lagerrand (Lecanora intumescens) und mit Eigenrand (Porpidia flavocruenta).
Bau der Flechte (Anatomie)
Das Lager
In der Flechte umhüllt der Pilz mit einem Geflecht von fädigen Strukturen (Hyphen) in der Regel zahlreiche ein-, selten mehrzellige Algen/Cyanobakterien der Partnerart. Die Algen/Cyanobakterien sind gewöhnlich in einer Zone konzentriert (Algenschicht). Den übrigen Raum in der Flechte nimmt der Pilzpartner ein, der auch durch die Anordnung der Hyphen meistens die Gestalt der Flechte bestimmt (Abb. 6).
Nach außen hin bilden die Pilzhyphen oft eine dichte schützende, besonders strukturierte Rinde. Unter der Rinde liegt die Algenschicht, in der die Algen/Cyanobakterien von Pilzhyphen umsponnen sind. Unter der Algenschicht ist ein Mark (Medulla) aus locker verflochtenen Hyphen entwickelt. Bei Krustenflechten sitzt das Lager mit dem Mark dem Substrat auf. Bei Laubflechten ist meist auch auf der Unterseite eine Rinde ausgebildet; auf ihr sind oft noch besondere Haftorgane, z. B. Rhizinen, vorhanden.
Abb. 6 Halbschematischer Schnitt durch eine Laubflechte. Zuoberst Rinde aus dichtem Pilzhyphen-Geflecht, darunter Algenschicht, gefolgt von der mächtigen Markschicht aus locker verlaufenden Hyphen, zuunterst Unterrinde.
Die Fruchtkörper
Für die in diesem Buch abgefragten Bestimmungsmerkmale sind keine sorgfältigen anatomischen Untersuchungen notwendig. Bei Sporenmerkmalen beispielsweise genügen Quetschpräparate (siehe unten). Bei einigen schwierigen Gruppen allerdings sind zur Absicherung der Bestimmung dünne Fruchtkörperschnitte sehr hilfreich.
Die Anfertigung der Schnitte ist nicht schwierig. Sie wird sehr erleichtert, wenn ein Binokular bzw. eine Präparierlupe zur Verfügung stehen, unter denen man mit beiden Händen arbeiten kann. Zumindest bei größeren Fruchtkörpern lassen sich auch ohne Hilfe von Lupen Schnitte herstellen. Mit der einen Hand hält man die Flechte fest, mit der anderen Hand zieht man mit einer ungebrauchten Rasierklinge parallele (vertikale) Schnitte durch den Fruchtkörper. Am besten entfernt man zunächst einen randlichen Teil, etwa ein Viertel bis ein Drittel des Fruchtkörpers und schneidet danach möglichst dünne Scheibchen, wie von einem Brot, ab. Hilfreich kann es sein, wenn man das Objekt so mit dem Zeigefinger festhält, dass der Fingernagel fast senkrecht steht und als „Rückenstütze“ für die Rasierklinge dienen kann. Die Schnitte lassen sich mit der angefeuchteten Ecke der Rasierklinge oder mit der Spitze einer Präpariernadel vom Flechtenlager abnehmen. Sie werden dann in einen kleinen Wassertropfen auf dem Objektträger gebracht und mit einem Deckglas bedeckt. Wenn die Schnitte dünn, aber nicht dünn genug sind, kann man quetschen. Dazu legt man den Objektträger mit dem Deckglas nach unten auf eine Lage Fließpapier (auf glatter Unterlage) und presst.
Abb. 7 Schematischer Schnitt durch ein Perithecium (aus POELT 1967, Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten).
Bei manchen Flechten brechen die Fruchtkörper leicht ab und sind dann kaum noch zu manipulieren. In diesem Fall kann man den Fruchtkörper mit einer Präpariernadel auf eine Pappunterlage bringen, festkleben und dort schneiden.
Die Apothecien bestehen im Wesentlichen aus dem Hymenium und dem es ring- bis schüsselförmig umschließenden Excipulum. Die Oberfläche des Hymeniums ist äußerlich als Scheibe, das Excipulum oft als Rand erkennbar. Unter dem Hymenium befindet sich das Hypothecium (Abb. 8). Das Hymenium ist aus mehr oder weniger senkrecht angeordneten Hyphenfäden, den Paraphysen, aufgebaut und an diesem Aufbau im Fruchtkörperschnitt leicht zu erkennen; zwischen den Paraphysen sitzen die zylindrischen, keuligen oder bauchigen Asci (Schläuche), in denen die Sporen heranreifen.
Die Sporen werden gewöhnlich zu acht gebildet und sind ein- oder mehrzellig, farblos oder gefärbt. Färbung, Septierung, Form und Größe sind bedeutende Bestimmungsmerkmale, werden hier aber nur ausnahmsweise gebraucht (ist die Sporenfarbe nicht erwähnt, sind die Sporen farblos). Das Hymenium wird seitlich vom Excipulum begrenzt. Enthält das Excipulum Algen, handelt es sich in der Regel auch um einen äußerlich als solchen erkennbaren Lagerrand, wenn nicht, um einen Eigenrand.
Geht es bei der Bestimmung nur um Sporenmerkmale oder die Färbung des Epihymeniums, genügt oft ein wenig aufwendiges Grobverfahren. Man feuchtet die Fruchtkörper an, lässt sie aufquellen, löst sie (am besten nach Halbierung oder Drittelung) von der Flechte ab und zerquetscht sie in einem Wassertropfen auf dem Objektträger, am besten mit der Klinge eines Taschenmessers.
Bestimmung mit Hilfe von Farbreaktionen
Viele Flechten enthalten bestimmte sekundäre Stoffwechselprodukte, sogenannte Flechtenstoffe. Sie können von Fachleuten z. B. mit Hilfe von Dünnschichtchromatographie ermittelt werden. Einige dieser Stoffe sind farbig (Pigmente) und für die gelbe, gelbgrünliche, braune oder rote Färbung vieler Arten verantwortlich. Die meisten Flechtenstoffe sind farblos; mit wenigen Ausnahmen befinden sie sich im Mark der Flechtenlager.
Ein Teil dieser Stoffe reagiert mit Reagenzien, wie Kalilauge oder Natriumhypochlorit, zu farbigen Verbindungen. Da ähnlich aussehende Arten oft verschiedene Flechtenstoffe beinhalten, kann diese „Farbreaktion“ als wertvolle Zusatzinformation und Bestimmungshilfe genutzt werden.
In der Praxis wird ein möglichst kleiner Tropfen des Reagenzes auf die Flechte gegeben und die Reaktion geprüft, die sofort oder allmählich, gewöhnlich aber innerhalb einer Viertelminute, eintritt. Die Reaktion von Flechtenrinde (d. h. der Oberseite der Flechte) und Mark ist wegen der unterschiedlichen Inhaltsstoffe dieser Lagerteile oft verschieden. Ist die Reaktion des Markes gefragt, muss das Mark in genügend großer Fläche entblößt werden, wozu man am besten eine sehr scharfe Rasierklinge verwendet und einen fast oberflächenparallelen Schnitt ausführt. Man kann z. B. die Rasierklinge an den Schmalseiten zwischen Daumen und Zeigefinger „einklemmen“, sie durch leichten Druck der Finger in eine schwach konvexe Form bringen und in sehr kleinem Winkel zur Flechtenoberfläche anschneiden. Diese Manipulation und die Beobachtung der Reaktion sind am einfachsten unter dem Binokular durchzuführen. Bei Laubflechten führt man den Schnitt zur Prüfung der Markreaktion am besten von der Unterseite her aus, weil hier eine eventuell störende Reaktion der Oberrinde vermieden wird.
Abb. 8 Schematischer Schnitt durch ein Apothecium mit Eigenrand (links) und mit Lagerrand (rechts).
Man trägt das Reagenz z. B. mit einer kleinen Pipette, einem spitzen Glasstab oder mit der Spitze einer Präpariernadel auf. Verfügt man nicht über eine sehr kleine Pipette, sind die Tropfen oft zu groß, so dass das Reagenz auf der Flechte flächig auseinander läuft. Dies stört besonders, wenn auf unterschiedliche Reaktion von Rinde und Mark geprüft werden soll. Besser ist es dann, einen Tropfen aus der Pipette auf die Ecke einer Rasierklinge zu bringen, überflüssige Flüssigkeit abzustreifen und dann erst aufzutragen.
Zur Prüfung der Reaktion nimmt man ein Teilstück der Flechte, das später weggeworfen wird. Die Reagenzien ätzen oder sind gesundheitsschädlich, Kontakte mit der Haut sollten vermieden werden. Vor allem para-Phenylendiamin ist giftig und verursacht zudem nicht mehr entfernbare Flecken auf Kleidern, Papier, Möbeln. Ist es zu einem Kontakt der Reagenzien mit den Augen gekommen, muss man die Augenregion sofort in fließendem Wasser spülen.
Folgende Reagenzien werden benötigt: 1. Kalilauge (Abkürzung: K), 2. Natriumhypochlorit (C), 3. para-Phenylendiamin (P). Eventuell 4. Jod-Lösung (J). Die Reagenzien halten bei Unterbringung in braunen Fläschchen und unter Lichtabschluss länger. Man kann die Reagenzien gebrauchsfertig in kleinen Mengen kaufen z. B. über www.myko-shop.de. Im Folgenden erhalten Sie Hinweise zur Zusammensetzung/Herstellung und Anwendung.
Kalilauge:
2–4 g Kaliumhydroxid werden in 20 cm3 Wasser gelöst. Unbegrenzt haltbar. Fehlbeurteilung ist manchmal möglich, da K die Rinde durchscheinend macht und dadurch die darunterliegende Algenschicht eine (grünliche) Gelbfärbung vortäuscht (Abhilfe: K-Tropfen mit weißem Saugpapier aufnehmen und dann Farbbildung beobachten).
Natriumhypochlorit-Lösung:
Die handelsübliche Natriumhypochloritlösung zur Erzielung der C-Reaktion muss von Zeit zu Zeit, am besten alle drei Monate, erneuert werden. Gleiche Wirkung haben auch chlorhaltige Reinigungsmittel für den Haushalt (z. B. Klorix, auf Wirkstoff im Mittel achten!), die aber auch nur begrenzt haltbar sind. Die C-Reaktion ist oft sehr flüchtig, daher muss man sie sofort beobachten. Klarheit über die Funktionsfähigkeit von C schafft ein einfacher Test mit einer Testflechte (z. B. Hypocenomyce scalaris). Bei der mitunter erforderlichen KC-Reaktion wird erst K, dann auf die gleiche Stelle C gebracht. In der Regel wird dadurch eine C-Reaktion verstärkt und deutlicher.
para-Phenylendiamin-Lösung:
Das Reagenz ist giftig und hinterlässt Flecken auf Kleidung etc. (s. oben). In den Artbeschreibungen ist die Reaktion mit P angegeben. Vermeiden Sie aber die Prüfung mit P, wenn sie zur Bestimmung nicht unerlässlich ist. Das Reagenz wird wie folgt hergestellt: 1 g para-Phenylendiamin, 10 g Natriumsulfit und 1 ml eines Spülmittels in 100 ml Wasser (mehrere Monate haltbar).
Bei dunkel gefärbten Flechten (z. B. Bryoria) wird die Farbreaktion getestet, indem man auf einen Objektträger ein Stück weißes Saugpapier legt und darauf die Flechten platziert. Nun werden wenige Tropfen P daraufgetropft: Das Reagenz diffundiert in das weiße Papier, so dass seine Färbung besser zu erkennen ist als auf der dunklen Flechte.
Jod-Lösung:
0,05 g Jod, 0,15 Jodkalium, 25 g dest. Wasser.
UV-Licht; polarisiertes Licht:
Hinweise zum Bildteil mit Bestimmungshilfe
Die Arten sind im Bildteil nicht in willkürlicher Reihenfolge behandelt, sondern nach gestaltlichen Merkmalen (Wuchsformen) und dem hauptsächlich besiedelten Substrat geordnet. Durch den kurzen Bestimmungsschlüssel (s. u.) kann die Zahl der infrage kommenden Arten erheblich eingeengt werden; berücksichtigt ist hier jedoch nur das üblicherweise besiedelte Substrat. In den Artbeschreibungen ist die Substratwahl ausführlicher behandelt, doch auch hier werden seltene Ausnahmen nicht genannt, weil für Einsteiger wenig hilfreich. Insbesondere unter Bäumen finden sich normalerweise rindenbewohnende Arten auch auf Mauern, Fels etc. Zur schnellen Orientierung sind die üblicherweise besiedelten Substrate zusätzlich in Form von Icons dargestellt, und zwar in der Reihenfolge ihrer Bedeutung für die jeweilige Flechte/das jeweilige Moos. Es bedeuten:
auf Rinde von Bäumen und Sträuchern
auf Holz
auf Gestein (Naturstein)
auf Mauern, Dächern, Denkmälern usw.
auf Erdboden, erdverkrustetem Fels, Bodenmoosen
Die Bilder geben die Flechten in der Regel in trockenem Zustand wieder. Sind die Lager in feuchtem Zustand abgebildet, ist dies mit einem „f“ neben dem Abbildungsmaßstab gekennzeichnet.
Die chemischen Reaktionen beziehen sich, wenn nicht anders vermerkt, auf die Lageroberfläche. K: Kalilauge, C: Natriumhypochlorit, P: para-Phenylendiamin, J: Jod. R- bedeutet: alle Reaktionen negativ. Ist die Prüfung der Reaktion diagnostisch von geringer Bedeutung, ist dies mit R* gekennzeichnet.
Die Flechten-Arten werden mit ihren wissenschaftlichen Namen vorgestellt, zusätzlich mit den deutschen Namen. Diese sind fast durchweg Kunstnamen, die noch wenig benutzt werden. Zurzeit ist die Systematik der Flechten erheblichen Veränderungen unterworfen, weil molekulargenetische Untersuchungen zu neuen Erkenntnissen in der Verwandtschaftsforschung führen. Etablierte, seit langer Zeit verwendete Namen sind in jüngster Zeit abgelöst worden. Wir tragen der schwierigen Situation Rechnung, indem wir in diesen Fällen den lange Zeit gültigen Namen an erster Stelle (wie sonst in grüner Farbe) bringen, den neuen Namen darunter in grauer Schrift. Wir haben fallweise entschieden, was als „etablierter“ Name gelten kann. In jedem Falle sind alle „neuen“ Flechtennamen, die noch nicht in „Wirth et al., Die Flechten Deutschlands (2013)“ genannt sind, als zweiter Name berücksichtigt. Im Register finden sich weitere verbreitete Synonyme.
Es wird in der Regel auf andere Arten verwiesen, mit denen die behandelte Art verwechselt werden kann. Sind diese Arten an anderer Stelle ausführlich beschrieben, sind die Namen mit einem ↑ versehen.
Kurzschlüssel
Man entscheidet sich im Folgenden für eine von zwei Möglichkeiten, die jeweils mit der gleichen Ziffer gekennzeichnet sind; so gilt entweder die Alternative 1 oder 1*; entscheidet man sich z. B. für 1*, so fährt man im Schlüssel mit 13/13* fort und entscheidet sich erneut für eine der Möglichkeiten.
1 Flechten mit überwiegend flächig ausgebreitetem Lager, flächig dem Substrat anliegend oder randlich aufsteigend (Krusten- und Laubflechten) (2)
1* Flechtenlager in die Länge/Höhe wachsend, entweder an einer Stelle festsitzend oder aufrecht wachsend, meist deutlich vom Substrat abstehend, mitunter zusätzlich mit einem auf dem Substrat ausgebreiteten schuppigen bis kleinblättrigen Lager (Strauch-, Bartflechten) (13)
2 Flechte rein krustig, mit der Unterlage dicht verwachsen und an sie völlig angeschmiegt, ohne vorgebildete Unterseite, nur bruchstückhaft mit dem Messer lösbar (Krustenflechten) (3)
2* Flechte nicht rein krustig, in deutliche schmale bis breite Lappen gegliedert oder einblättrig, selten auch in Form von aufgebogenen Schüppchen, mit ausgebildeter Unterseite, in der Regel an einzelnen Stellen oder mit Haftfasern festgewachsen (10)
3 Auf Gestein oder Erdboden (4)
3* Auf Rinde (6)
4 Auf Erdboden und Moosen (Seite 120–125)
4* Auf Gestein (5)
5 Auf Silikatgestein (Seite 137–154)
5* Auf kalkhaltigem Gestein (Seite 126–137)
6 Ohne Fruchtkörper (Seite (169), 171–177)
6* Mit Fruchtkörpern (7)
7 Fruchtkörper kurz stecknadelartig gestielt (Seite 155–156)
7* Fruchtkörper ungestielt, also sitzend oder eingesenkt (8)
8 Fruchtkörper kurz strichförmig, gegabelt oder sternförmig verzweigt, auch unregelmäßig fleckförmig (Seite 157–158)
8* Fruchtkörper in Aufsicht rundlich, aber oft am Rand wellig verbogen oder durch gegenseitigen Druck eckig (9)
9 Fruchtkörper in unregelmäßige oder regelmäßig vorgewölbte Lagerwarzen eingesenkt, nur mit feiner punktartiger Mündung (Lupe!) versehen (Seite 159–161)
9* Fruchtkörper sind rundliche bis etwas verbogene oder durch gegenseitigen Druck etwas eckige Scheiben (Seite 162–172)
10 Auf Rinde (Seite 65–97)
10* Auf Erdboden oder Gestein (11)
11 Auf Erdboden (Seite 113–120 (–122))
11* Auf Gestein (12)
12 Nur an einer einzigen Stelle (mit einem „Nabel“) angeheftet (zusätzlich oft auch nicht haftende Rhizinen vorhanden) (Seite 98–104)
12* Nicht mit einer einzigen Anheftungsstelle (Seite 105–114 (–118))
13 Flechte aus zwei verschieden gestalteten Lagerteilen bestehend, aus auf dem Substrat wachsenden kleinen Blättchen/Schüppchen und aufrechten bzw. aufsteigenden stift-, spieß-, horn-, trompetenförmigen oder strauchig verzweigten Teilen (sog. Podetien) (Seite 54–64, 123–124)
13* Flechte nicht aus zwei verschieden gestalteten Lagerteilen, ohne basal auf dem Substrat ausgebreitete Schüppchen/Blättchen (14)
14 Flechte hängend oder buschig bzw. strauchig abstehend, aus fädigen oder bandartigen Abschnitten, an einer Stelle fest mit dem Substrat verbunden, nie mit kleinen Blättchen oder Schüppchen besetzt. An Bäumen und Felsen (Bart- und Bandflechten) (15)
14* Flechte mit aufrechten bis aufsteigenden, unverzweigten bis reich verzweigten, stielrunden bis verflachten Abschnitten, strauchig verzweigt oder spieß-/stiftförmig. Auf Erdboden, seltener bemoosten Felsen oder an der Basis von Bäumen (Strauchflechten im engen Sinn) (16)
15 Abschnitte ringsum annähernd gleich gefärbt und strukturiert, im Querschnitt rund, rundlich eckig oder flach bis rinnig (Seite 25–36)
15* Abschnitte lassen eine Ober- und eine abweichend gefärbte Unterseite erkennen, bandartig verflacht bis rinnig (Seite 37–38)
16 Aufrechte bzw. aufsteigende Teile nicht aus ± zylindrischen, sondern verflachten (aber mitunter eingerollten) Abschnitten, nicht geschlossen röhrig (Seite 39–40, 42–43)
16* Aufrechte bzw. aufsteigende Teile aus ± zylindrischen Abschnitten, im Querschnitt rund bis oval (17)
17 Abschnitte durchgehend deutlich röhrig-hohl (Seite 43, 47–55)
17* Abschnitte nicht deutlich röhrig (Seite 41, 44–46)
Bryoria fuscescens (Gyeln.)
Brodo & D. Hawksw.
Brauner Moosbart (0,4 × bzw. 4,5 ×)
Merkmale:Braune Bartflechte mit fädigem, locker verzweigtem Lager, meist mit Soralen, auf Rinde, selten Silikatgestein. – Lager hell- bis schwarzbraun, auch braungrau, lang bartartig bis kurz buschig, aus stielrunden, stellenweise auch leicht abgeflachten Fäden, hängend oder der Borke/dem Gestein locker anliegend, 5–15 cm lang, aber an ungünstigen Standorten oft nur bis 3 cm. Fäden (bis 0,5 mm Durchmesser) sind locker gabelig verzweigt. Sorale oft vorhanden, aber meist spärlich, bei jungen oder kümmerlich entwickelten Exemplaren fehlend, bis 0,7 mm groß und warzen- bis spaltenförmig. Apothecien sehr selten.
Reaktionen: K-, C-, P+ rot oder P-, Mark P-, Sorale P+ rot.
Verwechslung:Bryoria ist an ihrem fädigen (nicht bandartigen), braun bis grau gefärbten Lager zu erkennen. Alectoria- und Usnea-Arten sind zwar ebenfalls fädig, aber blass grünlich bis gelbgrünlich gefärbt. Innerhalb der Gattung Bryoria ist nur in Gebirgslagen eine Verwechslung wahrscheinlich. Der weißgraue, früher als eigenständige Art gewertete Morphotyp ↑capillaris, hat mit K+ gelb und C+ (flüchtig) rosa reagierende Lager. Weitere Arten sind selten und schwer zu bestimmen.
Ökologie und Verbreitung: V. a. im Bergland in Wäldern an Zweigen und Stämmen, selten im Offenland, auch an Holzpfählen, reichlich nur an nebelbzw. niederschlagsreichen Orten. Ziemlich selten, gefährdet. Von der borealen Nadelwaldzone bis ins Bergland Südeuropas.
Bryoria fuscescens morpho. capillaris (Ach.)
Brodo & D. Hawksw.
Haarfeiner Moosbart (ca. 1,5 ×), mit Evernia divaricata (gelblich)
Merkmale:Hellgraue bis hellbraune Bartflechte mit fädigem, verzweigtem Lager, Sorale vorhanden oder fehlend, auf Rinde. – Lager hellgrau bis hellbraun, selten dunkler braun, bartartig bis locker fädig, an einer Stelle angewachsen, aus stielrunden, stellenweise auch etwas abgeflachten Fäden, der Borke locker anliegend oder hängend, bis 15 cm lang. Fäden (bis 0,5 mm Durchmesser) locker gabelig verzweigt. Sorale meist spärlich, v. a. bei jungen Lagern oft fehlend, bis 0,7 mm groß, warzen- bis spaltenförmig. Apothecien sehr selten.
Reaktionen: K+ intensiv gelb, C+ rot (rasch vergänglich, daher auch scheinbar C-), KC+ rot, P+ intensiv gelb; Mark P+ intensiv gelb; Sorale P+ orangerot.
Verwechslung: Ähnlich ist die häufigere braune bis schwarzbraune Form (↑B. fuscescens), die mit K und C nicht reagiert. Andere Bryoria-Arten sind selten. Bryoria unterscheidet sich von anderen Gattungen durch ihr fädiges, grau bis braun gefärbtes Lager. Die Alectoria- und Usnea-Arten sind auch fädigbärtig, haben aber einen gelblichen bis gelbgrünlichen Farbton, so auch Alectoria sarmentosa, eine seltene Art feuchter Bergwälder, die sonst habituell Bryoria-Arten ähnelt.
Ökologie und Verbreitung: In kühlen, feuchten Berglagen, meist in Wäldern, an sehr luftfeuchten Stellen auch an Einzelbäumen; selten, stark gefährdet (Klimawandel, Waldbewirtschaftung). Von der Nadelwaldzone Nordeuropas bis Südeuropa.
Usnea dasopoga (Ach.) Nyl.
Gewöhnliche Bartflechte (ca. 3 ×)
Merkmale:Grau- bis gelbgrünliche, hängende Bartflechte mit zahlreichen abstehenden Kurzzweigen und Isidien oder isidiösen Soralen. – Lager grau- bis gelbgrünlich, hängend, deutlich länger als breit, bis 15 (30) cm lang, in klimatisch weniger günstigen Lagen aber deutlich kürzer, nur an einer Stelle festgewachsen, dicht über der kurzen geschwärzten Basis in 4–6 Hauptäste verzweigt, diese bis 1 mm dick, dicht mit rechtwinklig abgehenden, bis 1 cm langen, wesentlich dünneren Kurzzweigen besetzt, mit halbkugeligen bis seltener kurz zylindrischen Warzen (Papillen) und mit Isidiengruppen oder isidiösen kleinen Soralen. Apothecien selten, dünn scheibenförmig, grüngelblich. Wie bei allen Usnea-Arten reißt bei Dehnung der Fäden die Rinde ringförmig auf und entblößt einen zähen weißen Zentralstrang.
Reaktionen: Mark K+ rot, C-, P+ orange.
Verwechslung: Die Arten der Gattung sind schwer zu bestimmen, besonders kleine Exemplare. Gut ausgebildete Lager dieser Art sind am hängenden Wuchs, den dicht „fischgrätenartig“ mit Kurzzweigen besetzten Hauptästen in Kombination mit den Isidien oder isidiösen (nie mehligen oder ausgehöhlten) Soralen und der K-Reaktion des Markes (nicht des Zentralstrangs!) zu erkennen. Anderen ähnlich gefärbten Bartflechten-Gattungen (Alectoria, Ramalina, Evernia) fehlt der für Usnea charakteristische zähe Zentralstrang.
Ökologie und Verbreitung: In Wäldern niederschlagsreicher Lagen, an nebelreichen Orten auch an freistehenden Bäumen; durch Eutrophierung, forstwirtschaftliche Einflüsse und Klimaerwärmung stark zurückgegangen, gefährdet, nur noch in den süddeutschen Gebirgen und v. a. in den Alpen stellenweise häufiger. Von der borealen Zone bis in Gebirge des Mittelmeergebietes.
Heilkunde: Die typische grau- bis gelblichgrüne Färbung der „Usneen“ rührt vom Gehalt an Usninsäure her, die in die Lagerrinde eingelagert ist. Usninsäure wirkt antibiotisch und wird in der Heilkunde angewandt (früher auch gegen Tuberkulose).
Usnea subfloridana Stirt.
Buschige Bartflechte (1,2 ×)
Merkmale:Grau- bis gelblichgrüne, aufrecht oder abstehend wachsende, dicht buschige Bartflechte mit kleinen körnigen oder zu Isidiengruppen auswachsenden Soralen, ohne Apothecien. – Lager gelblich- bis graugrün, aufrecht bis abstehend buschig oder kurz hängend, höchstens etwas länger als breit, an einer Stelle festgewachsen, aus kurzer geschwärzter Basis reich sparrig verzweigt, bis 8 cm lang. Äste innen mit zähem, weißem Zentralstrang. Hauptäste bis 1 (1,3) mm dick, mit senkrecht abgehenden, bis 1 cm langen Kurzzweigen, v. a. basal dicht mit kurzen, gerundeten Wärzchen (Papillen) besetzt, v. a. gegen die Enden mit körnigen Soralen, die auch isidiös werden können. Apothecien sehr selten.
Reaktionen: Mark K+ gelb, C-, KC-, P+ orange, selten auch K-, C-, P-.
Verwechslung: An der breiten, buschigen Wuchsform, an den körnigen bis isidiösen Soralen, dem reichen Besatz mit Papillen und der K-Reaktion des Markes zu erkennen. Andere ähnlich wachsende Usnea-Arten sind durch mehlige, ausgehöhlte Sorale oder das weitgehende Fehlen von Kurzzweigen oder Papillen unterschieden. Eine sichere Bestimmung erfordert eine Vertiefung in die Materie. Die behandelte Art wird heute zu U. florida gestellt, die keine Sorale, aber Apothecien hat.
Ökologie und Verbreitung: In lichten Wäldern und an Baumgruppen, v. a. in der Krone von Laubbäumen (oft Eiche, Eberesche) an nebelreichen Stellen, ziemlich selten, zurückgehend (Eutrophierung, Klimaerwärmung), gefährdet. Vom mittleren Fennoskandien bis ins Mittelmeergebiet.
Heilkunde: Wie bei U. dasopoga.
Usnea hirta (L.) F. H. Wigg.
Struppige Bartflechte, Grubige Bartflechte (3,1 ×)
Merkmale:Kleine, abstehend buschige bis kurz hängende, grau- bis gelbgrünliche Bartflechte mit heller Basis. – Lager graugrünlich bis blass gelblich, reich verzweigt, abstehend buschig bis kurz hängend, an einer Stelle festgewachsen, bis 4 cm, selten größer, Basis nicht geschwärzt. Äste innen mit weißem, zähem Zentralstrang. Hauptäste bis 0,6 (1) mm dick, bisweilen deformiert-kantig oder etwas grubig, ohne Papillen, mit zahlreichen, oft dicht stehenden dornartigen Isidien, durch Abrieb auch sorediös wirkend; Äste über den Verzweigungen nicht selten angeschwollen. Apothecien sehr selten.
Reaktionen: Mark K-, P- oder K+ rot, P+ orange; C-.
Verwechslung: Unter den häufigeren Usnea-Arten durch die helle Basis unterschieden; charakteristisch auch die oft vorhandenen Grübchen bzw. Kanten an den Hauptästen. Mit Arten anderer Gattungen sind die Usneen nicht zu verwechseln, wenn man auf den weißen Zentralstrang achtet, der beim Dehnen der Äste sichtbar wird.
Ökologie und Verbreitung: Ziemlich selten an freistehenden Bäumen und in lichten Wäldern; am wenigsten auf niederschlagsreiche bzw. luftfeuchte Habitate angewiesene Usnea-Art, v. a. in etwas kontinentaleren Lagen; gegen Eutrophierung empfindlich, mäßig häufig. In Europa verbreitet.
Heilkunde:Usnea-Arten, aber auch andere Flechten mit Usninsäure, können bei häufigem Kontakt von Bruchstückchen, Soredien und Isidien dieser Arten mit der Haut eine Kontakt-Dermatitis auslösen, die v. a. bei kanadischen Holzfällern beobachtet wurde.
Evernia divaricata (L.) Ach.
Sparrige Evernie (1 ×), mit Bryoria fuscescens (braun) und Hypogymnia physodes
Merkmale:Lager blass grünlich bis gelblich, bartförmig mit strangförmigen, kantigen, zugespitzten Abschnitten. – Lager blass grünlich, graugrünlich, grüngelblich, lang bartförmig, basal an einer Stelle festgewachsen, aus kantigen, verzweigten, schlaff hängenden, 1–2 mm dicken Strängen mit querrissiger Rinde, in den Rissen das lockere Mark sichtbar, mit abstehenden kurzen zugespitzten Seitenästen. Apothecien ziemlich selten, mit brauner Scheibe.
Reaktionen: K-, C-, P-.
Verwechslung: Ähnlich aussehende Usnea-Arten haben in der Regel stielrunde Zweige und einen scharf begrenzten, sehr zähen Zentralstrang, der beim Dehnen der Zweige zwischen den Rissen sichtbar wird; bei E. divaricata kommt beim Dehnen das filzige, nicht scharf begrenzte Mark zum Vorschein; die Art hat anders als viele Usneen keine Sorale, Isidien oder Papillen. ↑Evernia prunastri hat deutlich abgeflachte Zweige mit heller Unterseite.
Ökologie und Verbreitung: Im boralen Nadelwaldgürtel Nordeuropas, in Mittel- und Hochgebirgen Mittel- und Südeuropas an kühlen, nebelreichen Orten in Wäldern, v. a. an Zweigen von Nadelbäumen, neuerdings auch in trockenen, niederen Lagen auf Schlehengebüsch auftretend, insgesamt jedoch zurückgehend und selten, außerhalb höherer Gebirge stark gefährdet.
Heilkunde: Enthält die antibiotisch wirksame Usninsäure.
Ramalina farinacea (L.) Ach.
Mehlige Astflechte (1,6 ×/1,6 ×)
Merkmale:Allseits grau- bis gelbgrünliche Strauchflechte mit schmal-bandförmigen Abschnitten und ovalen Soralen. – Lager gelblich- bis graugrün, glatt bis schwach längsgrubig, leicht fettig glänzend, strauchig, abstehend bis bärtig hängend, an einer Stelle festgewachsen, von der Basis an mäßig verzweigt, bis 8 cm lang. Ober- und Unterseite gleich gebaut und gefärbt. Lappen schmal (0,5–2 mm), linealisch, gabelig verzweigt, spitz zulaufend. Sorale meist an den Lappenkanten (selten flächenständig), weiß, elliptisch, deutlich begrenzt (0,5–1 mm).
Reaktionen: K± gelb, C-, P-. Mark und Sorale K- oder K+ orangerot, C-, P- oder P+ gelborange bis orangerot.
Verwechslung: Die viel seltenere ↑R. pollinaria hat meist gedrungenere, oft fast kugelige Lager mit relativ breiten Lappen, an denen sich flächenständige und an den Enden relativ große Sorale bilden, während die Sorale bei R. farinacea randständig sitzen. Die Lappen sind meist relativ weich. Reaktion immer P-. Die übrigen Ramalina-Arten (außer sehr seltenen Species) sind nicht sorediös und besitzen oft Apothecien. Durch die gleichartig gebaute Oberbzw. Unterseite unterscheiden sich die Ramalinen von Evernia prunastri, die oberseits ebenfalls grünlich, auf der oft etwas rinnigen Unterseite jedoch überwiegend weißlich gefärbt ist.
Ökologie und Verbreitung: An Zweigen und Stämmen von Laub- und Nadelbäumen, in Wäldern und an Einzelbäumen, mit weiter ökologischer Amplitude, mäßig häufig. In ganz Europa mit Ausnahme der Arktis.
Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.
Staubige Astflechte (3,1 ×)
Merkmale:Graugrüne bis gelblichgrüne Strauchflechte mit bandförmigen Abschnitten und flächen-, rand- und endständigen Soralen. – Lager weißlich-, grau- bis gelblichgrün, kurz strauchig, oft kaum länger als breit, oft mehr kugelig als länglich, an einer Stelle festgewachsen und in mehrere bis zahlreiche bandartig verflachte „Äste“ geteilt, unregelmäßig verzweigt, bis 3 cm, selten 5 cm. Lappen meist mittelbreit (ca. 1–3 mm), gegen die Enden zu oft verbreitert und zerschlitzt. Ober- und Unterseite gleich gefärbt. Sorale