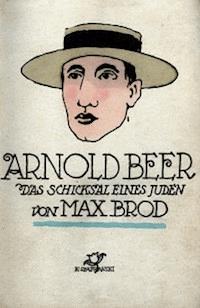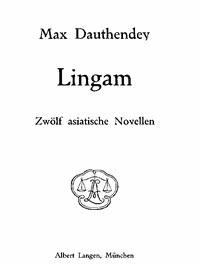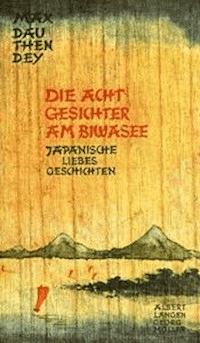0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Ähnliche
Gedankengut aus meinen Wanderjahren
Zweiter Band
Ein vollständiges Verzeichnis der SchriftenMax Dauthendeys findet man am Schlusse des Bandes
Max Dauthendey
Gedankengut aus meinen Wanderjahren
Zweiter Band
Albert Langen, München
Copyright 1913 by Albert Langen, Munich
Druck von Hesse & Becker in Leipzig Papier von Bohnenberger & Cie., Papierfabrik, Niefern bei Pforzheim Einbände von E. A. Enders, Großbuchbinderei, Leipzig
Im Januar 1894 reiste ich, von unbezwinglicher Sehnsucht getrieben, zum bohuslänschen Pfarrhaus zurück. Aber die starken Eindrücke des ersten Aufenthaltes, die in meinen Erinnerungen schlackenlos dastanden, hatten sich so vergeistigt, daß die Wirklichkeit jetzt nicht mehr die Höhe der vergangenen Eindrücke erreichen konnte.
Ich blieb deshalb nur bis zum Frühjahr dort und reiste dann, ehe der Schnee noch vollständig weggetaut war, im April nach England, wo ich mit einem amerikanischen Künstlerehepaar, — Freunden des jungen Schweden, mit denen er seit seiner Amerikareise im Briefverkehr stand — zusammentraf.
An diese neue Bekanntschaft knüpfen sich dann Reihen neuer, mein äußeres Leben und meine Gedanken bestimmende Erlebnisse und eine spätere Aufenthaltszeit in Paris und in Mexiko.
Bei jenem zweiten Aufenthalt im Pfarrhause, bis zum Frühjahr 1894, schrieb ich endlich jenes Drama ohne Menschen: „Sehnsucht,“ zu dem ich in München, am Achensee und im Hoftheater während der Byronschen Manfred-Aufführung angeregt worden war. Aber ich hatte den Stoff zu lange mit mir herumgetragen und hatte mich schon über den Ursprungsgedanken hinausentwickelt, und fand, daß ich die Gesänge der Sehnsucht, der Wüste, des Meeres und der Gletscher nicht so inhaltsschwer schreiben konnte, wie ich es gewünscht hätte.
Oder stand ich vielleicht nicht genug über der Sehnsucht und war ich selbst zu sehnsüchtig an Geist und Leib geworden? Denn der Wunsch, eine Frau zu finden, ein Mädchen, das liebend, häuslich und geistig kameradschaftlich um mich in einem kleinen stillen Haus walten sollte, dieser Wunsch wurde, je länger ich von der Heimat fort in der Fremde leben mußte, in mir immer dringender.
Aber die Erfüllung dieses Herzenswunsches lag ganz im Blinden. Denn ich konnte mich selbst nicht erhalten und wurde von meinem Vater nur notgedrungen unterstützt. Mit einem Hirn nur voll Pläne und mit Aussicht auf zukünftige Werke konnte ich kein Geld erwerben.
Und mein Vater, der von Monat zu Monat drohte, mir den Unterhalt zu entziehen, weil er mich dadurch auf seine Weise anspornen wollte, fleißig zu sein, er gab mir keine sichere Hilfe, so daß ich daraufhin hätte eine Frau an mich binden können. —
Schon bei meinem ersten Aufenthalt im Pfarrhause hatte ich im lautlosen Verkehr mit den Naturdingen eine Reihe Gedichte geschrieben, von denen jedes die Stimmung eines bestimmten Naturerlebnisses geben sollte.
Ein Gedicht hieß „Amselsang“, ein anderes „Faulbaumduft“, eines „Vollmond“, eines „Morgenduft“, eines „Wolkenschatten“, eines „Meerwassergeruch“, eines „Regenduft“. In diesen kleinen Gedichtversuchen hatte ich gewagt, Empfindungsbilder, die während des Mondaufganges oder beim Faulbaumduft, beim Regen, bei Wolkenschatten oder beim Amselsang in mir auftauchten, beinahe wahllos und getreu niederzuschreiben. Es waren gesteigerte, phantastische Bilder, die dem alltäglichen Leser sinnlos erscheinen mußten, die sich mir aber beim einsamen Erleben des Regens, des Mondaufganges und des Duftes von Pflanzen und vom Meer in der bohuslänschen Granitwüste aufgedrängt hatten. Und so verwirrt diese Gedichtversuche beim ersten Eindruck erscheinen mochten, es lag doch ein wahrheitsgetreuer Zusammenhang zwischen Bild und Empfindung darin.
Aus jugendlicher Begeisterung und von der Aufgabe durchdrungen, möglichst wirklichkeits- und empfindungsgemäß das Leben in der durchlebten Bilderkette wiederzugeben, entstanden scheinbar form- und sinnlose, abenteuerliche Gedichtversuche, die nichts anderes waren als erste Schiefertafelübungen meiner späteren Lyrik.
Diese Gedichte, die in dem Band „Ultraviolett, einsame Poesien“ erschienen sind, können nur als Entwicklungsversuche gelten und haben keinen Sinn für die breite Öffentlichkeit. Aber ohne diese Versuche wäre ich nicht zu meiner späteren Dichtungsweise gelangt, und wenn man mich noch einmal in dieselbe Welt setzen würde und in denselben Zeitgeist, in dem ich aufwuchs, ich würde nicht anders handeln können, als ich es getan habe.
Auf den Titel „Ultraviolett“ war ich durch einen Zufall gekommen. Bei einer Durchreise durch Berlin hörte ich, daß Paul Scherbart einen Verlag gründen wollte, genannt: Verlag der Phantasten. Und ich war aufgefordert, Beiträge zu schicken. Aber der Titel „Phantasten“ gefiel mir gar nicht. Er nahm der Phantasie die Würde und kam mir für die Dichter entwürdigend vor.
Ich machte eines Morgens Scherbart einen Besuch und fragte ihn, warum er denn das Wort Phantasten nötig habe. Wohl sei ich sehr dafür, daß die in den letzten Jahren durch den Naturalismus zu kurz gekommene Phantasie wieder zu Ehren kommen sollte, da die Phantasie der natürlichste Kern des dichterischen Geistes wäre. Aber das Wort Phantasten decke sich nicht mit dem ernsten Wert derer, die ihre Dichtungen phantasievoll und fern vom nüchternen Wirklichkeitsabschreiben gestalten wollen.
„Sagen Sie mir einen anderen Titel, wenn Ihnen einer einfällt,“ meinte Scherbart lebendig.
Nach kurzem Besinnen entfuhr mir das Wort „Ultraviolett“.
Scherbart sagte: „Das versteht nicht jeder.“ Und ich mußte ihm zustimmen, daß für einen Verlag der Name zu unverständlich sein konnte.
Aber als ich Scherbart verlassen hatte, hing ich auf der Straße dem Gedanken noch weiter nach. Denn Scherbart hatte mich gefragt: „Wie kommen Sie eigentlich auf das Wort ‚Ultraviolett‘?“
Dann hatte ich ihm erklärt, daß mein Vater, der sich auf Optik verstanden, durch seine Auseinandersetzungen über die ultravioletten Lichtstrahlen — die bewiesenermaßen im Weltraum leben, aber vom Menschenauge nicht erfaßt werden können — mir für dieses unsichtbare Licht eine große innere Ehrfurcht erweckt habe. Eine heilige Scheu habe sich immer bei der Vorstellung dieses Lichtes „Ultraviolett“ in mir geregt.
Außerhalb meines Augenkreises, sagte ich mir, war ein Licht entdeckt worden, das nur berechnet, aber nicht genossen werden konnte. Und es hatte mich bei der Vorstellung, daß jene ultravioletten Strahlen einsam im Weltraum leben müssen, ohne die Bewunderung des Menschenauges genießen zu dürfen, immer ein geheimnisvolles Wehgefühl durchschauert. Das ultraviolette Licht erschien mir als das Einsamste unter den einsamen Lebewesen.
Und da ich nun die Einsamkeit im Norden bewundern und schätzen gelernt und gefunden hatte, daß sie befruchtend auf meine Dichtung wirkte, sah ich die Phantasie des Dichters, die fern vom Weltgetriebe reifen und sich entwickeln muß, als den innigsten Gefährten jenes ultravioletten Lichtes an.
Ich weiß, daß dieses eine Jünglingsschwärmerei war, und daß ich im Grunde nicht das Alleinsein an sich meinte. Denn am liebsten hätte ich die Einsamkeit mit einem Weibe geteilt. Und in der Liebeseinsamkeit wäre ich nie auf den Gedanken verfallen, mich als Leidgenosse des einsamen Lichtes Ultraviolett zu fühlen.
Aber ich war damals stolz — wie jeder Asket stolz auf sein härenes Gewand, auf seine Geißel und auf seiner Geißel Wunde ist — stolz, der sehnsüchtige Gefährte des lebensfernen Ultravioletts zu sein.
Und so beschloß ich, da der Titel nicht für einen Verlag paßte, wie Scherbart gemeint hatte, denselben Titel „Ultraviolett“ meiner Sammlung Dichtungen zu geben, die ich teils in München nach Gemälden in der Sezession und teils nach Natureindrücken in Bohuslän niedergeschrieben hatte.
In meiner Weltabgeschiedenheit hatte ich auch gefunden, daß Gedichte sich besser einprägten, wenn jedes Gedicht auf ein einzelnes Buchblatt gedruckt war. So wie bei einem Gemälde auf der Rückseite der Leinwand nicht noch ein Gemälde Platz findet, so fand ich es übel, wenn nicht jedes Gedicht auf ein Blatt gedruckt war, ähnlich wie bei Handschriften, wobei man nur die eine Seite zu beschreiben pflegt. Und in diesem Sinne ließ ich mein Buch „Ultraviolett“ drucken.
Die Annahme, daß das Buch nur einigen Künstlern Anregung geben würde, bestimmte mich, dasselbe nur in hundert Exemplaren drucken zu lassen. Damit ich aber mit den fünfzig Exemplaren, die ich verkaufen ließ, da ich die übrigen fünfzig verschenkte, auf die Druckkosten kommen konnte, ließ ich den Preis für jedes Buch auf fünfundzwanzig Mark ansetzen. — Heute wird das Buch von den Antiquariaten für achtzig Mark verkauft, wie ich aus verschiedenen Katalogen in den letzten Jahren ersah.
Daß sich in der Welt der Kritik kein kleines Geschrei erhob, als dieses absonderliche Buch das Schaufensterlicht der Buchhandlungen erblickte, wird sich jeder denken können, der ein wenig das literarische Tagesleben kennt. Ich aber war damals ahnungslos wie Johannes der Täufer in der Wüste. Ich wußte nicht, daß ich eine vierfache Sünde in den Augen der Kritik begangen hatte.
Erstens: in einer Wirklichkeitszeit, in der „Wiedergabe des Alltagslebens“ das Losungswort der schreibenden Welt war, hatte ich phantastische Poesie erzeugt. Man sagte, ich wolle mit diesem Buch die Kritik an der Nase führen und säße heimlich daneben und verlachte alle und alles.
Zweite Sünde war: die Ausstattung des Buches, die nie dagewesene Ausstattung des nur halb bedruckten Buches. Und auch diese Sünde war, wie die erste, doch nur eine Einfaltssünde von mir.
Die dritte Sünde war der ungeheuerliche Titel „Ultraviolett“, wobei alle Kritiker den Nachdruck auf „Ultra“ legten. Während ich aber doch nie den lateinischen Ursprung des Wortes bedacht hatte, sondern nur immer von der Wehmut des Gedankens und des Gefühls beherrscht war, daß jenes wirkliche und unwirkliche Licht dort an der äußersten Grenze der Weltallvorstellung aufs Einsamste lebte.
Meine vierte und auch nicht kleine Sünde war, daß ich bei allen drei Überspanntheiten auch noch als vierte einen überspannt hohen Preis angesetzt hatte, der mir aber gar nicht zu hochgegriffen schien im Verhältnis zu meinen Druckunkosten. Warum sollte ich nicht für das Buch fünfundzwanzig Mark verlangen dürfen — alle fünfzig Exemplare wurden verkauft —, da ich doch gar keinen Gewinn für mich beanspruchte, sondern nur auf die Höhe der Druckkostensumme kommen wollte.
Ich merkte lange nicht, in welchem Grad ich mir durch dieses Buch meine Zukunft verbittert hatte. Zwar die Künstler, die Maler, liebten das Buch. Die Dichter blätterten darin verblüfft herum, fühlten den jugendlichen Drang des Dichtenden und waren gerührt von der Askese und der ehrlichen Weltfremdheit, die aus den Zeilen sprachen. Aber die Kritiker sahen mich für einen frechen Eindringling an, für einen wahnwitzigen Narren.
Zwanzig Jahre hindurch konnte ich in fast jeder Kritik, die über meine Art zu dichten geschrieben wurde, das Wort „Ultraviolett“ wiederfinden. Wie die Brandmarke, die man einem Galeerensträfling ins Fleisch brennt, rief man mir fortgesetzt das Abc-Buch meiner Lyrik in Erinnerung. Auch als ich schon längst über die Anfänge des ersten Könnens hinaus war, wollte man nur immer von meinen ersten Gehversuchen sprechen.
Wäre ich nicht in einer Zeit der allgemeinen Mauserung der Weltanschauung geboren, sondern wie die Dichter der früheren Jahrhunderte in einer Epoche feststehender Ideale, dann wären diese neuen Gehversuche nicht nötig gewesen. Aber gerade in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts begann sich allgemein die europäische Menschheit von einer beinahe zweitausend Jahre alten Idealwelt loszulösen.
Wie den Griechen und Römern der Olymp eingestürzt war vor zweitausend Jahren, so stürzte uns der alttestamentarische Himmel ein nach beinah zweitausendjährigem Glauben. Und wer es ehrlich mit seiner Zeit meinte, mußte dem Erlöschen alter Ideale Rechnung tragen und, im Dunkel stehend, Gehversuche machen, Tastversuche, um zu fühlen, zu suchen, von wo ein neues Licht der Zukunft für Leben und Kunst leuchten würde.
Solche Tastversuche waren für mich mein Buch „Ultraviolett“. Ich nehme dieses Buch nicht anders in Schutz. Es ist nur ein Dichtungsversuch, der mir in einer unklaren Zeit genützt hat, der aber nie für die breite Öffentlichkeit bestimmt war. —
Ich verweilte deshalb ausführlich beim Ursprung dieses Buches, nicht um mich zu entschuldigen, sondern um mich und unsere Zeitforderungen zu erklären. —
Mein zweimaliger Aufenthalt im Norden, im bohuslänschen weltfernen Pfarrhause, hatte zur Folge, daß ich einsames und ursprünglichstes Naturleben kennen gelernt hatte und dabei zugleich aus engen Kulturverhältnissen alter deutscher Vergangenheiten losgekommen war, so daß ich jetzt nicht mehr leicht ausgetretene Wege einschlagen konnte. Dieser zweimalige Aufenthalt in Schweden gab mir einen größeren Weltblick. Ein jahrelanges Auslandsleben folgte, wobei ich Kunsteindrücke und vielseitiges Menschenleben aufnahm und Zeit und Vermögen blindlings verschwendete, nie nach Nutzen und Einkünften, sondern nur nach Lebensbereicherung fragend.
Daß ich mir damals das Erleben noch durch die stete Frage störte: wird dieser Tag ein Gedicht bringen? Und daß ich mich bei jedem Weg fragte, ob ich auf ihm eine Dichtung erleben würde. Dieses gehetzte Fragen kam nicht aus meinem Innern. Es war teils von der äußeren jugendlichen Ungeduld, mich betätigen zu wollen, eingegeben, teils kam es aus dem Ansporn, den mein Vater brieflich auf mich ausübte, indem er von Vierteljahr zu Vierteljahr drängte, Neues von mir hören zu wollen. Immer sollte ich ihn auf dem Laufenden halten mit Plänen und Hoffnungen für neue Bücher. Er glaubte wahrscheinlich, Faulheit könne mich hinter seinem Rücken auffressen.
Man wollte zu Hause nicht dem harmonischen und angeborenen natürlichen Entwicklungsfleiß, der jedem jungen Mann, der sich ernstlich ein Ziel gesetzt hat, innewohnt, vertrauen und glauben. Und man spornte den von selbst Fortschreitenden so an, als wenn er ein Eingeschlafener wäre.
O wieviel Sorge kann solche Übersorge anderer uns bereiten! Vertrauen ist das Gefühl, auf das die Jugend ein unbedingtes Recht hat.
Unter diesen Umständen war ich gezwungen worden zu fragen: Wird eine Dichtung aus dieser Reise entstehen? Werde ich diese Reise literarisch verwerten können? — Aber erst nach der Reise um die Erde, in meinem vierzigsten Lebensjahr, fühlte ich mich reif, Geschehenes und Gehörtes in Prosa und Dichtungen ununterbrochen wiedergeben zu können. Dann erst war es mir wieder zur zweiten Natur geworden, unbewußt erleben zu können, ohne dabei an literarisches oder dichterisches Verwerten denken zu müssen.
Bei meinem Sommeraufenthalt in Dänemark am Isefjord 1893 hatte ich den Entwurf zu einer neuen Dichtung gemacht.
Dieser gab ich den Titel „Die schwarze Sonne“. In dieser Dichtung wollte ich im Gegensatz zur freudigen Sonne, die Sonne des Leides darstellen. So wie die Nacht dem Tag folgt, sagte ich mir, so wandert auch durch den Tag der Freuden der schwarze Strahl einer schwarzen Sonne, und die von ihm Gezeichneten ließ ich zu einer Leidensschar sich zusammenschließen. Es sollte dieser Zug von Leidenden ein Gegenstück zum Bacchuszug sein, den ich auf dem großen Gemälde von Rubens in der alten Pinakothek in München gesehen hatte.
Der Zug durchwandert die Heide. Nackte Männer, nackte Frauen, nackte Jungfrauen und Knaben, verwundet vom Leid, zusammengeschart im Leid und doch sich ihr Leid nicht eingestehen wollend, aber jeder gezeichnet vom Todeskeim, wandern und lagern abends im Wald. Die Stärksten unter ihnen, die reifen Männer und Frauen pflücken schwarze Giftbeeren, und Männer und Frauen sterben in einer letzten Umarmung.
Die Mädchen, Knaben und Greise aber steigen morgens vom Wald an den Felsenabhängen hinunter zum Meer und binden angeschwemmte Stämme zu einem Floß zusammen. Sie besteigen das Floß. Sie haben sich mit Waldkränzen geschmückt. Das Meersalz hängt sich an ihre Lippen, während sie singen. Und als die weiße Sonne des Tages im Mittag steht, schickt die schwarze Sonne des Leides aus der Tiefe des Meeres eine große finstere Welle herauf, die das Floß mit den bekränzten Singenden verschlingt. —
Der Einfall zu dieser Dichtung kam mir am Isefjord. Ich ging dort einmal bei einem Feldspaziergang in trauriger Stimmung, gequält von Einsamkeit und bedrängt von der Sorge um das tägliche Leben, an einem Moor vorüber. Vom Anblick der nachtschwarzen Moorerde und des unheimlichen Moorwassers angezogen, und angelockt von Todeslustgedanken, setzte ich mich am Rande des Moores nieder und fühlte, wie die Düsterkeit, die mich bei fröhlicher Stimmung vielleicht erschreckt hätte, mir jetzt in meiner Traurigkeit wohl tat.
Ich hatte bisher noch nie erlebt, daß mich Düsteres angelockt hätte, und daß ich mich bei Düsterem wohlgefühlt hatte, denn ich war immer lebenswarm und lebensfröhlich gewesen. Nun aber sagte ich mir, als ich am Moor saß und eine Wohltat von der Düsterheit der Landschaft empfing: es muß zwei Sonnen geben. Eine Freudengesinnte, die dem Freudiggestimmten gefällt, und eine Leidgesinnte, die dem Leidtragenden wohltut. Und es war mir, als sah mich aus der Tiefe des Moores die schwarze Sonne des Leides an und begrüßte in mir die Düsterheit meines Kummers.
Die Dichtung „Die schwarze Sonne“, die ich dann zu schreiben begann, dichtete ich zum erstenmal in Binnenreimen, wobei ich, um das Echo des Wanderns auszudrücken, die Reimworte mitten in die Zeilen stellte, um so die im Takt schreitenden Schritte der Wandernden ertönen zu lassen.
In Kopenhagen schrieb ich den ersten Gesang dieser Dichtung, in London den zweiten Gesang und später in Stockholm den Schluß. Das ganze Gedicht entstand im Laufe von ungefähr zwei Jahren. Ich hatte immer große Arbeitspausen zwischen den verschiedenen Gesängen eintreten lassen müssen, da ich nur dann an dieser Dichtung weiterschreiben konnte, wenn mich ein tiefes Leid grämte.
Auch dieses Epos, obwohl ich es später — noch vor zwei Jahren — in einer neuen Auflage erscheinen ließ, zähle ich unter die Entwicklungsschriften meiner Dichterlehrjahre, von welchen ich hier in diesem Buche nebenbei berichten will.
Diese Jugendbücher waren ekstatische Ausbrüche einer jungen Phantasie. Ich hatte noch nicht die Geliebte gefunden, die der geistigen Freudigkeit als Gegengewicht irdische Freudigkeit des Lebens gibt. Erst später, im Liebeserleben, wurde mein Dichten warmblütig, während meine Dichtungen vorher, Nordlichtstrahlen ähnlich, aus meinem Kopfe schossen und mehr Spukwerk als Kunstwerk waren.
Ich hatte in meiner Jugend immer einen heiteren und lebensfröhlichen Sinn, und wenn ich morgens aufwachte, war ich nie grämlich und ängstlich, immer von Hoffnungen und Lebenswärme bewegt. Alles Erlebte war für mich immer festlich gewesen trotz des unerbittlichen Ernstes, der in meinem Vaterhause geherrscht hatte. Denn mein Vater war, als ich zwanzig Jahre alt wurde, bald ein Greis von siebzig Jahren. Ich fühlte mich oft ein wenig zu weise erzogen und kam mir damals etwas greisenhaft und im Blute unbeholfen vor, besonders da ich nicht wie andere junge Leute meines Alters Liebesgetändel und flüchtige Liebesverhältnisse pflegen konnte. Ich war immer von einer steten Bangigkeit erfüllt, die große Leidenschaft versäumen und verfehlen zu können.
Meinen Vater und meine Mutter sah ich als Vorbild aufopferndster Liebe an. Ich wäre nur dann imstande gewesen, einem Mädchen von Liebe zu sprechen, wenn ich es zu meiner Frau machen wollte.
Aber die Bedrückung, in meinen damaligen Verhältnissen keine Frau ernähren zu können, und der Gedanke, daß ich vielleicht jeden Tag der Frau begegnen könnte, zu der ich hätte sagen mögen: „Wir wollen uns lieben,“ und für die ich dann wohl Liebe, aber keine Mittel zum Zusammenleben bereit haben würde — diese Erwägungen verfolgten mich unausgesetzt und machten mich zurückhaltend der Welt gegenüber, der ich jeden Tag von neuem, seit ich mein Vaterhaus verlassen hatte, die Hoffnung auf Lebensmöglichkeit abringen mußte.
Mein Vater drohte von Brief zu Brief, mir meinen monatlichen Unterhalt zu entziehen, deshalb waren meine Sorgen nicht unbegründet. Und jeden Tag genoß ich nur wie ein Mensch, der schnelle Blicke auf eine Landschaft wirft, indessen immer unterirdisches Erdbeben grollt, das ihn jeden Augenblick aufscheucht und ihm von seinem, in den nächsten Sekunden möglichen, Untergang redet.
Da ich auch nicht die Leichtigkeit in mir fand, im Plauderstil für Tageszeitungen schreiben zu können, um mir dadurch Geldmittel zu verschaffen, — weil ich mich in einer geistigen Umwälzung befand und bewußt und unbewußt einer neuen Dichtungsart zustrebte und unzersplittert, aufmerksam für den neuen Dichtungsgeist leben mußte, — so war ich oft recht unglücklich in allen Reisetagen, und trotz aller neuen Eindrücke, immer unglücklich umgeben von der mich hilflosmachenden Tagessorge.
Es sollte mir natürlich in Kleidung, Auftreten und Haltung niemand meine oft recht verzweifelte Lage anmerken. Und so trug mein Gesicht meist ein Lächeln, das nur zur Hälfte Lebensfreudigkeit war, zur anderen Hälfte aber eine Anstandsmaske über meine Sorgen legen sollte.
Ich hatte im Winter 1893, ehe ich zum erstenmal nach Bohuslän kam, eine kleine philosophische Betrachtung geschrieben, die ich „die Kunst des Intimen“ betitelt hatte. In Bohuslän fügte ich dieser Schrift einen zweiten Teil an, „die Kunst des Erhabenen“. In der „Kunst des Intimen“ sprach ich von Jakobsens Schreibweise, von Ola Hanson und von Ähnlichen, auch vom Maler Munch. Wogegen ich in der „Kunst des Erhabenen“ den vorgenannten Künstlern den Dichter Homer, Dante und ähnliche gegenüberstellte. Ebenso verglich ich in der Malerei Michel Angelo und die großen Italiener mit den alten Holländern und den Sezessionisten der Neuzeit. Und verglich in der Musik Beethoven und Wagner mit Mozart und Grieg. Mit diesem Überblick über das Kunstleben aller Zeiten wollte ich zeigen, wie die Anforderungen im Künstlertum immer auf Erhabenes und Intimes zugleich gerichtet waren.
Von dieser Handschrift, die, ich glaube, nur fünfzig Druckseiten aufwies, hoffte ich, daß sie mir nebenbei auch eine kleine Einnahme bringen möchte. Ein kopenhagener Rechtsanwalt, den ich kennen gelernt hatte, und dem die Arbeit gefiel, legte die Druckkosten für das Buch aus. Der junge Schwede hatte die Handschrift ins Schwedische übersetzt, und so erschienen diese Gedanken eines Deutschen in schwedischer Sprache bei einem dänischen Buchhändler in Kopenhagen gedruckt. Die deutsche Handschrift habe ich später auf den Reisen verloren, und die kleine Arbeit ist niemals anders als in schwedischer Sprache erschienen. Ich erzähle dieses, um an manche Hoffnungen und Pläne zu erinnern, die man sich als junger Schriftsteller macht, und die absterben wie Schößlinge eines Baumes, die neben den Hauptästen entstehen und verdorren müssen.
Während ich in Berlin im Winter 1893 jene Abhandlung über „intime Kunst“ niederschrieb, war mir auch der Gedanke gekommen, daß man intime Schauspielbühnen einrichten müßte, Bühnen in Zimmern oder Sälen, die nicht durch einen viereckigen Ausschnitt das Bühnenbild vom Zuschauer getrennt zeigen, sondern den Zuschauern, — welche zwanglos in Gruppen im Saal verteilt sein müßten —, den Eindruck geben sollten, als erlebten sie nicht bloß ein Schaustück, sondern ein intimes Ereignis, an dem sie selbst teilnahmen. Durch das Nichtgetrenntsein vom Bühnenbild sollten sich die Zuschauer enger mit den Erlebnissen verkettet fühlen.
Auch hatte ich geglaubt, da die Schauspieler damals das Pathos noch nicht ganz abgelegt hatten, es müßten die Schriftsteller zuerst noch selbst in einigen Schauspielen auftreten und die neue Spielart den Schauspielern zeigen. Denn die intime Wirklichkeitskunst bahnte sich zuerst in den Köpfen der Schriftsteller den Weg, und nur durch sie, meinte ich, könnte dem Schauspieler das damals noch fast unbekannte Wirklichkeitsspielen beigebracht werden.
Ich hatte ein Jahr vorher im Winter 1891, als ich noch zu Hause in Würzburg war, ein damals noch ziemlich unbekanntes Maeterlinksches intimes Drama, „Der Eindringling“ (l’Intruse) aus dem Buch „Die Blinden“ übersetzt. Von Maeterlink erhielt ich dann das Einführungsrecht dieses Stückes für Deutschland.
Ich machte dann Ende Winter 1892 mit Frau Marholm einige Besuche bei verschiedenen Schriftstellern in Berlin und forderte sie auf, ein „Intimes Theater“ zu gründen. Ich fand offene Ohren. Es schien, als sollten einige Aufführungen zustande kommen, denn die Lust nach einer intimen Bühne lag allgemein in der Luft.
Da es aber schon Frühjahr wurde, verschob man die Angelegenheit auf den nächsten Winter. Doch war keine rechte Sicherheit zu erlangen, und meine Reise nach Schweden und mein langjähriger Aufenthalt im Ausland, brachen dann die verschiedenen Unterhandlungen ab.
Etwas mutlos hatte mich der Ausspruch des damaligen Vorstandes der „Freien Bühne“ gemacht, dem ich Maeterlinks Drama „der Eindringling“ in meiner Übersetzung eingereicht hatte. Er meinte, daß es jetzt keine Zeit wäre für eine intime Kunst im Maeterlinkschen Sinne, die zu zart und phantasieblau sei. Besonders, da eben Gerhart Hauptmann das deutsche Publikum zu starker Nüchternheitskunst bekehren wolle, würde Maeterlink keine Aufmerksamkeit wecken.
Und ich sah auch ein, daß Berlin wirklich im Augenblick nicht der Boden für intime Phantasie und seelische Zartheit war, wie Maeterlink sie bot. —
In Kopenhagen hatte ich außer der kleinen Handschrift „Die Kunst des Intimen“ und „Die Kunst des Erhabenen“ auf eine Aufforderung der Zeitung „Politiken“ eine kleine Skizze geschrieben. Wie ich schon vorher erzählte, war ich damals noch nicht ganz frei von dem Wahn, Phantasien schreiben zu müssen, in welchen ich — als Gegensatz zu den alten abgebrauchten Menschenverkörperungen in der Natur, wie Elfen, Faune, Ungeheuer, Gnomen usw. — die Natur ohne menschliche Figurenwelt, einzig als Bild und Erlebnis für sich, geben wollte.
So hatte ich in jener Zeitungsskizze farbig beschrieben, was das Licht der Sommersonnenstrahlen erlebt, wenn es sich durch die Ritzen geschlossener Fensterläden von den Kornfeldern in einen alten Gobelinsaal eines dänischen Herrenhauses hineinstiehlt und dort bei den alten verstaubten Möbeln einen Aufruhr von neuem Leben hervorbringt.
Die Kopenhagener Zeitung brachte die erbetene Skizze, zugleich mit meinem Bild und einer Besprechung über meinen Roman „Josa Gerth“. Und diese Zeitung war es, die zum ersten Mal das Wort „Farbendichter“ auf mich anwendete, das Wort, das nachher noch jahrelang mein Begleitname in der literarischen Welt bleiben sollte. —
Nach meinem zweiten Aufenthalt im Winter 1893–1894 im bohuslänschen Pfarrhause reiste ich zu Anfang April 1894 von Schweden nach London. Ich fuhr auf einem Küstendampfer vom schwedischen Hafen Uddevalla, südlich von Fjellbacka, ab und erreichte, die Nordsee überquerend, in drei Tagen die Themsemündung.
Ich kann heute noch nicht den Eindruck vergessen, den mir die englischen Fischerflotten machten, die da still lagen im Meer am Themseeingang auf der großen Silberbank des Wassers, über dem die Vorfrühlingssonne bei silberberänderten Wolken blitzte. Die still arbeitenden Boote sahen aus wie unzählige dunkle Fische auf einer weißen Metallplatte.
Dieser Anblick der Vereinigung von Meer und stillen Meerarbeitern ließ mich noch einmal vor der Ankunft in London weit und frei aufatmen. Es sammelt sich in jedem jungen Herzen ein beklemmendes Gruseln an, wenn man zu einer fremden Weltstadt kommen soll. Es gruselte mich, von London verschluckt werden zu können, von den dort angestauten verschiedenen Lebensbegriffen und sich widerstreitenden Lebensgefühlen. Und so genoß ich noch einmal, wie im Abschiednehmen von der Meereseinsamkeit, die mir in Schweden ein weiser Kamerad geworden war, den letzten Meerblick, der mir so unendlich hell und friedlich mit seinen Meerarbeitern einen unzerstörbaren Glückszustand zuspiegelte.
Es wurde Abend, als wir in London in den schmutzigen Dockwassern, an rußigen düsteren Ausladehallen, im Finstern lautlos landeten. Und mehr als die See am Mittag gebraust, toste jetzt rundum das millionenträchtige London in der Nacht.
In einer Pension am Upper Wooburn Place, die in der Nähe des Britischen Museums lag, und wo die Freunde des jungen Schweden, das amerikanische junge Künstlerehepaar, lebten, nahm ich Wohnung.
Der Amerikaner hieß James mit Vornamen, und seine Frau hieß Theodosia. Er war Neuyorker und sie aus San Franzisko, und beide hatten sich in Frankreich auf dem pariser Montparnasse, dem Künstlerstadtteil der pariser Amerikaner, kennen gelernt. Sie hatten sich eben in England trauen lassen und lebten hier auf einem Zimmer der Pension, sorglos bei Künstlersorgen.
In ihnen lernte ich nicht bloß die Menschen eines neuen Zeitgeistes kennen, sondern es sprach auch die Einfalt und Unverbrauchtheit des jungen Erdteils, aus dem sie kamen, aus ihren Handlungen und ihren Gedanken.
Bei unseren ersten Gesprächen erschien es mir, als unterhielt ich mich mit Schulkindern. Die beiden amerikanischen Künstler hatten in allem einen etwas belehrenden Ton, so wie Schulkinder untereinander reden, die sich und ihre Gefährten ganz richtig für unerwachsene Menschen halten. Da sie kein Deutsch sprachen, wurde unsere Unterhaltung auf Englisch oder in schlechtem Französisch geführt, was den belehrenden Ton bei den beiden erhöhte.
Ich hatte noch nicht viel von Okkultismus gehört und nicht viel von Astrologie, nichts vom englischen mystischen Maler Blake und seinen Geisterdichtungen, ebensowenig kannte ich Swedenborgs übersinnliche Philosophie. Ich wußte nichts von Geheimbünden. Ich wußte nur, daß diese Art Gelehrsamkeit in Deutschland mittelalterliches Treiben genannt wurde, und daß sie mir auch immer aus der Ferne als solches erschienen war. Ich glaubte nie an Wahrsagungen, nie an Aufstellung von Horoskopen, noch an ägyptische, arabische oder indische Sterndeuterei. Das amerikanische Ehepaar aber nannte sich Adepten eines mystischen Geheimbundes, über den sie nicht reden durften.
James wollte Bildhauer werden, Theodosia Malerin, und deshalb waren sie von Amerika nach Europa gekommen. Und als ich sie fragte, wozu sie denn die mystische Lehre für ihre Kunst nötig hätten, so sagten sie mir ganz richtig, jede Kunst brauche einen seelischen Inhalt, eine geistige Bildungslinie. Und als ich sie fragte, ob ihr Geheimbund die Freimaurerei sei, da lachten sie und meinten, daß die Freimaurer weit entfernt seien von dem Kreis, dem sie angehörten.
Das Zimmer, das sie bewohnten, war geräumig und bildete für sie beide: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Eßzimmer und Atelier. Bisher hatte ich noch nie ein junges Ehepaar der gebildeten Stände kennen gelernt, das, auf einen so bescheidenen Raum angewiesen, so glücklich lebte wie diese Amerikaner. Und wenn ich heute an jenes londoner Zimmer zurückdenke und an das Kaminfeuer, an den londoner Nebel vor den Fenstervierecken und an das ewige Teewasser, das auf den Kohlen des Kaminrostes den ganzen Tag gekocht wurde, dann entzückt mich immer noch der bescheidene Geist jener strebenden und sich gegenseitig anspornenden amerikanischen jungen Eheleute.
An den Wänden ihres Zimmers waren mit Heftnägeln unzählige Photographien an die Tapete gesteckt. Botticelli, dessen Ruhm damals alle Amerikaner mit besonderer Vorliebe in Mode gebracht hatten, war mit seinem Bild „Primavera“ vertreten. Leonardi da Vincis „Mona Lisa“, einige Photos von Holzschnitten Albrecht Dürers und verschiedene Bilder von Michel Angelos Arbeiten waren hier zum Studium und zur künstlerischen Augenlust ganz willkürlich an der Wand um den Kamin verteilt.
Zuerst wollte ich nicht recht zuhören, wenn die Amerikaner mir die Mystik der Darstellungen Michel Angelo’s, die Mystik Leonardo da Vincis und Albrecht Dürers erklärten und immer von Mystik und Symbolik bei allen alten Meistern sprechen wollten. Aber zwei Menschen gefunden zu haben, die eine neue Weltanschauung in der Mystik suchten, die ein neues Heil in ägyptischer, arabischer und indischer Astrologie zu finden glaubten, die überhaupt nach einem Sinn des Lebens fahndeten, das fesselte mich an diese amerikanischen Künstler.
Und ich machte mich geduldig, um ihnen zuzuhören bei ihren ganz unglaublichen mystischen Ergründungen, die sie immer wieder von neuem aus ihrem Geheimbund mit nach Hause brachten.
Ich hätte gern etwas Näheres über diese geheimen Versammlungen erfahren. Sie aber sagten, ich wäre noch viel zu ungläubig und zweifelnd und müßte, blind ergeben, ohne Mißtrauen, mich zuerst in Astrologie und okkultistische Lehren vertiefen, und wenn ich dann von dem heiligen Drang erfüllt wäre, ein Adept werden zu wollen, so würde ich ganz von selbst den Weg zu diesem Geheimbund finden.
Manchmal in den ersten Tagen fragte ich mich, ob ihr ganzes Gebaren nicht vielleicht ein Künstlerscherz sei. Vielleicht würden sie später über mich belustigt lachen. Denn es schien mir ungeheuerlich, daß zwei aus dem Wirklichkeitsland Amerika, zwei aus dem Arbeitsland kommende Neuzeitmenschen, in die Dunkelheiten der Astrologie, der Alchemie, der Scholastik und Mystik zurückkehren wollten. Es war mir, als ob freie Menschen um Ketten und Kerker bettelten.
Der Amerikaner Weisheit hatte aber nichts mit dem Wissen der Theosophen gemein. Sie verneinten es lebhaft, als ich sie fragte, ob ihr Bund etwas mit Theosophie zu tun hätte.
Sie malten und bildhauerten in London nicht, sondern sagten, das würden sie wieder aufnehmen, wenn sie nach Paris zurückgekehrt wären. Sie waren nur jetzt nach London gekommen, um sich in die Geheimwissenschaften zu vertiefen und sich in jenem Geheimbund unterrichten und belehren zu lassen.
Sie waren aber niemals düster gestimmt, immer fröhlich und glücklich. Nur hatte für mich ihre Fröhlichkeit etwas Körperloses. Sie konnten sich nur immer bei übersinnlichen Gedanken aufhalten, ähnlich wie es jene Theosophen getan, denen ich in München begegnet war.
Sie lachten mich aus, als ich sie fragte, ob die Lehre, der sie nachgingen, der Spiritismus sei. Ich wußte damals noch zu wenig von Okkultismus und erst später erfuhr ich, daß jene beiden einer okkultistischen Gesellschaft angehörten.
Dadurch, daß die Unterhaltungen mit jenen beiden Okkultisten immer halb Englisch, halb Französisch geführt wurde, fühlte ich mich sehr aus meinem Gleichgewicht gehoben und aus meinem Deutschtum fortgerückt, und die Einsamkeit meiner Gedanken war dadurch in dem unendlichen London unendlich viel größer, als sie im Pfarrhaus im Bohuslän gewesen, wo ich mit der Natur erquickenden Gedankenaustausch gepflegt hatte. Denn die Gespräche über Mystik bereiteten mir zuerst nur Qual. Es war mir, wenn ich der Geistesrichtung jener Okkultisten folgte, als ginge ich in den Spuren der schwarzen Sonne, die ich am Isefjord in Dänemark in das schwarze Moor hineingedichtet hatte.
Das große düstere London selbst erschien mir wie eine schwarze mächtige Sonne. Als ich in jener Nacht, vom schwedischen Schiff kommend, die finsteren Docks betrat und sofort in den Bauch der Erde steigen mußte und in rauchigen Tunnels, beinahe zwanzig Stationen weit, unterirdisch reisen mußte, um zum Upper Wooburn Place zu gelangen, da glaubte ich durch die Eingeweide der Erde zu jagen.
Noch am Mittag desselben Tages war ich auf der Silberbank des Meeres unter silbriger Sonne gewesen, war durch silbrige Luft in die Themse eingefahren, an dem grünen Ufer von Greenwich und Richmond vorüber, und jetzt schien es nirgends mehr Meerfreiheit und ländliches Grün zu geben. Seitdem ich da in der Unterwelt fuhr, war mir, als führe ich in die Erdfinsternis, von aller Natur und Natürlichkeit fort, als tauschte ich klare Gedanken gegen dunkle Hirngespinste ein.
Seltsamerweise wirkte aber London, als ich es dann bei Tage sah, gar nicht so himmelgetürmt und nicht so geschäftshastig und großstadtgierig wie Berlin in jenen Zeiten auf mich gewirkt hatte. Die vielen Straßenzüge in London, in denen sich kleine Familieneinzelhäuser überaus schmucklos und einfach, ohne Schaufenster und, nur zweistöckig, aneinanderreihten, wirkten in ihrer Schlichtheit und Unauffälligkeit und in ihrer gediegenen Nützlichkeit, wenn auch eintönig, so doch menschenwürdig.
Die londoner Geschäftsstraßen waren sachliche Arbeitsstraßen, in denen einem das Geldverdienen als eine Naturnotwendigkeit erschien, wobei die Arbeit nicht fieberhaft war, sondern gründlich, stark und einfach verrichtet wurde.
Durch eine im englischen Volk eingewurzelte und durch Geschlechter eingeführte klare Lebensordnung, der sich die ganze Stadt wie eine gut arbeitende, nirgends von Willkür gestörte Maschine hingibt, wirkte diese Millionenstadt mit den kleinen Familienhäusern fast friedlich und traulich wie ein Riesendorf.
Der Segen des Sichunterordnenkönnens der einzelnen unter Vätersitte und unter unumstößliche gesellschaftliche Sitte wirkte bei einer Millionenbevölkerung ungemein wohltuend. Und die tadellose Ordnung im englischen Tagesleben umgab wie ein Schutz, wie die Weihe heiliger Naturgesetze, den Fremdangekommenen. Auch der willkürlichste Mensch wird vom englischen starken Ordnungsleben, das das riesige London, wie einen sicher geleiteten Gutshof, tadellos arbeitend zusammenhält, zur Selbstzucht angespornt. Denn ohne Selbstzucht und Unterordnung des einzelnen unter das Massengefüge konnte hier wie überall im Weltall keiner vorwärtskommen.
Der Engländer, der unausgesetzt Achtung oder Verachtung austeilt, züchtet sich auch die Fremden, die zu ihm kommen, so wie er gewöhnt ist, den Ländern, die er erobert hat, und ihren Eingeborenen englische Ordnung und englischen Lebenssinn beizubringen.
England hat es, wie man weiß, mit dieser Ordnungsstrenge erreicht, daß rund um die Erde seine Sprache die Reise- und Weltsprache wurde. Dieses von altersher feststehende, eingeschulte englische Wesen, das stolz auf sich selbst beruht und sich alles Fremde kraftvoll unterordnet, fühlte ich als wohltuende Macht vom ersten Schritte an, als ich englischen Boden betreten hatte.
Als ich an jenem Ankunftsabend, der Untergrundbahn entstiegen, zum Pensionshause am Upper Wooburn Platz kam — das sich in nichts unterschied von den tausend stillgeordneten Nebenhäusern, und das dadurch häuslich und vornehm in sich zurückgezogen wirkte —, fühlte ich mich schon in jener Straße durch die schweigende Ordnung wohl aufgehoben.
Da war noch ein altmodischer Türklopfer außen an der Haustüre, ein Klöppel, der auf eine Bronzeplatte fiel. Ein schlank gewachsenes Dienstmädchen in schwarzem Kleid mit weißen Manschetten, weißem Kragen und weißem Häubchen öffnete und geleitete mich durch die Vorhalle, die aber keinen kahlen Gang und kein kahles Treppenhaus aufwies. Selbst diese nebensächlichen Hausräume waren traulich mit Hausgeräten und Bilderschmuck ausgestattet, und mir war, als sei ich in ein altes Herrschaftshaus und in einen Kreis alter Familienüberlieferungen eingetreten.
Auch der überall sparsam verwendete Raum im Hause, wo eingebaute Schränke, Tapetentüren und eingeschachtelte Kammern den Hausraum ausnützten — ich möchte sagen das Hausleben verinnerlichten und einem den Wert von jedem Zoll des londoner Bodens deutlich in Erinnerung brachten —, dieses Raumsparen erhöhte den Reiz des Wohnens. Man befand sich in einem solchen Hause wie in einer Schatulle, welche Geheimfächer barg, und an der das sorgsam Durchdachte dem Eintretenden Vertrauen einflößte und ihm Bestätigung vom Wert des Lebens gab. Sich beschränken müssen und sich klug und gewandt beschränken können, sich für das Leben züchten müssen, das redete hier jeden, der das Leben ernst nehmen wollte, wohltuend auf Schritt und Tritt an, innerhalb und außerhalb der Häuser Londons.
Daß das englische Volk auf einer engen Insel lebt und in seinem Vaterland jeden fußbreit Erde liebt, daß es sozusagen im Meer verlassen lebt, auf sich allein angewiesen, umgeben von den ungeheuren Meereshorizonten, die dieses Volk weltblickend werden lassen und es zugleich heiß heimatliebend machen, dieses wurde einem in London täglich bewußt gemacht. Und daß dieses Meervolk, vom Festland getrennt, im Gegensatz zu den Festlandvölkern sich eigenwilliger und im besten Sinne eigensinniger entwickeln mußte, das wurde mir täglich beim Wandern und Beobachten englischer Eigenart und englischer Gediegenheit von den londoner Straßen erklärt.
So erstaunte es mich auch bald nicht, daß hier im Mittelpunkt der fünf Weltteile, hier wo man täglich großzügige Fühlung mit Ägypten, Indien und mit dem fernsten buddhistischen Asien hat, eigenartige Gedankenmischungen entstehen können. Gedankenmischungen, die, ebensogut wie die neuzeitliche Wissenschaft, eine Fortsetzung in der Entwicklung des Menschheitsgeistes hervorbringen können. Da die Engländer im fernen Osten mit fremdem Volksgeist in steter Berührung leben, können asiatische alte Weisheiten echter und unverfälschter durch den gradlinigen Meerverkehr der Engländer nach London kommen, als dieses in Deutschland oder in den anderen Festländern der Fall ist, die nicht so sehr im Mittelpunkt des Weltverkehrs stehen.
Bei uns in Deutschland riß die Wissenschaft im letzten Jahrhundert in den Herzen und den Hirnen der Gebildeten alte Weltanschauungen ein, aber sie baute keine neuen Ideale auf. In England aber, wo Vätersitte unerschütterlicher feststeht als bei uns, reißt man nicht so leicht ein, sondern baut — eingeschachtelten Räumen in den Häusern ähnlich — buddhistische, mohammedanische und altägyptische Ideenwelten in die christliche Weltanschauung hinein. Und, in dem man nicht bloß Rohprodukte aus den asiatischen Kolonien in London einführt, sondern auch die Geistesprodukte der unterworfenen asiatischen Nationen, versucht man in England, Gedankenreiche aus der Vereinigung fremder Weltanschauungen, zusammengeschmiedet mit der heimatlichen Gedankenwelt, zu gründen.
Die Inder, die Ägypter, Asiaten und Afrikaner, denen der Londoner täglich in seinen Straßen und in den Gesellschaften, als zum englischen Reich Zugehörigen, begegnet, konnte er auf die Dauer auch geistig nicht unbeachtet lassen und mußte über ihr ihm fremdes Geistesleben nachdenken.
So versteht sich meistens der Engländer heutzutage besser als irgend ein Europäer auf japanische und chinesische Kunstwerke, und die englische Literatur ist reich an asiatischen Übersetzungen und an ernsten Werken schlichter getreuer Kunst- und Sittenschilderungen asiatischer Völker. Während die deutschen Reisewerke vielfach von deutschem Gelehrtenwissen beleuchtet niedergeschrieben werden, sind die vielen Werke der englischen Privatreisenden — deren es natürlich bei dem ungeheuren Weltverkehr englischer Schiffe Legionen gibt — allmenschlicher, freundlicher und traulicher gehalten. Der Inhalt dieser Werke ist mehr von allmenschlicher Bewunderung erfüllt als von geistiger Überhebung.
Während in England durch den ungeheueren Welt- und Völkerverkehr sich neue Anschauungen den alten Anschauungen beimischen und Möglichkeiten einer gedanklichen Umgestaltung zulassen, stocken in Deutschland seit der Wirklichkeitserkenntnis der neunziger Jahre die Entwicklungen zu neuen geistigen Idealen hin fast vollständig. Man spürt von der großen deutschen Flotte her noch keinen Völkerweltverkehr und Weltgedankenaustausch im deutschen Lande selbst.
Ich will aber nicht sagen, daß in England in den breiten Volksmassen große gedankliche Umwälzungen erreicht worden sind. Doch praktische Umwälzungen sind erreicht worden, wie zum Beispiel die von England kommende Einrichtung der segenstiftenden Heilsarmee oder die von England und Amerika kommende Lehre von der „Christlichen Wissenschaft“, der „christian science“, die durch bewußte geistige Erhöhung die Gesundheit des Körpers anstrebt.
In Deutschland selbst ist nichts der Art aus der Nation entstanden. Man lebt bei uns noch von einem wissenschaftlichen Wirklichkeitssinn befangen.
Aber ein Siebzigmillionenvolk sollte sich doch zu neuen geistigen Höhen, zu neuen Idealen hin aufraffen. Immer noch befangen vom Geist der achtziger und der neunziger Jahre, in denen die Künstler und Gelehrten den Weg zur Wirklichkeit wiesen und zum Niederreißen falscher Ideale, verrannte sich jetzt die deutsche Welt in Wirklichkeitslust.
Die Zeit Goethes, die sich an den griechischen Göttern Erhebung holte, die Zeit Walters von der Vogelweide, in der das Christentum noch ein jung blühendes Ideal war, soll natürlich nicht wiederkommen. Aber die Wirklichkeitslust, die heute herrscht, die ohne Geisteslust ist, sie artet auf die Dauer in ein niederes Vergnügen aus, bei dem die nach neuem Geist sehnsüchtigen Menschen nicht ewig mittun können. Und die Lust nach einer neuen Geisteserhebung schwebt überall in der Luft, so wie am Ende des Winters die Sehnsucht nach dem Frühling da ist.
Dieses Streben nach einer neuen Weltanschauung, das ich bei dem jungen amerikanischen Ehepaar schon vor zwanzig Jahren in London miterlebte, bestätigte es mir schon damals, daß die naturalistische Kunst, die in der Literatur in Deutschland in Gerhart Hauptmann ihren ersten größten Vertreter fand, nicht die allein seligmachende Entwicklung in der Dichtung bleiben würde.
Eine Vereinigung von starker Wirklichkeit und höchster Geistigkeit, eine festliche Weltauffassung vom festlichen Weltalleben und aus einer sich demütig und doch allmächtig fühlenden Menschheit heraus wird eine neue Festwelt für die jungen Dichter entstehen.
Weil im Weltalleben nichts zu klein und nichts zu dunkel ist, als daß es nicht Aufnahme in den Verstand und in das Gefühl einer neuen Menschheit finden müßte, so öffnete ich damals, nachdem ich den ersten Widerwillen überwunden hatte, willig Herz und Ohr auch der mittelalterlichen Welt, der ägyptischen Magie, der assyrischen Sternkunde, der indischen Adeptenlehre, der mittelalterlichen Alchemie und hörte tage- und wochenlang den Auseinandersetzungen des jungen und geistig entzückten amerikanischen Ehepaares zu.
Ich ließ mir die dicken Bände des Geisterdichters William Blake vorlesen und deuten. Und war in Bohuslän die Welt für mich stark, prächtig, natürlich klar und handgreiflich am Meer und beim Granit und in dem würdigen Pfarrhaus ausgebreitet gewesen, so gerade dem entgegengesetzt, unklar, geisterhaft, aber doch nicht unnatürlich, bei aller Finsternis nicht unglaubhaft, malte sich jetzt vor mir in jenem kleinen londoner Zimmer die tastend begeisterte Dunkelwelt der Magie.
Ich glaubte zuerst, daß jene beiden Menschen, die mich in die Geheimwelt des Geisterlebens einweihen wollten, es ebenso auf Wunderverrichtung abgesehen hätten, wie ich und mein Freund, der junge Philosoph, einige Jahre vorher, an jenem Augustnachmittag auf dem Gute bei Würzburg, Wunderwünsche gehabt hatten.
Ich sagte deshalb den Amerikanern, daß ich längst über die Sehnsucht, Wunder zu erleben, fortgekommen sei und deutete ihnen an, daß meine Weltanschauung darin bestehe, das größte und kleinste Leben im Weltall, ebenso wie mich selbst, als festlich zusammengehörig anzusehen und jedes Leben als seinen eigenen Schöpfer und zugleich als Mitschöpfer des ganzen Alls zu betrachten. Ich sagte ihnen, das Weltall würde von mir als ein Festleben, als eine unendliche Festlichkeit angesehen, bei der wir alle ewig in Freude und Leid mitfeiern und alle von neuem Leben zu neuem Leben die Festgestalt wechseln und dabei alle alles besitzen und zugleich der Besitz aller sind.
Da sagten die beiden Amerikaner: „Das ist im Grund dieselbe Lehre, die wir meinen. Wir haben sie in einem Geheimbund erfahren, und Sie sind mit Ihrem Freund, dem Philosophen, durch eigenes Nachdenken zur selben Erkenntnis gelangt.
Wir glauben dasselbe. Wir glauben auch, daß wir Menschen Wunder wirken könnten, aber aus Weisheit das Schöpfungswerk nicht durch törichte Wundersucht stören wollen. Denn dann wären wir nicht mehr weise. Wir glauben ebenso an die Festlichkeit des Lebens. Wir glauben aber auch, daß man sich die großen Kräfte der Sterne ebenso zu Nutzen machen darf, wie man sich Elektrizität und Dampfkräfte zu Nutzen gemacht hat.
Denn es wird kein vernünftiger Mensch daran zweifeln können, daß die Sternenmassen, die sich im Himmelsraum bewegen, die sich bald einander nähern, bald voneinander entfernen, in denen ganze Sonnensysteme wandern, daß diese Sonnen, die sich mit ihren Planeten umkreisen — daß diese sich einander nähernden und sich entfernenden Weltkörpermassen nicht untereinander Einflüsse ausüben müssen auf das Leben, das auf ihnen besteht.
Die Riesenschwankungen, die die Annäherungen solcher Massenungeheuer gegenseitig erzeugen, bleiben nicht ohne Einfluß auf die pflanzliche, tierische, chemische und menschliche Welt, die sich auf den verschiedenen Gestirnen befinden mag.
Darum sind die sich verschiebenden Stellungen der Sterne von Bedeutung für das kleinste Atomleben, also auch für das Menschenleben auf unserem Gestirn. Die Verschiebungen der Sterne bringen durch bedingte Atomverschiebungen Veränderungen chemischer Prozesse hervor. Denn die verschiedenen Gestirne stehen, wie jeder weiß, auf verschiedenen Verbrennungsstufen. Sie sind außerdem verschiedenartig zusammengesetzt. Und angenommen, es würden auch auf jedem Stern dieselben Elemente vorhanden sein, so sind diese doch in verschiedenen Hitze- und Abkühlungsstufen von verschiedenster Wirkung.“
Diese letztere Erklärung sagte ich mir selbst, als die beiden Amerikaner mir die Sterneneinflüsse glaubhaft machen wollten. Ich sagte mir: betrachtet man das Weltall als eine chemische Masse, in der jedes Sonnensystem ein Molekül bedeutet, das sich wieder aus Atomen zusammensetzt, und sieht man die Planeten jedes Sonnensystems als Atome des Sonnensystemmoleküles an, so kann man sich recht gut vorstellen, daß Aufruhr und Änderungen in dieser chemischen Verbindung entstehen, wenn zum Beispiel ein Komet, der ein Atom darstellt, sich einem Molekül, einem Sonnensystem nähert, und dessen Bahn kreuzt.
Angenommen, es sei irgendein chemischer Stoff auf dem Komet überwiegender tätig als auf dem Planeten, dessen Bahn der Komet kreuzt, so wird er wie ein Gärungskeim auf die vorher ruhige Bahn des Planeten einwirken. Denn durch Strahlung kann der Komet kleinste Körperchen, wie zum Beispiel Elektronen, aus der Ferne in das Sonnensystem aufrührerisch schleudern und vorübergehend Zersetzungsprozesse erzeugen, die sich dann selbstverständlich als Unruhen, als Erdbeben, Störungen, Krankheiten des Wassers, Krankheiten der Luft, Krankheiten der Erde, Störungen in der Elektrizität, die sich also auch als Krankheiten der elektrischen Ströme auf jenem Planet fühlbar machen. Die Lebewesen unseres Planeten, die Menschen zum Beispiel, würden dann unruhiger denken, unruhiger handeln, gestört im Gleichgewicht, kriegerischer gesinnt sein und fieberhafter und gewalttätiger werden.
Kriege, die sonst bei ruhigerem Überlegen vermieden werden könnten, werden bei dem gereizten Geisteszustand, in dem sich der ganze Planet befindet, durch die Strahlenstörung, die er vom Kometen erhielt, unvermeidlich werden, ebenso wie Mißwachs, Erdkrankheit und Hungersnot dann die Folge sein könnten.
Den denkenden Menschen muß es einleuchten, daß die gesamte Sternenwelt als eine Molekül-, Atom- oder Elektronenwelt gedacht, mit kreisenden Molekülwelten, das heißt Sonnensystemen, fortgesetzten Veränderungen unterworfen ist, die je nach den Molekülverschiebungen, je nach den Sternstellungen einsetzen.
Zu jeder Stunde der Nacht und des Tages ist die Sternstellung eine andere rund um den Planeten Erde. Also sind die Wirkungen im Weltall und auf der Erde, die chemischen Prozesse, die statthaben, stündlichen Veränderungen unterworfen.
Sagen wir nun, die chemische Masse Jupiter, oder die chemische Masse Venus, oder die chemische Masse Merkur entfernt oder nähert sich der chemischen Masse Erde, so müssen unbedingt, wie bei dem Nahen eines Kometen, Schwankungen bei allen Leben der Erde eintreten.
Nun sind aber nicht bloß alle Sterne in verschieden starken Elementzusammensetzungen zu denken. Sondern auch die verschiedenen Pflanzen, die verschiedenen Tiere und die verschiedenen Menschen sind aus verschiedenen Gewichtteilen jener Elemente zusammengesetzt. Nähert sich nun ein Stern, der durch seine Zusammensetzung schädlich oder günstig wirken kann, so wird jedes Lebewesen auf der Erde sich bei seiner Annäherung glücklicher oder unglücklicher fühlen, glücklicher oder unglücklicher handeln.
Und darum sagten die alten Astrologen: dieser ist ein glücklicher Tag für diejenigen, die zum Beispiel unter Jupiter geboren sind. Denn an diesem Tag ist die chemische Zusammensetzung im Weltall durch die Jupiterstellung, das heißt durch Molekularveränderungen, die das Atom Jupiter erzeugt, günstig für alle die, welche aus einer ähnlichen chemischen Zusammensetzung bestehen wie der Planet Jupiter.
Die ewig sich ändernden chemischen Prozesse, die sich einander nähernden und sich voneinander entfernenden Sternmassen, die den aus Elementen zusammengesetzten Körper des Menschen, der Tiere, der Pflanzen und der ganzen Erde stündlich chemisch beeinflussen, so wie auch sie wieder beeinflußt werden, diese Sternwanderungen und die dadurch entstehenden stündlich verschiedenen Sternmischungen, diese stündlich wechselnden chemischen Prozesse lassen einem die Sterndeutung, die durch Jahrhunderte und Jahrtausende bei allen Erdvölkern, bei Chinesen, Indern, Afrikanern, Azteken und Germanen geübt wurde, als eine durchaus nicht übernatürliche Wissenschaft verstehen.
Ein Astrologe kann also, wenn er die Geburtsstunde eines Menschen weiß und die Sternstellung jener Stunde, die er in den astronomischen Aufzeichnungen bereits festgestellt findet, nachgeschlagen hat, jenem Menschen die Zukunftsstunden, in denen ihn schädliche Einflüsse unvermeidlich treffen werden, aus dem astronomischen Kalender berechnen. Ähnlich wie ein Chemiker voraussagen kann, welche Einflüsse einer bestimmten chemischen Mischung von Vorteil oder von Nachteil sein können.
Der Astrologe hält sich also an Sternenprozesse. Er ist sozusagen der Kenner der Himmelschemikalien, angewendet auf die Chemie des Menschenkörpers. Wie es kluge und unkluge Chemiker gibt, gibt es natürlich auch kluge und unkluge Astrologen.
Die Indier, die Araber, die Ägypter, die unter wolkenloserem Himmel geboren sind als wir, und die die Sterne in mehr Nächten des Jahres studieren konnten als wir, haben in ältester Zeit, wie jeder weiß, die größten Fortschritte in der Beobachtung des Himmels gemacht. Auf der Reise um die Erde wurde ich an einigen indischen Fürstenhöfen in geräumige, besonders für die Astrologie gebaute Höfe geführt, wo große gemauerte Instrumente verteilt waren, die heute noch, wie seit urältester Zeit, den Messungen und der Sternenkunde dienten.
Ob es Wert hat, die beeinflußten Lebenstage, die guten oder bösen, eines Menschenlebens aus den Sternen vorauszubestimmen, das wird jeder bei sich selbst fühlen müssen. Nicht jeder trägt Verlangen, die Stunden wissen zu wollen, die ihm schädlich oder günstig sind.