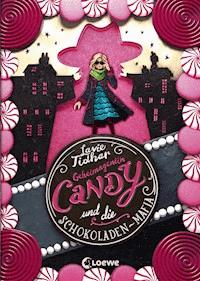
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Nelle lebt in einer Stadt, in der es seit drei Jahren keine Schokolade mehr gibt. Sie wurde verboten, doch es gibt Banden, die die illegale Ware für die Zucker-Junkies in die Stadt schmuggeln. Eines Tages steht der berüchtigte Gangster Eddie de Menthe in Nelles Detektivbüro. Und er hat einen Auftrag für sie. Was sie zu hören bekommt, gefällt ihr ganz und gar nicht. Ohne es zu wollen, wird sie immer tiefer hineingezogen in die dunklen Machenschaften der Schokoladen-Mafia… Ihr Deckname lautet nun Candy – Geheimagentin Candy. Eine starke Mädchenheldin ermittelt in einem spannenden Kriminalfall, rund um Intrigen, Schmuggelware und ein Geheimnis, das seit Jahrzehnten gut gehütet wird. Doch Candy taucht immer tiefer hinein in die Abgründe ihrer Stadt, in der Schokolade und Süßigkeiten ein Tabu sind. Ein Kinderbuch für Mädchen und Jungen ab 10 Jahren. Der Titel ist auf Antolin.de gelistet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 1
Die Sonne schien hell durch mein Bürofenster im Garten hinter unserem Haus und keine Wolke war am Himmel zu sehen. Ich hatte einen Schreibtisch und zwei Stühle, von denen einer für Besucher gedacht war, ein Bücherregal und einen Aktenschrank – alles, was ein Detektivbüro braucht. In meiner Schreibtischschublade befand sich außerdem eine halbvolle Schachtel Pralinen. Oder eine halbleere. Je nachdem. Sie war ein Geschenk von einem dankbaren Klienten. Und illegal, wie alle Süßigkeiten in der Stadt. Ich ging jedoch nicht davon aus, dass irgendjemand mich kontrollieren würde.
Ich hatte gerade meine Hand in die Schublade gesteckt und versuchte vergeblich, die Pralinen allein durch Tasten zu erkennen. Aber es war unmöglich herauszufinden, ob es sich um eine mit Karamell- oder Marzipanfüllung handelte. In dem Moment klopfte es an der Tür.
Schnell schob ich die Schublade wieder zu, wobei ich mir vor lauter Eile fast die Hand darin einklemmte. Dann richtete ich mich auf und gab mir alle Mühe, schwer beschäftigt und kompetent auszusehen, wie es sich für eine gute Privatdetektivin gehörte.
Es war schon einen Monat her, seit das Schuljahr zu Ende gegangen war und ich meinen letzten Fall gelöst hatte. Bei diesem Auftrag hatte ich mich mit Zuckerschnute Ratchet und ihrer Gang, den Naschkatzen, angelegt und seitdem waren sie nicht gut auf mich zu sprechen. Um die Wahrheit zu sagen: Mir war mal wieder das Taschengeld ausgegangen, das Glück hatte mich verlassen, mein Hut war älter als ich und ich brauchte noch dringender einen Job, als ich mich nach einer Praline mit Karamellfüllung sehnte.
»Herein!«, rief ich.
Die Tür ging auf und er trat ein. Er hatte Segelohren, feuerrote Haare und haufenweise Sommersprossen um die Nase, und in seinem Mund waren mehr Zähne als hineinpassten. Damit kaute er laut schmatzend auf einem Kaugummi herum, ohne sich darum zu scheren, dass das illegal war. Ich musterte ihn eingehend. Er roch förmlich nach Ärger.
»Nelle Faulkner?«, fragte er. »Die Detektivin?«
»Kommt drauf an, wer das wissen will«, antwortete ich. Er sah aus, als sei er aus Plätzchenteig gemacht, irgendwie roh und unförmig. Meiner Einschätzung nach musste er ungefähr in meinem Alter sein, also zwölf, vielleicht auch ein bisschen älter.
Er setzte ein entwaffnendes Lächeln auf, bei dem alle seine Zähne zum Vorschein kamen.
»Du kriegst noch Karies, wenn du weiter auf dem Kaugummi rumkaust«, brummte ich.
»Bist du etwa meine Mutter?«
Ich überging seine Bemerkung. So was perlte einfach an mir ab.
»Wer bist du?«, fragte ich stattdessen.
»Tut mir leid, ich hätte mich vorstellen sollen.«
Es tat ihm kein bisschen leid. Er knatschte weiter auf seinem Kaugummi herum, als hinge sein Leben davon ab.
»Ich bin Eddie. Eddie de Menthe.«
Ich setzte mich ein wenig aufrechter hin. Jetzt wusste ich, mit wem ich es zu tun hatte.
»Du bist der Süßigkeitenschmuggler?«, erwiderte ich. Ich hatte seinen Namen schon öfter in den Schulfluren gehört. Gerüchten zufolge unterstand ihm die Hälfte des illegalen Zuckerhandels in der Stadt. Wenn man Lust auf ein Marshmallow oder eine Schokolinse hatte, musste man sich angeblich nur an Eddie de Menthe und seine Gang wenden. Sie hatten einen richtigen Schwarzmarkt aufgezogen, auf dem sie alle Arten von Süßigkeiten verkauften, ohne dass die Erwachsenen davon Wind bekamen. Ich hatte keine Ahnung, woher seine Ware stammte, und ich wollte es auch gar nicht wissen.
»Nee«, wiegelte er ab. »So ist das nicht, ganz ehrlich. Ich bin nur ein Kind.«
Sein Gesichtsausdruck sprach eine andere Sprache. Er wirkte in etwa so unschuldig wie ein Kind, das man mit einer Tüte voller Karamellpopcorn erwischt hatte, und noch weniger unschuldig ging gar nicht.
»Ach ja?«, hakte ich nach.
Er zuckte mit den Schultern, als ginge ihn das alles nichts an. »Die Leute wollen eben ihren Süßkram«, sagte er. »Ich helfe ihnen bloß.«
Irgendwie mochte ich ihn. Er versuchte nicht, sich rauszureden. Aber er bedeutete Ärger, das wusste ich, und er wusste, dass ich es wusste.
»Wie kann ich dir helfen, Mrde Menthe?«, erkundigte ich mich.
»Eddie, bitte.«
»Wenn du darauf bestehst.«
»Ich brauche einen Privatdetektiv. Einen Schnüffler.« Er lächelte, zog ein Päckchen Kaugummi aus der Tasche und hielt es mir hin. »Auch eins?«
»Nein.«
»Ist doch kein Verbrechen«, sagte er.
»Genau genommen ist es das sehr wohl.«
Er kaute lächelnd auf seinem herum, als wäre es ihm herzlich egal, was es vermutlich auch war.
»Wie kann ich dir helfen?«, wiederholte ich.
»Ist kompliziert.«
»Wenn es etwas Illegales ist …«
»Nein, nein«, beschwichtigte er. »Um so was geht es nicht. Dafür habe ich … meine eigenen Leute.«
Den Gerüchten nach arbeitete jedes zweite Kind in der Stadt für ihn. Sie schmuggelten Süßigkeiten in die Stadt und verkauften sie dann weiter. Ich konnte mir nicht vorstellen, was er von mir wollte, und das sagte ich ihm auch.
»Mir ist etwas gestohlen worden«, erklärte er, »und ich brauche es zurück.«
»Aha«, sagte ich verständnisvoll. »Was wurde denn gestohlen?«
Jetzt wirkte er zum ersten Mal nervös. »Das bleibt aber unter uns, ja?«, fragte er.
»Wir Privatdetektive«, verkündete ich feierlich, »sind wie Priester oder Ärzte. Was auch immer du sagst, bleibt in diesem Zimmer.«
»Na ja, es ist aber nicht wirklich ein Zimmer, oder?«, erwiderte er. »Es ist ein Geräteschuppen.«
»Es ist mein Büro.«
»Aber es ist ein Schuppen«, beharrte er. »Im Garten deiner Mom. Ich kann ihr durchs Fenster beim Jäten der Rosenbeete zusehen.«
»Hör zu, Freundchen.« Langsam wurde ich ungehalten. »Du bist zu mir gekommen. Nicht ich zu dir. Wo ist dein Büro, auf irgendeinem verlassenen Spielplatz?«
»Um ehrlich zu sein …«
Ich hätte es wissen müssen.
»Der in der Malloy Road? Den sie vor sechs Monaten wegen Renovierungsarbeiten geschlossen haben?«, fragte ich.
»Du warst noch nie dort?« Er grinste. »Pass nur auf, dass du noch alle Murmeln im Sack hast, wenn du dich mal dort blicken lässt.«
»Wovon redest du?«
Er grinste unbeirrt weiter. »Wirst schon sehen.«
Ich seufzte, lehnte mich zurück und streckte unter dem Tisch die Beine aus. Ich dachte an Süßigkeiten. Daran, dass man sie in jeder anderen Stadt einfach im Laden kaufen konnte, nur nicht bei uns – nicht mehr. Ich dachte daran, wie lecker sie schmeckten, und daran, dass nur, weil etwas plötzlich illegal war, es noch lange nicht aus der Stadt und dem Gedächtnis verschwand.
»Du weichst meiner Frage aus«, sagte ich.
»Die da wäre?«
»Was hast du verloren?«
»Ich habe es nicht verloren. Ich hab dir doch gesagt, es wurde mir gestohlen.«
»Was wurde gestohlen?«, schrie ich. Er zuckte zusammen. Langsam ging er mir wirklich auf die Nerven.
»Ein Teddy, okay?«, antwortete er.
Ich richtete mich auf und musterte ihn über den Schreibtisch hinweg. Der Ausdruck in seinen Augen war sanft und ein bisschen traurig.
»Ein Teddy?«, wiederholte ich ungläubig. Machte er Witze? Er war mindestens zwölfeinhalb.
»Ein Teddybär. Ein alter Teddybär. In Ordnung? Das ist alles.«
Ich schwieg eine Weile. Anfangs wirkte er beschämt, doch dann hob er den Kopf und funkelte mich trotzig an.
Schließlich fragte ich: »Hat er auch einen Namen?«
»Einfach nur Teddy.«
»Sehr originell.«
»Es ist nicht meiner. Er … er gehört einem Freund.«
»Soso, einem Freund.«
»Ja, einem Freund«, antwortete er mit Nachdruck. »Und ich brauche ihn zurück. Es ist wichtig.«
»Hör mal«, sagte ich, »tut mir echt leid wegen deinem Verlust und so, aber kannst du dir nicht einfach, keine Ahnung, einen neuen kaufen?«
»Hattest du jemals einen Teddy?«, fragte er. Ich wand mich verlegen, was ihm natürlich nicht entging.
»Du hast ihn immer noch, hab ich recht?«
»Es ist eine sie und ihr Name ist Delphina«, erwiderte ich. »Del Bär.« Ich wusste nicht, warum ich ihm das erzählte. Mein Dad hatte sie mir gekauft, als ich klein war. Vor seinem Tod.
»Ich brauche ihn zurück«, wiederholte Eddie de Menthe.
Ich sah ihn durchdringend an.
Er war einer der gefürchtetsten Süßigkeitenschmuggler der Stadt und jetzt kam er wegen eines verschwundenen Teddybären zu mir? War das tatsächlich sein Ernst?
Ich blickte ihn nachdenklich an. Er sah aus, als sei es ihm todernst.
Nein, dachte ich. Es war noch mehr – er sah besorgt aus.
»Na schön.« Ich hatte mich entschieden. Ich griff nach meinem Notizbuch und einem Stift. »Kannst du ihn mir beschreiben?«
Eddie begann: »Er ist alt. Er hat braunes Fell, das ein paarmal zu oft gewaschen worden ist, weswegen es inzwischen eher schmutzig grau wirkt. Ihm fehlt das linke Auge und er hat ein zugenähtes Loch in der Brust, das ein bisschen wie eine Schusswunde aussieht. Außerdem fehlt ihm ein Stück von seinem rechten Ohr. Er hat eine süße schwarze Knopfnase. Und er hat noch sein Originaletikett, auch wenn das so verblichen ist, dass man es nicht mehr lesen kann. Aber wenn man es könnte, würde ›Farnsworth‹ draufstehen.«
Beim Klang des Namens hielt ich inne. Eddie beobachtete mich sehr aufmerksam. Er bemerkte mein Zögern.
Jeder kannte diesen Namen. Er prangte über dem Tor der stillgelegten Fabrik und er hatte auf fast allen Schokoriegeln gestanden, die in der Stadt verkauft worden waren, bevor Süßigkeiten verboten wurden.
Es war jetzt drei lange Jahre her, dass Bürgermeister Thornton das Prohibitionsgesetz erlassen hatte, durch das Schokolade und alle anderen Süßigkeiten aus unserer Stadt verbannt wurden. Ich war damals erst neun, aber ich konnte mich noch gut daran erinnern. Das konnten wir alle. Es war ebenfalls drei lange Jahre her, dass die Fabrik geschlossen worden und MrFarnsworth verschwunden war.
Inzwischen fiel es mir immer schwerer, mir eine Welt vorzustellen, in der man Schokolade essen konnte, wann immer einem danach war, einfach so in der Öffentlichkeit. Und in der man, wenn man keine hatte, problemlos in ein Geschäft gehen und welche kaufen konnte.
Damals hatte die ganze Stadt danach gerochen. Der Duft stieg Tag und Nacht von der Farnsworth-Fabrik auf und legte sich über die Dächer und Straßen, sodass alle etwas davon hatten, egal wie arm oder reich sie waren. Der Duft von Schokolade.
Er war überall.
Er hing in unseren Kleidern, in unseren Haaren und in der Wärme unserer Kissen, wenn wir abends schlafen gingen. Ich konnte mich immer noch daran erinnern. Es war der Duft meines Vaters.
Er hatte in der Fabrik gearbeitet und die Schokolade hatte sich auf seiner Haut, unter seinen Fingernägeln und in seinen Haaren festgesetzt. Der Geruch hatte ihm angehaftet, egal wie oft er sich gewaschen hatte, und egal, welches Rasierwasser er benutzt hatte.
Er war ein Teil von ihm gewesen.
Jetzt roch die Stadt nur noch nach Blumen und Erde, nach frischem Brot und Kaffee, nach Autoabgasen und Schweiß. So wie jede andere Stadt auch.
Aber früher einmal hatte sie nach Märchen gerochen.
Sie hatte wundervoll gerochen.
Ich räusperte mich. »Was kannst du mir sonst noch über ihn sagen?«
»Ich kann dir sagen, dass es wichtig ist, dass ich ihn wiederbekomme.«
»Ich verlange fünfzig Cent am Tag plus Spesen«, sagte ich.
Er zuckte gleichgültig mit den Schultern, so als würde Geld für ihn überhaupt keine Rolle spielen, was es vermutlich auch nicht tat.
»Ich brauche diesen Teddy zurück«, wiederholte er.
Nach und nach konnte ich ihm auch die restlichen Einzelheiten entlocken. Er bewahrte den Teddy in seinem »Büro« auf dem alten Spielplatz in der Malloy Road auf, wo sich die Kinder trafen, um geschmuggelte Schokolade zu kaufen und Murmeln zu spielen. Er hatte den Verdacht, dass einer seiner Rivalen ihn gestohlen haben könnte, wollte sich aber nicht dazu äußern, warum er das dachte. Ich hatte den Eindruck, dass er mir generell sehr viel verschwieg. Er sagte, sein größter Rivale sei ein Junge namens Waffles, der oben auf dem Hügel lebte. Ich hatte noch nie von ihm gehört. Mehr konnte er nicht erzählen. Ich sah ihm an, wie beunruhigt er war.
»Ich werde ein paar Nachforschungen anstellen«, sagte ich schließlich. »Und ich werde auch bei dir vorbeischauen müssen.«
»Ich hab meinen Leuten schon gesagt, dass sie mit dir rechnen sollen«, antwortete er.
»Wunderbar.«
Schweigend sahen wir einander über den Schreibtisch hinweg an. Eddie de Menthe war ein großer Junge. Er konnte gut auf sich selbst aufpassen, und doch wirkte er in diesem Moment fast ein bisschen verloren.
»Ich werde ihn finden«, versicherte ich.
»Gut.« Erleichtert stand er auf. An der Tür drehte er sich noch einmal zu mir um.
»Danke, Nelle.«
Er wandte sich zum Gehen.
»Hey«, sagte ich.
»Ja?«
»Warum ich?«
Für einen Moment stahl sich ein Lächeln auf seine Lippen und sein Ausdruck wurde milder.
»Wir haben früher zusammen im Sandkasten gebuddelt«, antwortete er.
Ich sah ihn überrascht an. »Daran kann ich mich nicht erinnern.«
»Tja, dann.« Er zuckte mit den Schultern. »Man sieht sich, Nelle.«
»Bis dann, Eddie.«
Nachdem er gegangen war, blieb ich noch eine Weile an meinem Schreibtisch sitzen. Meine Mutter war ins Haus gegangen und Eddie schlich durchs Gartentor nach draußen, ohne dass ihn jemand sah. Er war gut darin.
Die Sonne schien durchs Fenster herein.
Und ich dachte an Schokolade.
Kapitel 2
Es klang nach einem einfachen Fall. Die Art von Auftrag, die ich jederzeit annehmen würde. Es ging schließlich bloß um einen vermissten Teddybären.
Damit kam ich ja wohl klar.
Oder?
Der Süßigkeitenschwarzmarkt war allerdings etwas, womit ich bisher noch nie zu tun gehabt hatte. Ich meine, ich hatte kein Problem damit, hier und da mal einen Schokoriegel zu essen, der über Umwege in meine Hände gelangt war, aber ansonsten hielt ich mich an die Regeln.
An der Wand neben meinem Schreibtisch hing ein Foto von Dad. Ich hatte es jeden Tag vor mir, doch jetzt sah ich noch mal genauer hin.
Auf dem Bild war die funkelnagelneue Fabrik zu sehen. Sonnenlicht fiel auf das große Schild mit der Aufschrift »Farnsworth Schokoladenfabrik«.
Vor den Fabriktoren standen meine Mutter und mein Vater und lächelten in die Kamera. Mein Vater trug seinen blauen Arbeitsoverall, meine Mutter ein Sommerkleid. Auf dem Arm meines Vaters saß eine jüngere Version von mir und grinste strahlend und zahnlos in die Kamera.
Ich stellte mir gerne vor, dass ich mich an den Tag noch erinnern konnte: daran, wie mich mein Vater in den Armen hielt und ich mich sicher, warm und geborgen fühlte, während die Sonne wohlwollend auf uns herabschien.
Hinter uns dröhnten die großen Maschinen, die Tag und Nacht ohne Unterlass siebten, walzten, mischten, conchierten und temperierten. An diesem Tag musste die Fabrik die Tore für Familienangehörige geöffnet haben, denn um uns herum waren lauter andere Familien, andere Mütter und Väter, die dort als Mechaniker und Einpacker, als Buchhalter und Verkoster arbeiteten.
Manchmal glaubte ich immer noch, den Geschmack von Schokolade in der Luft wahrnehmen und die zuckerwatteflauschigen Wolken am Himmel sehen zu können.
Aber natürlich konnte ich das nicht.
Als ich nach draußen in den Garten ging, war meine Mutter zurück und goss die Blumen. Sie werkelte in ihren Gartenhandschuhen fröhlich vor sich hin. Ab und zu strich sie sich mit einem Finger die schweißfeuchten Haare aus der Stirn. Als sie mich sah, lächelte sie. Ich umarmte sie und sagte, dass ich zum Spielplatz wollte. Dann schloss ich mein Fahrrad auf und fuhr los.
Es war ein heißer Tag, einer von der Sorte, bei der Schokolade zu klebrigen Pfützen schmolz. Ich bog nach links in die Leigh Brackett Road, eine hübsche, ruhige Straße, die auf beiden Seiten von Bäumen gesäumt war und daher viel Schatten bot. Aus der Bäckerei an der Ecke wehte mir der Duft von frisch gebackenem Brot entgegen. Unwillkürlich musste ich an Donuts und Schokocroissants denken, an Plunderteilchen und Windbeutel. Alles, was ich in meiner Tasche hatte, waren ein halbes Käsebrot und ein Apfel. War sowieso gesünder. Das behauptete jedenfalls unser Bürgermeister.
Bürgermeister Thornton hatte sich in unser Leben gestohlen wie ein Dieb in einen Süßwarenladen. In seinem Wahlkampf hatte er überall herumposaunt, dass Schokolade und alle anderen Süßigkeiten verbannt werden müssten. Weil das besser für alle sei. Für die Kinder. Für unsere Gesundheit. Anscheinend hatten ihm die Leute geglaubt, denn er wurde tatsächlich gewählt.
Und in seiner allerersten Amtshandlung als Bürgermeister erließ er das Prohibitionsgesetz.
Egal wo ich langfuhr, überall war Bürgermeister Thorntons Gesicht: Er blickte mir von den Schildern entgegen, die die Hausbewohner in ihren Vorgärten aufgestellt hatten. Auf den Schildern lächelte er. Seine Zähne waren vollkommen ebenmäßig und sehr, sehr weiß. Er sah aus wie jemand, der in seinem ganzen Leben noch nie einen Schokoriegel gegessen hatte.
Schließlich erreichte ich die Malloy Road, eine breite Allee, die an ruhigen Apartmentkomplexen und Doppelhaushälften vorbeiführte. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite erstreckte sich die alte Schule fast über den gesamten Block. Das Gebäude war schon einige Jahre baufällig gewesen und nun endlich zu Renovierungszwecken geschlossen worden. Allerdings waren nirgends Bauarbeiter zu sehen und es schien, als sei das schon seit Monaten so. Das Areal war mit einem Bauzaun abgesperrt, an dem überall Schilder hingen, doch sie waren verrostet und der Zaun war voller Löcher, wo vermutlich Hunde ihn durchbrochen hatten. Auch auf diesen Schildern war der Bürgermeister zu sehen. Mit einem leuchtend gelben Schutzhelm saß er lächelnd in einem Kran.
Die Schulgebäude zeichneten sich grauschwarz vor dem blauen Himmel ab. Ihre Schatten fielen wie dunkle Schokolade auf die Straße, während ich darauf zuging.
Es war ruhig, auch wenn die Schule eindeutig nicht so verlassen war, wie es den Anschein hatte. Ich lief am Zaun entlang zur Rückseite, wo der Spielplatz lag. Hier war der Zaun ausgebessert und mit dünnen Holzpaneelen verstärkt worden, sodass man nicht hindurchsehen konnte. Es gab kein echtes Tor, aber als ich näher kam, entdeckte ich einen Jungen und ein Mädchen, die vor einer improvisierten Holztür Wache standen.
»Passwort?«
»Eddie meinte, ich könnte einfach vorbeikommen. Mein Name ist Faulkner. Nelle Faulkner.«
Die beiden wechselten einen Blick.
»Eddie hat uns schon gesagt, dass du kommen würdest. Du kannst reingehen.«
Ich musterte die Tür. Von außen war nicht zu erkennen, was dahinterlag.
Das machte mir ein bisschen Angst. Wenn ich durch diese Tür ging, betrat ich womöglich eine Welt, die ich nicht kannte und die ich nicht verstand, und vielleicht würde ich nie wieder rauskommen. Aber andererseits war ich auch neugierig. Ein Teil von mir wollte unbedingt wissen, wie es dahinter aussah. Ich mochte keine Geheimnisse. Deswegen versuchte ich, jedes Rätsel zu lösen, auf das ich stieß.
»Was ist? Gehst du jetzt rein oder nicht?«
Ich sah noch einmal die Tür an. Dann gewann meine Neugier die Oberhand. Ich nickte. Der Junge schob die Tür auf und trat beiseite, um mich vorbeizulassen.
So gelangte ich auf den Spielplatz.
Kapitel 3
Der Tag war heiß, aber der Spielplatz lag glücklicherweise im Schatten der Schulgebäude. Hier ging es zu wie in einem Bienenstock. Überall waren Kinder: Kinder, die auf den selbst gebauten Picknicktischen herumfläzten, Kinder, die sich durch einen Berg Süßigkeiten futterten, und weit und breit kein Erwachsener in Sicht.
Auf dem Boden waren mit Kreide Ringe aufgemalt und in jedem dieser Ringe waren Murmeln verstreut. Ziel des Spiels war es, so viele Murmeln wie möglich einzusammeln. Dafür musste man mit einer großen Murmel auf einen der Ringe zielen und möglichst viele von den kleineren Murmeln darin rausschießen.
Was nicht so einfach war, wie es klang.
Um die Spieler hatten sich weitere Kinder versammelt, die auf den Gewinner wetteten. Der Einsatz waren – was auch sonst – Süßigkeiten. Niemand war laut, aber jedes Mal, wenn ein Spieler an der Reihe war, wurde er flüsternd angefeuert. Ich entdeckte meinen Nachbarn Cody, den kleinen Jungen von nebenan. Ich wusste nicht, dass sich Cody an Orten wie diesem rumtrieb. Das gefiel mir nicht. Ich versuchte, ein Auge auf ihn zu haben, so gut es ging.
Er lag auf dem Bauch, einen riesigen Haufen Murmeln neben sich. Hoch konzentriert kniff er ein Auge zu und schnippte seine Murmel in den Ring. Sie prallte mit einem hörbaren Pling gegen mehrere Hindernisse. Die anderen Glaskugeln rollten in alle Richtungen davon und zwei sogar ganz aus dem Ring. Ein Junge kam, sammelte die beiden Murmeln auf und gab sie Cody, der sie zu seinem Haufen dazulegte. Er schlug sich offenbar gut.
Um ihn herum war aufgeregtes Raunen zu hören und ich sah, wie einige Süßigkeiten den Besitzer wechselten. Cody war erneut an der Reihe. Diesmal gelang es ihm, drei Murmeln aus dem Ring zu befördern, darunter auch eine große von einem seiner Gegner. Der andere stieß einen enttäuschten Fluch aus und stand mit leeren Händen auf.
Cody grinste.
Ich sah zu, bis der Ring leer geräumt war und die restlichen Spieler geschlagen waren. Cody verstaute seine Beute in einem Säckchen. Er war von zahlreichen Bewunderern umringt, die ihm anerkennend auf den Rücken schlugen und ihm durch die Haare strubbelten.
Er grinste immer noch. Bis er mich bemerkte.
»Nelle!«
»Hallo, Cody.«
»Du verrätst doch nichts, oder?«, fragte er besorgt.
»Wo ist deine Mom?«, wollte ich wissen.
»Sie ist mit Stuart im Kino.«
Stuart war sein Stiefvater.
»Du solltest nicht hier sein, Cody.«
Seine Miene verdüsterte sich. »Aber es gefällt mir hier«, beteuerte er. »Ich spiele gern Murmeln, Nelle. Da bin ich gut drin.«
Er blickte mich mit großen dunklen Augen an. Dann streckte er die Hand aus. »Hier«, sagte er. »Willst du ein paar Murmeln?«
Ich musste lächeln.
»Behalte sie«, erwiderte ich. »Aber du kommst mit mir nach Hause.«
»Na gut.« Er sah mich voller Vertrauen an.
»Wer hat denn hier das Kommando?«, fragte ich.
»Anouk«, antwortete er. »Anouk hat das Kommando.«
Ich schaute mich um. An der Mauer des Schulgebäudes lehnte ein dunkelhaariges Mädchen, das etwa zwei Jahre älter als ich sein musste. Als sie sah, dass ich zu ihr rüberblickte, kam sie auf uns zu. Ihre Bewegungen waren ruhig, aber zielstrebig.
»Faulkner?«
»Du musst Anouk sein.«
Sie strubbelte Cody liebevoll durchs Haar. »Eddie meinte, du würdest eventuell vorbeikommen. Er sagte, ich soll dir das Büro zeigen.«
»Das wäre nett.«
Ich wandte mich an Cody. »Du wartest hier.«
»In Ordnung, Nelle.« Sein Blick wanderte zum Murmelspiel. Ich ließ ihn stehen und folgte Anouk ins Büro. Sie führte mich durch eine Tür in einen kleinen Lagerraum.
Ich sah mich um. Überall standen Kisten, die wahrscheinlich voller Süßigkeiten waren. Ich hatte mir den Süßigkeitenschwarzmarkt immer wie eine Art Spiel vorgestellt: ein paar Pralinen hier, ein paar Schokoriegel da. Dementsprechend schockiert war ich nun, da ich das wahre Ausmaß erkannte. Plötzlich fühlte es sich ganz und gar nicht mehr wie ein Spiel an.
»Ich soll dir von Eddie sagen, dass der Teddy da oben auf dem Regal saß.« Anouk zeigte auf ein Regalbrett, das über einem alten Schreibtisch an der Wand befestigt war und in dem einige Gegenstände standen, die auf den ersten Blick nicht so recht zusammenpassen wollten: ein alter Pokal, ein Seestern und eine Blechdose mit Blumen. »Ich dachte immer, er sei so was wie Eddies Glücksbringer. Etwas, das seine Mom ihm geschenkt hat, bevor sie starb.«
»Er ist von hier gestohlen worden?«, fragte ich überrascht.
Anouk zuckte mit den Schultern. »Glaub schon«, antwortete sie. »Obwohl es nur eine Tür gibt und normalerweise immer jemand hier drin ist.«
»Und sonst fehlt nichts?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Merkwürdig«, sagte ich. »Wenn hier schon jemand einbricht, würde man doch meinen, dass er es eher auf die Süßigkeiten abgesehen hätte.«
Sie zuckte erneut mit den Schultern. »Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie es irgendjemandem gelingen konnte, den Teddy zu stehlen«, meinte sie. »Es sei denn, es war einer von uns.«
»Und, war es einer von euch?«
»Nein, Nelle«, erwiderte sie geduldig. »Von uns hat keiner den Teddy gestohlen. Wozu auch? Es war doch bloß ein altes Stofftier.«
Ich nickte zögerlich. Ich hatte keine Ahnung, wie der Teddy hier herausgeschafft worden war, aber um das herauszufinden, musste ich offenbar auch dahinterkommen, warum er gestohlen worden war. Meiner Meinung nach lag Anouk mit ihrer Einschätzung, dass es niemand von hier gewesen sein konnte, falsch. Besonders gut schienen sie den Raum nicht zu bewachen, sodass jeder auf dem Spielplatz lediglich einen günstigen Moment hätte abwarten müssen, um reinzulaufen und den Teddy zu klauen.
So gesehen war das Wie kein allzu großes Rätsel. Der Dieb hätte ihn anschließend problemlos vom Spielplatz mit nach Hause nehmen können.
Aber die Antwort, die ich suchte, fand ich dadurch auch nicht. Nämlich, wer ihn gestohlen hatte.
Die eigentliche Frage war: Warum war er gestohlen worden? Was war so wichtig an einem alten Teddybären?
Eddie bedeutete er offensichtlich viel … mehr als er sollte. Konnte er irgendwie mit dem Süßigkeitenhandel in Verbindung stehen? Und wenn ja, war es wirklich klug, mich weiter mit diesem Fall zu befassen?
»Lust auf Schokolade?«, fragte Anouk.
»Nein, danke.« Ich sah sie an, während ich über diese Spielplatzoperation und all die Kisten mit Süßigkeiten hier im Lagerraum nachdachte.
»Wo kriegt ihr die Schokolade eigentlich her?«, erkundigte ich mich.
Anouk warf mir einen abschätzigen Blick zu. »Diese Art von Fragen solltest du lieber nicht stellen, Nelle.« Es klang wie eine Warnung, deswegen hakte ich nicht weiter nach. Fürs Erste jedenfalls.
»Ach ja, eine Sache noch«, sagte ich, als ich schon fast zur Tür raus war.
Anouk drehte sich zu mir um und gab sich keinerlei Mühe, ihre Verärgerung zu verbergen. »Was ist denn?«
»Eddie hat erwähnt, dass ihr Rivalen habt? Einen gewissen …« Ich zog mein Notizbuch zurate. »Waffles McKenzie?«
»Ja, der hat seine eigene Gang«, antwortete sie. »Er verschachert seine Ware drüben in der Nähe der Altman Street, im Hinterzimmer eines Gebrauchtwarenladens.«
»Was, etwa bei Bobby Singh?«, fragte ich überrascht.
»Ja. Kennst du ihn?«
Ich nickte. Bobby war ein Freund von mir.
»Na dann. Ist sonst noch was, Fräulein Detektivin?«
»Nein. Danke noch mal.« Ich ging los, um Cody einzusammeln. Er war schon wieder mitten in einem Murmelspiel, stand aber widerspruchslos auf, als ich ihn rief.
Wir verließen den Spielplatz. Ich nahm seine Hand, die warm und von der vielen Schokolade ganz klebrig war. Als wir die Straße überquerten, glitt auf der anderen Straßenseite im Schatten der Bäume ein schwarzes Auto aus einer Parklücke, überholte uns und fuhr davon.
Kapitel 4
Nachdem ich Cody zu Hause abgesetzt hatte, machte ich mich wieder auf den Weg. Als ich am Ohls Square vorbeiradelte, war dort gerade eine Wahlkampfveranstaltung in vollem Gange. Die erste Amtszeit des Bürgermeisters war beinahe rum und jetzt kämpfte er für seine Wiederwahl. Der Platz war mit Fahnen und Wimpeln festlich geschmückt und in der Mitte, neben dem Springbrunnen, stand eine Bühne. Eine Blaskapelle spielte und an der Bühne waren Ballons festgebunden. Freiwillige verteilten Möhren und Selleriestangen, auch wenn die Leute, die sie entgegennahmen, nicht sonderlich begeistert wirkten.
Ich hielt an und ließ mir von einem der Freiwilligen ein Glas Rote-Bete-Saft in die Hand drücken, was ich jedoch sofort bereute, kaum dass ich einen Schluck davon getrunken hatte. In dem Moment lief MrLloyd-Williams von Teddys, Tollereien & Tüddelkram, dem örtlichen Spielwarenladen, an uns vorbei.
»Nein, vielen Dank, junge Dame, ich lege keinen Wert auf eine Karotte!«, verkündete er mit seinem britischen Akzent, als eine Frau ihm eine hinhielt. »Wenn ich Gemüse essen wollte, wäre ich in England geblieben, wo man wenigstens den Anstand besitzt, es vorher zu kochen!« Er stapfte empört davon.
Jemand klopfte aufs Mikro, worauf ein schrilles Rückkopplungskreischen aus den Lautsprechern vor der Bühne gellte. Dann trat Bürgermeister Thornton vor.
»Hallo!«
Er hob die Arme. Die Menge fing an zu applaudieren.
»Habt ihr alle Spaß?«
»Ja!«
Noch mehr Applaus. Der Bürgermeister lächelte strahlend auf uns herab. Da oben auf der Bühne wirkte er wohlwollend und gelöst.
»Gesundheit! Wohlstand! Folgt euren Träumen!«
»Ja!«
»Esst euer …«
»Gemüse!«
»Esst euer …«
»Gemüse!«
»Esst euer …«
»G…«





























