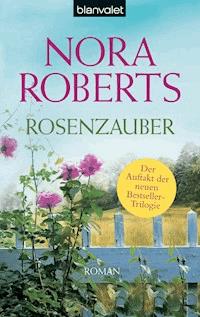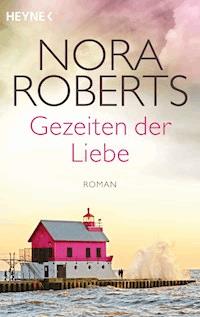
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Quinn-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Die Liebe kann alles heilen, selbst die Schmerzen der Vergangenheit. Das Leben des schweigsamen Naturmenschen Ethan Quinn verläuft in geregelten Bahnen - doch seine unerfüllte Liebe zu Grace Monroe lässt ihn nicht zur Ruhe kommen. Nora Roberts romantische Familiensaga von der Küste Marylands.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Ethan schüttelte die Traumbilder ab und rollte sich aus dem Bett. Draußen war es noch dunkel, aber das war nichts Ungewöhnliches, denn sein Tagewerk begann stets vor Anbruch der Morgendämmerung. Das Leben, das er führte, gefiel ihm – die Stille, die schlichte Routine, die harte Arbeit, die er Tag für Tag leistete.
Er war zutiefst dankbar, weil er die Wahl gehabt und sich für dieses Leben hatte entscheiden können. Die beiden Menschen, denen er dies verdankte, waren zwar tot, für Ethan war das hübsche Haus am Wasser jedoch immer noch von ihrem Geist erfüllt. Wenn er morgens allein in der Küche frühstückte und den Kopf hob, rechnete er halb damit, daß seine Mutter in der Tür erschien – herzhaft gähnend, die rote Haarmähne vom Schlaf wild zerzaust, die Augen halb geschlossen.
Obgleich sie bereits vor sieben Jahren gestorben war, wärmten und trösteten ihn diese vertrauten Bilder und Gedanken noch immer.
Schmerzlicher war die Erinnerung an den Mann, den er als seinen Vater betrachtet hatte. Knapp drei Monate nach dem Tod von Raymond Quinn war der Kummer einfach noch zu frisch. Ray war unter nach wie vor ungeklärten, rätselhaften Umständen ums Leben gekommen. Der tödliche Autounfall hatte sich auf trockener Fahrbahn ereignet, an einem hellen Tag im März, an dem ein erster Hauch von Frühling in der Luft lag. Augenzeugen gab es keine.
Raymond Quinn war offenbar zu schnell gefahren und hatte in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen verloren. Oder er hatte absichtlich das Lenkrad herumgerissen. Tests hatten ergeben, daß keine physische Beeinträchtigung vorlag, die erklärte, warum er frontal gegen den Telefonmast gerast war.
Doch gab es Hinweise auf emotionale Probleme, die Ethan schwer zu schaffen machten.
Tief in seine Gedanken versunken, trat er im Bad vor den Spiegel. Er zog flüchtig den Kamm durch sein vom Duschen noch feuchtes, von der Sonne aufgehelltes braunes Haar. Die dichten Wellen ließen sich ohnehin kaum bändigen. Dann begann er mit seiner Rasur. Ernste blaue Augen blickten ihm aus dem beschlagenen Spiegel entgegen, als er Schaum und Bartstoppeln von seinem Gesicht kratzte – einem gebräunten, markanten Gesicht, hinter dessen Zügen sich Geheimnisse bargen, die er fast nie mit jemandem teilte.
An seinem Kinn fiel eine helle Narbe auf, ein Andenken an eine Prügelei mit seinem ältesten Bruder. Seine Mutter hatte die Wunde selbst genäht. Wie praktisch, daß sie Ärztin gewesen war, dachte Ethan und fuhr geistesabwesend mit dem Daumen über die Kerbe. Drei Söhne, und mindestens einer mußte immer irgendwie zusammengeflickt werden.
Ray und Stella hatten sie bei sich aufgenommen – drei halbwüchsige Jungen, verschreckt, verwildert, zutiefst mißtrauisch. Und es war ihnen tatsächlich gelungen, sie alle zu einem festen Familienverband zusammenzuschmieden.
Wenige Monate vor seinem Tod hatte Ray dann noch einen vierten Jungen mit nach Hause gebracht.
Seth DeLauter war jetzt einer von ihnen. Daran bestand für Ethan nicht der geringste Zweifel. Für andere schon, wie man hörte. In St. Christopher’s, der Kleinstadt, in der er wohnte, wurde gemunkelt, daß Seth nicht bloß einer von Ray Quinns Streunern sei, sondern sein unehelicher Sohn. Ein Kind, das er noch zu Lebzeiten seiner Frau mit einer anderen gezeugt habe. Einer jüngeren Rivalin.
Bloße Gerüchte konnte Ethan mühelos ignorieren, nicht jedoch die Tatsache, daß der zehnjährige Seth die Augen von Ray Quinn hatte.
Die Schatten, die diese Augen trübten, kannte Ethan. Ein Leidtragender erkannte stets den anderen. Er wußte, daß Seth’ Leben, bevor Ray ihn zu sich geholt hatte, ein Alptraum gewesen war. Er selbst hatte einen ähnlichen Höllentrip hinter sich.
Aber jetzt ist der Kleine ja in Sicherheit, dachte Ethan, als er eine ausgebeulte Baumwollhose und ein verschossenes Arbeitshemd anzog. Jetzt war er ein Quinn, wenn auch noch nicht in streng formaljuristischem Sinn. Darum würde sich Phillip kümmern. Ethan verließ sich darauf, daß sein gewissenhafter Bruder zusammen mit dem Rechtsanwalt alle offenen Fragen klären könnte. Und Cameron, dem ältesten der Quinn-Brüder, war es bereits gelungen, eine emotionale Bindung zu Seth zu knüpfen.
Eine Bindung mit extremen Höhen und Tiefen, dachte Ethan grinsend. So manches Mal erinnerten sie an zwei rivalisierende Kater, die gefährlich fauchend ihre Krallen wetzten, um einander an die Kehle zu gehen. Doch nachdem Cam seine hübsche Sozialarbeiterin geheiratet hatte, würden sie vielleicht Frieden schließen.
Und Ruhe und Frieden gingen Ethan über alles.
Was nicht hieß, daß sie nicht noch allerlei andere Kämpfe zu bestehen hatten – zum Beispiel mit der Versicherung, die sich weigerte, Rays Police einzulösen, da der Verdacht auf Suizid nicht ausgeräumt sei. Ethans Magen zog sich zusammen, und er mußte tief durchatmen. Sein Vater hätte niemals Hand an sich gelegt, niemals! Völlig undenkbar. Der Große Quinn hatte sich alle Problemen mutig gestellt und seine Söhne dazu erzogen, seinem Beispiel nachzueifern.
Doch der Verdacht hing über der Familie wie eine dunkle Wolke, die sich nicht vertreiben lassen wollte. Hinzu kamen noch weitere Komplikationen. Einige Zeit vor Rays Tod war plötzlich Seth’ Mutter in St. Christopher’s aufgetaucht und hatte den Vorwurf erhoben, Ray habe sie sexuell belästigt. Sie hatte ihn sogar beim Dekan des Colleges angezeigt, an dem Ray englische Literatur lehrte. Das Verfahren war zwar eingestellt worden – ihre Aussage enthielt einfach zu viele Ungereimtheiten, zu viele Lügen -, aber jeder wußte, daß diese Episode seinen Vater zutiefst erschüttert hatte. Kurz nachdem Gloria DeLauter die Stadt verlassen hatte, war Ray ebenfalls weggefahren.
Er war mit Seth zurückgekommen.
Dann gab es da noch den Brief, den man nach dem Unfall in Rays Wagen gefunden hatte; einen erpresserischen Drohbrief von Gloria DeLauter. Wie sich herausstellte, hatte Ray ihr Geld gegeben – viel Geld.
Inzwischen war die Frau untergetaucht. Ethan hoffte, sie nie wieder zu sehen, obgleich das Gerede in der Stadt wohl erst dann verstummen würde, wenn Rays Verhältnis zu ihr geklärt wäre. Ihm selbst waren in dieser Hinsicht die Hände gebunden; er wußte zu wenig.
Ethan trat in den Flur und klopfte an die Tür des Zimmers gegenüber. Er hörte ein Stöhnen, dann undeutliches Gemurmel, gefolgt von einem wüsten Fluch. Ethan wandte sich ab und ging nach unten. So wie jeden Tag würde Seth sich auch heute beschweren, weil er so früh aufstehen mußte. Aber da Cam und Anna in Italien Flitterwochen machten und Phillip erst am Wochenende aus Baltimore zurückkam, oblag es Ethan, den Jungen morgens aus den Federn zu holen und bei einem Freund abzuliefern, mit dem er später zusammen zur Schule ging.
Ein Fischer mußte nun mal vor Sonnenaufgang draußen auf dem Wasser sein, zumal die Krebssaison mittlerweile in vollem Gang war. Deshalb würde sich Seth bis zu Cams und Annas Rückkehr wohl oder übel nach der Decke strecken müssen.
Ethan fand sich in dem dunklen, stillen Haus problemlos zurecht. Er besaß zwar eine eigene Bleibe, aber es war Teil der Vereinbarung mit den Behörden, daß die Quinn-Brüder unter einem Dach lebten und sich die Verantwortung für den Jungen teilten. Nur unter dieser Bedingung hatte man ihnen die Vormundschaft zugesprochen.
Es störte Ethan nicht, Verantwortung zu übernehmen; obwohl ihm sein kleines Haus und das ungestörte, selbstgenügsame Leben, das er dort geführt hatte, fehlten.
Er schaltete das Licht in der Küche an. Gestern war Seth an der Reihe damit gewesen, nach dem Essen Ordnung zu schaffen, eine Aufgabe, die er ausgesprochen halbherzig erfüllt hatte. Ethan übersah das klebrige Chaos auf dem Eßtisch geflissentlich und ging direkt zum Herd hinüber.
Dort lag Simon, sein Hund, streckte sich träge und wedelte zur Begrüßung mit dem Schwanz. Während Ethan den Kaffee aufsetzte, kraulte er dem Retriever zerstreut den Kopf.
Sein Traum fiel ihm wieder ein, die Bilder, die kurz vor dem Aufwachen an ihm vorübergezogen waren . . . Er fuhr mit seinem Vater auf dem Kutter raus, um die Krebsfallen zu überprüfen. Die Sonne schien heiß vom Himmel herab und blendete ihn; das Wasser lag still und spiegelglatt da. Alles war so lebensnah, daß er sogar den Geruch des Wassers, den Geruch nach Fisch und Schweiß wahrnahm.
Die Stimme seines Vaters, die er noch so gut in Erinnerung hatte, übertönte den Motorenlärm und das Geschrei der Möwen: »Ich wußte, daß Seth bei euch dreien in guten Händen sein würde.«
»Du mußtest ja nicht gleich sterben, um das zu wissen.« In seiner Stimme schwang Ärger, unterdrückte Wut auf seinen Vater, über seinen Tod mit, die er sonst erfolgreich verdrängte.
»Darum ging es mir ja auch gar nicht«, erwiderte Ray gelassen und pulte Krebse aus der Falle, die Ethan mit dem Fischhaken an Bord gehievt hatte. Seine dicken, leuchtend orangefarbenen Handschuhe reflektierten das Sonnenlicht. »Vertrau mir. Schau mal, was für prachtvolle Muscheln, und Blaukrabben noch und noch!«
Ethan warf einen Blick auf das Gewimmel im Drahtkorb und schätzte automatisch Größe und Anzahl der Meerestiere. Aber sein Interesse galt im Moment nicht dem Fang, jedenfalls nicht vorrangig. »Du willst, daß ich dir vertraue, aber du erzählst mir niemals etwas.«
Ray drehte sich um und schob sich die hellrote Mütze in den Nacken, unter der seine wilde Silbermähne hervorquoll. Der Wind spielte mit seinem Haar und wellte die Karikatur von John Steinbeck, die über seiner breiten Brust sein T-Shirt zierte. Der berühmte Schriftsteller hielt ein Schild in die Höhe, das aller Welt mitteilte, daß er Arbeit im Tausch gegen Naturalien biete. Sein deprimiertes Gesicht sprach Bände.
Im Gegensatz zu ihm strotzte Ray Quinn nur so von Kraft und positiver Energie. Die tiefen Runzeln in seinen geröteten Wangen taten dem Eindruck, den er bot, keinen Abbruch: ein mit sich und der Welt zufriedener vitaler Mann in den Sechzigern, der noch viele Jahre zu leben hatte.
»Du mußt deine eigenen Antworten, deinen eigenen Weg finden.« Ray lächelte ihm aufmunternd zu. Die Fältchen rings um seine strahlend blauen Augen vertieften sich. »So bringt es dir viel mehr. Du weißt ja nicht, wie stolz ich auf dich bin.«
Ethans Kehle brannte, sein Herz war schwer wie ein Stein. Dennoch legte er mit routinierten Handgriffen neue Köder in die Falle, bevor er den Blick auf die orangefarbenen Schwimmer richtete, die ringsum auf der Wasseroberfläche trieben. »Weshalb?«
»Weil du der bist, der du bist – Ethan Quinn.«
»Ich hätte dich öfter besuchen müssen. Ich hätte dich nicht so lang allein lassen dürfen.«
»Ach, Unsinn.« Ray winkte ungeduldig ab. »Ich war doch kein Pflegefall. Mein Gott, wie mich die ewigen Selbstvorwürfe nerven, daß du dich angeblich nicht genug um mich gekümmert hast! Du warst sauer auf Cam, weil er in Europa lebte, und auf Phillip, weil er nach Baltimore gegangen ist. Aber jeder gesunde junge Vogel wird einmal flügge und verläßt das Nest. Und deine Mutter und ich haben nur gesunde junge Vögel großgezogen.«
Als Ethan etwas erwidern wollte, hob Ray die Hand. Eine für ihn so typische Geste – der Professor, der eine zentrale wissenschaftliche Erkenntnis formuliert und keine Unterbrechungen duldet -, daß Ethan schmunzelte. »Sie haben dir gefehlt. Nur deshalb hast du dich so aufgeregt. Sie sind gegangen, während du geblieben bist und ihrer Gesellschaft beraubt warst. Aber jetzt hast du sie ja wieder, nicht wahr?«
»Sieht ganz so aus.«
»Und obendrein hast du noch eine bildhübsche Schwägerin hinzubekommen, du hast die Bootswerkstatt und das hier . . .« Ray zeigte auf das Wasser, die auf und ab hüpfenden Schwimmer, das hohe, naßglänzende Seegras am Ufer, in dem unbeweglich ein Reiher stand, wie zur Salzsäule erstarrt. »Außerdem verfügst du über eine Eigenschaft, auf die Seth dringend angewiesen ist – Geduld. In mancher Hinsicht übertreibst du es damit vielleicht sogar.«
»Was soll denn das heißen?«
Ray stieß einen Seufzer aus. »Dir fehlt noch etwas ganz Bestimmtes zu einem erfüllten Leben, Ethan. Aber du wartest und wartest, erfindest immer neue Ausreden und rührst keinen Finger, um etwas daran zu ändern. Wenn du deine Hemmungen nicht bald über Bord wirfst, könnte es zu spät sein.«
»Was meinst du?« Ethan zuckte die Schultern und schipperte zur nächsten Boje. »Ich hab’ doch alles, was ich brauche und was ich mir wünsche.«
»Frag dich nicht, was dir fehlt, sondern wer.« Ray verdrehte die Augen, dann rüttelte er Ethan sacht an der Schulter. »Wach auf, Junge.«
Und er war aufgewacht, obgleich er noch die große, vertraute Hand seines Vaters auf seiner Schulter spürte.
Antworten auf seine drängenden Fragen hatte er nicht bekommen. Ein rätselhafter Traum. Nachdenklich ließ er sich mit seiner Kaffeetasse am Tisch nieder.
1. Kapitel
»’n paar prächtige Butterkrebse haben wir uns da an Land gezogen, Capt’n.« Jim Bodine pulte die Krebse aus der Falle und warf die ansehnlichsten Exemplare in den Wassertank. Die klappernden Scheren schreckten ihn nicht – die Narben an seinen breiten Händen waren der beste Beweis dafür. Er trug zwar die traditionellen Handschuhe der Fischer, die sich jedoch – wie einem jeder, der sich auskannte, bestätigen konnte – im Nu abnutzten. Und hatten sie erst irgendwo ein Loch, schnappten die Krebse todsicher zu.
Er arbeitete in gleichmäßigem Rhythmus, stand breitbeinig da, um auf dem schaukelnden Boot das Gleichgewicht zu halten, und blinzelte gegen die Sonne. Sein vom Wetter und vom Leben gegerbtes Gesicht machte es einem schwer, sein wahres Alter zu schätzen. Man konnte auf fünfzig oder auch auf achtzig Jahre tippen; Jim war es ohnehin herzlich egal, was andere Leute über ihn dachten.
Meist gab er sich reserviert und wortkarg, was Ethan, den ›Capt’n‹, jedoch nicht im geringsten störte.
Ethan nahm jetzt Kurs auf die nächste Falle. Die Ruderpinne, die auf seinem Boot wie bei den meisten der Fischer das Steuerrad ersetzte, hielt er mit der rechten Hand. Mit der Linken bediente er Gashebel und Gangschaltung. Auf der Fahrt längs der Leine mit den Fallen mußten ständig kleinere Richtungskorrekturen vorgenommen werden.
Die Chesapeake Bay zeigte fast jeden Tag ein anderes Gesicht. Mal gab sie sich großzügig und goß ein wahres Füllhorn an Schätzen über die Fischer aus, dann wieder machte sie ihnen das Leben schwer und ließ die Männer für magere Ausbeute kräftig schwitzen.
Ethan kannte die Bucht, als wäre sie ein Teil von ihm selbst – ihre Unbeständigkeit, ihren Wankelmut. Die größte Meeresbucht des Kontinents maß von Norden nach Süden dreihundert Kilometer, war vor Annapolis ganze sechs Kilometer und an der Mündung des Potomac nur fünfundvierzig Kilometer breit. St. Christopher’s lag am südlichen Küstenabschnitt Marylands und profitierte von den ergiebigen Fanggründen der Bucht, hatte jedoch auch unter ihren Launen zu leiden.
Hier bestand die Küste aus Marschland, geädert von Binnengewässern mit steilen Ufern, die von Eukalyptus und Eichen beschattet wurden. Eine magische Welt mit Gezeitenbächen und tückischen Sandbänken, wo wilder Sellerie und Entengras wuchsen. Diese Welt mit ihrem jähen Wechsel der Jahreszeiten, plötzlich losbrechenden Gewittern und den zeitlosen, unwandelbaren Geräuschen und Gerüchen des Wassers war Ethans Universum.
Er griff nach seinem Fischhaken, paßte den richtigen Zeitpunkt ab und holte mit den fließenden Bewegungen eines Tänzers die Leine der nächsten Falle ein.
Wenig später tauchte die Falle aus dem Wasser auf, verklebt mit Seetang, Resten alter Köder – und randvoll mit Krebsen.
Als die Falle in der Halterung einrastete, fing die Sonne sich in den hellroten Zangen der ausgewachsenen Blaukrabben-Weibchen und den zornfunkelnden Augen der Männchen.
»Nicht schlecht.« Mehr sagte Jim nicht, als er die Falle an Bord hievte, als wiege sie nicht etliche Pfund, sondern nur einige wenige Gramm.
Es herrschte rauher Seegang, was auf einen nahenden Sturm schließen ließ. Als sie weiterfuhren, bediente Ethan die Steuerung mit den Knien. Dabei blickte er immer wieder prüfend zu den dunklen Wolken, die sich am westlichen Horizont zusammenballten.
Sie hatten noch genug Zeit, um die Fallen im Herzen der Bucht abzufahren. Er wußte, daß Jim dringend Geld benötigte – und auch er nahm, was er kriegen konnte, um es in die noch junge Bootswerkstatt zu stecken, die er mit seinen Brüdern zusammen aus der Taufe gehoben hatte.
Ja, die Zeit reicht gerade noch, sagte er sich, als Jim neue Köder aus tiefgefrorenen Fischresten in eine Falle legte und diese ins Wasser warf. Weit über die Reling gebeugt, holte Ethan den nächsten Schwimmer ein.
Simon, Ethans Chesapeake Bay-Retriever, stand mit hängender Zunge neben ihm, die Vorderpfoten auf das Dollbord gestützt. So wie sein Herrchen war er draußen auf dem Wasser in seinem Element.
Die Männer arbeiteten schweigend weiter; sie verständigten sich nur hin und wieder durch einen abgehackten Laut, ein Schulterzucken oder einen unterdrückten Fluch. Da es in dieser Saison Krebse in Hülle und Fülle gab, lohnte sich die Arbeit. In manchen Jahren bot sich ein völlig anderes Bild; dann schien der Winter nahezu den ganzen Bestand an Krustentieren vernichtet zu haben. Oder man hatte den Eindruck, daß das Wasser sich nie genug erwärmen würde, um sie aus ihren Schlupflöchern zu locken.
In solchen Jahren gerieten die Fischer in arge Bedrängnis, wenn sie nicht über zusätzliche Einkommensquellen verfügten. Deshalb hatte Ethan vor, sich ein zweites Standbein zu schaffen – durch den Bootsbau.
Das erste Boot der Quinn-Brüder war fast fertig. Ein erstklassiges, wunderschönes Boot, fand Ethan. Cameron hatte auch bereits einen Kunden für das zweite aufgetrieben – irgendeinen reichen Fuzzi aus seinen Regatta-Tagen –, so daß sie in Kürze mit ihrem nächsten Projekt beginnen könnten. Keine Frage, sein Bruder würde noch das ganz große Geld anlocken.
Sie würden es schaffen, sagte er sich, mochte Phillip auch noch so skeptisch sein.
Er blickte zur Sonne, um abzuschätzen, wie spät es war, und musterte sorgfältig die langsam nach Osten ziehende Wolkenbank.
»Wir laufen ein, Jim.«
Nach nur acht Stunden auf dem Wasser war dies ein ungewöhnlich kurzer Arbeitstag. Aber Jim protestierte nicht. Er wußte, daß Ethan nicht in erster Linie wegen des nahenden Sturms den Hafen ansteuerte. »Der Junge kommt gleich aus der Schule?« fragte er.
»Ja.« Seth war zwar selbständig genug, um nachmittags eine Zeitlang allein zu bleiben, aber Ethan wollte das Schicksal nicht unnötig herausfordern. Ein Zehnjähriger mit dem Temperament von Seth zog Ärger an wie ein Magnet.
Wenn Cam in etwa zwei Wochen aus Europa zurückkam, würden sie sich die Aufsicht über Seth wieder teilen. Bis dahin jedoch mußte Ethan allein die Augen offenhalten und aufpassen.
Das aufgewühlte Wasser inmitten der Bucht bot ein Spiegelbild des metallgrauen Himmels. Aber weder die beiden Männer noch der Hund zuckten mit der Wimper, als das Boot abwechselnd die steilen Wellenkämme erklomm und in die tiefen Täler hinabglitt. Simon stand mit hocherhobener Schnauze am Bug und ließ sich den Wind um die Nase wehen. Ethan, der den Kutter selbst gebaut hatte, war sicher, daß er dem Sturm standhalten würde. Nicht minder zuversichtlich zog Jim sich in den Schutz der Plane zurück und zündete sich zwischen den hohlen Händen eine Zigarette an.
Im Hafen von St. Chris wimmelte es von Touristen. Jedes Jahr im Juni strömten sie in Scharen aus den Vororten von Washington und Baltimore herbei. Ethan nahm an, daß sie St. Christopher’s mit seinen schmalen Gassen, den schindelgedeckten Häusern und den winzigen Läden wohl für malerisch hielten. Sie sahen gern zu, wie die Krabbensammler mit flinken Fingern die Meerestiere sortierten, kosteten von den knusprigen Krebspfannkuchen und freuten sich darauf, ihren Freunden zu erzählen, daß sie sich die berühmte Krebsconsommé zu Gemüte geführt hatten. Meist stiegen sie in den kleinen Pensionen ab – St. Chris wies die stolze Anzahl von sage und schreibe vier Familienpensionen auf – und ließen in den Restaurants und Geschenkshops die Kassen klingeln.
Ethan störten sie nicht. In den Jahren, wenn die Bucht mit ihren Schätzen geizte, erhielt der Tourismus die Stadt am Leben. Außerdem hoffte er, daß sich mit der Zeit so manch einer der Touristen mit dicker Brieftasche zu der Einsicht durchringen würde, daß ein maßgefertigtes Segelboot aus Holz sein geheimer Kindheitstraum war.
Als Ethan am Pier anlegte, frischte der Wind noch einmal auf. Gelenkig sprang Jim von Bord, um die Leinen zu vertäuen. Seiner kurzen Beine und seines untersetzten Körpers wegen erinnerte er an einen Frosch – einen Frosch, der in weißen Gummistiefeln und mit einer ölverschmierten Baseballmütze auf dem Kopf an Land stakste.
Auf ein Handzeichen von Ethan ließ sich Simon auf dem Deck nieder, um zu warten, bis die Männer den Fang ausgeladen hatten. Über ihm flatterte die grüne, von der Sonne ausgebleichte Plane in der Brise.
Als Ethan den Kopf hob, entdeckte er Pete Monroe, der zielstrebig auf ihren Anlegeplatz zukam. Sein stahlgraues Haar war unter einem verbeulten breitkrempigen Hut verborgen; sein stämmiger Körper steckte in einer ausgeleierten Khakihose und einem rotkarierten Hemd.
»Erstklassiger Fang, Ethan.«
Ethan lächelte. Er mochte Mr. Monroe recht gern, obgleich es hieß, daß er ein notorischer Geizhals sei und das ›Monroe’s Crab House‹, die Fabrik, in der die Krebse sortiert und verarbeitet wurden, mit eiserner Hand regiere. Aber welcher Unternehmer, der auf sich hielt, gab sich schon mit dem Erreichten zufrieden und versuchte nicht, immer noch mehr Profit herauszuschlagen?
Ethan schob sich die Mütze aus der Stirn und kratzte sich am Nacken, wo ihn feuchte Haare und Schweißtröpfchen kitzelten. »Ja, wir können wirklich zufrieden sein.«
»Ihr seid heute früh zurück.«
»Ein Sturm zieht auf.«
Monroe nickte. Seine Angestellten, die draußen unter den gestreiften Markisen gearbeitet hatten, zogen sich allmählich ins Innere der Fabrik zurück. Der Regen würde bald auch die Touristen von der Straße vertreiben; sie würden einen Kaffee trinken oder ein Eis essen gehen. Da das ›Bayside Eats‹-Restaurant zur Hälfte ihm gehörte, konnte dies Pete Monroe nur recht sein.
»Sieht so aus, als hättet ihr an die zweieinhalb Tonnen gefangen.«
Ethan lächelte in sich hinein. Hätte man ihm in diesem Moment gesagt, daß er etwas von einem Piraten an sich hatte, wäre er vielleicht überrascht, nicht jedoch gekränkt gewesen. »Eher drei Tonnen, schätze ich mal.« Er kannte den geltenden Marktpreis genau, aber feilschen würden sie dennoch. Das gehörte mit zum Geschäft. Seelenruhig holte er eine Zigarre aus seiner Hemdtasche und zündete sie an.
Als er später mit dem Kutter nach Hause fuhr, fielen die ersten dicken Regentropfen. Er fand, daß er einen fairen Preis für seine Krebse erzielt hatte – nahezu drei Tonnen waren es natürlich gewesen. Wenn es den ganzen Sommer über so gut lief, war zu überlegen, ob er im nächsten Jahr nicht noch hundert Fallen mehr auslegen und vielleicht sogar stundenweise eine Hilfscrew anheuern sollte.
Die Austernfischerei in der Bucht hatte längst nicht mehr die frühere Bedeutung, nicht seit Parasiten den Bestand erheblich dezimiert hatten. Hinter den Fischern lagen mehrere entbehrungsreiche Jahre. Trotzdem war Ethan optimistisch. Nur ein oder zwei ergiebige Krebssaisons, dann hatte er, was er brauchte. Den Löwenanteil der Einnahmen würde er in das Bootsgeschäft investieren, den Rest verschlangen die Anwaltshonorare. Bei diesem Gedanken ärgerte er sich und kniff unwillig die Lippen zusammen, während er das Boot vorsichtig durch einige besonders hohe Wellen heimwärts lotste.
Eigentlich war es eine Schande, daß sie diesen gelackten Rechtsverdrehern soviel schönes Geld in den Rachen werfen mußten, um den guten Namen ihres Vaters zu verteidigen. Das Gerede würde dadurch ohnehin nicht verstummen. Damit wäre erst Schluß, wenn die Klatschtanten der Stadt ein lohnenderes Thema fanden als das Leben und Sterben von Ray Quinn.
Ein lohnenderes Thema als Ray und als Seth, dachte Ethan und starrte auf die von dem prasselnden Regen aufgepflügte Wasseroberfläche. Fast jeder zerriß sich das Maul über den Jungen mit den strahlend blauen Augen Ray Quinns.
Der Klatsch, der ihn persönlich betraf, ließ ihn völlig kalt. Ihn konnten die Leute ruhig durchhecheln, bis ihnen die Zunge aus dem Mund hing. Doch beim kleinsten bösen Wort gegen den Mann, den er mit jeder Faser seines Herzens geliebt hatte, sah er rot.
Aus eben diesem Grund würde er schuften bis zum Umfallen, um die Anwaltskosten zu bezahlen. Und er würde tun, was in seiner Macht stand, um den Kleinen vor allem Üblen zu bewahren.
Donnerschläge ließen den Himmel erbeben und hallten auf dem Wasser wider wie Kanonenschüsse. Es wurde so düster, als sei plötzlich die Abenddämmerung hereingebrochen; die dunklen Wolken rissen auf und ergossen ihren Inhalt über Land und Wasser. Es schüttete wie aus Kübeln. Dennoch beeilte Ethan sich nicht sonderlich, als er an seinem Pier andockte. Naß bis auf die Haut war er ohnehin schon.
Als sei er ganz seiner Meinung, sprang Simon mit einem Satz ins Wasser, um zum Ufer zu schwimmen, während sein Herrchen noch die Leinen sicherte. Ethan nahm seinen Provianteimer und wandte sich dem Haus zu. Die Sohlen seiner Arbeitsstiefel quietschten auf dem Holzsteg, als er sich vom Kutter entfernte.
Auf der hinteren Veranda zog er die Stiefel aus. In seiner Jugend hatte seine Mutter ihn sich so oft zur Brust genommen, wenn er bei Regen in Schuhen durchs Haus ging und überall Fußspuren hinterließ, daß er sich das gründlich abgewöhnt hatte. Dennoch dachte er sich nichts dabei, den triefnassen Hund vor sich durch den Türspalt schlüpfen zu lassen – bis er den blitzblanken Fußboden und die spiegelnden Arbeitsflächen in der Küche sah.
Mist, dachte er, als sein Blick auf die frischen Pfotenabdrücke fiel. Simons freudiges Gebell war zu hören. Es folgte ein schrilles Kreischen, dann neues Gebell und lautes Lachen.
»Pfui, du machst ja alles wieder dreckig!« rief eine weibliche Stimme – zuerst gedämpft, weich, belustigt, dann zunehmend entschlossen. Ethan zuckte schuldbewußt zusammen. »Raus hier, Simon! Los, ab mit dir. Du wartest draußen auf der Veranda, bis du trocken bist.«
Erneut kreischte jemand, ein kleines Mädchen kicherte, ein Junge lachte. Die ganze Bande ist hier, dachte Ethan, während er sich den Regen aus dem Haar schüttelte. Als er Schritte kommen hörte, stürzte er zum Besenschrank, um schleunigst einen Wischmop zu organisieren.
»Oh, Ethan.« Grace Monroe stand vor ihm, die Hände in die schmalen Hüften gestemmt. Sie schaute erst ihn an, dann die Pfotenabdrücke auf dem frisch gebohnerten Fußboden.
»Ich kümmere mich sofort darum. Tut mir leid.« Als er feststellte, daß der Wischmop noch feucht war, wich er verlegen ihrem Blick aus. »Ich hab’ nicht aufgepaßt«, murmelte er und füllte am Spülbecken einen Eimer mit Wasser. »Ich hatte keine Ahnung, daß du heute kommst.«
»Ach, ihr paßt also nur auf, wenn ich komme?«
Er hob eine Schulter. »Der Boden war schon schmutzig, als ich heute morgen aus dem Haus gegangen bin. Da hätte das bißchen Wasser doch keine Rolle mehr gespielt.« Erst allmählich wurde er eine Spur lockerer. Neuerdings schien es immer länger zu dauern, ehe er sich in Grace’ Anwesenheit entspannen konnte. »Hätte ich gewußt, daß du mir deswegen an die Kehle springen würdest, dann hätte ich Simon gnadenlos aus dem Haus verbannt.«
Grinsend drehte er sich zu ihr um. Grace seufzte übertrieben. »Ach, gib den Mop schon her. Ich mach’s lieber selber.«
»Nein. Mein Hund – mein Dreck. Habe ich da übrigens gerade Aubrey gehört?«
Grace lehnte sich an den Türrahmen. Sie war müde, aber das war ja nichts Neues. Schließlich hatte sie bereits acht Stunden Arbeit hinter sich. Und am Abend mußte sie noch vier Stunden im Shiney’s Pub bedienen.
An manchen Abenden, wenn sie völlig ausgepowert ins Bett fiel, spürte sie ihre Füße kaum noch.
»Seth paßt für mich auf sie auf. Ich mußte meine Terminplanung ändern. Heute früh hat Mrs. Lynley angerufen, um mich zu bitten, erst morgen bei ihr sauberzumachen. Ihre Schwiegermutter aus Washington hat sich zum Abendessen angesagt. Mrs. Lynley behauptet, für Schwiegermama sei jedes Staubkorn eine Versündigung gegen Gott und die Menschen. Es macht dir doch nichts aus, daß ich die Termine getauscht habe?«
»Komm zu uns, wann immer du kannst, Grace. Wir sind dir so oder so zu ewigem Dank verpflichtet.«
Während er aufwischte, musterte er sie aus den Augenwinkeln. Schon als Mädchen hatte sie ihm gefallen. Sie erinnerte ihn an einen Palomino – goldbraun und langbeinig. Das Haar trug sie kurz geschnitten wie ein Junge, doch er fand es hübsch, wie es sich um ihren Kopf schmiegte – ein glänzender Helm mit Ponyfransen.
Grace war zwar groß und schlank wie eines dieser Supermodels, aber das hatte nichts mit der geltenden Modevorschrift zu tun. Als Kind war sie geradezu dürr gewesen, erinnerte er sich. Zu der Zeit, als er nach St. Chris kam, mußte sie sieben oder acht Jahre alt gewesen sein. Demnach war sie jetzt Anfang zwanzig – und ›dürr‹ war längst nicht mehr das passende Wort, um ihre bezaubernde Figur zu beschreiben.
Eher schlank und biegsam wie eine Weidengerte, dachte er und wäre dann fast rot geworden wegen seiner Schwärmerei.
Sie lächelte ihn an. Prompt erwärmten sich ihre Augen zu weichem Meergrün, und auf ihren Wangen erschienen kleine Grübchen. Es amüsierte sie, ein so starkes, muskulöses Exemplar der Gattung Mann den Wischmop schwingen zu sehen.
»Habt ihr heute einen guten Fang eingebracht, Ethan?«
»Ja, einen ziemlich guten.« Er wischte gründlich auf – schließlich war er ein durch und durch gründlicher Mensch -, dann ging er zum Spülbecken, um Eimer und Mop zu säubern. »Ich hab’ tonnenweise Krebse an deinen Daddy verscherbelt.«
Bei der Erwähnung ihres Vaters verblühte Grace’ Lächeln. Seit sie damals mit Aubrey schwanger geworden war und Jack Casey geheiratet hatte, den Mann, den ihr Vater nur als ›diesen windigen Automechaniker aus dem Norden‹ bezeichnete, herrschte Eiszeit zwischen ihnen.
Letztlich hatte ihr Vater mit seinem Vorurteil recht behalten. Vier Wochen vor Aubreys Geburt hatte Jack sich aus dem Staub gemacht und sowohl ihre Ersparnisse und ihren Wagen als auch ihre Selbstachtung mitgehen lassen.
Aber sie hatte die Krise gemeistert, rief Grace sich in Erinnerung. Sie kam bestens allein zurecht. Und sie würde es auch weiterhin aus eigener Kraft schaffen, ohne Geld von ihrer Familie anzunehmen.
Im Nebenzimmer hörte sie Aubrey lachen, ein fröhliches Glucksen, das tief aus dem Bauch kam, und sogleich hob sich ihre Stimmung. Das war alles, was zählte – das Glück ihres kleinen Engels mit den funkelnden Augen und dem blonden Lockenkopf.
»Ich mache noch das Abendessen, bevor ich gehe.«
Ethan schaute sie an. Sie war ein wenig braun geworden, was ihr gut stand. Die Sonne hatte ihrer Haut einen warmen Perlmuttschimmer verliehen, der ihr schmales Gesicht mit dem trotzigen Kinn weicher erscheinen ließ.
Auf den ersten Blick sah man eine hochgewachsene kühle Blonde mit einem tollen Körper und einem Gesicht, das bewundernde Neugier weckte. Dann allerdings fielen die dunklen Ringe unter ihren großen grünen Augen auf – und die Müdigkeitsfältchen rings um ihren vollen Mund.
»Das ist doch nicht nötig, Grace. Geh lieber nach Hause und ruh dich aus. Du mußt doch heute abend noch im Shiney’s ran, oder?«
»Ich hab’ noch Zeit – und Seth hat sich Hamburger gewünscht. Wird nicht lange dauern.« Sie trat von einem Fuß auf den anderen. Ethan hörte nicht auf, sie anzustarren, und dieses eindringlichen, forschenden Blicke gingen ihr durch und durch. Ob sie sich jemals daran gewöhnen würde? »Was ist denn?« fragte sie und rieb an ihrer Wange. Hatte sie sich etwa bei der Arbeit schmutzig gemacht?
»Nichts . . . Tja, wenn du dann schon kochst, solltest du aber auch zum Essen bleiben.«
»Gern.« Sie entspannte sich wieder und ging zu ihm, um Eimer und Wischmop wegzuräumen. »Aubrey ist so gern hier bei dir und Seth. Warum gehst du nicht schon mal zu ihnen rein? Ich muß noch die Wäsche zusammenlegen, bevor ich mich um das Essen kümmern kann.«
»Ich helfe dir.«
»Kommt überhaupt nicht in Frage.« Das verbot ihr der Stolz. Die Quinns bezahlten sie, also tat sie ihre Arbeit – die ganze Arbeit. »Geh du nur – und vergiß nicht, Seth nach der Mathearbeit zu fragen, die er heute vormittag zurückbekommen hat.«
»Wie hat er abgeschnitten?«
»Eine Eins, wie üblich.« Sie zwinkerte ihm zu, dann scheuchte sie ihn ins Wohnzimmer. Seth war so blitzgescheit, dachte sie, als sie in die angrenzende Waschküche ging. Hätte sie als Mädchen nur über halb soviel Grips verfügt, dann hätte sie ihre Schulzeit nicht mit Träumen und Phantastereien vertrödelt.
Sie wäre dann in der Lage gewesen, einen Beruf zu erlernen, einen richtigen Beruf, nicht nur wie man in einem Pub bediente, die Häuser anderer Leute putzte oder Krabben sortierte. Eine Berufsausbildung hätte ihr aus der Klemme geholfen, als sie hochschwanger allein geblieben war und ihre Hoffnungen, in New York Tanz zu studieren, endgültig hatte begraben müssen.
Es war ohnehin nur ein Luftschloß gewesen, tröstete sie sich, als sie den Trockner leerräumte und die nasse Wäsche aus der Waschmaschine hineinschob. Träume sind Schäume, hatte ihre Mama immer gesagt. Aber soviel stand fest – sie hatte sich in ihrem Leben nur zwei Dinge gewünscht: als Tänzerin Karriere zu machen – und Ethan Quinn zu erobern.
Beides sollte nicht sein.
Leise seufzend drückte sie das noch warme, glatte Laken, das sie aus dem Wäschekorb genommen hatte, an ihre Wange. Ethans Laken — sie hatte es heute erst von seinem Bett abgezogen. Da hatte es noch seinen Duft verströmt, und eine Zeitlang hatte sie geträumt, wie es sein könnte, wenn er sie mögen und sie sich auf eben diesem Laken, in eben diesem Haus lieben würden.
Aber Träume hielten einen nur von der Arbeit ab, und schließlich mußte sie die Miete bezahlen und ihre kleine Tochter ernähren.
Energisch begann sie die Laken zusammenzufalten und auf dem rumpelnden Trockner zu stapeln. Es war beileibe keine Schande, sich seinen Lebensunterhalt als Putzfrau oder Bedienung in einem Pub zu verdienen. Ihre Arbeitgeber waren mit ihr zufrieden. Sie konnte sich nützlich machen, sie wurde gebraucht. Das genügte.
Der Mann, der nur so kurze Zeit ihr Ehemann gewesen war, hatte sie nicht gebraucht. Hätten sie einander geliebt, wirklich geliebt, dann wäre alles anders gekommen. Doch ihrem Motiv, sich mit ihm einzulassen, war das verzweifelte Bedürfnis zugrunde gelegen, zu jemandem zu gehören, als Frau begehrt zu werden . . . Und Jack? Grace schüttelte den Kopf. Sie hatte keine Ahnung, was Jack veranlaßt hatte, mit ihr eine Beziehung einzugehen.
Eine flüchtige Verliebtheit, die dummerweise mit ihrer Schwangerschaft geendet hatte? Jedenfalls war er sich sehr ehrenhaft vorgekommen, als er an jenem kühlen Herbsttag mit ihr zum Standesamt ging, um sich vom Friedensrichter mit ihr trauen zu lassen.
Mißhandelt hatte er sie nicht. Er hatte sich nicht vollaufen lassen und sie im Rausch verprügelt, wie sie es von anderen Männern gehört hatte, die ihre Frauen nicht mehr liebten. Er stellte auch keiner anderen nach – zumindest wußte sie nichts davon. Doch als Aubrey in ihr wuchs und ihr Bauch immer dicker wurde, stand helle Panik in seinen Augen.
Eines Tages war er dann ohne ein Wort verschwunden.
Und das Allerschlimmste war, dachte Grace jetzt, daß sie sich erleichtert gefühlt hatte.
Eines hatte Jack für sie getan – er hatte sie indirekt gezwungen, erwachsen zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Was er ihr hinterlassen hatte, war kostbarer als alle Sterne des Himmels – Aubrey.
Sie legte die gefaltete Wäsche in den Korb, klemmte ihn sich unter den Arm und ging ins Wohnzimmer.
Dort war ihr kleiner Schatz – Aubreys blonde Locken wippten, das hübsche Gesichtchen mit den Rosenwangen strahlte vor Freude. Munter plappernd schaukelte sie auf Ethans Schoß.
Mit ihren zwei Jahren sah Aubrey Monroe aus wie ein Botticelli-Engel. Sie hatte goldenes Haar, leuchtend grüne Augen und Grübchen in den Wangen; kleine Katzenzähnchen und schmale Hände mit langen Fingern.
Obwohl Ethan nur die Hälfte verstehen konnte, nickte er ernst.
»Und was hat Foolish dann gemacht?« fragte er, als er begriff, daß sie ihm etwas über den Welpen von Seth erzählte.
»Mein Gesicht abgeschleckt.« Ihre Augen funkelten. »Überall.« Spitzbübisch lächelnd legte sie die Hände auf Ethans Wangen und rieb darüber – ihr Lieblingsspiel. »Autsch! Bart.«
Sanft fuhr er seinerseits mit den Fingerknöcheln über ihre flaumige Wange und zog sich plötzlich zurück. »Autsch! Du hast auch einen.«
»Nein! Du.«
»Nein.« Er drückte viele Küsse auf ihre Wangen, bis sie sich entzückt in seinen Armen wand. »Du . . . hast einen . . .«
Es gelang ihr, ihm zu entwischen. Lachend stürzte sie sich auf den Jungen, der sich auf dem Fußboden ausgestreckt hatte. »Seth hat einen Bart.« Sie bedeckte sein Gesicht mit nassen Küssen, und Seth wehrte sich prompt. So etwas konnte er als ganzer Mann nicht unwidersprochen hinnehmen.
»Laß das doch sein, Aubrey.« Um sie abzulenken, nahm er eines ihrer Spielzeugautos und ließ es sacht über ihren Arm gleiten. »Du bist eine Rennstrecke.«
Aubrey war hingerissen von dem neuen Spiel. Sie entriß ihm das Auto und rückte Seth damit zu Leibe – längst nicht so vorsichtig wie er.
Ethan grinste. »Du hast angefangen, Kumpel«, sagte er, als Aubrey in ihrem Eifer gegen Seth’ Oberschenkel trat.
»Immer noch besser als die Knutscherei«, erwiderte Seth, breitete jedoch instinktiv die Arme aus, um die stolpernde Aubrey festzuhalten.
Eine Zeitlang stand Grace nur da und beobachtete die drei – den Mann, der entspannt lächelnd in dem großen Ohrensessel saß und den Kindern zusah. Die beiden Kinder, die die Köpfe zusammensteckten – die eine klein und zart, mit blonden Locken, der andere mit dunkler Zottelmähne.
Der kleine einsame Junge, dachte sie, und ihr Herz flog ihm zu wie an dem Tag, als er ihr zum erstenmal begegnet war. Er hatte endlich ein Zuhause gefunden.
Auch ihr heißgeliebtes kleines Mädchen hatte eines. Als Aubrey noch nicht mehr war als ein Flattern von Schmetterlingsflügeln in ihrem Bauch, hatte Grace sich geschworen, sie zu hüten wie ihren Augapfel, sich jeden Tag an ihr zu freuen und ihr ein Leben lang Liebe und Geborgenheit zu schenken.
Und der Mann, der früher einmal selbst ein kleiner, einsamer Junge gewesen war und der sich schon vor Jahren in ihre Mädchenträume geschlichen und ihr seitdem nie mehr aus dem Sinn gekommen war – er hatte Seth ein Heim und eine Familie gegeben.
Der Regen trommelte aufs Dach, aus dem Fernseher drang leises, unzusammenhängendes Gemurmel. Die Hunde schliefen auf der vorderen Veranda, und durch das Gitter der Fliegentür wehte der feuchte Wind herein.
Sehnsucht ergriff sie, obgleich sie kein Recht dazu hatte – am liebsten hätte sie den Wäschekorb fallen lassen und sich auf Ethans Schoß gesetzt. Sie wollte sich fest an ihn schmiegen, die Augen schließen und das Gefühl haben, zu ihm zu gehören, wenigstens einen kurzen Moment lang.
Statt dessen machte sie kehrt, ohnehin viel zu rastlos, um sich Ruhe zu gönnen. Sie ging zurück in die Küche, wo die Deckenleuchte ihr grelles Licht verbreitete. Dort stellte sie den Korb auf dem Tisch ab und holte die Zutaten fürs Abendessen aus den Schränken.
Als Ethan wenig später hereinkam, um sich ein Bier zu holen, standen die Frikadellen schon auf dem Herd, die Kartoffelstäbchen brieten in Erdnußöl, und Grace traf die letzten Vorbereitungen für den Salat.
»Riecht himmlisch.« Ethan war ein wenig gehemmt, weil er es nicht gewöhnt war, daß jemand für ihn kochte – schon gar nicht eine Frau. Früher hatte sein Vater das Szepter in der Küche geschwungen, denn seine Mutter . . . Die vier Männer hatten behauptet, daß sie, sollte sie sich ernsthaft als Köchin versuchen, ein Massensterben auslösen würde – wäre da nicht ihre ärztliche Kunst, mit der sie gottlob das Schlimmste verhüten könne.
»Ich bin in etwa einer halben Stunde fertig. Hoffentlich macht es euch nichts aus, früher zu essen als gewohnt. Ich muß Aubrey noch nach Hause bringen und baden und mich dann für die Arbeit umziehen.«
»Essen kann ich jederzeit, besonders wenn ich nicht selbst kochen muß. Außerdem wollte ich heute sowieso noch in der Bootswerkstatt arbeiten.«
»Oh.« Sie blies sich die Ponyfransen aus der Stirn. »Das hättest du mir aber sagen sollen. Dann hätte ich mit dem Kochen früher angefangen.«
»Ich hab’ Zeit.« Er nahm einen Schluck aus der Flasche. »Willst du auch was trinken?«
»Nein, danke. Übrigens werde ich das Salatdressing benutzen, das Phillip mitgebracht hat. Es sieht viel appetitlicher aus als die Mixtur aus dem Supermarkt.«
Endlich hatte der Regen nachgelassen. Jetzt nieselte es nur noch, und wäßriges Sonnenlicht stahl sich zaghaft durch die Lücken zwischen den dunklen Wolken. Grace schaute zum Fenster. Bei solchem Wetter hoffte sie immer auf einen Regenbogen. »Annas Blumen gedeihen prächtig«, bemerkte sie. »Der Regen wird ihnen guttun.«
»So brauche ich wenigstens nicht zum Schlauch zu greifen. Sie würde mir den Hals umdrehen, wenn die ganze Pracht durch meine Schuld einginge.«
»Könnte ich gut verstehen. Sie hat sich solche Mühe gegeben, den Garten noch rechtzeitig zur Hochzeit herzurichten.« Während sie sprach, ließ sie die Fritten abtropfen und gab die nächste Fuhre in das brutzelnde Öl. »Die Hochzeit war wunderschön«, fuhr sie fort, als sie in einer Schüssel das Dressing für den Salat anrührte.
»Ja, es hat alles ganz gut geklappt. Wir hatten Glück mit dem Wetter.«
»Oh, an dem Tag hätte es einfach nicht regnen dürfen. Das wäre eine Sünde gewesen.« Sie sah alles noch deutlich vor sich: das satte Grün des Rasens, das funkelnde Wasser und die in allen Farben leuchtenden Blumen, die Anna gepflanzt hatte. Blumenarrangements vom Floristen ergossen sich aus Töpfen und Kübeln auf den weißen Läufer, über den die Braut zu Altar und Bräutigam geleitet wurde.
Sie erinnerte sich noch genau an das herrlich gebauschte weiße Kleid, den hauchzarten Schleier, der die dunklen Augen der glückstrahlenden Braut kaum verhüllte. Auf den bereitgestellten Klappstühlen saßen Freunde und Verwandte, um die Zeremonie zu verfolgen. Annas Großeltern hatten geweint. Und Cam – der mit allen Wassern gewaschene, berühmt-berüchtigte Cameron Quinn – hatte seine Braut angesehen, als habe man ihm gerade die Schlüssel zur Pforte des Paradieses überreicht.
Eine Hochzeit im eigenen Garten, dachte Grace überwältigt. Schlicht und doch feierlich, unerhört romantisch. Einfach vollkommen.
»Sie ist die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe«, sagte Grace mit einem Seufzer, in dem eine winzige Spur Neid mitschwang. »So dunkel und exotisch.«
»Sie paßt gut zu Cam.«
»Sie sahen aus wie Filmstars – der reine Hollywood-Glamour.« Verträumt lächelnd gab sie den Salat in die Schüssel. »Als du mit Phillip den Walzer angestimmt hast, den ersten Tanz – so was Romantisches hab’ ich noch nie erlebt.« Sie seufzte erneut, dann zog sie die Salatschüssel zu sich heran. »Und jetzt sind sie in Rom. Ich kann’s mir kaum vorstellen.«
»Gestern morgen haben sie angerufen, kurz bevor ich aus dem Haus ging. Sie sind im siebenten Himmel.«
Sie lachte – ein leises, perlendes Lachen, das über seine Haut zu streichen schien. »Flitterwochen in Rom – wem würde es da nicht so gehen?« Versonnen schöpfte sie die Kartoffelstäbchen aus der Pfanne und schrie plötzlich unterdrückt auf, als Öl auf ihre Hand spritzte. »Mist!« Noch ehe sie die Finger zum Mund führen konnte, um den Schmerz zu lindern, war Ethan zur Stelle.
»Hast du dir was getan?« Als er ihre stark geröteten Finger sah, nahm er sie bei der Hand und zog sie mit sich zum Spülbecken. »Am besten hältst du sie unter eiskaltes Wasser.«
»Es ist nichts. Bloß eine kleine Brandblase. Das passiert mir ständig.«
»Dann solltest du besser aufpassen.« Stirnrunzelnd hielt er ihre Hand in den Wasserstrahl, um die Rötung zu kühlen. »Tut es weh?«
»Nein.« Sie spürte nichts anderes als seine Berührung und ihren wilden Herzschlag. Aber sie durfte sich nicht lächerlich machen, indem sie sich den Gefühlen überließ, die er in ihr wachrief. Schnell versuchte sie, sich von ihm loszumachen. »Es ist nichts, Ethan. Laß es gut sein.«
»Wir brauchen Brandsalbe.« Er richtete sich auf, um im Schrank danach zu suchen. Ihre Blicke begegneten sich. Einen Moment lang standen sie nur da und hielten sich unter dem kalten Wasserstrahl an den Händen.
Ethan dachte, daß er es sonst tunlichst vermied, ihr so nahe zu sein, daß er die winzigen Goldpünktchen in ihren Augen sehen konnte. Sie brachten ihn dazu, über sie zu staunen, ins Schwärmen zu geraten. Dann mußte er sich jedesmal mühsam in Erinnerung rufen, daß diese Frau Grace war, die er schon als Mädchen gekannt hatte. Aubreys Mutter. Eine Nachbarin, die ihn als verläßlichen Freund kannte und schätzte.
»Du mußt besser auf dich aufpassen.« Seine Stimme klang rauh, weil seine Kehle plötzlich wie ausgedörrt war. Der zarte Limonenduft von Grace hüllte ihn ein.
»Ist doch halb so wild.« Sie verging vor Sehnsucht, hin und her gerissen zwischen überschäumender Freude und abgrundtiefer Verzweiflung. Er hielt ihre Hand so vorsichtig, als wäre sie aus Glas, und zugleich sah er sie vorwurfsvoll an, als sei sie nicht minder leichtsinnig als ihre zweijährige Tochter. »Die Pommes werden zu braun, Ethan.«
»Oh ... Natürlich. Entschuldige.« Verlegen trat er zurück und kramte wieder nach der Salbe. Einen Wimpernschlag lang hatte er sich gefragt, ob ihr Mund sich wohl so weich anfühlte, wie er vermutete. Sein Herz klopfte. Dabei gefiel es ihm ganz und gar nicht, die Kontrolle zu verlieren; er legte Wert darauf, immer ruhig und gelassen zu bleiben. »Nimm trotzdem was von der Salbe.« Er legte die Tube auf den Tresen, bevor er noch weiter zurückwich. »Ich . . . sorge inzwischen dafür, daß die Kids sich vor dem Essen die Hände waschen.«
Auf dem Weg hinaus klemmte er sich noch den Wäschekorb unter den Arm, dann war er auch schon verschwunden.
Grace drehte das Wasser ab und rettete die Fritten. Nachdem sie sich überzeugt hatte, daß sonst alles seinen regulären Gang ging, nahm sie die Tube und tupfte einen Klacks Salbe auf ihre Finger. Die Tube legte sie ordentlich in den Schrank zurück.
Nachdenklich stützte sie sich auf den Rand des Spülbeckens, um wieder aus dem Fenster zu schauen.
Am Himmel war weit und breit kein Regenbogen zu sehen.
2. Kapitel
Wahnsinn, endlich war Samstag – der letzte Samstag des Schuljahres, der letzte Samstag vor den Sommerferien! Seth hatte das Gefühl, alle Samstage seines Lebens seien zu einer einzigen großen bunten Kugel verschmolzen.
Samstag bedeutete, daß er mit Ethan und Jim auf dem Kutter rausfahren durfte, statt in einem Klassenzimmer zu versauern. Es bedeutete harte Arbeit, heiße Sonne und kalte Getränke. Ein Tag unter Männern.
Die Augen von seiner Orioles-Mütze und der supercoolen Sonnenbrille beschattet, die er auf einem Abstecher ins Einkaufszentrum erstanden hatte, warf Seth schnell den Fischhaken aus, um die nächste Markierungsboje einzuholen. Seine noch eher bescheidenen Muskeln wölbten sich unter seinem Akte X-T-Shirt, das alle Welt über das Geheimnis des Universums aufklärte.
Er beobachtete Jim bei der Arbeit: wie er die Falle seitlich kippte und die behelfsmäßige Sicherung des Köderfachs – den Deckel einer Konservendose – am Boden der Falle löste. Nummer eins, weg mit dem alten Köder, dachte Seth. Das Signal für die Möwen, laut kreischend im Sturzflug vom Himmel herabzustürzen. Cool. Dann nehme man die Falle fest in die Hand, drehe sie herum und schüttle sie so kräftig, daß die Krebse in die bereitstehende Wanne purzeln.
Seth war überzeugt, daß er das auch konnte – wenn er wollte. Er hatte keine Angst vor den blöden Krebsen, nur weil sie mit ihren abartigen Scheren so aussahen wie mutierte Riesenkäfer von einem unbekannten Planeten.
Statt dessen war es seine Aufgabe, die Falle mit neuen Ködern, einer Handvoll ekliger Fischreste, zu bestücken, das Fach zu sichern und darauf zu achten, daß die Leine sich nicht verhedderte. Anschließend galt es, den Abstand zwischen den Schwimmern richtig einzuschätzen und die Falle über Bord zu werfen. Platsch! Anschließend mußte er mit dem Haken die nächste Boje heranholen.
Mittlerweile wußte er auch, wie man bei Krebsen Männlein von Weiblein unterschied. Jim sagte, man könne die Weibchen daran erkennen, daß sie sich die Fingernägel anmalten – ihre Kneifer waren im Gegensatz zu denen der Männchen knallrot. Irgendwie irre, daß die Muster auf ihren Bäuchen wie Geschlechtsteile aussahen. Kein Witz – die männlichen Krebse hatten dort ein großes, längliches T eingezeichnet.
Jim hatte ihm sogar Krebse bei der Paarung gezeigt – er nannte es ›gemischtes Doppel‹ -, und das war die absolute Härte. Das Männchen kletterte auf das Weibchen und blieb einfach auf ihm sitzen. In dieser Position schwammen sie tagelang herum.
Aber es schien ihnen offenbar zu gefallen.
Ethan hatte behauptet, die Krebse feierten Hochzeit, und als Seth daraufhin ungläubig lachte, hob er nur vielsagend eine Braue. Seth war so fasziniert von all dem, daß er zur Schulbücherei gegangen war, um sich über Krebse schlauzumachen. Inzwischen glaubte er zu verstehen, was Ethan meinte. Das Männchen beschützte das Weibchen, indem es auf ihm sitzen blieb, weil sie sich nur während der letzten Häutung paaren konnte, wenn ihre Schale weich und verletzlich war. Nach dem Akt hingen sie aneinander, bis die Schale der Partnerin sich wieder gefestigt hatte. Das Weibchen paarte sich nur ein einziges Mal – also war es wirklich so etwas wie eine Hochzeit.
Er dachte an die Trauung von Cam und Miß Spinelli – Anna, verbesserte er sich, er mußte sie jetzt ja Anna nennen. Ein paar von den Frauen hatten geheult, die Männer hatten gelacht und Witze gerissen. Was das ganze Theater mit den vielen Blumen, der Musik und den Bergen von Essen sollte, verstand er nicht. Ihm kam es so vor, als heirate man nur, damit man Sex haben konnte, wann man wollte, ohne daß andere deshalb pampig wurden.
Aber cool war es schon. Er hatte noch nie bei so etwas mitgemacht. Es hatte ihm gefallen, obwohl Cam ihn vorher ins Einkaufszentrum mitgeschleift und sogar gezwungen hatte, Anzüge anzuprobieren.
Manchmal machte er sich allerdings Sorgen, was sich im Zusammenhang mit dieser Hochzeit alles ändern würde, wo er sich doch gerade an sein neues Leben gewöhnt hatte. Von nun an würde eine Frau bei ihnen im Haus wohnen. Eigentlich mochte er Anna ziemlich gern. Sie hatte ihn immer fair behandelt, obwohl sie Sozialarbeiterin war. Aber trotzdem – sie war eine Frau.
So wie seine Mutter.
Seth verdrängte diesen Gedanken schnell. Wenn er anfing, über seine Mutter nachzudenken, über das Leben, das er mit ihr geführt hatte – die Männer, die Drogen, die dreckstarrenden kleinen Zimmer -, dann wäre ihm der Tag verdorben.
Und in seinem Leben hatte es zu wenig schöne Tage gegeben, als daß er dieses Risiko eingehen wollte.
»Schläfst du mit offenen Augen, Seth?«
Ethans sanfte Stimme holte ihn in die Gegenwart zurück. Seth blinzelte, sah die Sonnenfunken auf dem Wasser tanzen und die schaukelnden orangefarbenen Bojen. »Hab’ bloß nachgedacht«, murmelte er und holte schnell die nächste Boje ein.
»Ich denk’ aus Prinzip so wenig wie möglich nach.« Jim stellte die Falle auf das Dollbord und begann die Krebse zu sortieren. Sein wettergegerbtes Gesicht legte sich in Falten, als er grinste. »Davon kriegt man nur Hirnerweichung.«
»Scheiße.« Seth beugte sich vor, um die Ausbeute zu begutachten. »Dem da wächst ein neuer Panzer.«
Jim grunzte zustimmend und hielt einen Krebs in die Höhe, dessen Schale oben am Rücken aufgeplatzt war. »Und dieser hier wird schon morgen auf einem leckeren Sandwich liegen.« Er zwinkerte Seth fröhlich zu, bevor er den Krebs wieder in den Tank warf. »Vielleicht sogar auf meinem.«
Foolish, der seinem Namen wieder mal alle Ehre machte, schnüffelte an der Falle und provozierte damit einen kurzen, aber heftigen Aufstand der Krebse. Als die Scheren ihm bedrohlich nahe kamen, sprang der Welpe laut kläffend zurück.
»Nein, dieser Hund.« Jim schüttelte sich vor Lachen. »Der braucht sich vor Hirnerweichung nun wirklich nicht zu fürchten!«
Auch nachdem sie den Fang in den Hafen gebracht, den Tank geleert und Jim zu Hause abgesetzt hatten, war der Arbeitstag noch nicht beendet. Ethan ließ die Ruderpinne los. »Wir müssen noch in die Bootswerkstatt. Willst du mal übernehmen?«
Obgleich Seth’ Augen sich hinter der dunklen Sonnenbrille verbargen, wußte Ethan, wie verblüfft er war – sein offener Mund sprach Bände. Es amüsierte ihn, als der Junge nur gleichmütig eine Schulter hob, als komme so etwas jeden Tag vor.
»Klar. Kein Problem.« Mit vor Aufregung feuchten Handflächen griff Seth nach der Ruderpinne.
Ethan stand neben ihm, die Hände lässig in den Hosentaschen, behielt ihn jedoch aufmerksam im Auge. Auf dem Wasser herrschte reger Verkehr; das schöne Wetter hatte die Freizeitsegler in die Bucht gelockt. Und wenn schon, sie hatten es nicht mehr allzu weit, und irgendwann mußte der Kleine es ja mal lernen. Man konnte nicht in St. Chris leben, ohne zu wissen, wie man einen Fischkutter steuerte.
»Ein wenig mehr Steuerbord«, sagte er zu Seth. »Siehst
Titel der Originalausgabe RISING TIDES
15. Auflage
Deutsche Erstausgabe 1/2000
Copyright © 1998 by Nora Roberts
Published by Arrangement with Author
Copyright © der deutschsprachigen Originalausgabe 2000 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlagillustration: Bavaria Bildagentur/VCI, Gauting Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München Satz: (3340) IBV Satz- und Datentechnik GmbH, Berlin
eISBN 978-3-641-09183-5
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Leseprobe