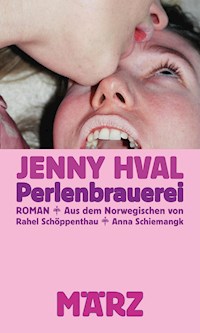Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MÄRZ Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Gott hassen ist ein kompromissloser, nachdenklicher, spielerischer und zutiefst faszinierender Roman über Black Metal und weiß getünchte Idylle, über Untergrundbewegungen, Magie und Rebellion. Norwegen in den 90ern: Weiße Lattenzäune stehen in Reih und Glied, die junge Erzählerin leidet an der Eintönigkeit und am christlichen Konservatismus. Als erwachsene Frau beginnt sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen, hinterfragt ihre künstlerische Praxis und dekonstruiert die Maßstäbe, nach denen wir Kunst definieren. Sie sucht nach Befreiung im Untergrund und zieht ihre Energie aus dem Hass – einem Gefühl, mit dessen Hilfe sie sich produktiv einem jahrhundertealten Genie-Kult entgegenstellen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JENNY HVAL
GOTT HASSEN
Roman
Aus dem Norwegischen von Clara Sondermann
MÄRZ
INHALT
1. DIE HEXENKUNST
DER RAUM
DIE BAND
DAS KONZERT
DER PAKT
DIE RITUALE
DER SABBAT
DAS KOSMISCHE INTERNET
DIE MAGIE
DIE PIXEL
2. DER WALD
3. DAS EI
DAS BECKEN
1. DIE HEXENKUNST
Ich hasse Gott.
Es klingt primitiv und erbärmlich, das zu sagen, aber ich bin eine primitive und erbärmliche Person.
Der Bildschirm vor mir zeigt Bilder aus dem Jahr 1990. Fichten, Berge, grauer Himmel. Das Video flimmert und die Kamera wird durch ein niedrig aufgelöstes Digital-Universum geschwenkt. Eine jungenhafte Gestalt, vielleicht Nocturno Culto, läuft zu brutalen Gitarrenriffs durch den Wald. Die Kamera folgt ihm nur träge. Das Bild ruckelt im Takt der Schritte des Filmenden. Ist das eine Art Geburt? Ich schreibe: »Homevideo, im Einklang mit der Lo-Fi-Ästhetik des Genres. Kurze, rätselhafte und hässliche Kamerariffs über langweiliger norwegischer Landschaft.«
Ich notiere: »Ich hasse Gott.« Was für eine arrogante Aussage, aber ich habe einen arroganten Charakter (»Ich« – ist das nicht auch nur ein anderes Wort für »Gott«?).
Im Jahr 1990 hasse ich Gott.
Nocturno Culto und seine Band spielen noch Thrash Metal, und ich hasse mich durch die Klassenräume der Grundschule und durch den dicken südnorwegischen Dialekt der Lehrer. Ich weigere mich, ihn anzunehmen, ich hasse seinen schweren Ton, mit dem die Ermahnungen einhergehen. Die Menschen aus Südnorwegen sagen so wenig anderes. Es ist auch gar nicht möglich, damit etwas Neues zu sagen, also verkünden sie die immergleichen Formeln. Ich weiß wirklich nicht, für was er sich eignen soll, abgesehen von Predigten. Wenn sie pRaktizieRendeR ChRist sagen, stößt die Zunge die r-Laute so heftig aus dem Rachen, dass die Konsonanten bis ins Fegefeuer fliegen müssen, und meine Ohren sind stigmatisiert.
Am meisten hasse ich Gøud, wie die Leute aus Aust-Agder sagen, und mein Lehrer in jedem seiner Morgengebete. Wie ich es verstanden habe, ist Gott nur ein flüchtiges Konzept in ein paar Büchern, während Gøud da draußen existiert und den Leuten in Südnorwegen das Haar in strenge Knoten und die Kehlen in Schlingen legt. Es ist Gøud, der in mein Schulheft schreibt, dass ich den dritten Vers unserer Psalmreihe »Mond und Sonne« nicht auswendig gelernt habe, und es ist Gøud, der entschieden hat, dass wir nichts über andere Religionen und Weltanschauungen lernen. Ich hasse Gottesdienste, die chRistliche Taufe, Hochzeiten und BeeRdigungen. Ich hasse die chRistliche VolkspaRtei und ich hasse das KlaubensbeKenntnis. Ich hasse es auswendig, rückwärts, hoch und runter. VateR unseR, der du bist in der Hölle.
Mir wird immer noch warm vor Freude, wenn ich das sage. Ich bin immer noch blasphemisch. Ich genieße das brennende Gefühl der Scham, und spüre, wie die Wangen anschwellen und im heißen Feuer der Ausgrenzung glühen. Ich kann mich mit Andersens Mädchen mit den Schwefelhölzern identifizieren. So wie sie in einer kalten Straße sitzt und sich am glücklichen Weihnachtsfest der anderen Menschen wärmt, wärme ich meine eiskalte Teufelsseele am Glaubensbekenntnis der anderen. Das Mädchen fröstelt zwischen den Visionen glitzernder Weihnachtsbäume und Hologrammen aus Engeln. Sie erfriert bei dem Versuch, sich an den Geistern des Heiligen, der Fata Morgana des Protestantismus, zu wärmen.
Es macht mich so glücklich zu hassen. Mein Hass ist radioaktiv, seine Strahlen umgeben mich, das Kind, im Jahr 1990. Der Hass ist meine Fantasiewelt, mein pleasure dome. Gibt es ein Wort für pleasure dome auf Norwegisch? Man sagt es nicht. Jedenfalls gibt es den Ausdruck nicht im südnorwegischen Dialekt, er sitzt nur tief in meinem düsteren Blick. Dieser Blick sieht auf Bildern scheinbar nach innen und implodiert fast. Ist dieser Blick die Sprache, die sie Hass nennen?
Du musst natürlich nicht antworten, nein. Wahrscheinlich verstehst du kein einziges Wort Dialekt. Aber vielleicht hat es dich schon mal glücklich gemacht zu hassen. Deswegen schreibe ich dir. Um mich zu zeigen.
Ich hasse Gott, seitdem ich das Schreiben gelernt habe. Ich muss diese ganzen Worte großschreiben, und ich hasse es. Jesus Christus, Vater, Gott und so weiter, schriftliche Unterwürfigkeit. In der Schule muss ich nachsitzen und lernen, wie man ein großes O schreibt. Ich zeichne nur Spiralen und sie denken, dass ich einfach keinen Kreis zeichnen kann. Also soll ich Worte mit großem O abschreiben, und ich erinnere mich vor allem daran, Ordet, Ordet, Ordet wiederholen zu müssen – Das Wort. Es fühlt sich an, als würde es in mir und den Großbuchstaben brennen, und zum Schluss knicke ich ein und schreibe eine lange Reihe OOOOOOOOOOOOO auf das Blatt, es sieht mehr aus wie Gekritzel, und weniger wie Buchstaben. Ich schreibe über alle Zeilen in meinem Heft und dann weiter über den Tisch, bis der Lehrer kommt und mir eine Verwarnung erteilt. Ist dir schon mal aufgefallen, wie ähnlich die Worte schreiben und schreien klingen? Ich hasse Großbuchstaben, ich hasse Das Wort.
Wir bekommen nicht die Erlaubnis, hassen auszusprechen – außer es geht um Hitler. Das hat ein Vater von jemandem mal gesagt. Aber ich sage es sowieso nicht wie die anderen, hadår, es ist viel zu weich und zu feucht, ich hasse, und ich liebe es zu hassen. Im Jahr 1992 bin ich die düsterste Kinderkönigin.
Auch auf dem Bildschirm vor mir ist jetzt 1992, es läuft eine Bonus-DVD, die mit der Neuauflage der ersten Alben von Darkthrone veröffentlicht wurde. Ein paar schwirrende Bäume in Schwarz-Weiß. Angespannte Atmosphäre. Ich folge der wackligen Kamera durch den Wald, erfreut über den Versuch, die schönen und ordentlich gewachsenen Fichten in etwas Hässliches, Furchterregendes und Mysteriöses verwandelt zu sehen. Als würde die Band jeglichen Lebenssaft aus dem Jahr 1992 herauspressen wollen, oder alles, was an 1992 gewöhnlich war.
Ein Junge, wahrscheinlich immer noch Nocturno Culto, raucht auf einer Bank im Wald. »Primitiver«, sagt Fenriz. Das Interview wurde viele Jahre später geführt, die Band analysiert und resümiert. Sie sehen zurück und sagen: »Wir wollten was Primitiveres.«
Du kannst dir das Interview selbst ansehen, es ist online.
Primitiv. Ich habe das Wort noch nie jemanden aus Südnorwegen sagen hören.
Ich hasse mich weiter durch die Klassenstufen hindurch, bis in das Jahr 1997, auf das Gymnasium, und es wird immer offensichtlicher, dass die Sprache nicht ausreicht. Irgendetwas stimmt nicht hier im Süden. Oder mit der norwegischen Sprache. Vielleicht gibt es im Norwegischen einfach nicht die richtigen Worte und Klänge für Genuss. Es fühlt sich wie eine provinzielle Sprache an, eine Sprache für wortkargen Austausch über das Wetter, Gottesdienste, Bootshandbücher und Strafpredigten. Die Worte klingen nicht so musikalisch und archaisch wie die aus dem Old English Dictionary oder aus den altenglischen Gedichten in gothischer Schrift. Die norwegische Sprache hält viele Worte für meine Sünden und meine Fehler bereit; meine auferlegte Muttersprache ist eine Sprache für Menschen, die eigentlich kein Verständnis von Sprache haben, von Poesie oder der Notwendigkeit von Kommunikation. Am Gymnasium verkörpert Inger aus Der Segen der Erde die norwegische Sprache: Inger hat eine Hasenscharte und einen Sprachfehler. Sie kann die Worte beim Sprechen nicht richtig koordinieren und hält, oder sollte, nach Hamsun ihren Mund halten. Die Vorstellung ihrer verworrenen Sprache macht mir Freude. Ich sollte mich vielleicht stärker mit ihr identifizieren: Sie ist der Ausdruck eines genetischen Fehlers, der Mund und Kopf betrifft, also auch mich – aber ich tue es nicht. Ich entscheide mich für den Hass. Ich hasse Knut Hamsun, und ganz besonders Pan. Ich weigere mich, dieses Buch durchzulesen. Ich sage dem Lehrer, dass es eine Beleidigung für das Gehirn sei, und der Lehrer erteilt mir eine schriftliche Warnung. Ich wünschte, ich hätte dem Lehrer gesagt, dass die Bibel eine Beleidigung für die Seele ist.
Während meiner gesamten Kindheit und Jugend schäumt die Spucke in meinem Mund. Wenn ich rede und wenn ich nicht rede. Es gibt nur eine Stelle, mit der ich etwas anfangen kann, wenn wir Terje Vigen von Ibsen laut vorlesen müssen: Die schäumenden Wellen an der Schärenküste von Homborsund, denn ganz genau so schäumt es in meinem Mund, wenn ich lese. Es gibt nichts Sanftes oder Weiches in meinem Mund; alles, was feucht ist, schäumt und brodelt endlos, wie ein geloopter Beat.
Nocturno Cultos Zigarette ist aus. Die Kamera fährt wieder in den Wald hinein, in den Schnee, Schwarz-Weiß, zur Musik von Transilvanian Hunger. Ich notiere: »Norwegische Landschaft sieht aus und klingt wie surrende, wütende Insekten.«
Ich sehe mir diese Clips an, weil ich ein Drehbuch schreiben will. Ich weiß noch nicht, worum es gehen soll, aber ich mag die frühe Black Metal-Ästhetik, die nur um Haaresbreite von meiner Jugend entfernt ist. Es erfüllt mich mit Hoffnung, dass Kunst auf so primitive Weise entstehen kann, ohne Spuren von Professionalität oder Kompromissen. Kunst, die Hass enthält. Ich denke daran, wie viel Hoffnung im Hass steckt.
Ich sehe mir noch einen Clip an. Darin spielt eine Black Metal-Band ein Konzert in der Turnhalle einer Schule, es sieht nach frühen Neunzigern aus. Ich schreibe: »Gesunde, norwegische Jugendliche unterhalten sich, verlassen die Halle und gehen wieder hinein, und die Band spielt vollkommen unbeeindruckt. Black Metal kriecht unbemerkt durch die Adoleszenz, auch durch meine, er gräbt sich nicht vollkommen hinein, aber solange er da ist, lebt und kriecht er.«
Ich hätte dabei sein können. Wäre ich nur ein paar Jahre älter gewesen, oder der Clip nicht von 1991, sondern 1997, wäre ich kein Mädchen gewesen und damit nicht automatisch von der schwarzen Leinwand ausgeschlossen. Ich hätte dabei sein können, wir hätten zusammen hassen können. Stattdessen musste ich allein hassen. Provinzhass.
»Der Jongleur«, sagt Fenriz in dem Clip. »Wir wollten den Jongleur spielen.«
Oder meint er den Gaukler? Den Hofnarren, der alles auf den Kopf stellt, die Welt in ein rabenschwarzes Spiel verwandelt, den Comedian, der dem König die schlechten Nachrichten überbringen soll? Fenriz sagt the Juggler. Schwer zu sagen, was Leute meinen, wenn sie ihre Gedanken in eine andere Sprache übersetzen müssen. Er sagt auch, bashed out primitive shit. Totale Misanthropie. Total misanthropic black metal.
Jungs aus Kolbotn, Sveio, Rauland oder Ski, meinetwegen auch Arendal: Ich zeige euch Misanthropie. Ich gehe auf Konzerte, die aussehen wie dieser Turnhallen-Gig. Ich gehe auf diese Konzerte, um dem konformen, norwegischen Christenalltag zu entkommen, ich suche nach einer neuen Gemeinschaft außerhalb des Klassenzimmers. Ich bin auch hier. Auf der Bühne stehen nur Jungs. Jungs mit langen, schwarzen Haaren, die ihre Köpfe mit choreografischer Präzision vor- und zurückwerfen. Es unterscheidet sich nicht mal so sehr von der Bewegung, die ich im Jazzballett gelernt habe. Während das Headbanging der Mädchen im Jazzballett sexy aussehen soll, steht die identische Bewegung in der Metal-Szene für Aggression. Hier gibt es nur eine Farbe, Schwarz, und nur zwei Materialien, Leder und Samt. Die glitzernden Gitarrenhälse ähneln Schwertern oder Schwänzen, oder beidem. Wenn ich mich umschaue, sehe ich nur Jungs im Publikum, oder nein, da sind auch andere Mädchen. Aber keines der Mädchen headbangt, niemand ist wie ich. Niemand sonst scheint zu hassen. 1997 ist es zu spät. Metal ist nach den Morden und Kirchenbränden ängstlich geworden und in einer romantischen Phase angekommen. Dem Hass wurden Beruhigungsmittel verschrieben. Die surrenden, chaotischen Gitarrenriffs auf den primitiven Aufnahmen wurden durch eine aggressive Tristesse ersetzt, die mit dem regnerischen Wetter, den synthetischen Drogen und der höflichen Wortkargheit in Südnorwegen vereinbar ist. Niemand im Publikum trägt corpse paint, ein paar Jungs mit schwarzem Kajal unter den Augen sind damit beschäftigt, den Schülern Ecstasy zu verkaufen und achten kaum auf die Musik. Nur ich stehe in der letzten Reihe, höre zu und hasse, alleine, unbeweglich und stumm in einer Ecke, eingeklemmt zwischen Handlung und Bedeutung, wie du vielleicht auch.
Wir treffen uns nie. Provinzhass ist so einsam. Aber er rettet uns davor, in unserer schäumenden Spucke zu ertrinken. Vielleicht hat er die Jungs auch gerettet.
Ich schreibe an meinem Film. Ich schreibe, um etwas herauszufinden, oder meinen Weg aus etwas heraus zu finden. Einen Weg aus der Sprache? Irgendwie macht man ja genau das, wenn man einen Film schreibt. Das Dokument bahnt sich einen Weg aus der Domäne der Schrift. Das Geschriebene existiert nicht mehr nur für sich allein, es ermöglicht ein neues Kunstwerk, den Film, und gibt sich ihm hin, so wie sich das Bonus-Material zu Darkthrone den Platten hingibt, die die Band einmal herausgegeben hat. Ich denke, so will ich schreiben: unbestimmt, unordentlich, unmöglich, primitiv. Das Drehbuch ist ein Fluch, der noch nicht ausgesprochen wurde. Ein Ritual, das noch nicht begonnen hat. Ein magisches Dokument. Vielleicht kann ich in diesem Dokument nach dem Primitiven suchen. Vielleicht kann ich in diesem Dokument etwas aus der Sprache ausgraben; etwas, das weder in der Schrift noch in Bildern existiert, sondern nur in einem Zwischenraum. In einem ganz neuen Raum. Weder dieser Raum noch das Schreiben selbst sollte eine Wiederholung gelernter Anweisungen sein. Auf diese Weise definieren wir Blasphemie. Ich habe nie gelernt, Gott zu hassen.
Im Schreiben gehe ich aus den Szenen heraus und betrete sie wieder, ich sehe alles. Hier drinnen bin ich Gott. Ich kann nur mich selbst hassen.
Ich sehe mir den letzten Clip der Bonus-DVD noch mal an. Wir sind wieder im Wald, immer im Wald. Der Hain ist dunkler geworden. Wird es Abend? Jetzt schneit es. Winterwald. Die Gitarren klingen fremdartig, als wären sie nicht mit Kabel und Mikrofon aufgenommen worden, und es hört sich an, als würden surrende Insekten über das Vierspurgerät krabbeln.
Ich versuche, eine neue Szene in meinen Film einzuschreiben, eine Erinnerung an eine Party, auf der ich mal gewesen bin: Ein eigensinniger, hagerer 16-Jähriger aus Nedenes versucht auf Gedeih und Verderb, allen zu erklären, was Satanismus wirklich ist. Der Mensch denke ohnehin nur an sich selbst, sagt er, deshalb solle man versuchen, Held des eigenen Lebens zu werden. Oder sagt er vielleicht, dass Satan nur ein Symbol für unsere innere Lebenskraft ist? So oder so ähnlich habe er es jedenfalls in einem Buch gelesen, einem Buch, das der Bibel und Dem Wort viel zu ähnlich sieht, und vielleicht ebenso viele Großbuchstaben und ebenso wenige weibliche Stimmen enthält. Niemand versteht, wovon er redet. Aber als er sich wenig später in den Bauch schneidet und Blut herausläuft, verstehen wir alles. Schneiden verstehen wir. Wir spüren es in unserem eigenen Bauch, auf unserer eigenen Haut. Wir identifizieren uns mit dem Schneiden, und dem Blut nach dem Schnitt. Das Blut spricht eine Sprache, die wir verstehen, ohne gebrochenen südnorwegischen Dialekt.
Ein ungefähr gleichaltriges Mädchen schafft es, ihm das Messer wegzunehmen und mit ihm zu sprechen. Ein anderes Mädchen sieht nur zu, sie wird später eine Blutspur im Neuschnee hinterlassen. Sie symbolisiert gewissermaßen mich, die einsame Blutende. 1997 hätte ich so nach Hause gehen können.
Ich streiche diese Szene. Zu viele einsame Blutende, ein Wettbewerb der Angst und adoleszenten Einsamkeit. Es wird zu psychologisch. Ich hasse Psychologie. Psychologie hat Ähnlichkeit mit Religion, und die Gestalt des Psychologen hat zu viel Ähnlichkeit mit Gott, du sollst dich vor ihm öffnen, ihm mit Ehrlichkeit begegnen, dich vor ihm in Stücke reißen und selbst zerstören, so grundlegend, dass die kleinen Splitter, die du hinterlässt, nicht mal mehr Kunst genannt werden können. Sich zu öffnen bedeutet, das zu wiederholen, was man gelernt hat. Das zu wiederholen, was man gelernt hat, ist menschlich: Das einsame Mädchen kniet vor Gott.
Ich bin es leid, einsam zu sein. Ich will dazugehören. Das übe ich schon seit 1991. Während Fenriz und Nocturno Culto mit ihrem Camcorder durch den Wald torkeln und dessen Strukturen zerstören, tue ich das Gleiche in meinen Notizbüchern und Schreibblöcken. Ich schreibe meine Essays und Aufgaben an jemanden. Nicht an den Lehrer, sondern an bekannte Autoren: Ibsen, Bjørnson, Shakespeare. Sie antworten häufig am Rand mit säuerlichen Kommentaren über die Jugend von heute, berichtigen Schreibfehler und stellen Sätze um, noch bevor ich die Aufgabe abgebe. Ich bekomme eine Verwarnung von meinem Lehrer, weil er meint, eR könne keine Aufgabe beweRten, die schon beweRtet wuRde. Aber ich hasse weiter, am Rand der A4-Seite, ich tue alles, um mir nicht vorstellen zu müssen, dass es Gott ist, dem ich schreibe, Gott in der Gestalt des Lehrers. Ich habe schon immer jemanden gebraucht, dem ich schreiben kann. Die Schreibhandlung soll ein Ort sein, an dem du jemanden triffst, die nicht Gott ist.
Was ich an der Partyszene mag, ist das Bild des fließenden Blutes: das lebende und das sterbende Gewebe. Es fließt kontinuierlich, unaufhaltsam und formlos, und es macht mir Hoffnung, genau wie die Kamera, die zwischen den Bäumen hindurchfährt. Blut hat keine Nationalität, keine Religion und kein Geschlecht. Vielleicht muss ich Handlung und Psychologie komplett aus dem Film streichen und mich auf Blut und Gedärme konzentrieren. So wie es Black Metal in seiner abstraktesten Phase getan hat, oder wie es in Aufnahmen der Fall war, die so schäbig waren, dass man die Mord- und Wikingertexte nicht von den surrenden Gitarrenriffs und Becken unterscheiden konnte. Wo sich alles anhörte wie ein einziger Schrei, ein mit formlosen Bestandteilen angefüllter Raum. Vielleicht muss ich auch so schreiben, verdunkelt.
Ich bin in einem weißen, skandinavischen Paradies in Südnorwegen aufgewachsen: weiße Wände, weißer Neuschnee, weiß lackiertes Laminat und weiße Spanplatten, weiße Fahnenstangen und weiße Kreidelinien an der Tafel, weißer Käse und weißer Fisch, Milch, Fischpudding, Fischgratin und Fischbällchen in weißer Soße, weiße Seiten in Büchern, weiße Pillen in Pillendosen, weißes Paper, platinblondes Haar, weiße Hochzeitskleider und weiße Arztkittel, Baiser und Sahnetorten, christliche Jungfrauen von der Jesus Revolution mit weißen Holzkreuzen, Christengrunge, hör mal, die Musik hört sich an wie normaler Grunge, wenn du nicht auf die Texte achtest, Ironie, alles ist bedeutungslos, die Jungs von White Revolution im Sommercamp, Mädchen, die es in Ordnung finden, dass die Jungs Rassisten sind, weil sie heiß sind, und: Jungs sind eben Jungs, Jungs und ihre Nazi-Punk-Songs, hört euch diesen Track an, der Text ist so undeutlich, dass man sowieso nichts versteht, hört zu, die Melodie ist toll, ihr Mädchen werdet ihn lieben, akustische Gitarren kommen auch vor. Zucker und Salz sind die einzigen Gewürze. Zucker und Salz sehen exakt gleich aus. White Revolution und Jesus Revolution, Nazipunk und Evangelistengrunge, Hakenkreuze und Purity Ringe. Haferschleim, Eiterpickel, Eiweiß, Weizencreme, Sperma.
Das norwegische Wort für weiß, hvitt, enthält ein stummes h, einen versteckten Buchstaben. Wir lassen ihn durchgehen. Aber was macht er mit uns, was verstecken wir im Buchstaben h, was versteckt sich im Weiß?
Die weiße Nachkriegszeit ist so reingewaschen, dass es keine Schatten gibt, wie in den Filmen von Carl Theodor Dreyer. Protestantisch, neureich, hinreichend liberal und auf minimalistische Weise modern. Südnorwegen in den späten Neunzigern ist ein bisschen weniger neureich und weniger modern, aber genauso weiß: Es ist salonfähig, sich auf die rechtmäßige Überlegenheit der Weißen zu berufen. Es ist absolut in Ordnung, jemanden mit dem N-Wort zu rufen, Jungs zu verprügeln, die in irgendeiner Form feminin aussehen, und per Handzeichen darum zu bitten, den Klassenraum verlassen zu dürfen, wenn die Lehrerin lesbisch ist, weil man Homosexualität nicht respektiert (wir respektieren dich als Mensch und beten für deine Erlösung.) Es ist salonfähig, auf die armen Menschen herabzublicken, die nicht christlich sind, nicht norwegisch, nicht weiß, nicht hetero. Im Inneren des versteckten h liegen Hunderte von Geboten – von den zehn ersten bis in die weiße Ewigkeit. Niemand kann sie aussprechen, aber alle kennen sie. Die Kindheit, die ich hinter mir gelassen habe, umgibt mich wie eine metaphysische Jauchegrube, in der die Christen ihre Gedanken und Gebete für meine Erlösung und meine Läuterung abgeladen haben.
Die Läuterung klingt in jedem Gespräch nach. Herrjemine, sagen die evangelischen Christenmädchen, wenn sie wütend sind, Herrgott können sie ja nicht sagen – sein Name darf nicht missbraucht werden, der Bibel zufolge wäre das vergleichbar mit Mord. Die Sprache soll keine Grenzen überschreiten, sondern gezähmt werden, du kannst nicht einfach hierhin oder dorthin gehen, komm nicht her mit deinen Worten. Du sollst das h nicht aussprechen.
Ich kann Südnorwegen nur von mir fernhalten, indem ich vollkommen schwarz und ernst werde. Ich beginne, in einer Metal-Band zu spielen, färbe meine Haare schwarz, die Farbe der Blasphemie, und ziehe mich so dunkel an wie möglich. Ich stelle mir vor, dass allein meine Anwesenheit im Klassenraum etwas zerstört, oder stört, selbst wenn die Kleidung, die ich trage, provinzschwarz ist, eben das, was man in dunklem Velour oder Samt im freundlichen Arena-Center unten in Arendal bekommt. Ich trage Dostojewski, Joyce und Baudelaire wie einen Panzer vor meiner Brust durch den Schulflur. An der Kette um meinen Hals hängt eine schwarze Rose, eine der Blumen der Toten, und ich stelle mir vor, dass die Musik, die aus meinen Kopfhörern kommt, in Schwarz-Weiß produziert worden ist. Ich taufe das Zimmer, das ich direkt neben dem Gymnasium gemietet habe, Hexenhöhle, hänge schwarzen Samt über die Gardinenstangen, zünde schwarze Kerzen an, und schreibe obszöne Kommentare in winzigen Buchstaben an den Rand meiner Ausgabe des Neuen Testaments aus der Nachttischschublade. Die Objekte, Worte und Symbole, all das Schwarze, es sind kleine Flüche, ein magischer Panzer, der das Christentum von mir fernhält. Ich bin ein provinzieller Goth.
Auch die Metal-Band versucht, das Christentum auszutreiben, mit Texten, Gitarrenriffs, dunklen Basstönen und einer MIDI-Kirchenorgel, die so kaputt klingt wie die klangliche Entsprechung eines auf dem Kopf stehenden Kreuzes. Bei unseren Konzerten erwarte ich, dass sich etwas löst, ich erwarte Momente, in denen ich weniger hassen muss. Stattdessen macht mich all das Gewöhnliche rasend, das ich von der Bühne aus sehen kann. Das Notausgangsschild des Rockclubs, die tristen Gardinen aus den Siebzigern, die aufgesprungene Holzvertäfelung in Weiß und Grün. Alles sieht einem Gemeindekonzert zum Verwechseln ähnlich. Die Jugendlichen im Publikum sehen genauso gewöhnlich aus, unterhalten sich laut am Tresen und kaufen so viel Limonade, dass die Kasse unaufhörlich fröhlich klingelt, oder sie headbangen mit offenem Mund vor der Bühne, und sie würden es nie zugeben, aber sie sehen dabei aus wie der Zungen-redende Jesus-Club, der in diesem Moment in Philadelphia oder Bethanien sitzt, für uns betet und es Jesus Revolution nennt.
Selbst die Band ist so gewöhnlich, so regelkonform und so hierarchisch. Die Jungs stehen ruhig hinter mir, spielen Riff für Riff auf schwarzen Gitarren und sehen auf den Boden, als würden sie ihre Hälse vor einer höheren Macht beugen. Ich kann mich auch nicht bewegen: Wenn ich mich vom Mikrofon entferne, beginnt es zu heulen und meine Stimme verschwindet. Ich halte mich am Mikrofonständer fest. Ich will das alles so gerne ändern, aus dem Loop ausbrechen, in etwas anderes hineinspringen, das mich an einen anderen Ort bringt, näher an etwas anderes heran. Ich will, dass der Rockclub sich in einen Zen-Tempel verwandelt, eine mittelalterliche Burg oder, am liebsten, einen Hexensabbat.
Im Jahr 1998 verdunkele ich das Klassenfoto der Klasse 2b. Ich stehe in der obersten Reihe links, trage meine schwarze Kleidung und schwarzen Lippenstift. Als mir die Aufforderungen des Fotografen, doch bitte zu lächeln, zu lästig werden, sage ich Zur Hölle. Die halbe Klasse bekreuzigt sich, als würden sie wirklich glauben, mein Wort könne den Teufel – die Hölle in Person – runter (oder hoch? Woher kommt er eigentlich?) nach Grimstad rufen. In Fleisch und Blut. Wir sind umgeben vom Glauben an Magie, Verstöße, und der Angst davor, dass Frommheit und Glaube mit Sprache vernichtet werden könnten.
Zwischen 1990 und 1998 hasse ich Gott, und ich sage das mit der Überzeugung einer echten Südnorwegerin, in der Hoffnung, mithilfe der Sprache ein Grenzland zu erreichen, ein Land zwischen Fantasie und Wirklichkeit, zwischen Materie und Metaphysik. Deswegen schreiben wir, um neue Orte zu finden, Orte weit weg von Südnorwegen.
DER RAUM
Lass uns jetzt rauszoomen.
Wir befinden uns in einem langen Gang mit grauen und grünen Wänden. Leuchtstoffröhren an der Decke gehen an und aus, Farbe blättert von den Wänden, und auf dem Fußboden liegt eine feine Staubschicht, die im flackernden Licht schimmert. Man hört Schritte, aber nur als schwaches Echo, als hätten wir uns in den verlassenen Kulissen eines alten, sozialrealistischen Films verirrt. Nicht nur die Farbe, auch der Realismus blättert in großen Flocken ab.
Wir befinden uns in einer Welt, in der nur Spuren real sind, die ursprünglichen Klänge zum Film gehören und den Ort längst verlassen haben. Hier und Jetzt sind ausradiert worden, oder existieren nicht für uns.
Hier will ich schreiben, an einem unmöglichen Ort, einem Ort, den es nicht mehr gibt. In der Leere nach Filmen aus den Jahren 1969 (Daisies), 1974 (Penda’s Fen) und 1976 (Jubilee) … Die leeren Studios gibt es noch. Lass uns dorthin gehen. Vielleicht gibt es dort noch andere Spuren, die niemand bemerkt, niemand sieht, die unmöglich sind, am Rand der Filme, in den perforierten Bildrändern, in herausgeschnittenen Szenen, Bonus-Material.
Ich will meinen Film hier beginnen lassen, in diesen Hinterlassenschaften. Ich will zu den Augenblicken gelangen, in denen sich der Realismus aufgelöst hat, und in den Szenen anwesend sein, in denen die unumstößlichen Regeln des Erzählens mit der größtmöglichen Selbstverständlichkeit umgestoßen wurden. Ich will dort sein, wo sie das Subtile und Erhabene aus dem Primitiven ausgegraben haben.
Die Filme, von denen ich spreche, weisen uns auf die Lücken in unserem eigenen Bewusstsein hin, die begrenzten Rahmen unseres täglichen Lebens. Und sie weisen mich auf die Lücken in den Paradigmen der Kunst für Gut und Böse hin, die so mystisch und hierarchisch sind wie das evangelisch-südnorwegische Normensystem. Die Filme erinnern mich an den Hass, sie lassen mich den Hass wertschätzen, das Gefühl, das mir in Südnorwegen verboten wurde, von Gott, von der Schule. Ich sollte »mein Herz öffnen«, »show, don’t tell«, subtiler sein. Weder Daisies noch Penda’s Fen oder Jubilee gehört zu den Filmen, die ich im Rahmen meines Film-Studiums in Oslo, und später New-England, zu sehen bekomme. Wir lernen, dass Citizen Kane der beste Film aller Zeiten ist, und danach kommt alles von Bergman und Tarkowski. Wir lernen nichts über den Untergrund. Wir lernen, dass es nicht gut ist, primitiv zu sein und mit einem zu dicken Pinsel zu malen. Wir lernen nicht, was ein dicker Pinsel ist. Als einer meiner Dozenten zum dritten Mal »das visuelle Motiv der Plastiktüte, die im Wind fliegt« aus dem »Meisterwerk« American Beauty lobt, spüre ich den Pinsel, den Hass, der sich im Hals rührt, und ich stelle mir vor, wie sich mein Mund öffnet und alles, was dick und schwarz ist, herausfliegt. Nicht, um mich zu entleeren, sondern um die Leinwand schwarz zu malen, die Plastiktüte und die Szene aus American Beauty zu übermalen, jedes einzelne Filmplakat und jede einzelne DVD dieses Films, jeden Film von Orson Welles und warum nicht auch gleich alles von Tarkowski und Bergman, ganz schwarz, Stalker und Wilde Erdbeeren und den ganzen Dreck, weg mit dem Kanon, rein in die Monochromie, einen Raum aus formlosen, schwarzen Bestandteilen. Der Hass ist nicht subtil, aber schön. Der Hass ist mein pleasure dome.
Vielleicht hat Nicolas Roeg mit seinem Film Insignificance etwas geschafft, das zugleich subtil und herausfordernd ist. In dem Film aus den Achtzigern, der in den Fünfzigern spielen soll, treffen eine Reihe Charaktere in einem Hotel aufeinander und durchlaufen die philosophischen und politischen Qualen der Nachkriegszeit. Die Charaktere sind fiktiv, aber Abbilder von Ikonen aus den Fünfzigern: Ein Filmstar sieht so aus wie Marilyn Monroe, ist es aber nicht, ein Professor sieht Albert Einstein ähnlich, ohne Einstein zu sein, ein Senator sieht aus wie Joseph McCarthy, ein Baseballspieler sieht aus wie Joe DiMaggio. Dass es sich um fiktive Kopien echter Personen handelt, wirkt zunächst verstörend und künstlich, denn sie sehen aus wie Darstellungen von Marilyn Monroe usw. – wie in anderen Filmen auch. Aber dann verblasst dieser Eindruck und der Unterschied zwischen Film und Realität wird immer komplexer. Die Charaktere ahmen die Ikonen nach, spielen aber gleichzeitig in völlig fiktiven Szenen, in denen Fast-Einstein und Fast-Monroe die Rollen tauschen und sie die Relativitätstheorie mit Kinderspielzeugen, Taschenlampe und Ballons nacherzählt. Als das Hotelzimmer am Ende explodiert, zerbröckelt die Ähnlichkeit mit der Realität. Dieses Ereignis hat nie wirklich stattgefunden. Es hat auch nicht unbedingt etwas mit dem Plot zu tun, abgesehen von der Uhrzeit der Explosion, 08:15, die gleiche Zeit, zu der die Atombombe über Hiroshoma abgeworfen wurde. Der Film verwandelt sich in eine ästhetische Party, bei der Spielzeuge, Ballons, eine Taschenlampe und der Körper von Fast-Marilyn zerstückelt, verbrannt und verflüssigt werden. Noch eine zusammenhangslose Fußnote hat es in die Struktur des Films geschafft, noch ein Fast-Charakter, Fast-Little Boy.
In erster Linie explodiert etwas Fiktives.
Die Handlung hat sich in einem Hotelzimmer abgespielt, das in einem Filmstudio aufgebaut wurde. Ein Hotelzimmer ist eine Art illusorisches, vorübergehendes Zuhause, vielleicht auf die gleiche Weise, wie Film und Filmstudio nur temporär die Produktion illusorischer Wirklichkeit beherbergen. Als der Illusionsraum explodiert, der Raum pulverisiert und in Zeitlupe vor der Kamera herunterrieselt, ist es, als hätte der Film das Dach der gesamten Filmgeschichte gesprengt. Das Bauwerk der Illusionen, das uns dazu bringt, echte Gefühle für etwas zu entwickeln, das nur so aussieht wie die Wirklichkeit, aber nicht wirklich ist, wird auseinandergezogen. Kleine Stückchen Holz und Metall, Kissenfedern, Kleiderfasern, Fleisch, Blutstropfen und Organteile schweben in Zeitlupe durch den Raum und finden neue Plätze, wie Essensreste, die in Aspik erstarren.
Vielleicht drückt der Film mit der Explosion auch einen primitiven Wunsch aus, den Wunsch, Wirklichkeit in Fiktion zu verwandeln. Nicht wie die großen Blockbuster, die Gewalt und Tod in etwas Schönes verwandeln und damit im Dienst einer kriegsverherrlichenden Kreuzzugspolitik stehen, sondern ganz im Gegenteil. Hier wird etwas gesprengt, das fiktiv und bedeutungslos ist. Vielleicht fragt Nicolas Roeg: Hätten wir etwas Fiktives in die Luft sprengen können, anstatt Hiroshima und Nagasaki? Wären Explosion und Bombe fiktiv gewesen, wären keine Leben genommen worden. Die Explosion hätte die gleiche Bedeutung für die Welt gehabt wie die Schneekugel, die dem sterbenden Citizen Kane aus der Hand fällt. Es wäre historisch unbedeutend gewesen, insignificant.
Könnten wir die Zeit zurückdrehen und fiktive japanische Städte sprengen, anstatt die echten, fragt Insignificance. Könnten wir unsere Fantasien ausleben, ohne die Grenzen zu überschreiten, hinter denen echte Menschen sterben? Ist das eigentliche Problem unsere Wahrnehmung der Realität und die Begrenzung, die sie der Fantasie auferlegt? Können die unbedeutenden Explosionen in der Kunst unsere Illusionen in die Luft sprengen?
Es ist dieser Raum, das gesprengte Hotelzimmer, in dem ich schreiben will, in dem langen Echo nach dem Augenblick, in dem die Illusion gesprengt wurde, während alles, was unsere erlernte Wirklichkeit nachahmt, in Stücke gerissen wird und auf uns herabrieselt.
Im Sommer 2005, nachdem ich meinen Bachelor in Oslo mit all seinen versteinerten Filmseminaren abgeschlossen habe, reise ich nach Japan. Nicht nach Hiroshima oder Nagasaki, sondern nach Kyoto, Japans alte Hauptstadt, die für ihre vielen Tempel, Kimonos, Teehäuser und Papiergeschäfte bekannt ist. Ich erinnere mich an ein Viertel, in dem jede Straße von niedrigen Holzhäusern gesäumt ist, ein Dorf mitten in der Stadt. Die Fenster zur Straße sind hinter Fensterläden, Pflanzen oder Zäunen derart versteckt, dass es unmöglich ist, hineinzusehen, und ich gleite ohne mein Spiegelbild durch die Straßen, unsichtbarer und weniger ich selbst als sonst. Ich verstehe, dass die Menschen in Japan die Dinge gern für sich behalten. Sie sind geheimnisvolle Wesen. Sie sehen eher zu Boden als in meine Augen, und viele tragen eine weiße Maske über Mund und Nase, wahrscheinlich um Bakterien nicht zu verbreiten oder fernzuhalten, aber auch, um sich zu verstecken.
Sie schwärmen durch Kyoto, unerkennbar und unangreifbar hinter den Masken, wie in einem Netz ohne Verbindungen. Ihre Geschichte ist eine lange Kette des Verschwindens, der Auslöschung und des Wiederaufbaus. Es gibt hier so viele Gründe, nicht zu existieren, oder nicht richtig.
Ich werde durch einen Zen-Tempel im Stadtzentrum geführt. Es überrascht mich, dass Wände, Decke und Boden fast unberührt aussehen, der Tempel sonst aber sehr alt wirkt, und ich erfahre, dass es stimmt, der Tempel ist alt, aber das Gebäude relativ neu. Er wird in jedem 50. Jahr abgerissen und wieder aufgebaut. Auf diese Weise soll die Bauweise erhalten werden, da das Handwerk wichtiger sei als das Objekt, der Tempel. Vielleicht vermeidet man damit auch die Aufwertung von Materialität. Oder die Aufwertung des Selbst, vielleicht sprengt man so die Illusion?