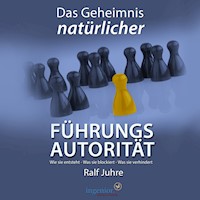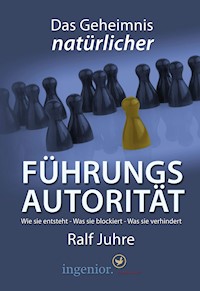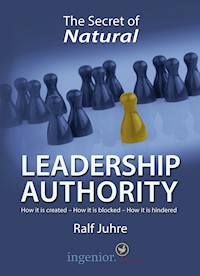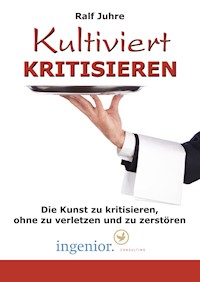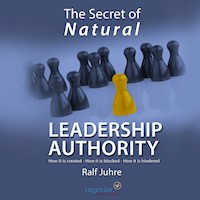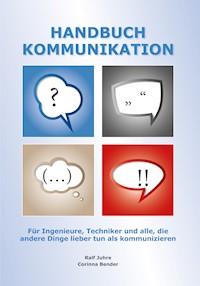
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ingenior training & consulting
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Handbuch Kommunikation - Grundlagen der Kommunikation speziell für Ingenieure und Techniker
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Handbuch Kommunikation
Für Ingenieure,
Techniker und alle,
die andere Dinge lieber tun, als kommunizieren
Ralf Juhre/Corinna Bender
© by ingenior-Verlag, Lise-Meitner-Straße 24, 63457 Hanau
Titel: www.shutterstock.com/Bild 106667612
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung: Carmen Fischer
eBook Erstellung und Konvertierung: Ebozon Distribution
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.ddb.deabrufbar.
ISBN 978-3-945975-22-0 (ePUB)
Für meine Eltern, die mich gelehrt haben, was Kommunikation ist.
Danke an alle, die mir in meinem Leben geholfen
haben zu verstehen und verstanden zu werden.
Danke auch an diejenigen, die mich gelehrt haben,
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Grundlagen der Kommunikation
1. 1. Erfolgreich mit Menschen umgehen – (k)ein Kunststück für technische Profis!?
1. 1. 1. Stärken und Schwächen von technischen Profis
1. 1. 2. Faktoren, die den Umgang mit anderen beeinflussen
1. 1. 3. Manipulation und Beeinflussung: der feine Unterschied
1. 1. 4. Erfolgsfaktor Kommunikation
1. 1. 5. Wie funktioniert Kommunikation?
1. 1. 6. Gefühl und Verstand
1. 1. 7. Individuelles Kommunikationsverhalten
1. 1. 8. Verhalten: Das prägt sich ein
1. 2. Die Botschaft hinter der Nachricht
1. 2. 1. Ursachen für Missverständnisse
1. 2. 2. Die vier Ebenen einer Nachricht
1. 2. 3. Gesagt ist nicht gehört!
1. 3. Der Gesprächsverlauf
1. 3. 1. Die Gesprächseröffnung
1. 3. 2. Die Situations- und Bedarfsanalyse
1. 3. 3. Die Präsentationsphase
1. 3. 4. Der Gesprächsabschluss
1. 4. Die eigene Einstellung
1. 4. 1. Einstellungen schaffen Tatsachen
1. 4. 2. Einstellung zu sich selbst
1. 4. 3. Einstellung zu anderen
2. Körpersprache
2. 1. Kommunikation – das Ende der technischen Beherrschbarkeit
2. 1. 1. „Man kann nicht nicht kommunizieren!
2. 1. 2. Einstellungen schaffen Tatsachen, Tatsachen schaffen Einstellungen
2. 1. 3. Körpersprache – was ist das?
2. 2. Die Mimik
2. 2. 1. Augen – die Brücke zum anderen
2. 2. 2. Die Kopfhaltung
2. 2. 3. Die Stirn
2. 2. 4. Mund und Lippen
2. 2. 5. Nase und Wangen
2. 3. Die Gestik
2. 3. 1. Aggressions- und Abwehrgesten
2. 3. 2. Unsicherheitsgesten
2. 3. 3. Kooperationsgesten / offene Gesten
2. 4. Die Kinesik
2. 4. 1. Sitzen
2. 4. 2. Stehen
2. 4. 3. Gehen
2. 4. 4. Die wichtigsten Haltungsmerkmale
2. 5. Körpersprache – Proxemik
2. 5. 1. Das Raumverhalten im Gespräch
2. 5. 2. Nähe und Distanz richtig steuern
2. 5. 3. Treten Sie in die Wahrnehmungsdistanz
2. 6. Körpersprache – die Macht des ersten Eindrucks
2. 6. 1. Keine zweite Chance für den ersten Eindruck
2. 6. 2. Was noch zum ersten Eindruck beiträgt
3. Praktische Techniken der Kommunikation
3. 1. Vertrauen aufbauen
3. 1. 1. Die richtige Gesprächsatmosphäre
3. 1. 2. Volle Aufmerksamkeit von Anfang an
3. 1. 3. So bekommen Sie Störquellen in den Griff
3. 1. 4. Immer freundlich sein
3. 1. 5. Aktiv zuhören
3. 1. 6. Den Gesprächspartner namentlich ansprechen
3. 2. Den richtigen Gesprächsstil verwenden
3. 3. Wie Sie richtig formulieren und was Sie besser nicht sagen sollten
3. 3. 1. Positiv formulieren
3. 3. 2. Direkt formulieren – Konjunktive vermeiden
3. 3. 3. Füllwörter und Verlegenheitslaute weglassen
3. 3. 4. Reizwörter vermeiden
3. 4. Überzeugungstechniken
3. 4. 1. Vorteil-Nutzen-Argumentation
3. 4. 2. Einwandbehandlung
3. 5. Fragetechniken
3. 5. 1. Die drei Fragetypen
3. 5. 2. Einleitungsformulierungen
4.Der Stoff aus dem Konflikte sind
4. 1. Konfliktbewältigung
4. 1. 1. Der „Besitzer“ eines Konflikts
4. 1. 2. Wer beginnt mit der Konfliktlösung?
4. 1. 3. Strategien zur Konfliktlösung
4. 2. Das Konflikt-Konfrontationsgespräch
4. 2. 1. Die Gesprächsvorbereitung
4. 2. 2. Das Gespräch planen
4. 2. 3. Das Gespräch ankündigen
4. 2. 4. Unter vier Augen sprechen
4. 3. Richtiges Verhalten im Konfliktgespräch
4. 3. 1. Verhalten und Person trennen
4. 3. 2.Das DISG-Modell anwenden
4. 3. 2. Die Gesprächsstile im Konfliktgespräch
4. 4. Beschwerdemanagement
4. 4. 1. Der Umgang mit Reklamationen
4. 4. 2. Fehler in der Reklamationsbehandlung
4. 4. 3. Grundsätze für ein erfolgreiches Beschwerdemanagement
4. 4. 4. Konfliktkonfrontation
4. 5. Mit Beleidigungen und persönlichen Angriffen umgehen
4. 5. 1. Strategie 1: Ignorieren
4. 5. 2. Strategie 2: Hinterfragen
4. 5. 3. Strategie 3: Betroffenheit signalisieren
Lösungsvorschlag: Formulierungen früher und heute
Lösungsvorschlag: Du-Botschaften in Ich-Botschaften umformulieren
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Außerdem sind im ingenior-Verlag erhältlich:
Vorwort
Kommunikation ist für Technik-Profis häufig eine Herausforderung. Lieber beschäftigen sich Ingenieure und Techniker mit Zählen, Messen, Wiegen – also mit Analyse und Problemlösung. Die Konzentration auf ein Problem, eine Aufgabe steht im Vordergrund, nicht so sehr das, was mit Menschen zu tun hat, nämlich das Kommunizieren, Konflikte lösen, Menschen führen. Seminare mit mittlerweile Tausenden von Entwicklungsingenieuren bestätigen es immer wieder: Ingenieure sind – was das angeht – anders als Angehörige anderer Berufsgruppen!
Und dennoch – Sozialkompetenz für eher technisch denkende Menschen ist möglich! Schließlich ist sie auch sehr nötig. Ich schätze, die Karriere eines Ingenieurs ist zu vielleicht 15 % von seinem Fachwissen, jedoch zu 85 % von seiner Sozialkompetenz abhängig, also von der Fähigkeit, mit Menschen umzugehen. Und das hat natürlich vorrangig etwas mit Kommunikation zu tun. Wie viele Projektprobleme würden vermieden, wenn Ingenieure besser wären in Kommunikation, Konfliktlösung und Führung? Hinzu kommt, dass für eine Beförderung in vielen Hunderten Unternehmen nicht Sozial- oder Führungskompetenz maßgeblich sind, sondern fachliche Expertise. So werden Ingenieure häufig zu Führungskräften, die hervorragende Fachleute mit leider jedoch maximal befriedigendem Sozialverhalten sind. In der Praxis der Zusammenarbeit im Team und mit Kunden und Lieferanten verursacht dies weitaus mehr Schaden, als vermutet wird.
Mit unserem Institut für Sozialkompetenztraining für Ingenieure und Techniker durften wir in der Vergangenheit vielen „technischen“ Profis helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Seit vielen Jahren nun stehen wir in Firmen und Organisationen Ingenieuren und deren Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern dienend zur Seite, wenn es darum geht, Kommunikations-, Konflikt- und Führungsverhalten zu verbessern. Einige wesentliche Erkenntnisse zur verbalen und nonverbalen Kommunikation haben wir in diesem Buch für Sie zusammengefasst.
Mein Dank gilt allen Teilnehmern von vielen hundert Seminaren von denen ich sehr viel gelernt habe. Und natürlich dem Team, das zu diesem Buch engagiert beigetragen hat. Ganz besonders bedanke ich mich bei Corinna Bender, die das Kapitel Körpersprache maßgeblich mitgestaltet hat, aber auch bei unserer Lektorin Christiane Kauer. Und natürlich bei unserem ingenior-office und Alexander Wege und Anna Dulewicz für den unermüdlichen Einsatz,
Ralf Juhre
Bruchköbel, im November 2012
1. Grundlagen der Kommunikation
1. 1. Erfolgreich mit Menschen umgehen – (k)ein Kunststück für technische Profis!?
Nichts ist so schwierig und gleichzeitig so leicht zu lernen, wie erfolgreich mit Menschen zu kommunizieren. Zwischenmenschliche Kontakte in Berufs- und Privatleben führen uns diese Erkenntnis täglich vor Augen. Erleichtert hat jeder schon einmal erlebt, wie sich scheinbar äußerst schwierige Kundengespräche oder interne Teamsitzungen letztlich doch als einfach herausgestellt haben. Aber wir erleben auch oft das Gegenteil. Der Umgang mit einem Kollegen, dem Kunden oder dem Vorgesetzten oder gar der Partnerin, den wir als unkompliziert eingeschätzt haben, entpuppt sich als eine wahre Katastrophe.
Besonders denen unter uns, die sich eher zurückziehen, wenn es zu reagieren gilt – also vor allem den introvertierten Persönlichkeitstypen – fällt die Kommunikation natürlich nicht leicht. Nicht jedem ist das Reden in die Wiege gelegt und längst nicht jeder hat Spaß und Freude daran. Im Gegenteil. Je stärker die Begeisterung für Dinge, Ergebnisse, Sachen, desto schwächer ist oft die Begeisterung für zwischenmenschliche Kommunikation ausgeprägt. Die Ursachen hierfür liegen gewiss in der Persönlichkeitsstruktur eines Menschen. Doch wirkungsvolles Reden kann man lernen, auch wenn man von Natur aus kein begabter Rhetoriker ist.
Gerade Ingenieuren, Meistern und Technikern – also Angehörigen technischer Berufe – sagt man nach, sie seien in ihrer Kommunikation oftmals wenig kundenorientiert. Und auch ich als nunmehr seit vielen Jahren aktiver Trainer mit Spezialisierung auf Verhaltenstrainings in der Zielgruppe der Ingenieure, Meister und Techniker bestätige diesen Eindruck. Es kommt nicht selten vor, dass man von einem technischen Profi barsche und vorwurfsvolle Antworten erhält wie „das geht so nicht“ oder „diese Änderung ist jetzt nicht mehr möglich“, oder „das hätten Sie uns früher sagen sollen, dass Sie diese Anforderung brauchen“. Inhaltlich ist diese Auskunft wohl richtig. Doch in Form und Tonfall ist sie unter Umständen nicht das, was zum Ziel führt: nämlich zur Kundenzufriedenheit, der Zufriedenheit nicht nur mit dem Produkt oder der Dienstleistung, sondern auch und insbesondere mit dem Service. Nur der Service ist es in vielen Branchen, der noch den Unterschied macht. Die Produkte sind bezüglich der Qualität oft vergleichbar geworden.
Inhaltlich richtige Botschaften, die vorwurfsvoll, aggressiv oder anklagend beim Empfänger ankommen, lassen den anderen in diesem Moment nicht nur dumm dastehen, sondern geben ihm das Gefühl, sich machtlos herumkommandieren zu lassen. Wer möchte sich so behandelt fühlen? Einfühlsamkeit in der Kommunikation ist eines der schwierigsten Lernfelder für Angehörige technischer Berufe. Eben weil in Entwicklungszentren und Produktionsstätten der Dialog zwischen den Beteiligten nicht selten vernachlässigt wird. Dabei ist er das A und O jeder erfolgreichen Projektarbeit. Sowohl innerhalb des Teams, als auch nach außen mit Kunden,Lieferanten und Partnern hängt vieles, wenn nicht alles von der Kommunikationskultur ab. Wer sie vernachlässigt, erfährt ihre Rache – früher oder später wird er von ihr eingeholt, und selbst beste fachliche Qualifikation schützt unter Umständen nicht vor Konsequenzen, die sich aus defizitärer individueller Kommunikationskultur ergeben.
1. 1. 1. Stärken und Schwächen von technischen Profis
Wenn wir uns die Stärken und die Schwächen anschauen, die Angehörige technischer Berufe auszeichnen, erkennen wir die Probleme, die in der Kommunikation mit Technikern und Ingenieuren entstehen können:
Die genannten Stärken und Schwächen verursachen z.B. im Projektmanagement Probleme, wie die folgende Tabelle zeigt. Doch daraus lassen sich wiederum Wachstumsbereiche definieren, die auch mit einer guten Kommunikationskultur verwirklicht werden können.
Stärken von Ingenieuren und deren Wachstumsbereiche
Schwächen von Ingenieuren und deren Wachstumsbereiche
1. 1. 2. Faktoren, die den Umgang mit anderen beeinflussen
Fangen wir einfach ganz am Anfang an und arbeiten wir uns Stück für Stück vorwärts auf dem Weg zu einer guten Kommunikationskultur, die gemeinsam mit fachlicher Qualifikation der Garant für beruflichen und privaten Verständigungserfolg ist. Schauen wir uns als Erstes an, welche allgemeinen Faktoren den Umgang mit Menschen beeinflussen:
Abbildung1: Erfolgsfaktoren
Zunächst ist es sinnvoll, den Einfluss zu betrachten, der von der jeweiligenSituationausgeht, in der wir uns befinden.
Je nachdem, ob wir gerade telefonieren, dem Gesprächspartner direkt gegenüber sitzen, an einer Teambesprechung teilnehmen oder in ein Gespräch in der Kantine verwickelt sind, haben wir es mit völlig verschiedenenäußeren Ausgangs- und Umgebungssituationenzu tun. Jede dieser unterschiedlichen Situationen birgt Möglichkeiten und Chancen, aber auch Risiken und Hindernisse für einen erfolgreichen Umgang miteinander in sich.
In seltenen Fällen haben wir Einfluss auf dieSituation, in der wir angesprochen werden, vom Chef, den Kollegen oder dem Kunden. Lediglich dann, wenn wir selbst die Initiative ergreifen und die Kommunikation mit anderen suchen, ist es an uns, die für uns geeignete äußere Umgebungs- und Ausgangssituation zu erzeugen. Doch im Arbeitsalltag müssen wir oft kurzfristig reagieren: Telefonate annehmen, Kunden bedienen, Probleme lösen etc. und dazu spontan in die Kommunikation mit anderen eintreten. Meist verfügen wir nicht über die Zeit und Möglichkeit, Situationen bewusst zu erzeugen. DieAusgangs- und Umgebungssituationen, in denen wir uns befinden, entziehen sich somit weitestgehend unserem direkten Einfluss.
Ein weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor für die Kommunikation mit anderen ist dasUmfeld.Auf der Baustelle, in der Produktionshalle im Großraumbüro oder in der Straßenbahn z. B. verläuft Kommunikation ganz anders als im Einzelbüro bei geschlossener Tür. Das Umfeld entzieht sich beim Entstehen einer Kommunikationssituation ebenso unserem Einfluss wie die konkrete Situation. Wir können es zwar wechseln, jedoch nicht ohne die Kommunikationssituation zu unterbrechen und neu aufzunehmen. DasUmfeldalso entzieht sich ebenso unserem direkten Einfluss.
Bleibt noch die Unternehmensphilosophie. Die Regeln und Gebote sowie Verbote, nach denen wir uns richten müssen. Natürlich lassen sich rein theoretisch die Zahlen aus SAP in Excel überführen, doch aufgrund einer Grundsatzentscheidung der Geschäftsleitung ist dies untersagt. Es wäre selbstverständlich technisch machbar, bei dieser Anwendung wie der Kunde wünscht noch eine Schnittstelle zu realisieren. Doch die Bereichsleitung lehnt jeglichen Kompromiss diesbezüglich aus strategischen Gründen ab. DieUnternehmensphilosophie,die Do’s und Don’ts sozusagen, sind hiermit also auch Erfolgsfaktoren. In der entstehenden Gesprächssituation haben wir in der Regel keinerlei Einfluss auf die Unternehmensphilosophie.
Bleiben nur noch die eigene Person und der Gesprächspartner: unsere Einstellungen, unsere Werte, unser Verhalten. Je nach Tagesform, Arbeitsbelastung, Jobzufriedenheit und allgemeiner Gemütsverfassung etc. sind Menschen in unterschiedlichen Stimmungslagen und verhalten sich entsprechend ihrer Natur. Unsere Einstellung, unsere bewussten und unbewussten Wahrnehmungen, unsere Gefühle und Denkweisen steuern unser Handeln. Inwiefern ist es möglich, sich selbst zu beeinflussen? Wie gut beherrschen Sie es, Ihre eigene Stimmung, Ihre Tagesform, Ihr momentanes Auftreten, Ihre Stimmführung, Ihre Körpersprache zu beeinflussen? Und können Sie eigentlich andere in Ihrer Stimmung, Tagesform, Gemütslage, Körpersprache etc. beeinflussen? Selbstverständlich. Echter Freundlichkeit kann sich niemand dauerhaft widersetzen und die beste Möglichkeit, einen handfesten Streit vom Zaun zu brechen, ist sicherlich die, einen anderen öffentlich anzuraunzen, auszuzählen oder sonst irgendwie verachtend zu behandeln. Kommunikationserfolg ist immer zweiseitig. Sender und Empfänger reagieren aufeinander und meist schallt es aus dem bekannten Wald so heraus, wie man hineinruft: Freundlichkeit für Freundlichkeit, Unfreundlichkeit für Unfreundlichkeit.
Wir haben also gesehen, das der Kommunikationserfolg immer eine Sache ist, die davon abhängt, wie gut der Sender
sich selbst und
seinen Gesprächspartner
beeinflussen kann. In dem Maß, in dem es uns gelingt, uns selbst zu beeinflussen, ist es uns folglich möglich, auf den Erfolg im Umgang mit anderen einzuwirken. Unsere Einstellungenbeeinflussen unser Verhalten. Sind wir gut gelaunt und haben eine positive Einstellung zu den Dingen, die auf uns zukommen, so kann sich dies als Lächeln oder in Form einer entspannten Körperhaltung, Gestik und Mimik ausdrücken. Sind wir schlecht gelaunt, haben wir eine negative Einstellung, so verhalten wir uns so, dass andere uns diese augenblickliche Einstellung oft schon aus zehn Metern Entfernung ansehen.
Doch die Wahrheit ist noch tiefer: Nicht nur unser Verhalten wird von unserer Einstellung beeinflusst, sondern auch unsere Einstellung durch unser Verhalten! Wenn wir beispielsweise keine Lust haben, den Kunden freundlich anzulächeln, uns aber dennoch dazu überwinden es zu tun, gelingt es uns, die eigene Schaltzentrale im Gehirn zu überlisten und es stellt sich durch das freundliche Verhalten nach und nach auch eine gesteigerte positive Einstellung ein. Fazit: Je besser wiruns selbstunter Kontrolle haben –unsereEinstellungen undunserVerhalten –, desto besser können wir uns an unterschiedliche Situationen anpassen, mit ihnen umgehen. Wie gut beherrschen Sie sich?
Schließlich ist da noch der andere, mit dem wir umgehen möchten oder müssen. Der Kunde, Kollege oder Mitarbeiter ist mit seinen Einstellungen, bewussten und unbewussten Wahrnehmungen, Gefühlen und gewohnten Denk- und Verhaltensweisen nicht weniger als wir selbst ein Erfolgs- oder Misserfolgsfaktor für den Umgang miteinander. Wenn wir also in der Regel keinen Einfluss auf die uns umgebende Ausgangssituation haben,sind nur noch wir selbst und der andere Erfolgsfaktoren für den Umgang miteinander.
Unser Bild muss dann also so aussehen:
Abbildung2: Erfolgsfaktoren 2
Da jeder seine eigenen Wertvorstellungen, Denk- und Verhaltensmuster in sich trägt, hängt der Erfolg im Umgang miteinander im Wesentlichen davon ab, von welcher Qualität die Beziehung zwischen uns und unserem jeweiligen Gesprächspartner ist. Immer dann, wenn wir Menschen mit unseren sehr ähnlichen Werten begegnen, sprechen wir von der „stimmigen Chemie“, dem „guten Verständnis“ oder davon, dass „wir uns auf Anhieb gut verstanden“ haben. Stoßen wir hingegen auf ein Gegenüber mit uns fremden Werten und daraus resultierend auch fremden Verhaltensweisen und Denkstrukturen, erscheint es uns als unheimlich und bedrohlich. Wir haben dann „völlig aneinander vorbeigeredet“ oder „nicht zusammengefunden“.