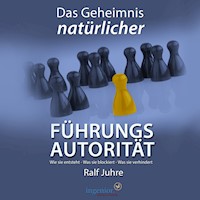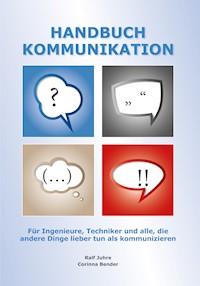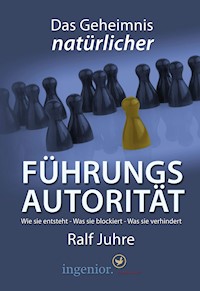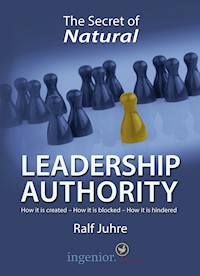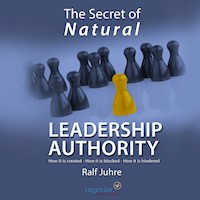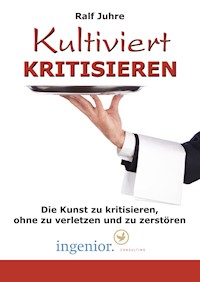
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ingenior training & consulting
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Kritik zu geben ist eine delikate Angelegenheit - sie anzunehmen auch. Vielleicht brauchen wir ja ein neues Kritikverständnis für uns selbst und für unsere Gesellschaft. Dieser Ratgeber möchte einen Beitrag dazu leisten, dass Kritik nicht als Feind sondern als Freund angenommen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 59
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kultiviert kritisieren
Die Kunst zu kritisieren, ohne zu verletzen und zu zerstören
Ralf Juhre
© by rj-Verlag, Fliederstraße 16, 63486 Bruchköbel
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Die Bibelstellen sind der Übersetzung Hoffnung für alle® entnommen, Copyright © 1983, 1996, 2002 by Biblica Inc.TM. Verwendet mit freundlicher Genehmigung des Brunnen Verlags. Alle weiteren Rechte weltweit vorbehalten.
Lektorat: Lektorat Christiane Kauer
Umschlaggestaltung: Angelika Stein, KreativGarten
eBook Erstellung und Konvertierung: Ebozon Distribution
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.ddb.deabrufbar.
ISBN 978-3-945975-09-1 (ePUB)
Für meine Ehefrau Ruth, die mir treu zur Seite steht und mich liebt.
Danke an alle, die mich in meinem Leben konstruktiv kritisiert und mir damit geholfen haben, diese Dinge zu erkennen!
Danke auch an diejenigen, die mich gelehrt haben,
Inhaltsverzeichnis
1. Kritik – was ist das und wofür brauchen wir sie?
Der Begriff „Kritik“
Warum müssen wir trennen können?
Was müssen wir trennen können?
Personen, Sachen und Geister unterscheiden
2. Konstruktiv kritisieren – (wie) geht das?
Grundsätzliches
Was ist konstruktiv?
Worauf verzichtet konstruktive Kritik?
Über mich reden – meine Gefühle beschreiben
Woran merken ich und andere, dass ich konstruktiv kritisiere?
In Liebe kritisieren
Ist Provokation/Konfrontation immer automatisch destruktiv?
Verletztheit und Bitterkeit als Wurzel von Kritik
Kritikleitfaden – so kritisieren Sie richtig
Kritikertest – welcher Kritikertyp sind Sie?
3. Kritik annehmen – Kritikfähigkeit – (wie) geht das?
Notwendige Voraussetzungen
Angst überwinden
Gefahr der Tyrannei
Konstruktiver Umgang mit Kritik
Aktiv nach Kritik ausstrecken
Sich von jedem hinterfragen lassen?
Destruktiver Umgang mit Kritik
Umgang mit destruktiver Kritik
Böses mit Gutem überwinden
Umgang mit Vorwürfen, Angriffen und Beleidigung
Kritikfähigkeitstest
4. Kritik- und Feedbacksysteme in Organisationen etablieren
Vorteile des Automatisierens von Kritik
Methoden des Automatisierens persönlicher Kritik
Der individuelle Einstellungs-TÜV
Automatisieren von Kritik in Organisationen
Organisationaler Kritikfähigkeitstest
Fußnoten
Einleitung
Immer wieder erlebe ich, dass Kritik eine ganz besonders delikate Angelegenheit des Lebens ist. Nichts ist so schwer, wie Kritik auf eine gute, konstruktive statt zerstörerische oder verletzende Weise zu üben. Genauso schwer ist es, Kritik auf eine ebenso gute Weise auszuhalten und anzunehmen, also mit ihr positiv statt ablehnend, leugnend oder um sich schlagend umzugehen. Doch nur selten gelingt es, Kritik gut zu formulieren und auch gut anzunehmen. Im Gegenteil. Im Zusammenleben und als Trainer stelle ich seit vielen Jahren fest, dass beide Seiten, das Geben und das Nehmen von Kritik für viele, ja vielleicht sogar für die Mehrzahl der Menschen, ein echtes Problem darstellt.
Woran liegt das eigentlich? Warum haben wir Menschen eher mehr als weniger Probleme damit, Kritik zu üben und anzunehmen? Sicher ist es die Angst davor, dass man jemandem wehtun könnte, die dazu führt, Kritik nicht zu üben, selbst wenn sie angebracht ist. Manchmal ist es auch die Angst vor Repressalien, die zu erwarten sind. Dies gilt insbesondere immer dann, wenn entweder Toleranz oder auch Harmonie ein hoher Wert in einer Gemeinschaft oder Gesellschaft sind. Sind diese beiden oder einer der beiden Werte ganz weit oben auf der Liste der Ideale, dann wird es ganz grundsätzlich schwerfallen, Kritik als etwas Positives einordnen zu können. Kritik wird bei überbordender Toleranz und bei überbordender Harmonie als etwas tendenziell Negatives, manchmal sogar als von Grunde auf Böses begriffen. Solche Gemeinschaften oder Gesellschaften laufen Gefahr, sich zu verrennen, da kein angemessen notwendiges Korrekturniveau existiert.
Folgendes beobachte ich in meinem privaten und beruflichen Umfeld: Bei einigen Menschen fehlt gänzlich die Fähigkeit, für Kritik offen zu sein. Nur einige wenige Menschen suchen Kritik offen und aktiv. Es ist zu beobachten, dass diese Suchenden sich deutlich schneller entwickeln. Die Mehrzahl der Mitmenschen übt und empfängt Kritik nicht gerade gerne. Sie sind im „Wenn es denn sein muss“-Modus, das ist aber auch schon alles. Ursachen der eigenen Kritikfähigkeit in beide Richtungen sind ganz sicher Ängste. Es ist die Angst, dass etwas dran sein könnte an der Kritik und dass ich mich selbst nicht mehr mögen könnte, wenn ich, der Kritik mein Ohr öffnend, Dinge an mir entdecke, die unansehnlich sind. Es ist die Angst, durch Kritik zum Außenseiter zu werden, nicht mehr dazuzugehören, wenn man etwas sagt, was zwar richtig ist, jedoch nicht gerne gehört werden wird. Und es ist sicher auch die Angst davor, nicht die richtigen Worte zu finden.
Was wäre, wenn Kritik nicht nur wichtig, sondern sogar notwendig wäre im Leben? Was wäre, wenn wir ohne Kritik zu geben und zu empfangen keine Chance auf Weiterentwicklung hätten und damit unweigerlich innerlich stehenbleiben müssten? Was wäre, wenn Organisationen und Unternehmen, Kirchen und Gemeinden, Werke und Einrichtungen sowie wir Menschen Kritik benötigen wie die Luft zum Atmen, damit wir zudem werden können, was wir sein sollen und unsere Berufung entdecken und leben können? Wir leben in einer Zeit, die ich als vom „Fundamentalismus der Toleranz“ geprägt bezeichne. Toleranz ist das höchste Prinzip, es ist gesellschaftlich wichtiger als das Leben. Ein Verstoß gegen die Toleranz ist weniger verzeihlich als alles andere. Inwiefern kann sich unter dieser Prämisse des Fundamentalismus der Toleranz eine gesunde Kritikkultur bei uns selbst und in unseren gesellschaftlichen Einheiten (Unternehmen, Organisationen) einstellen? Vielleicht brauchen wir ja ein neues Kritikverständnis für uns selbst und für unsere Gesellschaft. Ein neues Verständnis von konstruktiver Kritik im Geben und im Empfangen. Mit diesem Ratgeber möchte ich einen Beitrag dazu leisten, dass wir Kritik nicht als Feind, sondern als Freund annehmen und einlassen können in uns und in unsere Organisationen. Möge er Sie als Leser begeistern!
Bruchköbel, im Mai 2011
Ralf Juhre
1. Kritik – was ist das und wofür brauchen wir sie?
Der Begriff „Kritik“
Um den Begriff Kritik zu untersuchen, ist es sinnvoll, ein Lexikon zu bemühen. In der freien Enzyklopädie Wikipedia1wird er wie folgt erläutert:
Kritik (französisch: critique; ursprünglich griechisch: κριτική [τέχνη], kritikē [téchnē], abgeleitet von κρίνεινkrínein, „[unter-]scheiden, trennen“) bezeichnet „die Kunst der Beurteilung, des Auseinanderhaltens von Fakten, der Infragestellung“ in Bezug auf eine Person oder einen Sachverhalt.
Umgangssprachlich beinhaltet der Begriff zumeist das Aufzeigen eines Fehlers oder Missstandes, verbunden mit der impliziten Aufforderung, diesen abzustellen. Im philosophischen Sprachgebrauch bedeutet Kritik die Beantwortung der Frage nach den Bedingungen von etwas. In diesem Sinne meinte Immanuel Kant mit seiner Kritik der reinen Vernunft (1781) nicht eine Beanstandung reiner Vernunfterkenntnis, sondern er suchte nach den „Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis“ aus reiner Vernunft. Ebenso will die geschichtswissenschaftliche „Quellenkritik“ nicht ihre Quellen herabwürdigen, sondern fragt nach den Bedingungen, unter denen Quellen einen Wert für die historische Erkenntnisgewinnung haben.
Es geht beim Kritisieren also um das (Unter-)Scheiden,um dasTrennen,