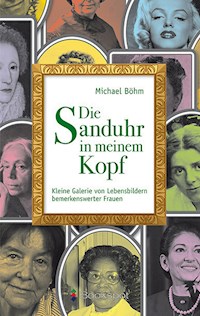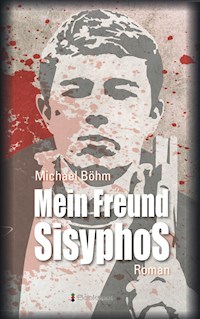0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bookspot Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Leo Petermann
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Leo Petermann geht seinen Neigungen nach: der vermögende Privatier genießt die absolute Ruhe seines Landsitzes und widmet sich seinen Hobbys. Das nötige Kleingeld dafür fließt aus den Anteilen seines Konzerns, für den er nur noch sporadisch als Berater tätig ist. Die friedliche Welt des ehemaligen Managers wird allerdings empfindlich gestört, als sein Nachbar stirbt. Kaum ist der alte Mann unter der Erde, übernimmt dessen Enkel das Regiment auf dem Anwesen, mit seinen Kumpanen terrorisiert er die Bewohner des Weilers mit endlosem Dauerlärm. Leo Petermann wird schnell klar, dass weder Geld noch gute Worte den jungen Mann zur Einsicht bringen werden. Und dann ist da noch sein Stiefsohn, der sich mit einem zwielichtigen Geschäftspartner eingelassen hat, der offensichtlich mit kriminellen Finanzgruppen aus Russland kooperiert. Eine radikale Lösung muss her, hier wie dort. Wie gut, dass Petermann nach wie vor über ein exzellentes Netzwerk verfügt, das sich darauf spezialisiert hat, Probleme ganzheitlich anzugehen und final zu beseitigen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Ähnliche
Michael Böhm
Herrn Petermanns unbedingter Wunsch nach Ruhe
Roman
EDITION 211
Impressum
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- und Bildteile.
Alle Akteure des Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind vom Autor nicht beabsichtigt.
Copyright © 2013 by Edition 211, ein Imprint von Bookspot Verlag GmbH
1. Auflage
Lektorat: Eva Weigl
Satz/Layout: Martina Stolzmann
Covergestaltung: Martina Stolzmann
Titelmotiv: tinadefortunata/Fotolia
E-Book: Mirjam Hecht
Druck: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Made in Germany
ISBN 978-3-95669-000-6
www.bookspot.de
Widmung
Für Christel und Manuel
Zitat
Störe meine Kreise nicht!
Archimedes
Erster Teil
1
Morgens beim Rasieren sieht Dr. Leo Petermann in das liebenswürdig lächelnde Gesicht eines Mörders.
Der Gedanke, diese Erkenntnis, dringt nicht einmal bis in mein Bewusstsein vor. Die Augen blicken mich nur ganz kurz aus dem Spiegel heraus kühl und ruhig an, lächeln nicht mit. Und schon kehrt das Lächeln in die Augen zurück. Ich grüße den Mann im Spiegel freundlich. Höflichkeit ist nun mal unwiderstehlich. Zusammen mit einem warmen Lächeln sind das erfolgreiche Waffen im ständigen Kampf mit den Mitmenschen. Damit sind sogar unüberwindlich erscheinende Festungen einzunehmen. Diese für mich wichtige, ja entscheidende Weisheit hatte ich als einen der ersten Eckpfeiler meines Lebens schon früh begriffen. Seitdem war die Liebenswürdigkeit stets ein wesentliches Zeichen meiner Persönlichkeit, wurde die Höflichkeit zu einem Teil meines Wesens. Und so wird es für den schmalen Rest meines Lebens auch bleiben.
Der neue Tag kann beginnen. Er wird so ablaufen, wie ich ihn mir vornehme, ihn mir gestalte. Ich habe mir nämlich die Freiheit erworben, zu machen, wonach mir der Sinn steht.
Heute setze ich mich an meinen Schreibtisch und fange an, mit grüner Tinte in ein leeres, rot gebundenes Buch zu schreiben.
Zu Beginn des Textes möchte ich erst einmal bei meinem Spiegelthema bleiben.
Als Dickköpfigkeit, Trotz, Zorn, die natürlichen Kampfmittel eines Kindes, zumeist an gezogenen Grenzen scheiterten, also zu nichts führten, den Gegenwind des überlegenen Gegners eher noch erhöhten, nahm ich mir, ein instinktives Wollen, mein damaliges Kindermädchen zum Vorbild. Verfolgte gespannt, wie sie es machte, jeden – und vor allem mich – regelrecht um den Finger zu wickeln. Weshalb waren alle, mit denen sie zu tun hatte, so nett zu ihr? Ich ließ Christa eine ganze Weile nicht mehr aus den Augen. Sie war mein erstes Forschungsobjekt. Ich sammelte Fakten, unterzog diese immer wieder einer Analyse. Ein noch unbewusster, ganz natürlicher Vorgang, denn damals gehörten Vokabeln wie Fakten oder Analyse noch längst nicht zu meinem Wortschatz. Und eines Tages wusste ich, erkannte ich die Antwort. Christa war zu allen höflich und zuvorkommend, schien jeden ernst, ja wichtig zu nehmen. Wie sie es machte, wirkte es nicht aufgesetzt, nicht gespielt. Christa war einfach so. Eine freundliche Person eben. Eine Frau, die mit einer Leichtigkeit erreichte, was wohl keine bewusst eingesetzte Strategie so einfach vermocht hätte.
Meiner Aufmerksamkeit entging ebenfalls nicht, dass Höflichkeit als eine hervorragende Tarnung dienen kann. Auf jeden Fall: Ich verdanke der Höflichkeit viel. Letztendlich wohl auch das wunderschöne Haus über dem See. Dort, im Weiler Kimmling-Hof, lebe ich seit etwas mehr als einem Jahr. Es war ein gutes Jahr. Wenn ich es in Gedanken Revue passieren lasse, eines der besten in meinem Leben, da es so gut wie immer selbstbestimmt, nur zu einem ganz geringen Teil fremdbestimmt ablief. Ich komme nicht leichtfertig zu dieser Aussage. Habe genügend Vergleichszeit angehäuft. Darf inzwischen auf sechs Jahrzehnte zurückblicken.
Wie bin ich in Kimmling-Hof gelandet?
An einem frühen Sonntagabend fuhr ich in meinem Wagen über Land, um einen Ort zu finden, der mich vielleicht verlocken könnte, dort für den Rest meines Lebens zu bleiben. Zudem hatte ich nachzudenken, wollte dabei nicht in meinen vier Wänden in München hin und her laufen. Meine Augen sollten die Grenze für meine Gedanken bestimmen. Ich wollte für den Rest meiner Zeit nicht mehr rund um die Uhr, wie seit Jahrzehnten, nur für die Firma, war es auch die meine, da sein. Noch hatte ich den roten Faden einer Alternative nicht in den Händen. Darum ging es, als ich fast den von Ästen eines Obstbaumes verdeckten Wegweiser hinunter zum See übersehen hätte. Ich war schon vorüber, setzte zurück und rollte im Schritttempo den geteerten Weg abwärts. Und dann entdeckte ich das Schild auf der Krone einer pittoresken Mauer, was heißen soll, sie war nicht mehr allzu gut in Form. Auf dem Schild standen zwei mit roter Farbe gepinselte Worte. Zu verkaufen. Das waren die magischen Zeichen, die den weiteren Weg vorgaben, den Denkprozess ab diesem Augenblick steuerten. Ich saß im Auto, der Motor lief, und ich starrte die zwei Worte an. Nach einigen Minuten stieg ich aus und kletterte auf die Mauer, sah das Haus und den Garten und den Blick hinunter zum See. Gerade in diesen Momenten malte die Sonne das Wasser golden. Farben, süß wie Limonade. Kitsch. Ich stand und schaute, bis das Wasser wieder fast schwarz wurde, begann mir dabei vorzustellen, wie ich auf diesem Fleckchen Erde meine Zeit verbringen würde.
Es zeigte sich tatsächlich, dass es eine gute Entscheidung war, mich hierher zurückzuziehen, die meiste Zeit mit mir alleine zu sein. Kann mich in meinem Refugium beschäftigen wie ich will, mich ungestört mit mir selbst befassen. Ohne Zeugen mit den hellen und den dunklen Seiten meines Wesens toben. Meine innere Stimme hat sich mit der Zeit immer mehr in den Vordergrund geredet und mich davon überzeugt, dass mir nicht mehr viel Zeit bleibt. Kein Arzt wird auf der Suche nach einer versteckten Krankheit bei mir fündig werden. Das weiß ich. Dennoch bin ich überzeugt, dass das Ende meines Lebens in der nahen Zukunft liegt. Nachdem die Stimme in meinem Kopf die Ahnung zur Gewissheit hochgeredet hatte, begann ich meinen Nachlass zu planen. Und dazu gehörte vor allem der Rückzug auf das Land. Nach Kimmling. Inzwischen ist so gut wie alles geordnet, einschließlich des Ablaufs meiner Beerdigung. So kann ich unbelastet von Ablenkung meine letzte Zeitspanne leben.
Wenn die Ruhe gegen Abend zur Stille wird, dann ist das jedes Mal ein Geschenk für meine Seele, so ich eine habe, wie Schopenhauer sagte. Ruhe ist ein unschätzbares Gut. Ich werde jedenfalls alles unternehmen, um mein kleines Reich, meinen Garten Eden, gegen mutwillige Störungen zu verteidigen. Wenn ich alles schreibe, dann meine ich auch alles.
Ein penetranter, unbelehrbarer Störenfried musste bereits für seine Sünden büßen.
Der Mann in dem Haus am Hang über dem See hat ihn auf den weiten Weg geschickt, von dem es keine Rückkehr gibt. Wenn der Mann am Morgen ab und zu sein Gesicht im Spiegel betrachtet, vermag er das Kainszeichen nicht zu entdecken, sucht es ernsthaft auch gar nicht. Niemand in seiner Umgebung vermutet in ihm einen Mörder. Die Menschen, mit denen er zu tun hat, etwa seine Nachbarn, sehen in ihm einen netten, zuvorkommenden älteren Herrn, der gerne hilft, wird er um Unterstützung gebeten.
Wie ist das mit dem Thema Tod?
Leo Petermann beschäftigt sich damit. Wie geht er mit den entscheidenden Fragen um? Hat er Angst vor dem Jenseits? Oder fühlt er vielmehr Neugierde? Der Tod ist für ihn kein theoretischer Fixpunkt. Nicht mehr, wie gesagt. Da ist zunächst einmal das Bewusstsein über seine eigene Endlichkeit auf Erden. Zum Zweiten der Tod eines Menschen, den er kalt, völlig emotionslos geplant und herbeigeführt hat. Belastet der Tote sein Gewissen? Er möchte nicht einfach so nein sagen. Er hört in sich hinein, forscht der Aussage seines Gewissens nach. In seinem Gesicht findet er nicht den Daumenabdruck Gottes, keinen Hinweis, der ihn zur Reue aufruft. Da war für ihn nur dieser dumme Mensch, der für seine provozierende Ungezogenheit bestraft wurde.
Was ich fühle, was ich höre, ist die Rückkehr der Stille auf den sanften Hügel über dem See.
Nein, ich vertrete keineswegs den Standpunkt, das Gewissen existiere nicht. Möchte da nicht falsch verstanden werden. Allerdings ist es meine Ansicht, dass ebenso wie bei den Tieren auch beim Menschen ein Gewissen nicht zur Grundausstattung des Baukastens der Natur gehört. Dann nämlich hätten sich die Menschen im Laufe der Geschichte ganz anders aufführen müssen. Das, was wir Gewissen nennen, ist dem Menschen anerzogen, das Ergebnis von Jahrtausenden, ist die lenkende Zuchtrute bei der Erziehung durch Eltern, Schule oder Kirche. Gewissen setzt unbedingt die Erkenntnis, das Eingeständnis von Schuld voraus.
Meine Eltern hatten keinen Einfluss, keinerlei Wirkung auf mich. Aus völlig unterschiedlichen Gründen. Meine Mutter habe ich nie kennengelernt. Sie starb nur wenige Monate nach meiner Geburt. Mein Vater kümmerte sich nicht um seinen Sohn. Dafür gibt es übrigens bis heute keine Anzeichen. Der Herr Professor lebte immer nur für die Wissenschaft. Wollte mit seiner Arbeit als Forscher die Menschheit einen Schritt weiterbringen. (So hat er es tatsächlich einmal formuliert.) Um die ersten tapsigen Gehversuche seines Sprösslings zu verfolgen, hatte er nicht nur keine Zeit, daran verschwendete er nicht einmal einen Gedanken. Verbrachte lieber seine Tage auf dem Campus, am Schreibtisch im Studierzimmer, von Bücherwänden eingemauert (wie er gerne ironisch gefärbt sagte), oder auf Symposien beim Austausch mit anderen klugen Köpfen. Also woher sollte er bitte die Zeit nehmen, vorausgesetzt er hätte es gewollt, seinem Kind Grundwerte zu vermitteln? Den kleinen Kerl aufzuziehen, überließ er großzügig den wechselnden Kindermädchen. Nur eines von ihnen, Christa, hat sich bis heute in meiner Erinnerung behauptet. Christa pflegte meine körperlichen Bedürfnisse, für Geist oder Seele sah sie sich nicht zuständig. Im privaten Kindergarten, der unter dem Kommando der lieben Tante Gretel reibungslos funktionierte, hatte Christas Vorbild bereits so weit Früchte getragen, um sicher getarnt zu sein. Im Internat – vom ersten Tag meiner Schulzeit bis zum letzten war ich Internatsschüler – war ich bereits ein Profi jener formvollendeten Liebenswürdigkeit. Mit ihr als Rüstung lächelte ich mich erfolgreich durch die Schuljahre. Ich sah mir von außen zu, dem Schauspieler, der auf der Bühne agiert. Einfluss auf mein Denken und Fühlen ließ ich nicht zu. Mein Inneres war von außen nicht mehr zugänglich. Der Kirche in Person des Internatsgeistlichen oder des Religionslehrers bin ich elegant ausgewichen. Letzterer hatte mich einmal Leo, der Schwindler genannt. Damit liefen die Versuche, mich in den Zirkel der Kirche zu locken, ins Leere. Sie rannten gegen eine Wand eisiger Höflichkeit. Ab da hatte die Kirche keinen Zugriff mehr auf mich, bekam auch keine Chance mehr.
Es brauchte seine Zeit, bis ich mir eingestand, offenbar nicht zu besitzen, was die anderen das Gewissen nannten. Es war in der Oberstufe, als mir das deutlich wurde.
2
Wie lange liege ich schon vor mich hindämmernd in meinem Bett? Es ist noch ziemlich zeitig am Morgen, fühle ich, weiß es nicht. Irgendwann bin ich so weit wach, mich zur Seite zu rollen, auf die Uhr zu sehen, um mir Gewissheit zu verschaffen. Halb drei. Die Stunde des Wolfes. Die Statistik behauptet, in den sechzig Minuten zwischen zwei und drei sterben die meisten Menschen. Wird sie auch meine Todesstunde sein? Soll ich es als Zeichen werten, gerade um diese Zeit aufzuwachen? Wenn es so weit ist, wer wird mich finden? Vermutlich Martha. Sicher ist nur, niemand wird bei mir sein, wenn ich den Schritt ins Jenseits mache, meinen Erdenweg beende. Ich schlafe alleine. Bewohne mein Haus alleine. Was sind das für Gedanken? Sie beginnen im Kreis zu laufen, blasen sich zu einem Haufen Schwachsinn auf. Ich kenne das. Kann recht gut damit umgehen. Um dem einen Schlusspunkt zu setzen, schwinge ich meine Beine aus dem Bett. Der Schlaf hat sich längst verzogen. An der Schalttafel in der Küche drücke ich das Icon, um die Läden hochfahren zu lassen. Auf nackten Sohlen streife ich einfach so durch das dunkle Haus. In der Küche trinke ich ein Glas Wasser. Trete auf die Terrasse hinaus. Die Luft ist frisch. Ein klarer Sternenhimmel. Über dem See schwebt Nebel. In der Bibliothek versuche ich, im Glasperlenspiel zu lesen. Nach noch nicht einmal einer Seite lege ich das Buch wieder auf den Tisch zurück. Mein Kopf weigert sich, dem wunderbaren Text zu folgen. Gehe ins Bad hinauf. Grüße den Mann im Spiegel mit einem freundlichen Grinsen. Kämme meine Haare, putze meine Zähne, rasiere mich. Immer noch im Schlafanzug setze ich mich an den Schreibtisch. Lese erst einmal die Abschnitte, die ich gestern geschrieben habe. Korrigiere hier und da, und schreibe dann weiter. Schreiben gehört zu meinem Tag im Haus über dem See.
Schon als Jugendlicher schrieb ich gerne. Es gefiel mir, eine andere Wirklichkeit allein durch Worte entstehen zu lassen. Angestachelt von unserem Deutschlehrer schrieb ich zwei kurze Stücke, die von der Theatergruppe der Schule aufgeführt wurden. Autor zu sein beförderte mich, zumindest für eine Weile, zu einem Star unter den Mitschülern. Allein, es blieb nur eine Episode. Nach der Schulzeit wurden die Weichen anders gestellt. Der Antrieb zum Schreiben war nicht einmal stark genug, um ein Tagebuch zu führen. Doch irgendwo in einer versteckten Falte meines Wesens blieb der Wunsch zu schreiben über die Jahre hinweg immer wach. Seit ich in Kimmling-Hof lebe, einem Weiler mit einem halben Dutzend locker am Hang verteilten Höfen sowie einigen auf großen Grundstücken stehenden Häusern, habe ich nun die Zeit für das Spiel mit der Fantasie und den Worten. Jetzt kann ich mir die Spinnerei mit Ideen erlauben. Kann mit ihnen spielen. Spielen. Das ist etwas, was ich bisher nicht kannte. Ein Herumtollen im weiten, unbegrenzten Garten der Sprache. Es macht Spaß, mit Wörtern zu hantieren. Ich baue fragile Türme damit. Wie andere es mit Bierdeckeln machen. Ich bin sehr behutsam, damit meine Wortgebäude nicht in sich zusammenstürzen.
3
Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs nach Kimmling, um beim Bäcker List meine Frühstückssemmeln zu holen. Könnte sie mir auch bringen lassen. Aber diese morgendliche Ausfahrt bei Wind und Wetter tut mir gut. Auf dem kurzen Anstieg vor dem Ort höre ich oft den Zug pfeifen, noch bevor ich ihn sehe. Wie ein beweglicher Scherenschnitt rollt der Schienenbus dunkel gegen den helleren Himmel auf der Höhe lautlos auf Kimmling zu. Wenn ich die Schienen erreiche, ist die Bahn bereits vorüber, steht vor dem kleinen Bahnhof.
Während ich in der Bäckerei vor der Theke warte, bis ich an der Reihe bin, sehe ich die Frau durch die Schaufensterscheibe. Zufällig. Hätte ich mich nicht umgedreht, wäre sie gleich wieder aus dem Bild gewesen. Was tut sie hier? Macht sie Urlaub? Möglich. Die Fremdenzimmer im Ort sind, soviel ich weiß, gut ausgelastet. Weshalb verschwende ich überhaupt Gedanken an diese Fremde? Was geht sie mich denn an? Nichts. Überhaupt nichts. Dennoch frage ich gleich darauf die Verkäuferin so nebenbei nach der Unbekannten. Die Frau suche ein Haus in der Gegend, kommt die Antwort prompt, wohne drüben beim Lindenwirt.
Darf ich einfach so daraus schließen, sie ist nicht wegen mir hier? Die Frau ist mir nämlich in den letzten Tagen zu häufig über den Weg gelaufen, um sie einfach abzutun. Auch wenn Kimmling nur ein kleines Dorf ist, kann ich nicht an eine solche Häufung von Zufällen glauben.
Ich verlasse die Bäckerei, besteige mein Fahrrad und habe die Frau schon aus meinen Gedanken verabschiedet.
4
Es war nach den ersten Wochen, als Korbinian mich herumführte, mir die nähere Umgebung vorstellte.
Wir sagten noch nicht du zueinander, doch Korbinian schon Herr Doktor zu mir. Ich habe mir da noch nicht vorstellen können, dass dieser breitschultrige, direkte, mit viel Mutterwitz gesegnete Mann, dass er mir einmal zu dem werden würde, was die Italiener Freund des Herzens nennen. Diese Stelle hatte ich bisher noch nie zu besetzen gehabt.
Der Himmel war blassblau, die Luft angenehm kühl, ein heller, durchsichtiger Morgen. Wir schritten über die Wiesen auf den Wald zu. Bevor wir den Turm erreichen würden, wollte er mir die im Wald versteckten Felsen zeigen. Tatsächlich waren es mächtige Brocken, stark mit Moos überzogen und stellenweise von kleinen, verkrüppelten Bäumen bewachsen. Korbinian führte mich in das Felsenlabyrinth hinein und deutete auf zwei gegenüberliegende, mit ihrer stumpfen Schwärze drohend wirkende Spalten. Auf seinem Gesicht meinte ich einen gewissen Stolz zu erkennen, den ich mir zunächst einmal nicht erklären konnte. Inzwischen weiß ich, es ist der Ausdruck von Korbinians Stolz auf seine Heimat. Er stammt aus Kimmling und viele herzeigbare Besonderheiten hat der kleine Ort nicht aufzuweisen. Die Spalten führen tief hinunter, sagte er. Wie tief? Keine Ahnung. Es war noch keiner unten. Warum nicht? Ich beugte mich über die Spalte. Ein nicht zu dicker Mensch müsste da hineinschlüpfen können. Zu uninteressant, zu unbedeutend für Höhlenforscher, meinte Korbinian. Wir gingen zurück zum Weg und weiter hinauf zum Turm.
Welche Rolle diese Felsspalten noch spielen sollten, war wirklich nicht einmal zu ahnen, lag noch in der Zukunft versteckt.
5
Die Zeitung steckt im Briefkasten am Tor. Ich lese sie beim Frühstück, das ich mir auf der Terrasse serviert habe, mit Blick hinunter zum See. Einer der schönen Momente des Tages. Zudem gibt es heute keine bedenklichen Schlagzeilen, die von Katastrophen irgendwo auf der Welt künden. Die ersten Seiten sind mit politischen Blaupausen gefüllt. Lese nur quer. Formuliere nicht mal meine kommentierenden Gedanken aus. Finde Punkte, bei denen mich verwundert, was politisch und wirtschaftlich Kurioses von den Menschen alles geduldet wird. Frage mich, warum murren sie nicht, ist doch oft genug sogar genügend Potenzial für Wut vorhanden? Das Volk zeigt sich erstaunlich geduldig. Es bleibt eine Schafherde, von oft ungeeigneten Hirten geweidet. Die Seiten des Feuilletons interessieren mich inzwischen viel mehr als Politik oder Wirtschaft. Das Kellertheater in der Kreisstadt kündigt ein neues Kabarettprogramm an. Ich mache mir gedanklich einen Knoten in mein Taschentuch. Das kleine Theater hat für mich einen anziehenden Charme, ist gemütlich, fast familiär. Man sitzt unter Gleichgesinnten, ohne sich allzu nahe auf den Pelz zu rücken. Kennt sich, wenn auch nur vom Sehen. Nur vor Beginn der Vorstellung und während der Pause spricht die Bedienung am Tisch vor. So fällt das Schlange stehen am Tresen weg, was immer wieder zu Unterhaltungen führt, denen ich allerdings meistens elegant aus dem Weg gehe. Ich unterhalte mich gerne, allerdings weniger mit Menschen, die mir der Zufall in den Weg spült. Da gebe ich mich scheu, strahle Abneigung gegen Annäherung aus. Zwei Mal war ich mit Paula in diesem Theater. Sie zog wie magisch die Blicke auf sich, was sie gar nicht zu bemerken schien, ist daran gewöhnt. Ihre lockere Natürlichkeit ist eine unsichtbare zusätzliche Anziehung, die auf die Menschen wirkt.
Ich lege die Zeitung zur Seite. Die Tasse in der Hand, lasse ich zu den letzten Schlucken Kaffee meine Augen spazieren gehen. Ein winziges Ritual. Unmittelbar vor mir, quasi zu meinen Füßen, breitet sich der Rosengarten aus, in dem ich die nächste Stunde zu verbringen gedenke. Blumen, allen voran die Rose, sind für mich das Synonym für Schönheit überhaupt. Dem Rosengarten schließt sich der Obstgarten mit Kirsch-, Apfel-, Pflaumen- und sogar zwei Birnbäumen an. Das hohe Gras unter den Bäumen wogt hellgrün im schwachen Morgenwind. Franz, der alte Schäfer, wird in diesen Tagen mit seinen Tieren kommen. Ich mag diese natürlichen Rasenmäher. Die modernen mit ihrem nervtötenden Motor sind mir ein Gräuel. Franz’ Hütehund wird darauf achten, dass die Tiere nicht übermütig über die niedrige Mauer in die Rosen springen. Die Mauer ist aus hellen faustgroßen Seekieseln errichtet, worauf der Makler immer wieder stolz hinwies, als sei das seine Idee gewesen. Seitlich der Bäume ist die Sicht frei auf eine breite Bucht des Sees mit Schilfufer und einigen dunklen Bootshäusern. Drüben auf der anderen Seeseite, vielleicht so um die zehn Kilometer entfernt, steigen die grünen runden Hügel an. Fruchtbares, buckeliges Bauernland. Davor, im klaren Morgenlicht, sind die roten Dächer, der hellgrüne Zwiebelturm der Kirche des kleinen Ortes zu sehen, dessen Namen ich bis heute nicht kenne. Mitte Mai kommt, ich habe es mir gemerkt, die Zeit, in der die Rapsfelder gelb herüberleuchten. Hebt sich der feine Schleier vor dem Horizont, stehen die Gipfel der Alpen zum Greifen nahe.
Diese wenigen Minuten des meditativen Schauens, diese wunderbare Stille, die wie Manna vom Himmel fällt, sind ein Geschenk, sind Balsam für das Gemüt. Das ist das Fleckchen Erde, für das ich mich entschieden habe, von dem ich sicher bin, dass ich genau hierher gehöre. Und wieder wird mir bewusst, wie wichtig mir vor allem die wunderbare Ruhe ist.
Bis zum Mittag arbeite ich im Rosengarten, länger als ich es eigentlich vorhatte. Immer wieder gebe ich mich der Sinnenfreude hin, mich über ein besonders schönes Exemplar zu beugen und den Duft zu genießen.
Irgendwann fühle ich Blicke in meinem Rücken. Oben auf der Terrasse steht Martha. Sie hat mir das Essen gebracht. Eine der eher raren Ausnahmen. Gewöhnlich gehe ich hinüber zu den Weilnböcks zum Essen. Martha und ihr Mann Korbinian sind meine Nachbarn. Zu Freunden sind mir die beiden inzwischen geworden. Martha ist meine Haushälterin. Mit Korbinian spiele ich Schach.
Den Korb und die Schere in der Hand verlasse ich den Rosengarten. Schenke Martha mein schönstes Lächeln, danke ihr, lasse damit ihr rundes offenes Gesicht strahlen. Sie betritt vor mir das Haus. Im Esszimmer hat sie den Tisch gedeckt. Mit kurzen Sätzen teilt sie mir mit, was sie mir aufgetischt hat.
Du bist eine Magierin der Küche, Martha.
Wenn möglich, würde sie jetzt schweben.
Ihr Blick geht zum Fenster. Vor dem Haus sitzt Korbinian wartend im Auto. Einmal im Monat besuchen sie Marthas Bruder, der den elterlichen Hof übernommen hat, im Bauernland drüben jenseits des Sees.
Marthas gutes Essen versetzt mich in eine behagliche, beinahe schon träge Stimmung. Mit dem Glas Rotwein in der Hand gehe ich hinaus, genieße Wein und Aussicht. Ein leichter Wind streicht von den Hügeln herüber. Nach einer Weile gehe ich in die Bibliothek, lege mich auf die Couch, lese im Glasperlenspiel. Schnell werden mir die Augen schwer. Obwohl ich gar nicht lange schlafe, bin ich nach dieser Siesta putzmunter. Stelle mich ans Fenster, die Hände, wird mir bewusst, wie zu einem Gebet gefaltet, und sehe hinüber zum Kastlerhof.
Da ich den letzten Schluck Wein vorhin auf der Terrasse getrunken habe, öffne ich in der Küche eine neue Flasche. Keine von meinen besten, doch eine gute. Schlechte Weine habe ich gar nicht im Keller. Mit einem Tuch poliere ich zwei Gläser. Lasse Flasche und Gläser erst einmal auf der Anrichte stehen. Trage zunächst den kleinen runden Tisch und zwei Stühle vom Gartenhaus in den Schatten eines Apfelbaumes hinüber. Von dort ist ein schmaler Streifen des Sees zu sehen. Über den Rasen gehe ich am Haus vorbei nach vorne zu den Garagen, bleibe dort stehen und sehe die Auffahrt hinunter. Ich gehe davon aus, dass der Pfarrer, der sich telefonisch ankündigte, pünktlich sein wird. Ich werfe eben einen Blick auf meine Uhr, da biegt der alte verbeulte, ehemals hellblaue Golf in die Auffahrt ein.
Es ist Hochwürden Demmes dritter Besuch bei mir. Das erste Mal stand er vor der Tür, da war ich gerade erst wenige Wochen in das Haus übersiedelt, noch mit der Organisation und Überwachung des Umbaus sowie mit der Inneneinrichtung gut beschäftigt. Auf eine liebenswürdige Art – er war mir da wohl etwas ähnlich – kam der Pfarrer ziemlich schnell zur Sache. Ihm war selbstverständlich zugetragen worden, dass ein vermeintlich Gutbetuchter aufgetaucht war. Viele unsichtbare Augen beobachten das Treiben jedes Neuen in einem kleinen Ort. Bis zu diesem Tag hatte ich die Vorstellung gehabt, das Kunstverständnis eines Dorfpfarrers sei an Heiligenbildchen geschult. Weit gefehlt. Hochwürden Demme kannte sich aus. Ihm ging es um das alte Kloster von Kimmling. Er hatte eine Stiftung gegründet, für die er unermüdlich Geld sammelte. Hatte es sich zur Aufgabe gemacht, das alte Gemäuer vor dem Verfall zu retten. Es war ihm eine Herzensangelegenheit. Wie man mir mehrfach zuraunte, wohl ein Kampf gegen Windmühlenflügel. Zu dieser Zeit kannte ich das Kloster noch nicht, hatte noch nicht einmal davon gehört. Niemand, vom Pfarrer abgesehen, interessierte sich wirklich dafür. Nicht einmal der Denkmalschutz, der gewöhnlich eifersüchtig die Hand auf jeden bemoosten Stein legt. Der so freundliche, harmlos wirkende Mann mit den roten Bäckchen war beharrlich, ließ sich durch nichts entmutigen. Irgendwie imponierte mir seine Haltung. Ich hatte alle Hände voll zu tun, eigentlich gar keine Zeit für Pfarrer Demme. Er schlug mich mit meinen eigenen Waffen, mit seinem Lächeln. Meinen höflichen Einwand, ich sei nicht katholisch, tat er mit einem Kopfschütteln und den Worten ab, es gehe gar nicht um Religion. Ein altes Kulturgut gelte es zu bewahren. Das Kloster von Kimmling. Um ihn loszuwerden, der Architekt stand mit einem Plan ungeduldig wartend in der Nähe, versprach ich ihm eine Spende, wenn er mir die Kontonummer dalasse. So schnell wie ein geschickter Hütchenspieler zog er ein Formular aus seiner Jackentasche, drückte es mir in die Hand, sagte, er wolle nicht weiter stören, und trat mit der Andeutung einer Verbeugung augenblicklich den Rückzug an. Und schon hatte ich ihn vergessen.
Unser zweites Treffen fand im Garten statt. Ich sah mir gerade die Obstbäume an, die jetzt meine waren, als ich eine Bewegung im Augenwinkel wahrnahm. Pfarrer Demme stand drüben auf dem Pfad, der vom Dorf her zum See hinunterführt, und winkte. Ich malte ihm den Weg um das Haus herum in die Luft und er nickte als Zeichen, dass er verstanden habe. Während er zwischen den Büschen verschwand, ging ich ins Haus, wusch mir die Hände, öffnete mit Knopfdruck das Tor zur Auffahrt und erwartete ihn an der Haustür. Wir reichten uns die Hand und ich schlug vor, uns unter die Bäume zu setzen, lud ihn zu einem Glas Rotwein ein. Ohne kokettierendes Zögern nahm er meine Einladung an.
Nach dem ersten Schluck, den er mit einem Lächeln und dem Streichen der Zungenspitze über die Lippen würdigte, deklamierte er, das Glas in der Hand:
Du lässest Gras wachsen für das Vieh
und Saat zu Nutz den Menschen,
dass du Brot aus der Erde bringest,
und dass der Wein erfreue des Menschen Herz.
Die Psalmen sind ein wunderschöner poetischer Teil der Weltliteratur, sagte ich lächelnd zu ihm.
Der Pfarrer neigte seinen Kopf und zollte meinen Bibelkenntnissen Respekt. Daran schloss er, fast in einem Atemzug, seinen Dank für meine, wie er sagte, großzügige Spende, die ich gar nicht als solche eingeschätzt hatte.
Die Bibel ist eines der schönsten Bücher, in denen man seinen Geist spazieren gehen lassen kann, rückte ich sein Lob an den richtigen Platz.