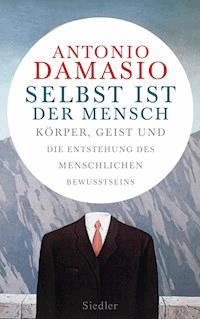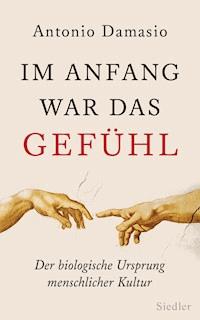
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Das neue Buch von Bestsellerautor Antonio Damasio: Wie die Gefühle unsere Kultur prägen
Wie ist der Mensch zum Menschen geworden – und wie ist all das entstanden, was wir Kultur nennen? Der weltbekannte Neurowissenschaftler Antonio Damasio hat eine verblüffende Erklärung: Nicht Verstand und Intellekt, sondern die Gefühle haben dabei die entscheidende Rolle gespielt. Ein neuer, aufregender Blick auf die Fundamente menschlicher Zivilisation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Ähnliche
Das Buch:
Wie ist all das entstanden, was wir Kultur nennen? Der weltbekannte Neurowissenschaftler und Bestsellerautor Antonio Damasio hat eine verblüffende Erklärung: Nicht Verstand und Intellekt, sondern die Gefühle haben dabei die entscheidende Rolle gespielt. Basierend auf seiner jahrelangen Forschung erklärt Damasio das ständige Wechselspiel zwischen Körper und Geist, das die Evolution des Menschen geprägt hat. Und er spannt dabei einen großen Bogen von den evolutionären Anfängen des Lebens bis hin zur aktuellen Hirnforschung. Ein neuer, aufregender Blick auf den biologischen Ursprung menschlicher Zivilisation.
Der Autor:
Antonio Damasio, geboren 1944, ist Professor für Neurowissenschaften, Neurologie und Psychologie an der University of Southern California und Direktor des dortigen Brain and Creativity Institute. Für seine Arbeit wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Damasio ist Fellow der American Academy of Arts and Sciences, Mitglied der National Academy of Sciences sowie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Seine Bücher, darunter »Descartes’ Irrtum« und »Ich fühle, also bin ich«, sind internationale Bestseller und wurden in über 30 Sprachen übersetzt. Bei Siedler erschien 2012 »Selbst ist der Mensch. Körper, Geist und die Entstehung des menschlichen Bewusstseins«.
Antonio Damasio
IM ANFANG WAR DASGEFÜHL
Der biologische Ursprung menschlicher Kultur
Aus dem Englischen vonSebastian Vogel
Siedler
Die amerikanische Originalausgabe erscheint 2018 unter dem Titel »The Strange Order of Things. Life, Feeling and the Making of Cultures« bei Pantheon Books, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 by Antonio DamasioCopyright © 2017 by Siedler Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Rothfos + Gabler, Hamburg
Umschlagabbildung: © Bridgeman Images
Redaktion: Jan Schleusener, Berlin
Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
ISBN 978-3-641-15899-6V002
www.siedler-verlag.de
Für Hanna
Ich seh' es fühlend.
Gloucester zu Lear in König Lear, vierter Akt, sechste Szene
Die Frucht ist blind. Es ist der Baum, der sieht.
René Char
Inhalt
Anfänge
TEIL I: Über Leben und seine Regeln (Homöostase)
1 Über die Natur des Menschen
Eine einfache Idee · Gefühl und Intellekt · Wie originell war der kulturelle Geist der Menschen? · Bescheidene Anfänge · Aus dem Leben der sozialen Insekten · Homöostase · Geist und Gefühle vorausahnen zu lassen, ist nicht das Gleiche, wie Geist und Gefühle hervorzubringen · Frühe Lebewesen und menschliche Kulturen
2 Im Bereich des Ungleichen
Leben · Leben in Bewegung
3 Varianten der Homöostase
Die verschiedenen Formen der Homöostase · Homöostase heute · Die Wurzeln einer Idee
4 Von einzelnen Zellen zu Nervensystem und Geist
Seit es Bakterien gibt … · Nervensysteme · Der lebende Körper und der Geist
Teil II: Der Aufbau des kulturellen Geistes
5 Der Ursprung des Geistes
Der folgenschwere Übergang · Geistbegabtes Leben · Die Eroberung · Bilder erfordern ein Nervensystem · Bilder der Welt außerhalb unseres Organismus · Bilder der Innenwelt unseres Organismus
6 Der Geist erweitert sich
Das verborgene Orchester · Bilderzeugung · Bedeutungen, verbale Übersetzungen und die Entstehung von Erinnerungen · Die Bereicherung des Geistes · Eine Anmerkung zum Gedächtnis
7 Affekte
Was Gefühle sind · Wertigkeit · Arten von Gefühlen · Der emotive Reaktionsprozess · Woher kommen die emotiven Reaktionen? · Emotionale Stereotype · Die Geselligkeit der Triebe, Motivationen und konventionellen Emotionen · Gefühlsschichten
8 Gefühle werden aufgebaut
Woher kommen die Gefühle? · Gefühle werden zusammengebaut · Die Kontinuität von Körper und Nervensystem · Die Rolle des peripheren Nervensystems · Andere Besonderheiten der Beziehung zwischen Körper und Gehirn · Die missachtete Rolle des Darms · Wo sind Gefühlserlebnisse lokalisiert? · Sind die Gefühle nun erklärt? · Erinnerungen an frühere Gefühle: eine Abschweifung
9 Bewusstsein
Über Bewusstsein · Das Bewusstsein wird beobachtet · Subjektivität: der erste und unverzichtbare Bestandteil des Bewusstseins · Der zweite Bestandteil des Bewusstseins: Integration von Erlebnissen · Von der Sinneswahrnehmung zum Bewusstsein · Das schwierige Problem des Bewusstseins: eine Abschweifung
Teil III: Der kulturelle Geist bei der Arbeit
10 Über Kulturen
Der kulturelle Geist des Menschen in Aktion · Homöostase und die biologischen Wurzeln der Kulturen · Ausgeprägt menschliche Kulturen · Gefühle als Schiedsrichter und Vermittler · Einschätzung der Vorzüge einer Idee · Von religiösen Überzeugungen und Moral zu politischer Führung · Kunst, Philosophie und Naturwissenschaften · Widerspruch gegen eine Idee · Bilanz ziehen · Eines harten Tages Nacht
11 Medizin, Unsterblichkeit und Algorithmen
Moderne Medizin · Unsterblichkeit · Algorithmen als Beschreibung des Menschseins · Roboter als Diener der Menschen · Zurück zur Sterblichkeit
12 Die Conditio humana heute
Ein zweideutiger Zustand · Hat die Kulturkrise einen biologischen Hintergrund? · Ein ungelöster Konflikt
13 Die seltsame Reihenfolge der Dinge
Dank
Anmerkungen und Literatur
Personenregister
Anfänge
I
Dieses Buch handelt von einem Interesse und einer Idee. Ich interessiere mich schon lange für die menschlichen Affekte – die Welt der Emotionen und Gefühle – und erforsche sie seit vielen Jahren. Warum und wie spüren und fühlen wir? Wie konstruieren wir mithilfe der Gefühle unser Selbst? Wie unterstützen oder untergraben Gefühle unsere besten Absichten, warum und wie interagiert dabei das Gehirn mit dem Körper? Zu all diesen Themen kann ich neue Fakten und Interpretationen beisteuern.
Was die Idee angeht, so ist sie sehr einfach: Den Gefühlen wird nicht die Bedeutung zugeschrieben, die sie als Motive, Begleiter und Vermittler der kulturellen Unternehmungen des Menschen tatsächlich haben. Menschen erschaffen im Gegensatz zu allen anderen Lebewesen eine spektakuläre Vielfalt an Gegenständen, Handlungsweisen und Ideen, die zusammenfassend als Kultur bezeichnet werden. Dazu gehören Kunst, Philosophieren, Moralsysteme und religiöser Glaube, Ideen von Gerechtigkeit, Regierungshandeln, wirtschaftliche Institutionen, Technologie und Wissenschaft. Warum und wie nahm dieser ganze Prozess seinen Anfang? Als Antwort auf diese Frage wird häufig auf eine wichtige Fähigkeit des menschlichen Geistes – die verbale Sprache – und andere charakteristische Merkmale verwiesen, etwa das stark ausgeprägte Sozialverhalten und der überlegene Intellekt. Diejenigen, die der Biologie zuneigen, erwähnen auch die natürliche Selektion auf der Ebene der Gene.
Ich habe zwar keinen Zweifel daran, dass Intellekt, Geselligkeit und Sprache für die Entwicklung eine Schlüsselrolle gespielt haben, und es versteht sich von selbst, dass die Organismen, die zu kulturellen Schöpfungen fähig sind, zusammen mit den spezifischen Fähigkeiten, die dabei zutage treten, im Menschen aufgrund natürlicher Selektion und genetischer Übertragung vorhanden sind. Die Idee ist, dass aber noch etwas anderes hinzukommen musste, damit die Geschichte der menschlichen Kulturen ihren Anfang nehmen konnte. Dieses andere war ein Motiv. Damit meine ich vor allem Gefühle, von Schmerz und Leiden bis hin zu Wohlbefinden und Freude.
Deutlich wird das am Beispiel der Medizin, einer unserer wichtigsten kulturellen Errungenschaften. Die Verbindung in der Medizin von Wissenschaft mit Technik war ursprünglich eine Reaktion auf die Schmerzen und Leiden, die durch Krankheiten aller Art verursacht werden, von körperlichen Verletzungen und Infektionen bis hin zu Krebs. Demgegenüber stand das Gegenteil von Schmerzen: Wohlbefinden, Freude und die Aussicht auf gutes Gedeihen. Die Medizin begann keineswegs als intellektueller Zeitvertreib, mit dem man die eigene Klugheit an einem diagnostischen Rätsel oder einem physiologischen Mysterium trainieren wollte. Sie erwuchs vielmehr als Konsequenz aus ganz bestimmten Gefühlen der Patienten und Gefühlen der ersten Ärzte, nicht zuletzt aus dem Mitgefühl, das aus Empathie geboren wird. Diese Motive sind bis heute erhalten geblieben. Es wird keinem Leser verborgen geblieben sein, dass sich Zahnarztbesuche und chirurgische Eingriffe zu unseren Lebzeiten zum Besseren verändert haben. Diese Verbesserungen, wie etwa wirksame Anästhesie oder präzise Instrumente, haben vor allem mit dem Management von unangenehmen Gefühlen zu tun. Ingenieure und Wissenschaftler hatten daran ihren Anteil, aber es steckt auch ein Motiv dahinter. Das Profitstreben der Medikamenten- und Geräteindustrie als Motiv ist ebenso wichtig, denn die Leute haben das Bedürfnis, Leiden zu mindern, und die Industrie reagiert darauf. Das Profitstreben ist seinerseits von verschiedenen Bedürfnissen getrieben, die nichts anderes sind als Gefühle – etwa das Streben nach Fortschritt und Ansehen, aber auch pure Habgier. Die enormen Anstrengungen zur Entwicklung von Therapieverfahren für Krebs oder für die Alzheimer-Krankheit kann man unmöglich verstehen, wenn man nicht Gefühle als Motive, Begleiter und Vermittler des ganzen Prozesses berücksichtigt. Auch warum die westliche Kultur etwa bei der Heilung von Malaria in Afrika oder dem Umgang mit der Drogensucht in den meisten anderen Regionen so viel weniger Leidenschaft zeigt, versteht man nicht, wenn man nicht das jeweilige Geflecht der Gefühle zur Kenntnis nimmt, das diese Handlungen begünstigt oder behindert. Sprache, Sozialverhalten, Wissen und Vernunft sind die Erfinder und zugleich die Exekutoren dieser komplizierten Prozesse. Aber eigentlich werden sie angetrieben von Gefühlen, die wiederum so lange erhalten bleiben, bis die Resultate überprüft sind und nötige Anpassungen vorgenommen werden.
Im Wesentlichen lautet der Grundgedanke: Kulturelle Tätigkeit hat ihren Ausgangspunkt im Affekt und bleibt tief in ihm verwurzelt. Wenn wir die Konflikte und Widersprüche in der Natur des Menschen begreifen wollen, müssen wir das vorteilhafte und nachteilige Wechselspiel zwischen Gefühlen und Vernunft verstehen lernen.
II
Wie konnten Menschen gleichzeitig zu Leidenden, Bettelmönchen, Priestern der Freude und Menschenfreunden werden, zu Künstlern und Wissenschaftlern, Heiligen und Verbrechern, wohlwollenden Herrschern über die Erde und Ungeheuern mit dem Drang, sie zu zerstören? Um diese Frage zu beantworten, brauchen wir natürlich die Beiträge von Historikern und Soziologen, aber auch die von Künstlern, die mit ihrer Sensibilität sehr häufig intuitiv die verborgenen Gesetzmäßigkeiten im Drama der Menschheit erfassen; außerdem brauchen wir die Erkenntnisse verschiedener Teilgebiete der Biologie.
Als ich der Frage nachging, wie Gefühle nicht nur den ersten Schub von Kultur in Gang setzten, sondern auch zu einem integralen Bestandteil ihrer weiteren Entwicklung wurden, suchte ich nach einem Weg, um das Leben der Menschen, wie wir es heute kennen – ein Leben, das mit Geist, Gefühl, Bewusstsein, Gedächtnis, Sprache, komplexen Sozialbeziehungen und kreativer Intelligenz versehen ist –, mit dem Leben der Frühzeit vor bis zu 3,8 Milliarden Jahren in Verbindung zu bringen. Um den Zusammenhang herzustellen, musste ich für die Entwicklung und das Auftreten dieser entscheidenden Fähigkeiten in der langen Geschichte der Evolution eine Reihenfolge und einen zeitlichen Ablauf bestimmen.
Die von mir beschriebene tatsächliche Reihenfolge, in der biologische Strukturen und Fähigkeiten zutage traten, läuft der herkömmlichen Auffassung zuwider. Denn in der Geschichte des Lebendigen richten sich die Ereignisse nicht nach den hergebrachten Vorstellungen, die wir Menschen uns vom Aufbau dieses wunderbaren Instruments gemacht haben, das ich den kulturellen Geist nenne.
Als ich mir vornahm, eine Geschichte über die Substanz und die Folgen menschlicher Gefühle zu schreiben, kam ich zu der Erkenntnis, dass unsere Gedanken über Geist und Kultur nicht im Einklang mit der biologischen Realität stehen. Wenn ein Lebewesen sich in einem sozialen Umfeld intelligent und einnehmend verhält, nehmen wir an, dass dieses Verhalten aus Weitblick, Berechnung, enormer Komplexität und der Mithilfe eines Nervensystems resultiert. Heute ist aber klar: Solche Verhaltensweisen konnten schon der nackten, sparsamen Ausrüstung einer einzelnen Zelle – eines Bakteriums – entspringen, als sich die Biosphäre gerade zu formen begann.
Wir können uns dafür eine Erklärung ausmalen, die ansatzweise auch Befunde einschließt, die der Intuition widersprechen. Diese Erklärung stützt sich auf die Mechanismen des Lebens als solches und auf die Bedingungen für seine Regulation, das heißt auf eine ganze Reihe von Phänomenen, die in der Regel mit einem einzigen Sammelbegriff als Homöostase bezeichnet werden. Gefühle sind der mentale Ausdruck von Homöostase, und Homöostase, die unter der Decke der Gefühle aktiv wird, ist der Faden, der, was die Funktion angeht, die frühen Lebensformen mit der außergewöhnlichen Partnerschaft von Körper und Nervensystem verbindet. Diese Partnerschaft ist die Ursache für die Entstehung eines bewussten, fühlenden Geistes, der seinerseits die charakteristischen Aspekte des Menschseins prägt: Kultur und Zivilisation. Gefühle stehen im Mittelpunkt des vorliegenden Buches, aber ihre Kraft beziehen sie aus der Homöostase.
Indem wir die Kulturen mit Gefühlen und Homöostase in einen Zusammenhang bringen, stärken wir ihre Verbindung zur Natur und vertiefen die menschlichen Aspekte des kulturellen Prozesses. Gefühle und der kreative kulturelle Geist sind durch einen langen Prozess verbunden, in dem die genetische Selektion, die von Homöostase gelenkt wurde, eine herausragende Rolle spielte. Indem wir Kulturen mit Gefühlen, Homöostase und Genetik in Verbindung bringen, sorgen wir dafür, dass sich kulturelle Ideen, Praktiken und Objekte vom eigentlichen Lebensprozess nicht noch weiter ablösen.
Es sollte auf der Hand liegen, dass die vor mir hergestellten Zusammenhänge nicht die historische Eigenständigkeit kultureller Phänomene vermindern. Weder reduziere ich kulturelle Phänomene auf ihre biologischen Wurzeln noch versuche ich, den kulturellen Prozess in allen seinen Aspekten naturwissenschaftlich zu erklären. Naturwissenschaft allein kann das menschliche Erleben in seiner Gesamtheit nicht erhellen, wenn nicht das Licht aus Kunst und Geisteswissenschaft hinzukommt.
Diskussionen über die Entstehung von Kulturen quälen sich häufig mit zwei widersprüchlichen Überlegungen herum: Nach der einen erwächst das Verhalten der Menschen aus autonomen kulturellen Phänomenen, in der anderen ist es die Folge der natürlichen Selektion, wie sie von den Genen übermittelt wird. Es besteht aber keine Notwendigkeit, die eine Erklärung gegenüber der anderen zu bevorzugen. Menschliches Verhalten erwächst – in unterschiedlichen Stärkeverhältnissen und unterschiedlicher Reihenfolge – aus beiden.
Aber auch wenn wir in der Biologie nichtmenschlicher Lebewesen die Wurzeln der menschlichen Kultur ausmachen, tut dies der Sonderstellung des Menschen merkwürdigerweise keinen Abbruch. Jeder Mensch bezieht seine Sonderstellung aus der einzigartigen Bedeutung seines Leidens und Gedeihens im Kontext der Erinnerungen an die Vergangenheit und der Vorstellungen von Zukunft, die wir uns unaufhörlich zurechtlegen.
III
Wir Menschen sind geborene Geschichtenerzähler und finden es höchst befriedigend, davon zu erzählen, wie alles begann. Beliebt sind Geschichten, die etwa von bestimmten Dingen oder einer Beziehung handeln – Liebesaffären und Freundschaften sind für Geschichten über den Anfang dankbare Themen. Weniger gut sind wir, wenn wir uns der Natur als Ganzem zuwenden – und häufig liegen wir hier sogar falsch. Wie nahm das Leben seinen Anfang? Wie entstanden Geist, Gefühle oder Bewusstsein? Wann tauchten zum ersten Mal soziale Verhaltensweisen und Kulturen auf? Solche Fragen zu beantworten, ist kein einfaches Unterfangen. Als der Physiker und Nobelpreisträger Erwin Schrödinger sich der Biologie zuwandte und sein klassisches Werk Was ist Leben? verfasste, zielte er im Titel interessanterweise eben nicht auf den »Ursprung« des Lebens ab. Dies, so war ihm klar, wäre vergebliche Mühe gewesen. Dennoch ist der Reiz dieser Aufgabe unwiderstehlich.
Das vorliegende Buch wird einige Tatsachen präsentieren, die die Entstehung des Geistes beleuchten – eines Geistes, der denkt, Narrative und Sinn erschafft, sich an die Vergangenheit erinnert und sich die Zukunft ausmalt; sie erklären aber auch den Apparat von Gefühlen und Bewusstsein, der für die Wechselbeziehungen zwischen dem Geist und der Außenwelt und ihren jeweiligen Lebensformen verantwortlich ist.
In ihrem Bedürfnis, mit den menschlichen Herzensnöten umzugehen, und in ihrem Drang, die Widersprüche in Einklang zu bringen, die durch Leiden, Ängste, Wut und das Streben nach Wohlbefinden entstehen, wandten sich die Menschen dem Staunen und der Ehrfurcht zu, und dabei entdeckten sie Musik, Tanz, Malerei und Literatur. In der Folge schufen sie mitunter schöne, zuweilen aber auch fragwürdige Erzählungen, die man religiöser Glaube, philosophisches Erkunden und politische Führung nennt. Auf diesem Wege, von der Wiege bis zur Bahre, versucht der kulturelle Geist, das Drama des Menschlichen zu bewältigen.
TEIL I Über Leben und seine Regeln (Homöostase)
1 Über die Natur des Menschen
Eine einfache Idee
Wenn wir verletzt sind und Schmerzen haben, können wir etwas dagegen tun, ganz gleich, was die Ursache der Verletzung ist oder wie sich der Schmerz im Einzelnen anfühlt. Das Spektrum der Situationen, die beim Menschen Leid verursachen können, umfasst nicht nur körperliche Wunden, sondern auch die Verletztheit, die wir empfinden, wenn wir einen geliebten Menschen verloren oder eine Demütigung erlitten haben. Die Fülle derartiger Erinnerungen erhält das Leiden aufrecht und verstärkt es zugleich. Das Gedächtnis trägt dazu bei, dass wir die Situation in eine imaginäre Zukunft projizieren und uns die Folgen ausmalen.
Menschen waren imstande, auf ihr Leiden zu reagieren, indem sie zunächst versuchten, ihre missliche Lage zu verstehen, und indem sie dann für Ausgleich, Korrektur oder sonstwie effektive Abhilfe sorgten. Menschen konnten nicht nur Schmerz erleiden, sondern auch das genaue Gegenteil – Freude und Begeisterung – erleben, und das in vielfältigen Situationen vom Einfachen und Banalen bis hin zum Erhabenen – von der Freude als Reaktion auf Geschmack und Geruch, auf Essen, Wein, Sex und körperliches Wohlbehagen, bis hin zum Wunder des Spielens, zu dem Staunen und den erhebenden Gefühlen, die sich bei der Betrachtung einer Landschaft einstellen, oder wenn wir einen anderen Menschen bewundern oder tiefe Zuneigung zu ihm empfinden. Ebenso haben die Menschen entdeckt, dass Machtausübung, Dominanz und sogar die Vernichtung anderer, nicht nur zu schierem Chaos und Zerstörung führen, sondern auch strategisch von Vorteil sein oder gar Vergnügen bereiten können. Auch solche Gefühle wurden von Menschen zu einem praktischen Zweck genutzt: Sie waren der Antrieb zu der grundsätzlichen Frage, warum es Schmerzen überhaupt gibt, und vielleicht rätselte man deshalb auch über den grotesken Umstand, dass das Leiden anderer unter bestimmten Umständen für Wohlbefinden sorgt. Vielleicht nutzten die Menschen verwandte Gefühle wie Furcht, Überraschung, Wut, Traurigkeit und Mitgefühl als Orientierung, um Wege zu finden, wie man dem Leiden und seinen Ursachen entgegenwirken kann. Wie ihnen vielleicht schnell klar wurde, repräsentierten manche der sozialen Verhaltensweisen, über die sie bereits verfügten, das genaue Gegenteil von Aggression und Gewalt – sie gingen offenbar nicht nur mit dem eigenen Wohlbefinden einher, sondern auch mit dem von anderen.
Warum gelingt es den Gefühlen, unseren Geist so zu beeinflussen, dass er derart vorteilhaft handelt? Ein Grund liegt in der Beobachtung dessen, was Gefühle im Geist bewirken und für den Geist tun. Ohne dass ein einziges Wort gesprochen wird, teilen Gefühle dem Geist unter normalen Umständen in jedem einzelnen Augenblick mit, ob der Lebensprozess in dem zugehörigen Körper in eine gute oder schlechte Richtung verläuft. Damit stufen die Gefühle den Lebensprozess auf natürlichem Wege danach ein, ob er dem Wohlbefinden und Gedeihen dienlich ist oder nicht.1
Ein weiterer Grund, warum Gefühlen gelingt, was Ideen nicht schaffen, hat mit dem einzigartigen Wesen der Gefühle zu tun. Gefühle wurden nicht allein vom Gehirn hervorgebracht, sie sind vielmehr das Ergebnis einer partnerschaftlichen Kooperation von Körper und Gehirn, die mittels ungehindert fließender chemischer Moleküle und Nervenbahnen in Wechselbeziehung stehen. Dieses besondere, häufig übersehene Arrangement sorgt dafür, dass Gefühle einen ansonsten vielleicht gleichmäßigen Gedankenstrom stören können. Die Quelle des Gefühls ist das Leben auf dem Drahtseil, das zwischen Gedeihen und Tod balanciert. Deshalb sind Gefühle mentaler Aufruhr, beunruhigend oder prachtvoll, sanft oder intensiv. Sie können uns subtil und eher intellektuell erregen, aber auch heftig und eindringlich, sodass sie unsere volle Aufmerksamkeit verlangen. Selbst in ihrer positivsten Form neigen sie dazu, den Frieden zu verletzen und die Ruhe zu stören.2
Der einfache Grundgedanke lautet also: Gefühle von Schmerz und Gefühle der Freude in allen Abstufungen vom Wohlbefinden bis zu Elend und Krankheit lösten Prozesse des Fragens, der Erkenntnis und der Problemlösung aus, die den Geist des Menschen so grundlegend vom Geist anderer biologischer Arten unterscheiden. Durch Fragen, Verstehen und Problemlösung waren Menschen in der Lage, raffinierte Lösungen für die Lebensnöte zu entwickeln und gleichzeitig die Mittel zu schaffen, die ihr Gedeihen fördern. Sie haben Wege vervollkommnet, um sich zu ernähren, zu kleiden und zu wohnen, ihre körperlichen Wunden zu versorgen und das zu erfinden, was später Medizin genannt wurde. Wenn Schmerzen und Leid von anderen verursacht wurden – durch Gefühle gegenüber anderen oder die Wahrnehmung der Gefühle anderer gegenüber sich selbst – oder wenn der Schmerz aus der Analyse des eigenen Zustandes – etwa durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit – erwuchs, konnten Menschen auf ihre Fähigkeit zurückgreifen, individuelle und kollektive Ressourcen zu mobilisieren. Sie erfanden eine Fülle von Reaktionen. Das Spektrum reichte dabei von moralischen Vorschriften und juristischen Prinzipien über Formen der gesellschaftlichen Organisation und Führung bis hin zu künstlerischen Ausdrucksformen und religiösen Überzeugungen.
Genaue Aussagen darüber, wann solche Entwicklungen stattgefunden haben, sind nicht möglich. Sie verliefen in einzelnen Bevölkerungsgruppen und verschiedenen geographischen Regionen mit sehr unterschiedlichem Tempo. Wir wissen aber mit Sicherheit, dass entsprechende Prozesse vor 50000 Jahren im Mittelmeerraum, in Mittel- und Südeuropa sowie in Asien im Gange waren, also in Regionen, in denen der Homo sapiens – wenn auch in Gesellschaft der Neandertaler – gegenwärtig war, und lange nachdem er vor mindestens 200000 Jahren erstmals auf der Bildfläche erschienen war.3 Demnach liegen die Anfänge der Kultur bei den Jägern und Sammlern, das heißt lange vor der kulturellen Erfindung namens Landwirtschaft vor rund 12000 Jahren und vor der Erfindung von Schrift und Geld. Dass es sich bei der kulturellen Evolution um einen multizentrischen Prozess handelte, wird besonders an den verschiedenen Schriftsystemen deutlich, die sich an verschiedenen Orten zu ganz unterschiedlichen Zeiten entwickelten. Zuerst entstand die Schrift in Sumer (in Mesopotamien) und Ägypten zwischen 3500 und 3200 v. Chr. Später tauchte in Phönizien ein anderes Schriftsystem auf, das letztlich auch von Griechen und Römern benutzt wurde. Unabhängig davon entwickelten sich Schriften um 600 v. Chr. in der Kultur der Maya in der mittelamerikanischen Region des heutigen Mexiko.
Dass das Wort »Kultur« auf das Universum der Ideen angewandt wird, haben wir Cicero und dem alten Rom zu verdanken. Cicero beschrieb mit dem Wort das Heranziehen der Seele – cultura animi; dabei dachte er offensichtlich an den Ackerbau und sein Ergebnis, die Vervollkommnung und Verbesserung des Pflanzenwachstums. Was für das Land gilt, kann demnach genauso auch für den Geist gelten.
An der heutigen Hauptbedeutung des Wortes »Kultur« gibt es kaum Zweifel. Aus Wörterbüchern erfahren wir, dass Kultur eine Sammelbezeichnung für Ausdrucksformen intellektueller Errungenschaften ist, und wenn nichts anderes gesagt wird, meinen wir damit die Kultur der Menschen. Künste, philosophische Untersuchungen, religiöse Überzeugungen, moralische Fähigkeiten, Justiz, Regierungsführung und wirtschaftliche Institutionen – Märkte, Banken –, Technologie und Wissenschaft sind die wichtigsten Kategorien der Bestrebungen und Errungenschaften, die das Wort »Kultur« vermittelt. Die Ideen, Einstellungen, Sitten, Verhaltensweisen, Praktiken und Institutionen, durch die sich verschiedene soziale Gruppen unterscheiden, gehören ebenso zum breiten Spektrum der Kultur wie der Gedanke, dass Kulturen durch Sprache sowie durch ebenjene Objekte und Rituale, die durch Kultur geschaffen wurden, von Mensch zu Mensch und von Generation zu Generation weitergegeben werden. Wenn ich in diesem Buch von Kulturen oder dem kulturellen Geist spreche, meine ich damit dieses breite Spektrum verschiedener Phänomene.
Das Wort »Kultur« wird aber noch in einer anderen geläufigen Bedeutung verwendet. Amüsanterweise bezeichnet es die Zucht von Bakterien und anderen Mikroorganismen im Labor. Man meint damit Bakterien in einer Kultur, aber die kulturähnlichen Verhaltensweisen von Bakterien, die wir gleich genauer betrachten werden. Auf diese oder jene Weise sind Bakterien dazu ausersehen, zu einem Teil der großartigen Geschichte über die Kultur zu werden.
Gefühl und Intellekt
Herkömmlicherweise erklärt man die kulturellen Bestrebungen der Menschen unter dem Gesichtspunkt des außergewöhnlichen menschlichen Intellekts, jener leuchtenden Extrafeder im Kopfschmuck der Lebewesen, die in den langen Zeiträumen der Evolution durch verschiedene genetische Programme entstand. Dabei hält man die Gefühle kaum einer Erwähnung für wert. Die Stars der kulturellen Entwicklung sind vielmehr die Expansion von menschlicher Intelligenz und Sprache sowie das ungewöhnliche Ausmaß an Geselligkeit. Auf den ersten Blick gibt es gute Gründe dafür, eine solche Erklärung für plausibel zu halten. Die Kulturen der Menschen zu erklären, ohne dabei die Intelligenz zu würdigen, die sich hinter den neuartigen Mitteln und Vorgehensweisen namens Kultur verbirgt, ist undenkbar. Dass die Beiträge der Sprache für die Entwicklung und Weitergabe von Kulturen entscheidend sind, muss nicht eigens betont werden. Und was die Geselligkeit angeht, so wurde ihr Beitrag häufig übersehen, aber heute tritt ihre unverzichtbare Rolle deutlich zutage. Kulturelle Praktiken hängen von sozialen Phänomenen ab, für die erwachsene Menschen hervorragend geeignet sind – beispielsweise wenn zwei Personen gemeinsam über das gleiche Thema nachdenken und entsprechend gemeinsame Absichten verfolgen.4 Und doch scheint es, als ob in der Beschreibung, in der nur der Intellekt vorkommt, irgendetwas fehlt. Man könnte meinen, die kreative Intelligenz habe sich ohne einen effektiven Antrieb verwirklicht und sei vorangeschritten, ohne dass im Hintergrund ein anderes Motiv als die reine Vernunft gestanden hätte. Das Überleben als Motiv zu nennen reicht nicht, denn damit sagt man nichts darüber aus, warum das Überleben überhaupt ein Anliegen sein sollte. Es ist, als wäre die Kreativität nicht in das komplexe Gebäude der Affekte eingebettet. Als wäre die Fortentwicklung und Betrachtung der Prozesse kultureller Erfindungen allein mit kognitiven Mitteln möglich gewesen – ohne dass dabei der tatsächliche, gefühlte Wert guter oder schlechter Folgen im Leben eine Rolle gespielt hätte. Wenn Schmerzen mit der Therapie A oder der Therapie B behandelt werden, bedienen wir uns der Gefühle und teilen mit, mit welcher Therapie die Schmerzen nachlassen, völlig verschwinden oder sich nicht verändern.
Gefühle und – allgemeiner gesagt – Affekte jeder Art und Intensität sind die stillen Teilnehmer am Konferenztisch der Kultur. Jeder im Raum spürt, dass es sie geben muss, aber niemand redet mit ihnen. Sie werden nicht mit ihren Namen angesprochen.
In dem ergänzenden Bild, das ich hier zeichne, hätte der individuelle und soziale Intellekt der Menschen ohne eine stichhaltige Rechtfertigung nicht den Versuch unternommen, intelligente kulturelle Praktiken und Instrumente zu erfinden. Gefühle aller Arten und Schattierungen, die durch tatsächliche oder imaginierte Ereignisse verursacht wurden, lieferten dafür die Motive und zogen den Intellekt hinzu. Kulturelle Reaktionen wurden demnach von Menschen hervorgebracht, deren Absicht es war, ihre Lebenssituation zu verändern und zu verbessern, sie bequemer und angenehmer zu machen, während die Probleme und Verluste, die solche Hervorbringungen letztlich und praktisch überhaupt erst geschaffen haben, sich vermindern, und das nicht nur im Sinne eines zukünftigen Überlebens, sondern auch des fortan besseren Lebens.
Als Menschen erstmals die goldene Regel formulierten, wonach wir andere so behandeln sollten, wie wir selbst behandelt werden wollen, taten sie dies vor dem Hintergrund dessen, was sie fühlten, wenn sie selbst oder andere schlecht behandelt wurden. Natürlich spielte faktenbasierte Logik dabei eine Rolle, aber entscheidend waren die Gefühle.
Leiden oder Gedeihen, die beiden äußersten Enden des Spektrums, waren demnach die wichtigste Motivation für die kreative Intelligenz, aus der die Kultur erwuchs. Die gleiche Wirkung hat aber auch das Erlebnis von Affekten, die mit grundlegenden Wünschen – Hunger, Lust, soziale Gemeinschaft – zu tun haben, oder auch mit Angst, Wut, dem Streben nach Macht und Ansehen, Hass, dem Trieb, Gegner und alles, was sie besessen oder gesammelt haben, zu zerstören. Tatsächlich liegen Affekte hinter vielen Aspekten des sozialen Lebens verborgen: Sie bestimmen über die Zusammensetzung großer und kleiner Gruppen und finden ihren Ausdruck in den Bindungen, die die Menschen rund um ihre Wünsche und etwa das Wunder des Spiels geschaffen haben – die aber auch hinter Konflikten um Ressourcen und Paarungspartner stehen und sich dann in Aggression und Gewalt ausdrücken.
Andere mächtige Anreize bilden etwa Erfahrungen von Erhabenheit, Ehrfurcht und Transzendenz, die aus der Betrachtung natürlicher oder erschaffener Schönheit erwachsen. Aber auch aus der Aussicht, die Mittel für das Wohlergehen unserer selbst und anderer zu ergründen, aus dem Finden einer möglichen Lösung für metaphysische oder wissenschaftliche Rätsel – oder aus der bloßen Auseinandersetzung mit ungelösten Fragen.
Wie originell war der kulturelle Geist der Menschen?
An dieser Stelle erheben sich mehrere faszinierende Fragen. Nach dem, was ich gerade geschrieben habe, liegt der Ursprung der kulturellen Bestrebungen in einem Projekt der Menschen. Aber lösen Kulturen ausschließlich Probleme der Menschen oder betreffen sie auch andere Lebewesen? Und wie steht es mit den Lösungen, die der kulturelle Geist der Menschen hervorbringt? Sind sie ausschließlich originelle Erfindungen der Menschen oder wurden sie zumindest teilweise auch von Lebewesen genutzt, die uns in der Evolution vorausgingen? Die Auseinandersetzung mit Schmerzen, Leiden und dem sicheren Tod als Gegensatz zu der unerreichten Möglichkeit von Wohlergehen und Gedeihen könnte durchaus – und dürfte sogar mit ziemlicher Sicherheit – bei den Menschen hinter manchen kreativen Prozessen gesteckt haben, aus denen die heutigen, verblüffend komplexen Instrumente der Kultur hervorgegangen sind. Aber stimmt es nicht auch, dass solche Konstrukte der Menschen durch ältere biologische Strategien und Instrumente unterstützt wurden, die ihnen vorausgegangen sind? Wenn wir Menschenaffen beobachten, spüren wir, dass es Vorläufer unseres kulturellen Menschseins gibt. Darwin war bekanntermaßen erstaunt, als er 1838 zum ersten Mal die Verhaltensweisen des Orang-Utans Jenny beobachtete, der kurz zuvor in den Londoner Zoo gekommen war. Auch Königin Victoria staunte. Sie hielt Jenny für »unangenehm menschlich«.5 Schimpansen können einfache Werkzeuge herstellen, nutzen sie auf intelligente Weise für die eigene Ernährung und geben die Erfindungen sogar auf visuellem Weg an andere weiter. Manche Aspekte ihres Sozialverhaltens (insbesondere bei den Bonobos) kann man mit Fug und Recht als Kultur bezeichnen. Das Gleiche gilt für die Verhaltensweisen von Arten, die so weit voneinander entfernt sind wie Elefanten und Meeressäuger. Alle diese Tatsachen ändern nichts an den Erklärungen, die ich auf den vorangegangenen Seiten vertreten habe. Dank der genetischen Übertragung besitzen Säugetiere einen hoch entwickelten affektiven Apparat, der, was seine emotionale Zusammensetzung angeht, in vielerlei Hinsicht dem unseren ähnelt. Säugetieren die Gefühle abzusprechen, die im Zusammenhang mit ihrer Emotionalität stehen, ist heute keine haltbare Einstellung mehr. Gefühle spielten auch bei anderen Tieren als dem Menschen eine motivierende Rolle, mit der sich »kulturelle« Ausdrucksformen erklären lassen. Was dabei wichtig ist: Der Grund, warum ihre kulturellen Errungenschaften so bescheiden sind, hat mit der geringeren Entwicklung oder dem Fehlen von Merkmalen wie gemeinsamer Intentionalität und verbaler Sprache sowie ganz allgemein mit ihrem bescheideneren Intellekt zu tun.
Aber so einfach ist die Sache nicht. Angesichts der Komplexität und der weitreichenden positiven und negativen Auswirkungen kultureller Handlungsweisen und Hilfsmittel kann man vernünftigerweise damit rechnen, dass ihre Konzeption nur bei Lebewesen, die einen Geist besitzen – was bei nichtmenschlichen Primaten sicher der Fall ist –, angelegt und ausgeprägt werden konnte, und das vielleicht erst nachdem eine heilige Allianz aus Gefühl und kreativer Intelligenz sich den Problemen widmen konnte, die durch die Existenz in einer Gruppe aufgeworfen wurden. Bevor in der Evolution die ersten kulturellen Ausdrucksformen entstehen konnten, musste man auf die evolutionäre Entwicklung von Geist und Gefühlen – einschließlich des Bewusstseins, mit dem das Gefühl subjektiv erlebt werden konnte – warten, und weitere Zeit war für die Entwicklung einer gesunden Dosis Geist geleiteter Kreativität erforderlich. Das jedenfalls ist die landläufige Auffassung, die aber nicht stimmt, wie wir sehen werden.
Bescheidene Anfänge
Die soziale Steuerung erwuchs aus bescheidenen Anfängen, und bei ihrer Entstehung in der Natur gab es weder den Geist des Homo sapiens noch den anderer Säugetierarten. Sehr einfache, einzellige Lebewesen bedienten sich chemischer Moleküle, um zu spüren und zu reagieren oder, mit anderen Worten, um bestimmte Verhältnisse in ihrer Umwelt einschließlich der Gegenwart anderer Lebewesen wahrzunehmen und die Handlungen zu steuern, die notwendig waren, um ihr Leben in einem sozialen Umfeld zu organisieren und aufrechtzuerhalten. Wenn Bakterien in einem fruchtbaren Umfeld leben, das reich an den für sie nötigen Nährstoffen ist, können sie es sich bekanntermaßen leisten, ein relativ unabhängiges Leben zu führen; leben sie dagegen in einem Umfeld mit knappen Nährstoffen, ballen sie sich zu Klumpen zusammen. Bakterien nehmen wahr, welche Zahl von Individuen die von ihnen gebildeten Gruppen umfassen, und beurteilen die Stärke solcher Gruppen, ohne dabei zu denken; außerdem können sie je nach der Stärke der Gruppe den Kampf um die Verteidigung ihres Territoriums aufnehmen oder auch nicht. Sie können sich physisch nebeneinander anordnen und einen Zaun bilden, und sie scheiden Moleküle aus, die einen dünnen Schleier bilden, einen Film, der die ganze Gruppe schützt und vermutlich auch für ihre Resistenz gegen die Wirkung von Antibiotika eine Rolle spielt. Genau das geschieht, nebenbei bemerkt, regelmäßig in unserem Rachen, wenn wir uns erkälten und eine Hals- oder Kehlkopfentzündung bekommen. Wenn Bakterien in unserem Rachen ein großes Territorium erobern, werden wir heiser und verlieren die Stimme. Den Prozess, der den Bakterien bei solchen Abenteuern hilft, nennt man »Quorum Sensing«. Es ist eine derart spektakuläre Leistung, dass man geneigt ist, an Fähigkeiten wie Gefühl, Bewusstsein und vernunftbasierte Entscheidungen zu denken, aber tatsächlich haben Bakterien solche Fähigkeiten nicht; sie verfügen vielmehr über die leistungsfähigen Vorläufer solcher Fähigkeiten. Wie ich noch genauer darlegen werde, fehlt ihnen der mentale Ausdruck dieser Vorläufer. Einzeller betreiben keine Phänomenologie.6
Bakterien sind die ältesten Lebensformen; sie gehen auf eine Zeit vor fast vier Milliarden Jahren zurück. Ihr Körper besteht jeweils aus einer einzigen Zelle, und diese Zelle hat noch nicht einmal einen Zellkern. Ein Gehirn besitzen sie nicht. Sie verfügen nicht über einen Geist in dem Sinn, wie Sie und ich ihn besitzen. Bakterien führen scheinbar ein einfaches Leben und handeln nach den Regeln der Homöostase, aber die vielseitigen chemischen Vorgänge, die sie in Gang setzen und mit deren Hilfe sie sowohl das nicht Atembare atmen als auch das nicht Essbare essen, sind alles andere als simpel.
In der zwar geistlosen, aber komplexen sozialen Dynamik, die Bakterien herstellen, können sie mit anderen Bakterien kooperieren, ganz gleich, ob diese im Hinblick auf ihr Genom mit ihnen verwandt sind oder nicht. Wie sich herausstellt, nehmen sie in ihrem geistlosen Dasein sogar etwas an, was wir als eine Art »moralische Einstellung« bezeichnen können. Die engsten Mitglieder ihrer sozialen Gruppe – gewissermaßen ihre Angehörigen – erkennen sich gegenseitig an den von ihnen produzierten Oberflächenmolekülen oder an ausgeschiedenen Substanzen, die ihrerseits im Zusammenhang mit den einzelnen Genomen stehen. Bakteriengruppen müssen aber auch mit den Widrigkeiten ihrer Umwelt zurechtkommen und häufig mit anderen Gruppen in Konkurrenz treten, um sich Territorium und Ressourcen zu verschaffen. Damit eine Gruppe Erfolg hat, müssen ihre Mitglieder kooperieren. Während einer solchen Gruppenanstrengung können faszinierende Dinge geschehen. Wenn Bakterien in ihrer Gruppe »Abtrünnige« entdecken – einzelne Mitglieder, die die Verteidigungsanstrengungen nicht unterstützen –, werden diese selbst dann ausgestoßen, wenn sie ein verwandtes Genom besitzen und demnach zur gleichen Familie gehören. Bakterien kooperieren nicht mit Verwandten, die nicht ihr gesamtes Gewicht in die Anstrengung der Gruppe einbringen oder, mit anderen Worten: Sie weisen unkooperative, verräterische Artgenossen ab. Dennoch können solche Betrüger zumindest eine Zeit lang Zugang zu Energieressourcen und Verteidigungsanstrengungen haben, die von der übrigen Gruppe unter großem Aufwand zur Verfügung gestellt werden. Bei Bakterien ist bemerkenswert vielfältiges »Benehmen« möglich.7
Ein aufschlussreiches Experiment stellte der Mikrobiologe Steven Finkel an: Darin mussten sich mehrere Bakterienpopulationen ihre Ressourcen in Kulturflaschen beschaffen, die notwendige Nährstoffe in unterschiedlichen Mengenanteilen enthielten. Unter bestimmten Bedingungen zeigten sich in dem Experiment im Laufe zahlreicher Generationen drei ganz unterschiedliche, erfolgreiche Bakteriengruppen: Zwei davon hatten einander bis zum Tod bekämpft und dabei große Verluste erlitten, eine dagegen war über längere Zeit ohne jede Konfrontation unaufdringlich zurechtgekommen. Allen drei Gruppen gelang das Überleben über 12000 Generationen hinweg. Um sich vergleichbare Gesetzmäßigkeiten für Gesellschaften großer Lebewesen auszumalen, muss man nicht besonders fantasievoll sein. Sofort fallen uns Gesellschaften aus Betrügern oder aus friedliebenden, gesetzestreuen Bürgern ein. Wir können uns leicht eine buntscheckige Mischung verschiedener Gestalten vorstellen, mit Kriminellen, Rüpeln, Schlägern und Dieben, aber auch mit stillen Heuchlern, die zwar nicht herausragend, aber doch gut genug zurechtkommen, und nicht zuletzt mit den wunderbaren Altruisten.8
Die hoch entwickelten moralischen Regeln der Menschen und die Anwendung juristischer Grundsätze auf das spontane Verhalten von Bakterien zurückführen zu wollen, wäre töricht. Wir sollten die Formulierung und gezielte Anwendung einer gesetzlichen Regelung nicht mit der schematischen Strategie verwechseln, deren sich Bakterien bedienen, wenn sie sich am Ende mit kooperativen, aber nicht verwandten Bakterien – ihren gewöhnlichen Feinden – zusammentun und nicht mit ihren Verwandten, die in der Regel ihre Freunde sind. In ihrem geistlosen Streben nach Überleben tun sie sich mit anderen zusammen, die das gleiche Ziel haben. Alle folgen der gleichen, unbewussten Regel, und die Antwort der Gruppe auf einen Angriff gegen alle besteht darin, automatisch Stärke in der großen Zahl zu suchen, was gleichbedeutend mit dem Prinzip der geringstmöglichen Anstrengung ist.9 Dabei gehorchen sie streng den Notwendigkeiten der Homöostase. Im Kern unterliegen moralische Prinzipien und Gesetze den gleichen Regeln, allerdings nicht ausschließlich. Moralische Prinzipien und Gesetze erwachsen aus intellektuellen Analysen der Bedingungen, mit denen Menschen sich auseinandersetzen mussten, und aus der Machtausübung durch die Gruppe, die solche Gesetze erfindet und durchsetzt. Sie wurzeln in Gefühl, Wissen und Vernunft, und werden unter Verwendung der Sprache in einem mentalen Raum verarbeitet.
Ebenso töricht wäre es aber auch, wenn man nicht anerkennen würde, dass das automatische Schema, nach dem Bakterien ihr Leben seit Jahrmilliarden gestalten, mehrere Verhaltensweisen und Ideen vorausahnen lässt, deren sich Menschen beim Aufbau der Kulturen bedient haben. Nichts in unserem bewussten menschlichen Geist sagt uns ausdrücklich, dass es diese Strategien in der Evolution schon seit so langer Zeit gibt oder wann sie zum ersten Mal aufgetaucht sind; wenn wir allerdings in uns hineinblicken und unseren Geist danach befragen, wie wir handeln sollten, finden wir »Hinweise und Tendenzen«, die von Gefühlen gespeist werden oder Gefühle sind. Diese Gefühle lenken unsere Gedanken und Handlungen sanft oder nachdrücklich in eine bestimmte Richtung, liefern ein Gerüst für intellektuelle Ausgestaltung und legen sogar eine Rechtfertigung für unsere Handlungen nahe. Deshalb begrüßen und akzeptieren wir diejenigen, die uns helfen, wenn wir in Notlagen sind; wir lehnen diejenigen ab, die unserer Not gegenüber gleichgültig sind, und wir bestrafen jene, die uns verlassen oder betrügen. Aber dass auch Bakterien kluge Dinge tun, die in die gleiche Richtung weisen, hätten wir nie erfahren, wenn die moderne Wissenschaft es uns nicht gezeigt hätte. Unsere natürlichen Verhaltenstendenzen haben uns in Richtung einer bewussten Ausgestaltung grundlegender, nichtbewusster Prinzipien von Kooperation und Kampf gelenkt, die schon zuvor im Verhalten zahlreicher Lebensformen angelegt waren. Diese Prinzipien haben über lange Zeiträume hinweg und bei zahlreichen biologischen Arten den evolutionären Aufbau der Affekte und ihrer entscheidenden Bestandteile gelenkt: Dazu gehören die emotiven Reaktionen nach der Wahrnehmung vielfältiger innerer und äußerer Reize, die appetitive Reize wie Durst, Hunger, Wollust, Zuneigung, Fürsorge und Kameradschaft anregen, und das Erkennen von Situationen, die emotionale Antworten wie Freude, Furcht, Wut oder Mitgefühl erfordern. Diese Prinzipien sind, wie bereits erwähnt wurde, bei Säugetieren leicht zu erkennen, sie sind aber in der Geschichte des Lebens allgegenwärtig. Es liegt auf der Hand, dass die natürliche Selektion viel dazu beigetragen hat, solche Reaktionsformen zu prägen und zu formen, und das in einem sozialen Umfeld, in dem das Gerüst für den kulturellen Geist der Menschen aufgebaut wurde. Subjektive Gefühle und kreative Intelligenz haben in diesem Umfeld zusammengewirkt und kulturelle Instrumente geschaffen, die den Notwendigkeiten unseres Lebens dienen. Wenn dies stimmt, geht das Unbewusste des Menschen buchstäblich auf die ältesten Lebensformen zurück, das heißt tiefer und weiter, als Freud oder Jung es sich jemals hätten träumen lassen.
Aus dem Leben der sozialen Insekten
Nun bedenken wir einmal Folgendes: Eine relativ kleine Zahl von Arten wirbelloser Tiere – nämlich nur zwei Prozent aller Insektenarten – ist zu einem Sozialverhalten fähig, das in seiner Komplexität an viele soziale Leistungen der Menschen heranreicht. Die herausragenden Beispiele sind Ameisen, Bienen, Wespen und Termiten.10 Ihre genetisch festgelegten, unflexiblen Verhaltensweisen machen es möglich, dass die Gruppe überlebt. Sie teilen die Arbeit innerhalb der Gruppe intelligent auf und begegnen so den Problemen, Energiequellen zu finden, diese in nützliche Produkte für das eigene Leben umzuwandeln und die Verteilung der Produkte zu organisieren. Das geht so weit, dass sich die Zahl der Arbeiterinnen, denen bestimmte Aufgaben zugewiesen werden, je nach den verfügbaren Energiequellen ändert. Immer wenn Opfer notwendig sind, handeln sie scheinbar altruistisch. Die Nester, die sie in ihren Kolonien bauen, sind bemerkenswerte urbane Architekturprojekte und bieten sehr wirksam Schutz, Verkehrswege, ja sogar Belüftungs- und Abfallentsorgungssysteme, von einer Leibwache für die Königin gar nicht zu reden. Man würde fast damit rechnen, dass sie das Feuer gezähmt und das Rad erfunden haben. Ihr Eifer und ihre Disziplin stellen jeden Tag die Regierungen unserer führenden Demokratien in den Schatten. Diese Lebewesen beziehen ihre komplexen sozialen Verhaltensweisen nicht aus Montessorischulen oder Spitzenuniversitäten, sondern aus ihren biologischen Eigenschaften. Aber obwohl sie schon vor 100 Millionen Jahren über solche erstaunlichen Fähigkeiten verfügten, trauern Ameisen oder Bienen weder einzeln noch als Kolonie um den Verlust ihrer Kameraden, wenn diese verschwinden, und sie fragen sich auch nicht nach ihrem Platz im Universum. Sie forschen nicht nach ihren Ursprüngen, von ihrem weiteren Schicksal ganz zu schweigen. Ihr scheinbar verantwortungsbewusstes, sozial erfolgreiches Verhalten wird weder durch ein Verantwortungsgefühl gegenüber sich selbst oder anderen noch durch ein System philosophischer Überlegungen über den Zustand des Insektseins gelenkt. Der Leitfaden ist vielmehr die Gravitationsanziehung der Notwendigkeiten zur Regulation ihres Lebens, die auf ihr Nervensystem einwirkt und ein bestimmtes Verhaltensrepertoire hervorbringt, das im Laufe der Evolution über zahlreiche Generationen hinweg unter der Kontrolle ihrer fein abgestimmten Genome von der Selektion ausgewählt wurde. Die Mitglieder einer solchen Insektenkolonie denken nicht viel, sondern handeln. Damit meine ich, dass sie ein bestimmtes Bedürfnis – das eigene, das der Gruppe oder der Königin – wahrnehmen, dann aber nicht auf irgendeine Weise, die mit der unseren vergleichbar wäre, Alternativen zur Befriedigung eines solchen Bedürfnisses in Erwägung ziehen. Sie befriedigen es einfach. Ihr Handlungsrepertoire ist begrenzt und beschränkt sich in vielen Fällen auf eine einzige Option. Das allgemeine Muster ihrer hoch entwickelten Gesellschaftsbildung ähnelt tatsächlich dem menschlicher Kulturen, ist aber ein festgelegtes Schema. E. O. Wilson bezeichnet soziale Insekten als »roboterähnlich«, und das aus gutem Grund.
Aber zurück zu uns Menschen. Wir erwägen Verhaltensalternativen, betrauern den Verlust anderer, wollen etwas gegen unsere Verluste tun und möglichst große Gewinne erzielen, stellen Fragen nach unserer Herkunft und unserem Schicksal, schlagen Antworten vor und sind in unserer schäumenden, widersprüchlichen Kreativität so unordentlich, dass wir häufig ein Durcheinander produzieren. Wir wissen nicht genau, wann die Menschen erstmals trauerten, auf Verluste und Gewinne reagierten, Kommentare über ihren eigenen Zustand abgaben oder unbequeme Fragen nach dem Woher und Wohin ihres Lebens stellten. Aufgrund von Funden aus Grabstätten und Höhlen, die heute untersucht werden, wissen wir aber mit Sicherheit, dass manche dieser Prozesse vor 50000 Jahren bereits gut ausgeprägt waren. Dabei müssen wir allerdings die erstaunliche Tatsache festhalten, dass dieser Zeitraum unter Evolutionsgesichtspunkten nur ein Wimpernschlag ist, wenn wir beispielsweise 50000 Jahre der Menschheitsgeschichte mit 100 Millionen Jahren der Geschichte sozialer Insekten vergleichen, von der jahrmilliardenlangen Geschichte der Bakterien ganz zu schweigen.
Obwohl wir nicht direkt von Bakterien oder sozialen Insekten abstammen, ist es nach meiner Überzeugung aufschlussreich, wenn man über diese drei Indizienketten nachdenkt: Bakterien, die weder ein Gehirn noch einen Geist besitzen, verteidigen ihr Revier, führen Kriege und handeln gemäß einem Verhaltenskodex; unternehmungslustige Insekten schaffen Städte, Regierungssysteme und funktionsfähige Volkswirtschaften; und Menschen erfinden Flöten, schreiben Gedichte, glauben an Gott, erobern den Planeten einschließlich des Weltraums in seiner Umgebung und bekämpfen Krankheiten, um das Leiden zu vermindern. Sie können aber auch um des eigenen Gewinns willen andere Menschen vernichten, erfinden das Internet, finden Wege, um es zu einem Instrument des Fortschritts und der Katastrophe zu machen, und stellen obendrein noch Fragen nach Bakterien, Ameisen, Bienen und sich selbst.
Homöostase
Wie können wir die offenkundig vernünftige Idee, dass Gefühle das Motiv der intelligenten kulturellen Lösungen für Probleme waren, die aus der Natur des Menschen erwachsen, mit der Tatsache in Einklang bringen, dass geistlose Bakterien effiziente soziale Verhaltensweisen an den Tag legen, die in Umrissen manche kulturellen Reaktionen der Menschen vorausahnen lassen? Welcher Faden verbindet diese beiden Gruppen biologischer Ausdrucksformen, deren Entstehung durch Milliarden Jahre der Evolution getrennt ist? Nach meiner Überzeugung liegen die Gemeinsamkeiten und der Faden im Prozess der Homöostase.
Wie wir in den beiden nächsten Kapiteln noch genauer erfahren werden, verweist Homöostase auf das grundlegende System von Vorgängen, die den Kern des Lebendigen bilden, von seinem ältesten, längst entschwundenen Ausgangspunkt in der Biochemie der Frühzeit bis zur Gegenwart. Homöostase ist die leistungsfähige, ungedachte, unausgesprochene Notwendigkeit, deren Verwirklichung für alle Lebewesen, ob groß oder klein, nichts weniger ist als die Voraussetzung für Bestehen und Gedeihen. Der Teil der homöostatischen Notwendigkeit, der das »Bestehen« betrifft, ist leicht durchschaubar: Er sorgt für das Überleben und wird ohne besondere Bezugnahme oder Ehrfurcht als selbstverständlich vorausgesetzt, wenn man die Evolution irgendeines Lebewesens oder einer Spezies betrachtet. Der Teil der Homöostase, der das »Gedeihen« ermöglicht, ist komplizierter und wird nur selten zur Kenntnis genommen. Er sorgt dafür, gewährleistet, dass das Leben innerhalb eines Bereichs reguliert wird, der nicht nur mit dem Überleben verträglich ist, sondern auch dem Gedeihen dient und eine Fortsetzung des Lebens in der Zukunft eines Organismus oder einer Spezies ermöglicht.
In den Gefühlen offenbart sich für jeden einzelnen Geist der Zustand des Lebens innerhalb des jeweiligen Organismus, ein Zustand, der seinen Ausdruck entlang eines Spektrums vom Positiven bis zum Negativen findet. Mangelnde Homöostase drückt sich im Wesentlichen in Form negativer Gefühle aus, während positive Gefühle ein Anzeichen für ein angemessenes Niveau an Homöostase sind und den Organismus aufgeschlossen für vorteilhafte Möglichkeiten macht. Gefühle und Homöostase stehen zueinander in einem ganz prinzipiellen, widerspruchsfreien Zusammenhang. Gefühle sind bei allen Lebewesen, die mit einem Geist und einem bewussten Blickwinkel ausgestattet sind, das subjektive Erlebnis des Lebenszustandes, das heißt der Homöostase. Wir können uns die Gefühle als mentale Stellvertreter der Homöostase vorstellen.11
Ich habe die Missachtung der Gefühle in der Naturgeschichte der Kulturen beklagt, aber im Zusammenhang mit der Homöostase und dem Leben als solchem ist die Lage noch bedauerlicher. Homöostase und Leben werden vollkommen außen vor gelassen. Talcott Parsons, einer der angesehensten Soziologen des 20. Jahrhunderts, führte die Homöostase im Zusammenhang mit Gesellschaftssystemen zwar an, aber für ihn steht der Begriff nicht im Zusammenhang mit Leben oder Gefühlen. Parsons ist eigentlich sogar ein gutes Beispiel dafür, wie Gefühle im Zusammenhang mit dem Kulturbegriff vernachlässigt wurden. Für ihn ist das Gehirn die organische Grundlage der Kultur, weil es »das wichtigste Organ ist, das komplexe Handlungen und insbesondere manuelle Fähigkeiten steuert und visuelle und akustische Informationen koordiniert«. Vor allem aber sei das Gehirn »die organische Grundlage der Fähigkeit, zu lernen und Symbole zu handhaben«.12
Homöostase hat unbewusst, ohne Absicht und ohne vorherige Planung die Selektion der biologischen Strukturen und Mechanismen gelenkt, die nicht nur in der Lage sind, das Leben aufrechtzuerhalten, sondern auch die Evolution von Arten an den verschiedenen Ästen des Evolutionsstammbaumes voranbringen können. Diese Vorstellung von der Homöostase, die am besten zu den physikalischen, chemischen und biologischen Befunden passt, unterscheidet sich bemerkenswert stark von der üblichen, verarmten Konzeption, wonach die Homöostase sich auf eine »ausgewogene« Regulation der Lebensvorgänge beschränkt.
Nach meiner Überzeugung war die unerschütterliche Notwendigkeit der Homöostase der umfassende Regulator des Lebens in allen seinen Gewändern. Homöostase war die Grundlage für den Wert hinter der natürlichen Selektion, und diese begünstigt ihrerseits die Gene, Organismen oder Gruppen, die eine besonders innovative, effiziente Homöostase aufweisen. Die Entwicklung des genetischen Apparats, der dazu beiträgt, das Leben optimal zu regulieren und an Nachkommen weiterzugeben, ist ohne Homöostase nicht vorstellbar.
Vor dem Hintergrund solcher Überlegungen können wir eine vorläufige Hypothese über den Zusammenhang zwischen Gefühlen und Kulturen aufstellen. Gefühle waren als Stellvertreter der Homöostase die Katalysatoren für die Reaktionen, mit denen die Kulturen der Menschen ihren Anfang nahmen. Kann man sich vorstellen, dass Gefühle zum Antrieb für die intellektuellen Erfindungen wurden, die den Menschen erstens die Künste, zweitens die Philosophie, drittens religiöse Überzeugungen, viertens moralische Regeln, fünftens die Justiz, sechstens die Systeme der politischen Regierungsführung und die wirtschaftlichen Institutionen, siebtens die Technologie und achtens die Wissenschaft schenkten? Ich würde aus ganzem Herzen sagen: ja. Ich kann darlegen, dass kulturelle Praktiken oder Instrumente in jedem der acht genannten Bereiche über die erforderlichen Gefühle hinaus entweder eine Situation der tatsächlichen oder erwarteten abnehmenden Homöostase (zum Beispiel Schmerzen, Leiden, dringende Bedürfnisse, Gefahren, Verlust) erforderten oder aber einen potenziellen Nutzen für die Homöostase (zum Beispiel ein lohnendes Ergebnis) voraussetzten. Das Gefühl wirkte demnach als Motiv, um mit den Instrumenten von Wissen und Vernunft die Möglichkeiten zu erkunden, mit denen sich ein Bedürfnis befriedigen ließ oder mit denen man aus dem Überfluss, der sich durch lohnende Zustände darstellte, Kapital schlagen konnte.
Aber das ist nur der Anfang der Geschichte. Die Folge einer erfolgreichen kulturellen Reaktion ist die Abnahme oder Beseitigung des motivierenden Gefühls, ein Prozess, der im Zustand der Homöostase eine Beobachtung von Veränderungen erfordert. Der Prozess, durch den die eigentlichen intellektuellen Reaktionen und ihre Aufnahme in die Gesamtheit einer Kultur – oder ihre Ablehnung – erfolgt, ist seinerseits komplex und erwächst aus den Interaktionen vielfältiger sozialer Gruppen über längere Zeit hinweg. Er ist abhängig von zahlreichen Merkmalen dieser Gruppen, von ihrer Größe und früheren Geschichte bis hin zu ihrer geographischen Position sowie ihren internen und externen Machtverhältnissen. Er umfasst spätere intellektuelle und emotionale Schritte: Wenn beispielsweise kulturelle Konflikte ausbrechen, kommen sowohl negative als auch positive Gefühle zum Einsatz und tragen dazu bei, die Streitigkeiten entweder beizulegen oder zu verschärfen. Und er bedient sich der kulturellen Selektion.
Geist und Gefühle vorausahnen zu lassen, ist nicht das Gleiche, wie Geist und Gefühle hervorzubringen
Ohne die Merkmale, die von der Homöostase erzwungen werden, wäre das Leben kein Leben, und wir wissen, dass es Homöostase immer gab, seit das Leben seinen Anfang nahm. Aber Gefühle – das subjektive Erlebnis des derzeitigen Homöostasezustandes innerhalb eines lebenden Organismus – entstanden nicht zur selben Zeit wie das Leben selbst. Nach meiner Vermutung entwickelten sie sich erst, nachdem die Lebewesen mit einem Nervensystem ausgestattet waren, und diese weitaus spätere Entwicklung begann erst vor ungefähr 600 Millionen Jahren.
Nervensysteme machten einen Prozess möglich, durch den die Welt um sie herum – eine Welt, die im Innern des Organismus beginnt – vieldimensional kartiert werden konnte, sodass ein Geist und innerhalb dieses Geistes auch Gedanken und Gefühle möglich wurden. Die Kartierung bediente sich verschiedener sensorischer Fähigkeiten; am Ende waren das Geschmack, Geruch, Tasten, Hören und Sehen. Wie in den Kapiteln 4 bis 9 deutlich werden wird, hat die Entstehung des Geistes – und insbesondere der Gefühle – ihre Grundlage in Interaktionen des Nervensystems mit seinem Organismus. Das Nervensystem erzeugt den Geist nicht allein, sondern in Kooperation mit dem restlichen, zugehörigen Organismus. Diese Vorstellung widerspricht der traditionellen Ansicht, das Gehirn sei die einzige Quelle des Geistes.
Aber auch wenn die Entstehung der Gefühle weit jüngeren Datums ist, als es die Anfänge der Homöostase sind, spielte sie sich ab, lange bevor Menschen die Bildfläche betraten. Nicht alle Lebewesen sind mit Gefühlen ausgestattet, aber alle Lebewesen verfügen über die Regulationsmechanismen, die die Vorläufer der Gefühle waren (von denen einige in den Kapiteln 7 und 8 erörtert werden).
Wenn wir das Verhalten der Bakterien und sozialen Insekten betrachten, erscheint das Leben in seiner früheren Form nur noch vom Namen her bescheiden. Die tatsächlichen Anfänge dessen, was später zum menschlichen Leben, zur menschlichen Kognition und zu dem Teil des Geistes wurde, den ich gerne als kulturell bezeichne, gehen auf einen verschwindend kleinen Punkt in der Erdgeschichte zurück. Zu sagen, dass unser Geist und unsere kulturellen Erfolge ihre Ursache in einem Gehirn haben, das zahlreiche Merkmale mit dem Gehirn unserer Säugetierverwandten gemeinsam hat, reicht nicht. Wir müssen hinzufügen, dass unser Geist und unsere Kultur auch mit der Lebensweise und den Mitteln uralter einzelliger Lebensformen und vieler anderer Zwischenstufen verknüpft sind. Im übertragenen Sinn kann man sagen: Unser Geist und unsere Kultur haben großzügige Anleihen bei der Vergangenheit gemacht, ohne dass es ihnen peinlich wäre und ohne dass sie sich dafür entschuldigen müssten.
Frühe Lebewesen und menschliche Kulturen
Hier muss man an einer wichtigen Erkenntnis festhalten: Wenn man Verbindungen zwischen biologischen Prozessen auf der einen Seite sowie mentalen und soziokulturellen Phänomenen auf der anderen erkennt, bedeutet das nicht, dass man die Gestalt von Gesellschaften oder die Zusammensetzung von Kulturen vollständig mit den biologischen Mechanismen erklären könnte, die wir hier skizzieren. Natürlich habe ich die Vermutung, dass die Entwicklung von Verhaltenscodices unabhängig davon, wo oder wann sie auftauchten, ihre Anregung im Homöostasegebot hatten. Solche Codices zielen im Allgemeinen auf die Verminderung von Risiken und Gefahren für Individuen und soziale Gruppen, und tatsächlich haben sie dazu geführt, dass das Leiden sich verminderte und das Wohlergehen der Menschen gefördert wurde. Sie haben den sozialen Zusammenhalt gestärkt, der schon allein der Homöostase dienlich ist. Aber über die Tatsache hinaus, dass sie von Menschen erdacht wurden, wurden der Hammurabi-Codex, die Zehn Gebote, die Verfassung der Vereinigten Staaten und die Charta der Vereinten Nationen von den jeweiligen besonderen Umständen ihrer Zeit und ihres Ortes geprägt, aber auch von den Personen, die solche Codices entwickelten. Eine universelle, umfassende Formel gibt es nicht, sondern hinter solchen Entwicklungen stehen mehrere Formeln; Teile jeder denkbaren Formel sind allerdings tatsächlich universell.
Biologische Phänomene können Ereignisse, die zu kulturellen Phänomenen werden, in Gang setzen und prägen, und das muss am Anbeginn der Kulturen unter ganz bestimmten Umständen, die durch die Individuen und Gruppen sowie ihren Ort, ihre Vergangenheit und so weiter definiert wurden, durch das Wechselspiel von Affekt und Vernunft geschehen sein. Der Einfluss der Affekte beschränkte sich nicht auf ein anfängliches Motiv, sondern er kehrte in Form der Beobachtung des Prozesses wieder. Außerdem griff er auch weiterhin in die Zukunft vieler kultureller Erfindungen ein, je nachdem, wie es das ständig andauernde Wechselspiel zwischen Affekt und Vernunft erforderte. Die entscheidenden biologischen Phänomene – Gefühle und Intellekt im kulturellen Geist – sind nur ein Teil der Geschichte. Darüber hinaus muss man auch die kulturelle Selektion in Rechnung stellen, und zu diesem Zweck brauchen wir die Erkenntnisse der Geschichtsforschung, Geographie, Soziologie und vieler anderer Fachgebiete. Gleichzeitig müssen wir anerkennen, dass die Anpassungen und Fähigkeiten, deren sich der kulturelle Geist bediente, das Ergebnis von natürlicher Selektion und genetischer Übertragung waren.
Für den Übergang von den frühen Lebensformen zum heutigen Leben der Menschen waren Gene von zentraler Bedeutung. Das liegt auf der Hand und ist wahr, aber es wirft die Frage auf, wie die Gene ins Dasein traten und warum sie diese Wirkung hatten. Eine vollständigere Antwort lautet vielleicht: Schon zu einem frühen, längst verblichenen Zeitpunkt waren die physikalischen und chemischen Bedingungen der Lebensprozesse dafür verantwortlich, die Homöostase in einem weiten Sinn des Begriffs herzustellen; aus dieser Tatsache leitet sich dann alles andere ab, einschließlich des Apparats der Gene. Das alles geschah in Zellen ohne Zellkern, den Prokaryonten. Später stand die Homöostase hinter der Selektion kernhaltiger Zellen (Eukaryonten) und – noch später – komplexer, vielzelliger Lebewesen, in denen »Organsysteme« – Kreislauf, Immun- und Nervensystem – schließlich komplizierte Bewegungen, den Geist, Gefühle, Bewusstsein und den Apparat der Affekte hervorbrachten. Ohne solche Organsysteme könnten vielzellige Lebewesen ihre »globale« Homöostase nicht aufrechterhalten.
Das Gehirn, mit dessen Hilfe die Menschen kulturelle Ideen, Praktiken und Instrumente erfanden, wurde durch genetische Vererbung zusammengefügt und unterlag über Jahrmilliarden hinweg der natürlichen Selektion. Der kulturelle Geist der Menschen und die Menschheitsgeschichte dagegen wurden im Wesentlichen mit kulturellen Mitteln an uns weitergegeben und vorwiegend durch kulturelle Selektion gestaltet.
Auf dem Weg zum kulturellen Geist des Menschen ermöglichten es die neu entstandenen Gefühle der Homöostase, einen gewaltigen Sprung nach vorn zu machen, weil sie mental den Lebenszustand innerhalb des Organismus repräsentieren konnten. Als Gefühle zur mentalen Mischung hinzukamen, wurde der homöostatische Prozess durch direkte Kenntnisse über den Lebenszustand angereichert, und dabei handelte es sich zwangsläufig um bewusste Kenntnisse. Irgendwann konnte jeder von Gefühlen getriebene, bewusste Geist mental und mit ausdrücklicher Bezugnahme auf denjenigen, der sie erlebte, zwei entscheidende Gruppen von Tatsachen und Ereignissen mental repräsentieren: erstens die Bedingungen in der Innenwelt des eigenen Organismus und zweitens die Bedingungen in seiner Umgebung. Zu diesen gehörte insbesondere auch das Verhalten anderer Organismen in einer Vielzahl komplexer Situationen, die durch soziale Wechselbeziehungen wie auch durch gemeinsame Absichten erzeugt wurden und die vielfach von den individuellen Triebkräften, Motivationen und Emotionen der Beteiligten abhängig waren.
Als Lernen und Gedächtnis sich immer weiter entwickelten, waren die Individuen zunehmend in der Lage, Erinnerungen an Tatsachen und Ereignisse zu erzeugen, abzurufen und zu handhaben; damit eröffnete sich der Weg zu einer Intelligenz, die auf Wissen und Fühlen basierte. Zu diesem Prozess der intellektuellen Erweiterung kam die verbale Sprache hinzu, die eine leicht zu handhabende und zu übertragende Beziehung zwischen Ideen, Worten und Sätzen herstellen konnte. Von da an war die kreative Flut nicht mehr einzudämmen. Die natürliche Selektion hatte ein weiteres Tätigkeitsfeld erobert, nämlich das der Ideen, die hinter bestimmten Handlungen, Praktiken und Erzeugnissen standen. Jetzt konnte die kulturelle Evolution sich der genetischen Evolution anschließen.
Der fruchtbare Geist des Menschen und das komplizierte Gehirn, das ihn erst möglich macht, lenken uns von der langen Reihe biologischer Vorläufer ab, die für ihre Existenz verantwortlich sind. Wegen der prachtvollen Errungenschaften von Gehirn und Geist kann man sich leicht ausmalen, dass Körper und Geist des Menschen vollständig ausgebildet wie ein Phönix aus der Asche steigen, während ihre Vorfahren unbekannt oder sehr jungen Datums sind. In Wirklichkeit stehen hinter solchen Leistungen aber eine lange Kette von Vorläufern und ein verblüffendes Maß von Konkurrenz und Kooperation. Nur allzu leicht übersieht man in der Geschichte unseres Geistes die Tatsache, dass das Leben in komplexen Organismen nur von Dauer sein und sich durchsetzen konnte, wenn es betreut wurde, und dass Gehirne in der Evolution begünstigt wurden, weil sie diese Betreuung so gut unterstützen konnten, insbesondere nachdem sie den Organismen halfen, einen bewussten, an Gefühlen und Gedanken reichen Geist hervorzubringen. Letztlich hat die Kreativität der Menschen ihre Wurzeln im Leben und in der atemberaubenden Tatsache, dass das Leben mit einer präzisen Vorgabe ausgestattet ist: Es soll in jedem Fall widerstandsfähig sein und sich in die Zukunft fortpflanzen. Es mag hilfreich sein, diese bescheidenen, aber leistungsfähigen Anfänge zu betrachten, wenn wir mit den Instabilitäten und Unsicherheiten der Gegenwart zurechtkommen wollen.
In den Zwangsläufigkeiten des Lebens und seiner scheinbar magischen, gewissermaßen verwickelten Homöostase sind die Anweisungen für das unmittelbare Überleben enthalten – Instruktionen für die Regulation des Stoffwechsels und die Reparatur von Zellbestandteilen, aber auch Regeln für das Verhalten in einer Gruppe und Maßstäbe für die Messung positiver und negativer Abweichungen vom homöostatischen Gleichgewicht, auf deren Grundlage geeignete Reaktionen in Gang gesetzt werden können. Die Zwangsläufigkeit birgt aber auch die Neigung, zukünftige Sicherheit in immer komplexeren, robusteren Strukturen zu suchen und damit rücksichtslos in die Zukunft einzutauchen. Die Verwirklichung dieser Neigung erfolgte durch unzählige Kooperationen sowie durch die Mutationen, Variationen und hitzigen Konkurrenzkämpfe, die die natürliche Selektion möglich machten. Das Leben ließ in seiner Frühzeit viele spätere Entwicklungen vorausahnen; heute können wir sie im Geist des Menschen beobachten, der von Gefühlen und Bewusstsein durchtränkt ist und durch die Kulturen bereichert wird, die vom Geist vieler Menschen konstruiert wurden. Der komplexe, bewusste, fühlende Geist wurde zur Anregung und zum Steuer für die Ausweitung von Intelligenz und Sprache, und er schuf neuartige Instrumente der dynamischen homöostatischen Regulation, die außerhalb der Lebewesen wirksam sind. Die Absichten, die sich in solchen neuen Instrumenten ausdrücken, stehen immer noch im Einklang mit den Zwangsläufigkeiten aus der Frühzeit des Lebens, und immer noch zielen sie nicht nur auf das Überdauern, sondern auch auf das Gedeihen.
Warum sind die Folgen dieser ungewöhnlichen Entwicklungen dann aber so widersprüchlich, um nicht zu sagen willkürlich? Warum gab es in der Menschheitsgeschichte so viel aus dem Gleis geratene Homöostase und so viel Leid? Eine vorläufige Antwort, mit der wir uns später noch genauer befassen werden, lautet: Kulturelle Instrumente entwickelten sich anfangs im Zusammenhang mit den homöostatischen Bedürfnissen von Individuen und kleinen Gruppen wie Kernfamilien und Stämmen. Die Erweiterung auf einen größeren Kreis von Menschen konnte dabei nicht berücksichtigt werden. In solchen größeren Kreisen verhalten sich kulturelle Gruppen, Staaten und selbst geopolitische Blöcke häufig wie einzelne Organismen und nicht wie Teile eines größeren Organismus, der einer einzigen Homöostaseregulation unterliegt. Vielmehr nutzt jeder die eigene Homöostasesteuerung, um die Interessen des eigenen Organismus zu verteidigen. Deshalb ist kulturelle Homöostase immer ein unfertiges Werk, das häufig durch Phasen der Adversität zurückgeworfen wird. Man kann die Vermutung wagen, dass der Erfolg der kulturellen Homöostase letztlich von einer heiklen Anstrengung der Zivilisation abhängt, verschiedene Ziele der Regulation in Einklang zu bringen. Das ist der Grund, warum die stille Verzweiflung von F. Scott Fitzgerald – »so regen wir die Ruder, stemmen uns gegen den Strom, und treiben doch stetig zurück, dem Vergangenen zu« – bis heute eine weitsichtige, angemessene Art ist, die Natur des Menschen zu beschreiben.13
2 Im Bereich des Ungleichen
Leben
Das Leben – zumindest in der Form, von der wir abstammen – nahm seinen Anfang offenbar vor ungefähr 3,8 Milliarden Jahren und damit lange nach dem berühmten Urknall. Es geschah in aller Stille auf dem Planeten Erde unter dem Schutz der Sonne in der großen Region der Milchstraße – und keine Fanfaren kündigten seinen erstaunlichen Beginn an.
Vorhanden waren bereits die Kruste der Erde, ihre Ozeane, ihre Atmosphäre, besondere Umweltbedingungen wie eine geeignete Temperatur und bestimmte lebenswichtige Elemente: Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Phosphor und Schwefel.
Von einer Membranumhüllung geschützt, entwickelten sich mehrere Prozesse innerhalb einer abgegrenzten Region der Ungleichheit, die wir als Zelle bezeichnen.1 Das Leben begann mit dieser ersten Zelle – es war