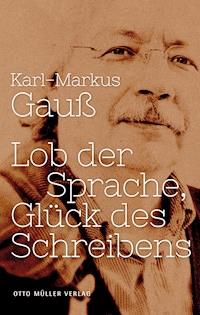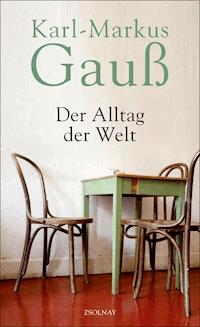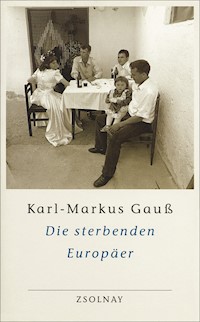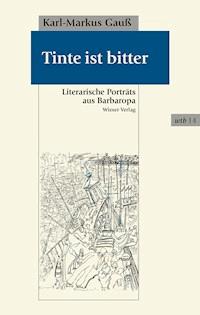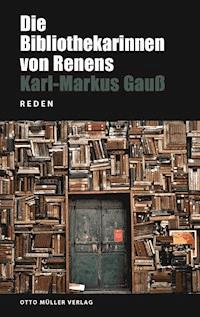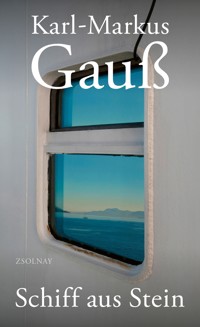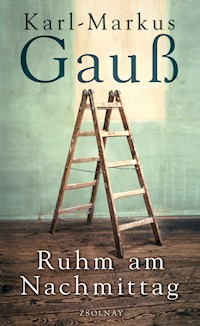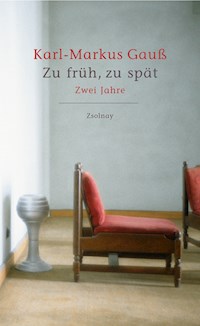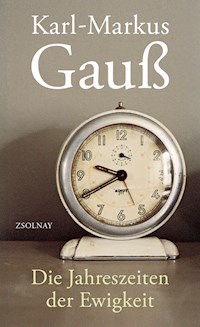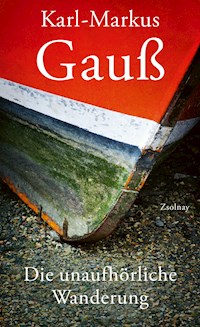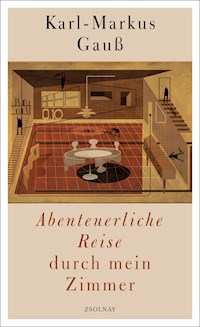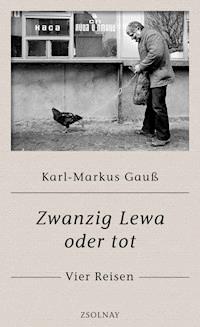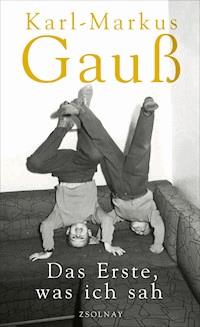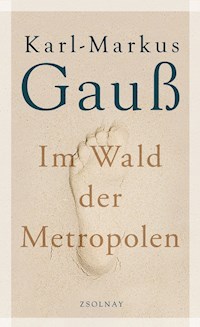
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Karl-Markus Gauß erprobt sich mit seinem neuen Buch in verschiedenen Genres und erfindet dabei ein neues: "Im Wald der Metropolen" ist eine große Erzählung über eine Reise, die vom Burgund nach Transsilvanien, von der Kleinstadt in Thüringen auf die Insel in Griechenland führt, eine Reportage in dreizehn Stationen, die von den Straßen von Bukarest berichtet, im Niemandsland an der Grenze zwischen Slowenien und Kroatien haltmacht, den Geräuschen von Istanbul und der Stille auf einem Militärfriedhof in Italien nachspürt; es ist eine Kulturgeschichte von Europa, wie wir sie, so reich an Zusammenhängen und ungeahnten Verwandtschaften, bisher noch nicht gekannt haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
»Im Wald der Metropolen« ist eine große autobiographische Erzählung, die vom Burgund nach Transsilvanien, von der thüringischen Kleinstadt auf die griechische Insel führt; eine weit gespannte Reportage, die von den Straßen von Bukarest berichtet, im Niemandsland an der slowenisch-kroatischen Grenze Halt macht, den Geräuschen von Istanbul und der Stille auf einem italienischen Militärfriedhof nachspürt; eine Kulturgeschichte Europas, wie wir sie bisher noch nicht gekannt haben, geschrieben in einer Prosa, für die es keinen Vergleich gibt.
Karl-Markus Gauß
Im Wald der Metropolen
Paul Zsolnay Verlag
Inhalt
Kapitel 1
Der Grimassierer von Beaune
Messerschmidt. Ein Hinweis
Soliman, der ausgestopfte Aufklärer. Ein Addendum
Feuchtersleben. Eine Fährte, die falsch, aber schön ist
Ungargasse 5. Ein Postskriptum
Kapitel 2
Die Straße der Erlösung. Belgrad
Die Erfindung Jugoslawiens in Wien/Landstraße. Und ein Ausflug nach Jasenovac
Kapitel 3
Die große Welt von Dragatuš. Zu Hause bei Oton Župančič
Der Traum von Vrzdenec. Unterwegs mit Ivan Cankar
Die Ottakringer Straße. Ein Sommerspaziergang
Kapitel 4
Vom Sichtbarwerden in Siena
Piccolomini (Die Neulateiner I)
Kapitel 5
Die Tote von Sélestat
Beatus Rhenanus (Die Neulateiner II)
Ein Apropos: Janus Pannonius (Die Neulateiner III)
Kapitel 6
Der Regen von Brünn. Ivan Blatný und der mährische Portugiese
Verlorene Seele, geretteter Körper. Brünn, Spielberg, Kapuzinergruft
Swoboda, der Menschenfreund (Die Neulateiner IV)
Kapitel 7
Lost in București. Bulevardul Mihail Kogălniceanu
Nach Văcărești. Besuch bei Tudor Arghezi
»Von denen Europa nichts weiß …« Rosetti, Rosenthal, Margul-Sperber
Taurinus Olomucensis (Die Neulateiner V)
Kapitel 8
Die Kulissen von Oppeln
Der schlesische Esperantist. Gedenkblatt für Jan Fethke
Opole, schlesische Täuschung
Schlonsaken, Wasserpolaken, Lachen. Exkurs zur Verwirrung
Óndra Łysohorsky und die Lachen. Ein Epitaph
Kapitel 9
Die Republik von der Piazza San Francesco
Kapitel 10
Der gläserne See. Die Glocken von Slaghenaufi
Der Chronist von Patmos
Die Wächterin von Čara
Die Alte von der Ordu Caddesi
Begegnung in der Kathedrale
Vier Fratzen mit Katze
Kapitel 11
Die Vandalen von Fontevraud
St. Genet. Ein Apropos zu Fontevraud
Strindberg. Eine Fußnote zu St. Genet
Kapitel 12
Die Puppen von Arnstadt
Willibald Alexis. Ein Apropos zu Arnstadt
Sir Walter Scott. Eine Fußnote zu Alexis
Kapitel 13
Europa—Afrika. Eine Brüsseler Reise
Sprachlos in zwei Sprachen. Der Coiffeur Brahym und die Erfindung des Belgischen
Louis Paul Boon. Wiederholung der Lektüre
Karl von Ligne in Beloeil und am Kahlenberg. Noch ein Schritt zur Seite
Nachbemerkung
Kapitel 1
Der Grimassierer von Beaune
Den ärgsten Grimassierer meines Lebens habe ich in Beaune gesehen. Der Ort sei von Touristen überlaufen, hatte uns ein Tourist gewarnt, der glaubte, wir würden seine Selbsttäuschung teilen und uns, bloß weil wir auf eigenen Wegen und nicht nach dem Pauschalangebot eines Reisebüros unterwegs waren, für Nomaden der Moderne halten. Der Hass des Touristen auf den Touristen ähnelt dem des Provinzlers auf den Provinzler, er gebiert kuriose Selbstentwürfe, von denen der Abenteurer mit der Kreditkarte einer der apartesten ist. Man begegnet ihm überall, in der Wüste und im Hochgebirge verursacht er abenteuerliches Gedränge, und seine Flotte pflegt über entlegene Inseln im Pazifik, die ihm alleine bekannt sind, herzufallen. Wir hatten nicht vor, in Beaune, einem von Touristen überlaufenen Ort, zu übernachten. Aber als wir das berühmte Hôtel-Dieu besichtigt hatten, machten wir uns doch auf die Suche nach einem Quartier in dieser großen kleinen Stadt.
Was der burgundische Kanzler Nicolas Rolin und seine Gemahlin Guigon de Salins beabsichtigten, als sie 1443 das Hôtel-Dieu errichten ließen, war nach den Worten des Kanzlers nichts anderes, als ihre Seele mit einem mildtätigen Werk für die Ewigkeit zu retten. Mehr als sechshundert Jahre diente das Hôtel-Dieu, großzügig angelegt über alles bekannte Maß hinaus, als Krankenhaus der Armen, die hier medizinische Behandlung wie religiösen Beistand erfuhren. Der gotische Krankensaal ist fünfzig Meter lang und vierzehn Meter breit, an den beiden Längsseiten stehen Betten, aus denen die Kranken auf die Kapelle und den Altar, die die Stirnseite des Saales beschließen, blicken konnten, sodass sie sich nicht vom Krankenlager erheben mussten, um der Heiligen Messe beizuwohnen.
Der Saal wird von einem prächtigen Spitzbogen überwölbt. Das Interessanteste an der eleganten Deckenkonstruktion sind die hölzernen Querbalken, die aus dem Rachen speiender Drachen zu ragen scheinen und mit possierlichen Gesichtern versehen sind, denen wieder-um groteske Tierköpfe gegenübergesetzt wurden. Die Gesichter waren bekannten Bürgern von Beaune nachempfunden, und die Tierköpfe, von denen jeder einem bestimmten der einfältig grinsenden Bürgergesichter zugeordnet ist, sollten etwas über den Charakter derer verraten, die hier wie für alle Zeiten in ihrer Lasterhaftigkeit gezeichnet wurden. Wir staunten über die kluge Funktionalität, mit der der Krankensaal seinem medizinischen Zweck entsprechend ausgestattet wurde, über die spirituelle Kraft, auf die er, der sich auf den Altar hin ausrichtet, bezogen ist; doch am allermeisten staunten wir, in einem Bauwerk, das doppelt ernstem Zweck gewidmet war, der Heilung des Körpers, der Erlösung der Seele, solchen Aberwitz zu finden, wie er sich über den Kranken in der Holzkonstruktion des Gewölbes manifestierte, solchem Spott, der den wohlhabenden Leuten von Beaune, die das ihre zur Ausstattung und zum Unterhalt des Hospizes beizusteuern hatten, zweifach zuteil wurde: in Form ihrer zum Lachen, zum Verlachen dummen Gesichter — und in jener der Tierköpfe, die ihren Geiz, ihre Gier, Beschränktheit und Gemeinheit bloßstellten.
Unter diesem Gewölbe sah ich ihn zum ersten Mal. Er hatte seinen Blick nicht nach oben gerichtet, er ahnte nicht, dass es dort etwas, vielleicht sogar ihn selber zu entdecken gab. Er ging im Tross, wie im Hôtel-Dieu jeder im Tross zu gehen hat, er folgte den anderen, und ich folgte ihm, aus dem Krankensaal in den Ehrenhof, von dem sich uns der beste Blick auf das weitverzweigte Bauwerk bot, auf die bunten Dachziegel, die mit Schnitzereien verzierten Dachluken, die Schieferplatten, und an dessen Rand ein Brunnen mit filigranem schmiedeeisernem Zierrat steht; ich folgte ihm, der anderen folgte, vom Ehrenhof in den kleineren Saal Saint-Hugues, in dem einst die Kranken und Alten untergebracht waren, die längerer Pflege bedurften, von dort in den Saal Saint-Nicolas, in dem die Todkranken und Sterbenden ihrem Ende entgegensahen, wir waren zusammen in der Apotheke, der Küche, den Räumen, in denen die Alltagsgeräte längst vergangener Tage ausgestellt werden.
Er war etwa so alt wie ich, drahtig, mit einem kanti-gen Gesicht, hatte kurzgeschorenes Haar und einen kuriosen Bart, der als dünner weißer Strich von der Unterlippe zum Kinn herunterführte, wie eine schmerzende Kerbe. Er schien aufmerksam bei der Sache, zeigte einer neben ihm stehenden Frau mit ausgestrecktem Arm etwas an der Fassade, verzog bald für ein paar darüber erschreckende Kinder schmerzhaft das Gesicht, als sie vor einer Amputationsschere, einem Ausstellungsstück des achtzehnten Jahrhunderts, standen, gesellte sich dann einer Gruppe von Männern zu, die sich im Hof ihre Zigaretten angezündet hatten.
Abends sah ich ihn wieder. Wir waren, nachdem wir das Hôtel-Dieu verlassen hatten, durch die Stadt flaniert und aus dem Kreis geraten, den die alte, fast vollständig erhaltene Stadtmauer um das Zentrum beschreibt. Die Place Madeleine ist quadratisch und wird von Platanen gesäumt, dort fanden wir die Auberge Bourguignonne, die hinter einem unverputzten Mauerwerk, das Abertausende helle Steine sehen lässt, ein kleines Hotel und ein Restaurant birgt. Als wir kurz nach acht Uhr abends den Speisesaal betraten, war er fast vollständig besetzt. Nach französischer Sitte standen die Tischchen eng aneinander gerückt, gerade dass ein schmaler Abstand zwischen ihnen die symbolische Grenze markierte. Wer hier Platz nimmt, grüßt die Leute nicht, die am Nebentisch sitzen, er hört nicht, was sie, die nicht mehr als einen halben Meter neben ihm sitzen, sprechen, nie würde er in ihr Gespräch, in ihr Revier eindringen, wie sie wiederum ihn nicht hören und gleichmütig bei ihrer Sache bleiben, was immer er im Übrigen an seinem Tisch tut. Auf dieser Übereinkunft gründet die Kultur der französischen Restaurants, der Bistros, die mit Tischen und Stühlen vollgeräumt und dennoch kein Ort der Intimität sind.
Der Mann mit dem scharf gezogenen Bartstrich war der einzige Alleinesser des Restaurants, das sah ich, noch bevor wir selber Platz genommen hatten, und was es bedeutete, wusste ich auf vegetative Weise bereits, ehe ich es mir in seinen erschreckenden Möglichkeiten vorgestellt hätte. Er saß vielleicht vier Meter schräg links von mir entfernt, wenn ich an der rechten Schulter meiner Frau vorbeisah, schaute ich ihm ins Gesicht, über das eine unaufhörliche Bewegung lief und in dem sich die verschiedensten, nur schwer zu deutenden Gefühlsregun-gen abbildeten. Er war, als wir mit der Vorspeise begannen, schon mit dem Hauptgang beschäftigt, aber mehr damit, irgendjemanden zu finden, der ihn aus dem Zwang, alleine zu essen, befreien hätte können. Der Alleinesser wusste nicht um die symbolische Grenze, die es in einem Restaurant wie diesem zu wahren gilt, er meinte, die räumliche Nähe als Aufforderung zur Kameraderie verstehen zu dürfen. Anfangs probierte er es mit dem links von ihm sitzenden Paar, offenbar Bewohnern von Beaune, die wenig Neigung zeigten, sich von dem Fremden neue Sitten weisen zu lassen. Unwirsch reagierten sie auf seinen Versuch, mit ihnen über die aufgetragenen Gerichte ins Gespräch zu kommen, gerade noch dass sie wenige Worte erwiderten, dann brachen sie die Unterhaltung ab und ließen es sich nicht verdrießen, neben ihm zu sitzen und ihn nicht zu beachten. Der Mann kam, wie wir nach und nach erschlossen, aus Holland, sein Französisch klang passabel, sein Deutsch, mit dem er die Touristen rechts von ihm ansprach, nicht minder. Die zwei Deutschen, eine elegante Frau von vielleicht fünfzig Jahren und ein großgewachsener, zur Fülligkeit neigender Mann, der acht oder zehn Jahre jünger sein mochte, ließen sich von ihm in einen Austausch der Urteile über Küche und Hotellerie von Frankreich verlocken, wurden dann aber einsilbig, nicht nur was das Gespräch mit dem Nachbarn, sondern auch ihr eigenes betraf, von dem sie jetzt nicht mehr sicher sein konnten, dass es nur das ihre war. Sie verließen das Lokal vor allen anderen Gästen, ihr Gruß an den Mann, der sich zu gerne als ihr Begleiter durch den Abend im Restaurant bewährt hätte, fiel knapp aus, wie es zwei Flüchtenden geziemt.
Jetzt sitzt er alleine, er sucht sich mit irgendetwas zu beschäftigen, prüft zum wiederholten Male die Weinflasche, fraternisiert mit dem Kellner, blickt hilfesuchend im Raum herum, begierig, auf einen, einen einzigen Blick zu treffen, der dem seinen nicht auswiche, doch er findet keinen, er bleibt in der Öffentlichkeit dieses Restaurants ganz mit sich alleine, und so oft er das in seinem Leben schon gewesen sein mag, er scheint sich immer noch nicht daran gewöhnt zu haben. Als ihm das Dessert aufgetragen wird, spricht er bereits vor sich hin und in die dichte Leere des Raumes hinaus, er reckt sich, mit ruckartigen Bewegungen, bald auf die eine, bald auf die andere Seite, dann nach vorne über den halben Tisch, von dem er wieder zurückschnellt, dass die Lehne seines Sessels kracht.
Dann zieht eine ungeheuerliche Veränderung über sein Gesicht, das bis jetzt alle paar Sekunden den Ausdruck verändert hat und in dauernder Bewegung gewesen ist. Mit einer gewaltigen Anstrengung spannt er schier alle Muskeln seines Gesichtes an, dass es in einer erschütternden Grimasse erstarrt. Das kantige Kinn ist auf die Brust gedrückt, sodass unter ihm die Wülste des Halsansatzes hervorquellen, die Lippen, wie im Krampf aufeinander gepresst, verschließen fest den Mund, von der Oberlippe führt zu beiden Seiten eine wie ins Fleisch geschnittene Falte zum Kinn hinunter, das sich zu blähen scheint und von dem weißen Strich des Bartes gespalten wird. Die Nasolabialfalten ziehen von den aufgebogenen Nasenflügeln wie zwei große geschwungene Schnitte zum Mund, wo sie sich mit den zum Kinn führenden Schnitten vereinen. Die Nase selbst ist auf so gewaltsame Weise gerümpft, dass ihre Wurzel mit den schmerzhaft zusammengepressten Augenlidern einen einzigen verformten Wulst bildet, auf dem eine Unzahl von kleinen, krähenfußartigen Falten geradezu hervortritt.
Ich bin Zeuge eines psychischen Elementarereignisses, eines grandiosen Schauspiels der malträtierten Natur, es ist völlig ruhig geworden im Raum, kein Scheppern von Geschirr und Besteck, kein Lachen oder Gläsergeklirre, und in dieser Stille glaube ich die Muskeln des Alleinessers zu hören, wie sie an ihrer Verkrampfung arbeiten, das Knirschen der Zähne, sein Keuchen der Anstrengung, welche ihm das Theater, in dem er sich selbstvergessen zur Schau stellt, bedeutet.
Ein derart dramatisches Gesichtsspiel habe ich noch nicht gesehen, auch nicht als Kind, wenn wir an verregneten Ferientagen unsere Weltmeisterschaft im Grimassenschneiden veranstalteten und die Kinder der Gegend sich abmühten, einander im Grimassieren zu übertreffen. Das ganze Gesicht des Alleinessers scheint zugleich aufgebläht und zusammengedrückt, von einer immensen Kraft verformt zu werden. Der Ausdruck, zu dem er in dieser Grimasse erstarrt, ist vieldeutig, es ist der Ausdruck namenloser Verzweiflung, aber auch der eines in sich verschlossenen Hochmuts, und obwohl er, der vorher so unruhig war, jetzt reglos wie hingegossen sitzt und kein Zucken mehr das versteinerte Gesicht belebt, kommt mir vor, er würde alle paar Augenblicke die Miene verändern, sodass ich einmal glaube, er grinse, dann wieder, er weine, einmal glaube ich die Bösartigkeit selbst, dann wieder den reinen Schmerz vor mir zu sehen.
Was grimassierst du so entsetzlich, fragte mich meine Frau. Hört sie mich telefonieren, weiß sie wegen meines charakterlosen Hanges zur Imitation meist, mit wem ich spreche und wessen Tonfall, Redegeschwindigkeit, Dialekt ich unbeabsichtigt angenommen habe. Obwohl ich nie zuvor jemanden erlebt habe, der sich so hemmungslos an eine Grimasse verloren hat, war ich mir doch sicher, dass ich die Grimasse selbst bereits kannte. Ich kam aber an diesem Abend so wenig wie an den folgenden dahinter, was es damit für eine Bewandtnis hatte.
Messerschmidt. Ein Hinweis
Die ganze Anlage, die ein prächtiges oberes Schloss, einen hügelabwärts der Stadt sich zuneigenden weiträumigen Garten und nebst mancherlei Nebengebäuden noch ein unteres, eingeschossiges Schloss umfasst, das den Garten abschließt, hat der Feldherr Prinz Eugen zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts errichten lassen. Weil sich vom oberen Schloss ein grandioser Blick auf die Stadt bietet, wurde der Komplex schließlich Belvedere genannt. Das obere, später fertig gestellte Schloss, ein Hauptwerk des Architekten J. Lukas von Hildebrandt, gedachte Prinz Eugen der fürstlichen Repräsentation zu, für Feste, Einladungen und derlei Angelegenheiten, die einem der reichsten Männer, klügsten Geister und skrupellosesten Feldherren Europas zu Gebote standen, das untere Schloss war als Sommerresidenz angelegt. Erst Monate, nachdem mich der Grimassierer in Beaune in seinen Bann geschlagen hatte, fiel mir unvermittelt ein, diesem zum ersten Mal dort, im Unteren Belvedere, begegnet zu sein.
Heute ist im Belvedere die Österreichische Galerie untergebracht, und im unteren Schloss werden namentlich die älteren Sammlungen gezeigt. Und dort, in einem Saal, der nur ihm vorbehalten schien, bin ich als Zwanzigjähriger auf ihn gestoßen, den Grimassierer, der sich in Beaune als Holländer ausgegeben hatte und der seit mehr als 230 Jahren unter mancherlei Identitäten durch die Welt wandert. Der Saal war den so genannten »Charakterköpfen« des österreichischen Bildhauers Franz Xaver Messerschmidt vorbehalten, die dieser, nachdem ihm, dem anfangs gefeierten Hofkünstler, eine »Verwürrung im Kopfe« attestiert und die akademische Laufbahn in Wien zerstört worden war, zwischen 1777 und 1783 in Pressburg geschaffen und selber »Köpf-Stückhe« genannt hat. Es sollen 69 sein, die er davon verfertigt hat, 55 haben sich erhalten, etliche davon sind im Unteren Belvedere zu sehen.
Die »Köpf-Stückhe«, siebzehn davon aus Alabaster, die meisten aus Metall gefertigt, sind Büsten, die ihr menschliches Objekt meist frontal und vom Scheitel herunter bis etwa zur Schulter fassen. Was sie zeigen, das sind die wildesten Grimassen der Kunstgeschichte, Gesichter, die in vorher nie gesehener Weise verzerrt sind, deren Muskeln auf anatomisch mögliche, aber alltäglich unwahrscheinliche Weise gegeneinander angespannt werden und so das Antlitz zu einer erschreckenden Kenntlichkeit verformen; einer Kenntlichkeit, die keine Gewissheit bedeutet, denn wird in diesen Gesichtern, in denen die Augen weit aufgerissen oder krampfhaft verschlossen sind, die Lippen zusammengepresst werden, dass sich vor Anstrengung noch kurios die Backen blähen, das Kinn so kraftvoll auf den Hals gedrückt wird, bis es einen unförmigen Wulst bildet, und die Stirne sich in grässlichen Kerben des Schmerzes furcht; kurz: Wird in diesen Gesichtern auch nichts gezeigt, was dem anatomisch Möglichen widerspräche, ist es doch das extremistisch Unalltägliche, das sich auf ihnen, mit ihnen ereignet. Und das hat einen merkwürdigen, zusätzlich irritierenden Effekt: Da wir für solchen mimischen Extremismus keine alltäglichen Erfahrungen besitzen, wissen wir den Ausdruck der Gesichter auch kaum zu deuten, und die erst später so genannten »Charakterköpfe« lassen uns über den Charakter der gezeigten Personen in Wahrheit völlig im Ungewissen.
Das hat schon Messerschmidts Zeitgenossen so verunsichert, dass sie trachteten, den Künstler, der 1755 mit neunzehn Jahren nach Wien gekommen war und wenige Jahre später mit kolossalen Bronzebüsten der Kaiserin Maria Theresia und ihres Gatten Franz I. Stephan beauftragt wurde, zum grillenhaft verschrobenen Außenseiter zu erklären. Die versprochene Professur an der Akademie wurde ihm verweigert, da er sich von der perfekt beherrschten barocken Repräsentationskunst zu entfernen begann, und dem noch nicht Vierzigjährigen stattdessen angeboten, sich gegen ordentliches Salär in die Pensionierung zu fügen. Dieses Angebot hat Messerschmidt schroff abgelehnt, denn er war kein Staatskünstler, auch wenn er sich als solcher in jungen Jahren allergrößtes Renommee erwarb und mit den Porträtbüsten und Statuen von Fürsten und Grafen ebenso betraut wurde wie mit Marmorskulpturen der heiligen Maria und des heiligen Johannes, die heute noch im Dom zu St. Stephan zu sehen sind. Messerschmidt verließ Wien, ging nach München, endlich nach Pressburg, wo er seiner für die Marotte eines Verrückten gehaltenen künstlerischen Mission lebte, für die »Köpf-Stückhe«, die er jetzt frei von Rücksichten auf Hof und höfische Geschmacksrichter verfertigte.
Aber diese kamen ihm selbst dort, wo er 1783 gerade 47-jährig starb, hinterher. Ein Anonymus hat ein paar Jahre nach seinem Tod die erste Bestandsliste der »Köpf-Stückhe« erstellt und diese mit den noch heute gebräuchlichen Namen versehen, die zum Verständnis der Köpfe, der Gefühlsexpressionen, die sich in ihnen materialisieren, und des Werkes von Messerschmidt nicht das geringste beitragen. Im günstigen Falle lenken sie von dem Charakter ab, den sie bezeichnen, häufiger aber konterkarieren sie den Ernst wie den Witz von Messerschmidts Porträts durch einfältige Gelehrsamkeit, die dem Rätsel der Köpfe in Titeln wie »Ein absichtlicher Schalksnarr«, »Ein mit Verstopfung Behafteter« oder »Der Schaafkopf« beizukommen versucht.
Ich war damals bei einem meiner ersten Besuche von Wien eher zufällig in die Galerie im Unteren Belvedere, dann in Messerschmidts Saal der Grimassierer hingegen notwendigerweise außer Fassung geraten. Die »Köpf-Stückhe«, die ich dort zu sehen bekam, machten einen erschreckenden und auflachend komischen Eindruck zugleich auf mich, und diese doppelte Wirkung des Befremdens, dass man nämlich, diese Köpfe betrachtend, von paradox gegensätzlichen Gefühlen ergriffen wird, scheint bereits in den Objekten angelegt, sie ist eine Energie, die von diesen selber ausstrahlt.
Der Grimassierer, dem ich dreißig Jahre später gewissermaßen in der Natur, wenn auch in der äußerst kultivierten Natur eines französischen Restaurants begegnete, hier, im Saal der Österreichischen Galerie trug er den Namen »Der Erzbösewicht«. Damals wusste ich von Messerschmidt noch gar nichts, weder wie er aus Wien geekelt worden war noch wie die Nachwelt seine Charakterköpfe, die sich in ihrer Zeit völlig fremd und einzig ausnahmen und es im Grunde noch heute tun, zu pathologisieren versuchte. Aber schon damals, als ich noch glaubte, der Titel stamme vom Künstler selbst, hat er mich ratlos gelassen. Ich erklärte ihn mir schließlich als Witz, den sich der Bildhauer gemacht hatte, denn der »Erzbösewicht«, der sein Gesicht voller Falten und Wülste in eine Grimasse verzerrt, war in dieser keineswegs als der zu erkennen, der er dem Titel zufolge sein sollte. Schmerz und Qual, unerträglichen körperlichen Schmerz und krampfartig in sich verschlossene seelische Qual schien mir der ungeheure Schädel aus Zinn und Blei, dieses wuchtig entstellte Antlitz auszudrücken. Als ich nach einem in staunendem Befremden absolvierten Gang durch den Saal zum »Erzbösewicht« zurückkehrte, glaubte ich noch etwas ganz anderes in seinem verquollenen Gesicht zu erkennen: eine Andeutung von Hohn, einen von der Verkrampfung der Muskeln fast verdeckten Spott.
Seither bin ich in Zeitschriften, Katalogen, Büchern noch öfter auf Abbildungen des »Erzbösewichts« und anderer »Köpf-Stückhe« von Messerschmidt gestoßen. Und gerade indem ich sie immer wieder anders sah, habe ich es stets auf die nämliche Weise erfahren: Den Charakterköpfen ist psychologisch nicht beizukommen, sie sind mit unserem Repertoire an Mienen nicht zu fassen, sie verstören, gerade weil sie sich auf den Charakter, den sie angeblich aufdecken, nicht zurückführen lassen; auf keinen Charakter übrigens, und auf keines der uns bekannten Gefühle.
In diesen Gesichtern zeichnet sich stets auch das Gegenteil dessen ab, was sie auf den ersten Blick zu bedeu-ten scheinen. Und jeder dieser Köpfe ist ein Schauspiel für sich, in dem widerstreitende Charaktere miteinander ringen, gegeneinander kämpfen — und sich, auf erschreckende, nein, auf empörende Weise ineinander mischen.
Soliman, der ausgestopfte Aufklärer. Ein Addendum
Erst vor einigen Jahren wurde eine Büste, die den Fürs-ten Joseph Wenzel I. von Liechtenstein zeigt, als Werk Franz Xaver Messerschmidts identifiziert. Der Fürst von Liechtenstein war nicht irgendein österreichischer Aristokrat, sondern gebot als Herr des Liechtensteinschen Majorats über eine Million Untertanen und galt mit all seinen Latifundien als reichster Mann der Monarchie. Ein aufgeklärter Despot, hielt er es keineswegs nur mit dem fröhlichen Verschleiß des feudalen Reichtums, den die auf ihn überkommenen Besitztümer eintrugen, sondern suchte diese durchaus produktiv zu nutzen und, nach dem Maßstab seiner Ära und seines Standes, mit modernem Merkantilismus effizient auszubauen. Die Büste, die Messerschmidt von ihm anfertigte, vermutlich ein Jahr bevor er Wien verließ, zeigt den Bildhauer auf seinem Weg vom gefeierten Repräsentationskünstler zum verfemten Schöpfer der »Köpf-Stückhe«.
Joseph Wenzel I. wird mit erstaunlichem Naturalismus und, wie bei den späteren »Charakterköpfen«, nur vom Haupt bis zur nackten Schulter erfasst. Er ist ohne die Insignien seiner Macht, ohne allen Zierrat seines Standes abgebildet, ein selbstbewusster alter Mann mit schmalem, zum Kinn sich zuspitzenden Gesicht, hochgezogenen Augenbrauen, gebogener Nase, sinnlich breiten Lippen und einer Miene, in der sich scharfe Intelligenz und lei-ser Spott gleichermaßen abzeichnen; abzuzeichnen scheinen, muss ich sagen, denn schon in dieser Porträtbüste hält es Messerschmidt mit der Doppel-, ja Vieldeutigkeit des Ausdrucks, der es schwer macht, ihn auf den Begriff zu bringen.
Etwa zehn Jahre, bevor Messerschmidt ihn so für die Ewigkeit bannte, hatte Joseph Wenzel I. einen Mann nach Wien gebracht, den er zu seinem fürstlichen Kammerdiener und Reisebegleiter machte. Unter einem Kammerdiener darf man sich keinen Lakaien vorstellen, der seinem Herrn die Nachtschüssel leerte oder diesem, der damit aus eigenem vielleicht überfordert gewesen wäre, beim An- und Auskleiden zu helfen hatte. Der Kammerdiener war vielmehr einer der engsten Vertrauten seines Grafen, Fürsten, Kaisers, ein Mann, dem die Aufgabe des Einflüsterers zugedacht war, der mit den Vorkommnis-sen bei Hof ebenso vertraut war, wie er über die Stimmung im Volk Bescheid wusste, der seinem Herrn darum Rat geben konnte, den dieser von seinesgleichen und den besoldeten Schmeichlern nicht erfahren konnte; ein Intellektueller zudem, der auch von geistigen Strömungen Kenntnis hatte, von denen Kenntnis zu haben von Staats wegen verboten war.
Der Kammerdiener Angelo Soliman war als Einflüsterer so erfolgreich, dass er von seinem Herrn nicht nur mit vielerlei Aufgaben betraut und auf heikle Missionen entsandt wurde, sondern in ganz Wien bald eine populäre Gestalt war. Den legendären Ruf, den sich der Fürst als freigebiger Wohltäter der Bettler und Armen von Wien erwarb, soll er nicht zuletzt Soliman verdankt haben, der des Fürsten huldvolle Augen auf Dinge zu richten verstand, die diesem, der sich über die anderen Hocharistokraten durch seine goldene Karosse schon in fast monarchischen Stand erhob, sonst nie und nimmer aufgefallen wären.
Als Soliman es wagte, eine bürgerliche Wienerin zu ehelichen, ohne seinen Herrn um jene Erlaubnis gefragt zu haben, die ihm sicherlich verweigert worden wäre, hat ihn Joseph Wenzel I. zwar umstandslos seiner Würden entledigt und aus seiner Nähe entfernt. Doch gleich nach dem Tod des nicht nur in seiner Wohltätigkeit, sondern auch in seinem Zorn wahrhaft großen Fürsten wurde er von dessen Sohn wieder in sein Amt eingesetzt. Soliman, der in mehreren Sprachen konversierte, war ein bekennender Aufklärer und wurde in seinen letzten Lebensjahren Mitglied der Freimaurerloge »Zur wahren Eintracht«. Der vom Volk geliebte, in den gebildeten Kreisen hochgeschätzte Soliman starb am 21. November 1796 — und wurde tags darauf ausgestopft. Denn Angelo Soliman war ein Afrikaner, ein Mohr, wie sie damals genannt wurden, der als Sklave nach Wien gebracht worden war.
Seine Herkunft wurde schon früh mit zahllosen Legenden überrankt. Ein afrikanischer Königssohn soll er gewesen sein, ein Abkömmling des antiken Stammes der Numidier oder einer des freien Stammes der Kanuri, die an der späteren Grenze zwischen Nigeria und dem Tschad siedelten … Gewiss ist nur, dass er als Kind von Sklavenjägern geraubt wurde, verschiedene europäische Besitzer wechselte, endlich bei einer sizilianischen Gräfin landete, die ihn, nobel wie sie war, dem österreichischen Gouverneur von Sizilien, dem Fürsten Lobkowitz, als Präsent überreichte. Von Lobkowitz ist er auf den Fürsten Liechtenstein überkommen und aus Sizilien nach Wien überstellt worden. Vom Sklaven zum fürstlichen Berater, vom afrikanischen Königssohn zum bürgerlichen Wiener Ehemann, vom Mohr zum Mitglied der Freimaurer: Die Gewalt hat viele Wege, dieser eine führte nach Wien.
So angesehen Angelo Soliman, so bedeutend seine Stellung unter den Lebenden war, schon am Tag nach seinem Tod wurde er gegen die inständigen Bitten seiner Tochter, gegen den christlichen Einspruch des Erzbischofs von Wien dem Präparator übergeben und nach fachkundiger »Ausschoppung« dem »Physikalischen Kunst- und Tierkabinett« des Kaisers als kurioses Beutestück eingegliedert. Dort haben ihn jene, die ihn noch gekannt, und die, die nur von ihm gehört hatten, zehn Jahre lang, halbnackt zum edlen Tier präpariert, besichtigen können, dann kam sein »Stopfpräparat« ins Depot, bis es 1848 bei einem Brand vernichtet wurde und es dem Toten, von dem niemand wusste, woher er gekommen war, endlich gelang, von der Erde zu verschwinden.
Feuchtersleben. Eine Fährte, die falsch, aber schön ist
Als ich 1994 monatelang von einer rätselhaften Schwäche ergriffen war, sodass meine Freunde schon spotteten, ich, der ich damals meinen höchsten Gewichtsstand erreicht hatte, werde bald an der »Auszehrung« dahinschwinden, wie sie in alten Büchern genannt wird, machte mir ein Freund bei einem Krankenbesuch ein solches altes Buch zum Geschenk. Er überreichte es mir mit melancholischem Spott, der wohl mehr ihm selbst als mir galt, denn er litt weit öfter als ich, der ich darin noch ein Anfänger war, an unerwarteten Einbrüchen von Kraft und Zuversicht, aus denen er sich nach einiger Zeit ebenso rätselhaft wieder zu erheben wusste. Das Buch stammte von einem mir damals nur als Namen bekannten Ernst von Feuchtersleben, hieß »Zur Diätetik der Seele« und war im Wiener Verlag Carl Gerold’s Sohn 1886 in der 46. Auflage erschienen.
Aus Langeweile, die ich mir mit der Lektüre eines kuriosen Fundstücks zu vertreiben trachtete, begann ich darin zu blättern. Unter »Diätetik der Seele« verstand der Verfasser die »Lehre von den Mitteln, wodurch die Gesundheit der Seele bewahrt werden kann«. Er war überzeugt, dass sich die Seele, wenn sie in Gefahr steht zu erkranken, irgendein lästiges oder schmerzhaftes Gebrechen des Körpers sucht, um ihm von ihrer Kränkung oder Gefährdung Kunde zu geben. Umgekehrt hielt er darauf, dass sich manche Eintrübung des Gemüts durch körperliche Tätigkeit verscheuchen lasse. Lesend begann ich bald schon zu begreifen, warum dieser Feuchtersleben von so vielen Zeitgenossen als Lebenslehrer und Seelentröster verehrt wurde. »Der Mensch kann nicht immer zu Allem aufgelegt sein«, las ich, »aber er ist immer zu Etwas aufgelegt. Dies thue er.« Hatte der kluge Mann dies um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts nicht wie für mich gesprochen, der ich am Ende des zwanzigsten in eine unbegreifliche Apathie geraten war, weil ich eine Sache, zu der ich mich beruflich verpflichtet fühlte, in Wahrheit schon längst nicht mehr tun wollte? Das Buch nahm mich so ein für sich, dass ich aus dem faulen Lehnstuhl aufstand, um mir einen Bleistift zu holen und Sätze anzustreichen wie diesen, in dessen Lebensweisheit natürlich, so wie in jeder Lebensweisheit, auch etwas Biedersinniges steckt: »Zur Heilung von Gemüthsleiden vermag der Verstand nichts, die Vernunft wenig, die Zeit viel, Resignation und Thätigkeit alles.«
Punktum. Resignation — und Thätigkeit also. Aber was ist das? Passives Tätigsein, aktives Resignieren? Oder das, was Thomas Mann später als Ethos des Standhaltens, des Ausharrens bezeichnet hat und noch später Jean Améry als »heroischen Nihilismus«, das Weitermachen im Wissen darum, dass es aussichtslos sei? Wie auch immer, ein schöner Satz erfreut das Gemüt, selbst wenn der Verstand ihm nicht Recht gibt, die Vernunft ihm widersprechen möchte und man glaubt, keine Zeit dafür zu haben, die heilende Wirkung der Zeit zu erwarten. Nicht dass ich über den luziden Gedanken des Ernst Freiherr von Feuchtersleben unverweilt wieder zu Kräften gekommen wäre, aber immerhin fasste ich den Vorsatz, mich, wenn es so weit gekommen sein werde, mit dem Autor des wunderlichen Trostbuchs etwas genauer zu befassen.
Dies war es, was ich dann aufs erste herausfand. Der 1806 geborene Feuchtersleben war Arzt und Schriftsteller gewesen, und er hatte, kaum glaublich, zur Schriftstellerei erst gefunden, weil er als Arzt in Wien sich und seiner Frau in kinderloser Ehe die schiere Existenz nicht bestreiten konnte. Als Arzt gilt er heute als einer der großen Ahnherren der Psychosomatik, auf den sich namentlich Viktor Frankl emphatisch bezog, als Schriftsteller ist er in die Fußnoten abgesunken, die sich in Studien über die österreichische Literatur des Biedermeier finden.
Das nächste, was ich von ihm erfuhr, gefiel mir noch besser, wahrscheinlich weil es eine falsche Fährte war, auf die ich geraten war. Feuchtersleben stammte aus einer alten österreichischen Offiziersfamilie. Sein Vater, in jungen Jahren nach irgendeinem habsburgischen Feldzug mit hohen Tapferkeitsmedaillen ausgezeichnet, verliebte sich in eine hochgebildete, selbstbewusste Frau, die als die »schöne Mulattin von Wien« bekannt war. Als er Josephine Soliman zwei Jahre, nachdem diese ihren Vater nicht davor hatte bewahren können, zum Ausstellungsstück zu werden, heiratete, musste er als Offizier abdanken, den Beruf eines Ingenieurs ergreifen und mit seiner Frau nach Krakau übersiedeln.
Der Ahnherr der Psychosomatik, der ärztliche Tröster ungezählter Leser und Leserinnen, die in seiner seit 1841 wieder und wieder aufgelegten »Diätetik« lesen konnten, dass körperliche Krankheiten mittels der Selbsterkenntnis seelischer Verstrickung zu heilen und seelischem Leid mittels körperlicher Betätigung und sinnvoller Arbeit für die Gesellschaft zu entrinnen sei: Hatte er also einen Afrikaner zum Großvater und eine vorurteilsfreie Frau namens Magdalena Cristiani zur Großmutter? Das hätte mir gepasst. Leider wurde ich ein paar Jahre später in einem Buch über Feuchtersleben eines anderen belehrt. Josephine Soliman, verehelichte von Feuchtersleben, gebar ihrem Mann in Krakau einen Sohn, der auf den Namen Eduard getauft wurde, und verblich wenig später im Alter von 29 Jahren. Der Witwer kehrte nach Wien zurück, begleitet von einem kleinen Sohn mit auffallend dunklem Teint, verheiratete sich neuerlich, und seine zweite Frau, Cäcilie von Clusolis, gebar ihm, so wie die erste, nach Jahresfrist einen Sohn, Ernst genannt, um kurz darauf das Schicksal der Vorgängerin zu teilen und, keine dreißig Jahre alt, zu sterben.
Wie es weiterging? Ach, gar nicht schön. Der zweifach verwitwete Vater suchte 1834 den Tod in der Donau. Immerhin, sein älterer Sohn Eduard, Angelo Solimans Enkel, wurde ein honoriger Sudmeister, der die Arbeit in den Salinen des Ausseerlandes leitete; ein Stich zeigt ihn als einen auf geradezu feminine Weise attraktiven Mann mit Zügen, die man später wohl als ausgeprägt negroid bezeichnet haben würde. Und Ernst von Feuchtersleben, der unverdrossen nicht allein das Recht des Menschen behauptet hatte, glücklich zu sein, sondern ihm auch die Begabung zusprach, es durch Selbsterziehung zu werden, er, der »Resignation und Thätigkeit« als geeignete Haltungen empfahl, der ewig lockenden Traurigkeit zu entrinnen? Er hat es auf gerade 43 Jahre gebracht und ist den schweren Tod nach langem Siechtum gestorben.
Seine ganze Lehre, wie die Seele gesund zu halten und der Körper durch seelische Selbsterkenntnis zu heilen sei, ist am Rande eines Abgrunds entstanden, in den Ernst von Feuchtersleben früh geblickt hat und um den er sein Leben lang wusste: »In der Brust eines jeden Menschen schlägt ein entsetzlicher Keim von Wahnsinn. Ringt mittelst aller heitern und thätigen Kräfte, dass er nie erwache!« Er hat ihn gekannt, den Grimassierer von Beaune, und gewusst, dass er sprungbereit auch in ihm selber lauerte, und es wäre interessant gewesen, sich mit ihm über die »Köpf-Stückhe« Messerschmidts, von denen er wohl keines je gesehen hat, zu unterhalten. Sie hätten ihm nicht gefallen, denn geradezu verzweifelt pries er Maß und Selbstbeherrschung, auf dass der Mensch in sich zur heiteren Harmonie bringe, was Messerschmidt muskelverkrampfende Zwangsharmonie hat werden lassen.
Ungargasse 5. Ein Postskriptum
Der literarische Ruhm der Ungargasse im dritten Wiener Gemeindebezirk gründet darauf, dass Ingeborg Bachmann ihren Roman »Malina« topographisch exakt in ihr situiert und dem umliegenden »Ungargassenland«, auch wenn es zum tödlichen Schauplatz für die Erzählerin wird, eine geradezu utopische Dimension von Heimat zugesprochen hat. »Aber Washington und Moskau und Berlin«, heißt es bald zu Beginn, »sind bloß vorlaute Orte, die versuchen, sich wichtig zu machen. In meinem Ungargassenland nimmt niemand sie ernst oder man lächelt über solche Aufdringlichkeiten wie über die Kundgebungen ehrgeiziger Emporkömmlinge …« Die Erzählerin wohnt in der Ungargasse 6, ihr Geliebter Ivan — weniger praktisch als quälend nah — im Haus »mit der Nummer 9 und den beiden Löwen aus Bronze am Tor«. Die langgezogene Gasse, vom Heumarkt bis hinauf zum Rennweg — welcher am unteren Schloss Belvedere mit der Österreichischen Galerie vorbeiführt — wird von der Erzählerin, die sich auf den Weg in die Stadt begeben hat oder wieder auf der Flucht vor sich und ihrem bedingungslosen Begehren ist, mehrfach beschrieben. Meist rühmt sie die Ungargasse, weil sie bietet, was man zum städtischen Leben braucht, ein paar alte Gasthäuser, kleine Cafés, dazu Apotheke, Tabak Trafik, Bäckerei, und ihr zugleich alles abgeht, was sie zur Attraktion für Touristen machen könnte, die es auch kaum hierher verschlägt. Die Gasse verdankt ihren Namen den Kaufleuten, die einst aus Ungarn mit Pferd und Wagen in einer ihrer vielen Herbergen Station machten, wie ja auch der Liebhaber, der die Radikalität der Hingabe, die Bachmanns Erzählerin selbst erprobt und verzweifelt fordert, nicht zu geben imstande ist, aus Ungarn nach Wien gekommen ist.
Im Winter 2007 war ich eine Woche lang in Wien, um einiges zu erledigen, was nur in der Hauptstadt zu erledigen war, fand dazwischen aber genügend Zeit, mich in meinem Hotel zu langweilen, sodass ich mich eines Nachmittags aufmachte, es einmal mit der Ungargasse zu probieren, in deren Nähe es mich seit meinem ersten Besuch von Wien vor langer Zeit nie mehr geführt hatte. Ich kam vom Ende der Gasse her, vom Rennweg, wo die Ungargasse in eine sehr belebte, etwas unübersichtliche Kreuzung mündet. Wer, Bachmanns Roman im Kopf, die vom Rennweg leicht bergab sich neigende Straße entlangschlendert, findet vieles noch so, wie es die Autorin benannt und beschrieben hat, die kleinen Geschäfte, eine trotz des starken Verkehrs zwischendurch immer wieder geradezu kleinstädtische Atmosphäre. Dann wieder sieht man, dass die »beleidigenden Neuerungen«, von denen die Erzählerin 1971 spricht, inzwischen erheblich gealtert sind und von weit gröberen Beleidigungen überboten wurden.
Schräg gegenüber dem Gasthaus »Zum Alten Heller«, das Ingeborg Bachmann mehrfach und immer so, als gehöre es zum Reiz ihres Ungargassenlandes, erwähnt, fiel mir auf der anderen Straßenseite ein wenig spektakuläres Haus auf, das in »Malina«, fast möchte ich sagen, merkwürdigerweise, nicht erwähnt wird und an dem die Tafel angebracht ist: »Tafel für Petar Preradović. 1819—1872. Großer kroatischer Dichter.« Wie Ivan, der eine Mann in Ingeborg Bachmanns Roman, war Petar Preradović als Fremder nach Wien gekommen, aus Kroatien, wie Malina, der titelgebende zweite Mann, der im Heeresgeschichtlichen Museum arbeitet, hatte er etwas mit der k.u.k. Armee zu tun, er brachte es dort, in einem ungeliebten Beruf, gar zum General. Und wie die Erzählerin und ihre Autorin war Petar Preradović, der ein paar Jahre gegenüber dem in »Malina« gerühmten Wirtshaus gelebt hatte, Dichter gewesen, Liebeslyriker vor allem und Verfasser patriotischer Verse, die nicht den nationalistischen Dünkel verklären, sondern in denen Patriotismus und Demokratie, Ansprache an das entrechtete, in Unwissenheit gehaltene Volk und Pathos der Weltverbrüderung in eins fallen.
Preradović war in einem dalmatinischen Dorf zur Welt gekommen und durch die Militärschulen der habsburgischen Armee gegangen. Als er zwanzig war, hatte er über dem Drill in all den Garnisonsstädten seine Muttersprache vergessen; ausgerechnet in Mailand, wo er eine Zeitlang stationiert war und das eine alte Verbindung zu Zadar und Dalmatien hatte, entdeckte er sie wieder. Als Erwachsener eignete er sich die verlorene, die ihm geraubte Sprache der Kindheit wieder an, und nach wenigen Jahren schon schrieb er das nuancenreichste Kroatisch seiner Zeit. Die Balkanslawen sah er berufen, Europa endlich in die Epoche des immerwährenden Friedens zu führen, »Slavjanstvu« ist eine Ode betitelt, die das Slawentum als befreiende und zugleich vereinende Kraft der kommenden Zeit beschwört. Eigenartige Gedichte für einen österreichischen General, gleichermaßen wegen ihrer Verkündung von Frieden und Freiheit und in ihrem Pathos eines südslawischen Aufbruchs. In seinem Versepos »Die ersten Menschen« geht es — wie in »Malina« — um die Liebe und um die Frage, ob Liebe und Vernunft, Leidenschaft und Verstand sich je vereinen lassen. Als Adam, verloren in seinem Paradies, sich im Wasser spiegelt, wird er sich seiner Einsamkeit bewusst und ruft verzweifelt seinen Schöpfer an, dass er sein Werk vollende und »meinem Ich eines zugeselle, das mir ähnlich ist«, worauf Gott, nicht aus Adams Rippe, sondern aus einem anderen, einem zweiten Staubkorn die Frau erschafft.
Sonderbar, dass Ingeborg Bachmann, die in ihrem Roman mancherlei Bezug über das Ungargassenland verstreut, jenen auf Petar Preradović unterlassen hat, aber vielleicht hat sie ihn auch nicht gekannt, und das Haus in der Ungargasse 39 trug, als sie ihren Roman schrieb, noch nicht jene Tafel, die es heute trägt und die doch heute niemals mehr an ihr angebracht werden könnte. Denn unterzeichnet ist der Aufruf, sich an einen großen kroatischen Dichter zu erinnern — der sich die Slawen des Balkans als Friedensbringer des neuen Europa träumte —, von einer Institution, die es längst nicht mehr gibt, die hinweggeschwemmt wurde in Strömen von Blut und die doch hier, in Wien, in der Ungargasse, auf einer rostenden Tafel überlebt hat: »Errichtet von der Jugoslawischen Akademie der Künste und Wissenschaften.«
Der Winter 2007 war der wärmste seit Menschengedenken, in vielen österreichischen Wintersportorten blieben die Schilifte außer Betrieb. Selbst gewohnheitsmäßige Schönredner entdeckten, dass sie sich auch als Apokalyptiker der Erderwärmung bemerkbar machen konnten, und weil es über Wochen so warm war, erkrankten Hunderttausende Österreicher an Erkältung. Auch ich litt an den bekannten Symptomen, und als es jetzt zu regnen begann, suchte ich Unterschlupf. Ich fand ihn, gegenüber der nicht eben auffälligen Nummer 6, in einem einstöckigen, ein wenig an ein Landpalais erinnernden Eckhaus, das den Namen »Bierteufel. Das Gasthaus der hundert Biere« trug. Es war später Nachmittag, und als ich den vom Rauch mehrerer Generationen gut gebeizten Raum betrat, sah ich sogleich, dass nur wenige Tische besetzt waren und ich der einzige Alleintrinker sein würde, denn die anderen Nachmittagszecher saßen zu zweit oder viert an ihren Tischen. Ich bestellte, von der Getränkekarte mit ihren hundert Biersorten überfordert, das Bier einer privaten steirischen Brauerei, von der ich noch nie etwas gehört hatte, und trat noch einmal vor das Haus, um nachzulesen, worauf ich beim Hineinhuschen nur einen raschen Blick geworfen hatte. Ja, das Haus Ungargasse Nummer 5 war das so genannte Beethovenhaus, eines der unzähligen Beethovenhäuser, muss man hinzufügen, die es in Wien gibt, und dieses eine konnte damit renommieren, dass der Komponist hier seine Neunte Symphonie fertiggestellt hatte.
Ich trank dann ein slowakisches Bier, das mir der Kellner, der vielleicht selber Slowake war, mit besonderem Wohlgefallen auf den Tisch zu knallen schien. Ich war im »Bierteufel« angekommen, kein Zweifel, und als ich nach einer Weile des Trinkens das Gefühl hatte, dass ich von den Leuten an den anderen Tischen in verhohlenen Augenschein genommen wurde, beschloss ich, den Teufel, von dem ich nur zu gut wusste, dass er auch in mir steckte, zu flüchten, zahlte und ging in den Regen hinaus. An der Seitenfront zur Beatrixgasse hatte das Haus, an dem an der Eingangsseite zur Ungargasse zwei Hinweise auf Beethoven angebracht waren, noch eine weitere, eine dritte Tafel. »Hier lebte und starb Jan Kolár. 1849—1852. Professor und slowakischer Dichter. Gestiftet von den Slowaken Wiens.«
Kollár, wie er sonst meist geschrieben wird, lebte natürlich nicht nur drei Jahre, aber die letzten drei eben in Wien und gerade in diesem Haus. Zu ihm gäbe es viel zu erzählen, aber auch ein Buch der Abirrungen darf nicht jeden Seitenweg bis zum Ende gehen, zumal es dieses Ende nicht gibt, da es mich auf den Seitenwegen tatsächlich immer weiter und weiter führen würde. Als ich aber meine Erinnerungen an den Grimassierer von Beaune niederschrieb und auf die Wege geriet, die mich aus dem Restaurant im Burgund ein paar Jahre später bis in dieses Wiener Gasthaus in der Ungargasse 5 geführt hatten, fand ich in dem Zettelwerk, das ich mir zu Messerschmidt gesammelt hatte, eine biographische Nachricht, die mir bisher gänzlich belanglos erschienen war.
Als er in Wien noch die Gunst der Erlauchten genoss und glaubte, hier ein geachtetes Leben als Bildhauer verbringen zu dürfen, hat er mit dem Geld, das ihm seine Porträtbüsten eintrugen, ein großes Haus oder kleines Palais erworben, das ihm Wohnung, Werkstatt und Depot seiner Skulpturen zugleich war. Es war das Haus in der Ungargasse 5, das Beethoven-, das Kolárhaus: der Bierteufel, dem ich, wenigstens an diesem milden Frühsommerabend im Februar 2007, entronnen war.