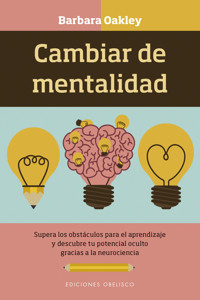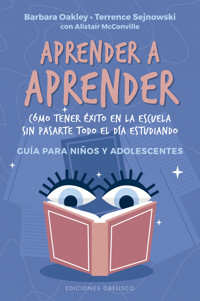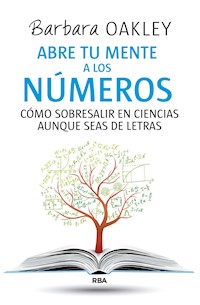12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: mvg
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Mathematik versteht man oder eben nicht. Der eine ist dafür natürlich begabt, dem anderen bleibt dieses Fach für immer ein Rätsel. Stimmt nicht, sagt nun Barbara Oakley und zeigt mit ihrem Buch, dass wirklich jeder ein Gespür für Zahlen hat. Mathematik braucht nämlich nicht nur analytisches Denken, sondern auch den kreativen Geist. Denn noch mehr als um Formeln geht es um die Freiheit, einen der vielen möglichen Lösungsansätze zu finden. Der Weg ist das Ziel. Und wie man zum richtigen Ergebnis kommt, ist eine Kunst, die man entwickeln, entdecken und in sich wecken kann. Die Autorin vermittelt eine Vielfalt an Techniken und Werkzeugen, die das Verständnis von Mathematik und Naturwissenschaft grundlegend verbessern. (K)ein Gespür für Zahlen nimmt Ihnen — vor allem wenn Sie sich in Schule, Uni oder Beruf mathematisch oder naturwissenschaftlich beweisen müssen — nicht nur die Grundangst, sondern stärkt Ihren Mut, Ihren mathematischen Fähigkeiten zu vertrauen. So macht Mathe Spaß!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Ähnliche
Barbara Oakley
(K)ein Gespür für Zahlen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
1. Auflage 2015
© 2015 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH, Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
© der Originalausgabe 2014 by Barbara Oakley
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2014 bei Jeremy P. Tarcher/Penguin unter dem Titel A Mind for Numbers.
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with Jeremy P. Tarcher, an Imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Marion Zerbst
Redaktion: Manuela Kahle
Umschlaggestaltung: Kristin Hoffmann
Umschlagabbildung: unter Verwendung von iStockphoto/Shutterstock
Satz: Daniel Förster
Druck: CPI books GmbH, Leck
eBook: ePubMATIC.com
ISBN Print 978-3-86882-595-4
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86415-780-6
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86415-781-3
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.mvg-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unterwww.muenchner-verlagsgruppe.de
Dieses Buch widme ich Dr. Richard Felder, der mit seinem Scharfsinn und leidenschaftlichen Engagement weltweit für enorme Verbesserungen in der Lehre von Mathematik, Ingenieurwesen, Technik und anderen Naturwissenschaften gesorgt hat. Wie Zehntausende anderer Pädagogen verdanke auch ich meine Erfolge seinen kreativen Lehrmethoden. Il miglior maestro.
Das Gesetz des glücklichen Zufalls: Fortuna ist denjenigen hold, die nicht aufgeben.
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Ein paar Anmerkungen für den Leser
1 Überwinden Sie Ihre Scheu!
2 Immer mit der Ruhe Zu krampfhaftes Bemühen bringt Sie nicht weiter
Fokussiertes versus diffuses Denken
Der fokussierte Denkmodus – ein Flipperautomat mit vielen Bumpern
Warum Mathe und Naturwissenschaften oft schwieriger sind als andere Fächer
Der diffuse Denkmodus – ein Flipperautomat mit wenigen Bumpern
Warum gibt es zwei verschiedene Denkmodi?
Ein paar Worte zum Thema Aufschieberei
3 Lernen ist ein schöpferischer Prozess Was wir von Thomas Edison lernen können
Wechsel zwischen fokussiertem und diffusem Denkmodus
Um kreativ zu sein, müssen Sie Ihre Fähigkeiten nutzen und erweitern
Wie man beim Lernen zwischen den beiden Denkmodi hin- und herwechselt
Versuchen Sie nicht mit Ihren »schlaueren« Studienkollegen mitzuhalten!
Hüten Sie sich vor der Sackgasse des Einstellungseffekts!
Was tun, wenn Sie wirklich nicht mehr weiterwissen?
Unser Arbeits- und Langzeitgedächtnis
Warum guter Schlaf für erfolgreiches Lernen so wichtig ist
4 Chunking und Vermeidung von Kompetenzillusionen So werden Sie zum »Gleichungsflüsterer«
Was passiert, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf etwas konzentrieren?
Was ist ein Chunk? Solomons Chunking-Problem
So baut man Chunks auf: eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Kompetenzillusionen – und warum regelmäßiges Sich-Abfragen so wichtig ist
Durch Übung verfestigt sich der Lernstoff in Ihrem Gedächtnis
Abfragen von Lernstoff außerhalb Ihres Studierzimmers: Spaziergänge sind eine fantastische Lernhilfe!
Interleaving und Überlernen – zwei Lernstrategien im Vergleich
5 Was tun gegen die leidige Aufschieberei? Machen Sie sich Ihre schlechten Angewohnheiten (»Zombies«) zu Verbündeten!
Wir schieben nur unangenehme Dinge auf die lange Bank
So verleitet unser Gehirn uns dazu, Pflichten auf die lange Bank zu schieben
6 Zombies, nichts als Zombies Was steckt hinter unserem Hang zur Aufschieberei?
Spannen Sie Ihre Gewohnheiten (»Zombies«) als Helfer ein!
So kommen Sie in den Flow: Konzentrieren Sie sich nicht auf das Endprodukt, sondern auf den Arbeitsprozess
Unterteilen Sie Ihre Arbeit in kleine Häppchen – und bewältigen Sie diese in kurzen, konzentrierten Lernschritten
7 Chunking stärkt die Nerven So bauen Sie Fachkompetenz auf und schlagen Prüfungsängsten ein Schnippchen
So baut man stabile Chunks auf
Lernblockade: Wenn Sie plötzlich das Gefühl haben, gar nichts mehr zu wissen
Um Ihren Lernstoff in den Griff zu bekommen, müssen Sie ihn erst einmal ordnen
Prüfungssituationen sind eine gute Lernhilfe: Testen Sie sich immer wieder selbst!
8 Hilfsmittel, Tipps und Tricks
Selbstversuche: Wege zu einem besseren Ich
Die ultimative Zombie-Bekämpfungsmethode: Nutzen Sie einen Tagesplaner!
Nutzen Sie moderne Technologien: Die besten Apps und Computerprogramme für Studenten
9 Resümee: So bekommen Sie die Zombies Ihrer Aufschieberei in den Griff
Warum man sich nicht ständig im »Flow« befinden sollte
»Abwarten und Tee trinken«: eine kluge Strategie
Fragen und Antworten zum Thema Aufschieberei
10 So verbessern Sie Ihr Gedächtnis
Wissen Sie noch, wo Ihr Küchentisch steht? Ihr überdimensionales räumlich-visuelles Gedächtnis
Die Macht einprägsamer Bilder
Die Gedächtnispalasttechnik
11 Noch mehr Gedächtnistipps Denken Sie sich eine fantasievolle visuelle Analogie oder Metapher aus
Durch regelmäßiges Wiederholen verankern sich Ideen in Ihrem Gedächtnis
Kombinieren Sie Informationen zu Gruppen
Erfinden Sie Geschichten!
Das Muskelgedächtnis
Muskelgedächtnis – wörtlich genommen
Durch »Eselsbrücken« werden Sie schneller zum Experten
12 Seien Sie zufrieden mit dem, was Sie haben! Bemühen Sie sich um ein intuitives Verständnis Ihres Lernstoffs
Auch Genies fällt nicht alles in den Schoß
13 Formen Sie Ihr Gehirn
Ändern Sie Ihre Gedanken – ändern Sie Ihr Leben
Mit Chunks dringen Sie leichter in die Tiefe eines Fachgebiets vor
14 So entwickeln Sie Ihr bildhaftes Vorstellungsvermögen anhand von Lerngedichten Lernen Sie, ein Gleichungsgedicht zu verfassen!
Vereinfachen und personalisieren Sie Ihren Lernstoff
Wissenstransfer: So wendet man das Gelernte auf neue Kontexte an
15 Selbstständiges Lernen Warum selbstständiges Lernen so sinnvoll ist
Warum ausgezeichnete Lehrer so wertvoll sind
Noch ein Grund, warum selbstständiges Lernen sinnvoll ist: kniffelige Prüfungsfragen
Achtung vor geistigen Scharfschützen!
16 Hüten Sie sich vor übersteigertem Selbstvertrauen! Warum Teamarbeit sinnvoll ist
So schützen Sie sich vor übermäßigem Selbstvertrauen
Warum man beim Brainstorming auf so gute Ideen kommt
17 Ein paar wichtige Überlebensstrategien für Prüfungen
Die Schwer-leicht-Strategie
Warum viele Menschen bei einer Prüfung Angst bekommen – und was man dagegen tut
Noch ein paar abschließende Gedanken zum Thema Prüfungen
18 So erschließen Sie sich Ihr geistiges Potenzial
Anmerkungen
Nachwort
Danksagung
Literaturverzeichnis
Bildnachweis
Vorwort
Ihr Gehirn besitzt erstaunliche Fähigkeiten – aber leider hat man Ihnen keine Gebrauchsanweisung dafür mitgeliefert. Diese Anleitung finden Sie in (K)ein Gespür für Zahlen. Egal, ob Sie noch ein Neuling oder bereits Experte auf dem Gebiet der Naturwissenschaften sind: Sie werden in diesem Buch auf jeden Fall interessante neue Methoden zur Verbesserung Ihrer Lernfähigkeiten und -techniken entdecken.
Der im 19. Jahrhundert lebende Mathematiker Henri Poincaré berichtet von einer interessanten Erfahrung, die er beim Knacken einer schwierigen Mathematikaufgabe gemacht hat, mit der er sich bereits wochenlang vergeblich abgemüht hatte: Er fuhr einfach in den Urlaub. Als er in Südfrankreich in einen Bus stieg, fiel ihm plötzlich ganz unerwartet die Lösung ein – aus einer Region seines Gehirns, die an der Aufgabe weitergearbeitet hatte, während er seine Ferien genoss. Und Poincaré wusste genau, dass diese Lösung richtig war, obwohl er die einzelnen Lösungsschritte erst später, bei seiner Rückkehr nach Paris, zu Papier gebracht hat.
Was dieser Mathematiker konnte, können Sie auch! Wie das geht, erklärt Barbara Oakley Ihnen in diesem interessanten Buch. Erstaunlicherweise kann Ihr Gehirn sogar an einem Problem arbeiten, während Sie schlafen und sich dieser mentalen Vorgänge gar nicht bewusst sind. Das funktioniert allerdings nur, wenn Sie sich vor dem Einschlafen auf dieses Problem konzentrieren: Am nächsten Morgen kommt Ihnen dann oft eine ganz neue Erkenntnis, die Ihnen den Weg zur Lösung zeigt. Dieser intensive Denkprozess vor einem Urlaub oder vor dem Einschlafen ist wichtig, denn dadurch »programmieren« Sie Ihr Gehirn gewissermaßen darauf, genau diese Aufgabe zu lösen; sonst konzentriert es sich auf ein anderes Problem. Mathematik und Naturwissenschaften stellen in dieser Hinsicht keine Ausnahme dar: Ihr Gehirn wird sich bei der Bearbeitung solcher Aufgaben genauso große Mühe geben wie beispielsweise bei der Lösung sozialer Probleme – je nachdem, womit Sie sich vorher beschäftigt haben.
Sie werden in diesem faszinierenden Buch, das genau zum richtigen Zeitpunkt erschienen ist, noch viele weitere Erkenntnisse und Techniken zu effektivem Lernen finden – und wenn Sie diese beherzigen, werden Sie den Lernprozess nicht mehr als harte Arbeit, sondern eher wie ein spannendes Abenteuer empfinden. Auf dieser Entdeckungsreise werden Sie interessante Erfahrungen machen: zum Beispiel, dass man sich manchmal einbildet, einen Stoff bereits verstanden und gelernt zu haben, obwohl man in Wirklichkeit noch weit davon entfernt ist. Außerdem werden Sie Wege zur Verbesserung Ihres Konzentrationsvermögens finden und lernen, Ihren Stoff regelmäßig zu wiederholen, um ihn sich besser einzuprägen. Sie werden auch erfahren, wie man wichtige Ideen so komprimiert, dass man sie sich leichter merken kann. Wenn Sie sich diese einfachen, praxisorientierten Methoden aneignen, werden Sie in Zukunft effektiver lernen können und dabei mehr Erfolgserlebnisse haben. Dieser großartige Ratgeber wird nicht nur Ihren Lernprozess verbessern, sondern auch Ihr Leben bereichern!
Terrence J. Sejnowski, Francis-Crick-Professor am Salk-Institut für biologische Studien
Einleitung
Dieses Buch kann Ihre Sichtweise und Ihr Verständnis des Lernprozesses drastisch verändern. Es will Ihnen die einfachsten, effektivsten und effizientesten Lerntechniken vermitteln, die der Wissenschaft bisher bekannt sind. Und Sie werden sehen: Es macht Spaß, sich diese Techniken anzueignen!
Seltsamerweise setzen viele Menschen, die etwas lernen möchten, dabei ineffektive und ineffiziente Strategien ein. In meinem Forschungslabor befragten wir Collegestudenten nach ihren Lernmethoden. Die meisten versuchten, sich ihre Lernstoffe durch wiederholtes Lesen anzueignen: Sie lasen ihre Lehrbücher oder Notizen immer wieder durch. Doch das ist leider vergebliche Liebesmühe – es kostet zwar eine Menge Zeit, man erreicht damit aber nichts. Wer seinen Lernstoff einfach nur mehrmals hintereinander durchliest, ist nicht etwa dumm oder faul, sondern einer kognitiven Illusion zum Opfer gefallen: Wenn wir etwas immer wieder lesen, wird uns dieser Stoff mit der Zeit so vertraut und geläufig, dass unser Gehirn ihn leicht verarbeiten kann. Und diese mühelose Verarbeitung interpretieren wir als Zeichen dafür, dass wir unseren Lernstoff jetzt gut beherrschen, obwohl das in Wirklichkeit gar nicht stimmt.
In diesem Buch werden Sie diese und andere Lernillusionen kennenlernen und erfahren, wie man sie überwindet. Außerdem vermittelt die Autorin Ihnen effektive neue Lerntechniken (beispielsweise regelmäßiges Sich-Abfragen), mit denen man bei geringem Aufwand eine durchschlagende Wirkung erzielt. Dank diesem sehr praxisorientierten und doch inspirierenden Buch werden Sie endlich begreifen, warum manche Lernmethoden sehr viel wirksamer sind als andere.
Zurzeit stehen wir in der Erforschung der effektivsten Lerntechniken vor einer wahren Wissensexplosion. (K)ein Gespür für Zahlen ist ein unentbehrlicher Reiseführer durch diese Welt faszinierender neuer Erkenntnisse!
Jeffrey D. Karpicke, James-V.-Bradley-Extraordinarius für Psychologie an der Purdue University
Ein paar Anmerkungen für den Leser
Wer beruflich mit Mathematik oder Naturwissenschaften zu tun hat, verbringt oft Jahre mit der Suche nach sinnvollen Lerntechniken. Wenn man diese Methoden dann endlich gefunden hat, ist das ein enormer Fortschritt! Damit hat man, ohne es zu wissen, die Initiationsriten durchlaufen, die notwendig sind, um in den geheimnisvollen Klub der professionellen Mathematiker und Naturwissenschaftler einzutreten.
In meinem Buch möchte ich Ihnen diese eigentlich ganz einfachen Techniken erklären, damit Sie von Anfang an damit arbeiten können. So haben Sie das ganze Arsenal an Lernmethoden, das sich Fachleute erst in jahrelanger mühevoller Kleinarbeit aneignen müssen, von vornherein zur Hand.
Mit diesen Methoden können Sie Ihr Denken und Ihr Leben verändern – egal, wie gut Sie bisher in Mathematik und Naturwissenschaften waren. Wenn Sie bereits Experte auf diesem Gebiet sind, wird Ihnen dieser Einblick in die Arbeitsweise Ihres Gehirns künftig zu mehr Lernerfolgen verhelfen. Unter anderem finden Sie in diesem Buch scheinbar widersinnige, aber effektive Praxistipps und Erkenntnisse, dank denen Sie Ihre Hausarbeiten mit minimalem Zeitaufwand erledigen und ohne Panik in die Prüfung gehen können. Falls Sie immer noch zu den Leuten gehören sollten, denen Mathematik und Naturwissenschaften schwerfallen, bietet mein Buch Ihnen eine wahre Fundgrube an übersichtlich dargestellten Arbeitstechniken und Aufgabenlösungsmethoden. Wenn Sie ein bestimmtes Fachgebiet besser beherrschen möchten, wird Ihnen dieses Buch ebenfalls ein unentbehrlicher Wegweiser sein.
Es ist genau die richtige Lektüre für Schüler, die Fremdsprachen lieben, im Zeichnen immer eine Eins haben – und den Matheunterricht abgrundtief hassen. Aber es eignet sich auch für Studenten, die sich bereits sehr gut in Mathematik, Physik, Ingenieurwissenschaften oder Betriebswirtschaft auskennen, jedoch den Verdacht haben, dass es bessere Lerntechniken gibt, die sie unbedingt kennenlernen sollten. Auch Eltern, deren Kinder entweder immer schlechtere Mathenoten nach Hause bringen oder gerne zu mathematischen oder naturwissenschaftlichen Genies werden möchten, werden dieses Buch hilfreich finden. Ebenso der frustrierte kleine Angestellte, der beruflich nicht weiterkommt, weil er bei einer wichtigen Zertifizierungsprüfung durchgefallen ist, oder der Verkäufer, der schon lange davon träumt, Krankenpfleger – oder vielleicht sogar Arzt – zu werden. Ferner ist dieses Buch für die wachsende Schar der Kinder gedacht, die zu Hause unterrichtet werden; und es ist eine wichtige Lektüre für Lehrer und Professoren (nicht nur für diejenigen, die Mathematik, Physik, Chemie oder Ingenieurwissenschaften unterrichten). Auch der Rentner, der jetzt endlich Zeit hat, sich neue Computerkenntnisse oder die Raffinessen der Kochkunst anzueignen, wird von meinem Buch profitieren. Und nicht zuletzt habe ich es schlicht und einfach für Leser aller Altersstufen geschrieben, die gerne von allem ein bisschen Ahnung haben möchten.
Langer Rede kurzer Sinn: Dieses Buch ist genau das richtige für Sie. Viel Spaß beim Lesen!
Dr. Barbara Oakley,
P.E., Fellow am American Institute for Medical & Biological Engineering und Vice President am Institute for Electrical and Electronics Engineers – Engineering in Medicine and Biology Society
1
Überwinden Sie Ihre Scheu!
Wie groß ist die Chance, dass Sie die Tür Ihres Kühlschranks öffnen und darin einen Strümpfe strickenden Zombie vorfinden? Ungefähr genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass ein gefühlsbetonter, sprachbegabter Mensch wie ich irgendwann einmal Professor für Ingenieurwissenschaften wird.
Als Kind habe ich alle naturwissenschaftlichen Fächer gehasst. Ich quälte mich mit Ach und Krach durch die Mathematik-, Chemie- und Physikkurse am Gymnasium, wobei ich etliche Prüfungen wiederholen musste. Erst mit 26 Jahren begann ich, Förderunterricht in Trigonometrie zu nehmen.
Als Kind kam mir selbst etwas so Einfaches wie das Ablesen der Uhrzeit sinnlos vor. Warum zeigte ausgerechnet der kleine Zeiger die volle Stunde an? Sollte das nicht eigentlich der große Zeiger tun, da die Stunde schließlich eine wichtigere Zeiteinheit ist als die Minute? Wie spät war es denn nun eigentlich – zehn nach zehn oder zehn vor zwei? Die Uhrzeit stürzte mich in ständige Verwirrung. Und mit dem Fernsehen war es noch schlimmer: Damals gab es noch keine Fernbedienung, und ich hatte keine Ahnung, mit welchem Knopf man das Fernsehgerät einschaltet. Fernsehshows konnte ich mir immer nur im Beisein meines Bruders oder meiner Schwester anschauen – und die waren nicht nur in der Lage, den Fernseher einzuschalten, sondern konnten sogar das richtige Programm wählen. Beneidenswert …
Aus meiner mangelnden technischen Begabung und meinen katastrophalen Zensuren in Mathematik, Physik und Chemie konnte ich nur schließen, dass ich eben einfach nicht besonders intelligent war. Zumindest nicht auf diesem Gebiet. Obwohl mir das damals nicht bewusst war, hat mein Selbstbild als technisch, naturwissenschaftlich und mathematisch unbegabter Mensch damals meinen ganzen Lebensweg geprägt. Die eigentliche Ursache des Übels waren meine Probleme in Mathematik. Zahlen und Gleichungen waren für mich wie lebensgefährliche Krankheiten, denen man um jeden Preis aus dem Weg gehen sollte. Damals wusste ich noch nicht, dass es ganz einfache mentale Tricks gibt, die mir das Matheverständnis erleichtert hätten – und diese Tricks helfen nicht nur Schülern, die schlecht in Mathematik sind, sondern auch Studenten, die dieses Fach bereits gut beherrschen. Damals begriff ich nicht, dass meine Denkweise typisch für Menschen war, die glauben, in naturwissenschaftlichen Fächern totale Nieten zu sein. Inzwischen ist mir klar, worin mein Problem bestand: Ich kannte nur einen einzigen Lernmodus – und war daher taub für die Musik der Mathematik.
Die Mathematik, so wie sie in amerikanischen Schulsystemen gelehrt wird, kann wie eine heilige Muttergottes sein: Logisch und majestätisch erklimmt sie die Stufen der Subtraktion, Multiplikation und Division und schwingt sich erhaben in den Himmel der mathematischen Schönheit auf. Aber sie kann auch eine böse Stiefmutter sein: Wenn uns nur ein einziger Schritt in der logischen Abfolge ihrer Denkprozesse entgeht, verzeiht sie uns das nie – und so etwas kann sehr leicht passieren. Dazu reichen schon ein paar familiäre Probleme, ein burn-out-geplagter Lehrer oder eine längere Krankheit – eine ein- oder zweiwöchige Grippe in einer besonders wichtigen Unterrichtsphase, und schon hat man den Faden verloren.
Oder vielleicht hat man – so wie ich damals – einfach kein Interesse an Mathe oder ganz offensichtlich kein Talent dafür.
Als ich die siebte Klasse besuchte, passierte in meiner Familie eine Katastrophe: Mein Vater zog sich eine schwere Rückenverletzung zu, durch die er arbeitslos wurde. Wir mussten umziehen und landeten in einem ärmlichen Schulbezirk, in dem ein grantiger alter Mathelehrer uns bei glühender Hitze stundenlang stumpfsinnig Zahlen addieren und multiplizieren ließ – ohne uns zu erklären, wozu das eigentlich gut sein sollte. Anscheinend machte es ihm Spaß zuzusehen, wie wir uns mit seinen Aufgaben abquälten.
Das war ich im Alter von zehn Jahren mit dem Lamm Earl. Ich liebte Tiere, las und träumte gern. Mathe, Chemie und Physik standen nicht auf meiner Prioritätenliste.
Damals fand ich Mathematik nicht nur sinnlos – nein, sie war mir aus tiefster Seele zuwider. Und mit allen anderen naturwissenschaftlichen Fächern ging es mir genauso. Bei meinem ersten Chemieexperiment gab mein Lehrer mir und meinem Mitschüler, mit dem zusammen ich die Aufgabe lösen musste, eine andere chemische Substanz als den anderen Schülern. Als wir die Daten »frisierten«, um auf das gleiche Ergebnis zu kommen wie unsere Klassenkameraden, machte er sich über uns lustig. Angesichts meiner katastrophalen Zensuren rieten mir meine besorgten Eltern, in die Sprechstunde meines Lehrers zu gehen und ihn um Nachhilfeunterricht zu bitten; aber den Gefallen tat ich ihnen nicht. Mathe, Chemie und Physik hatten sowieso keinen Sinn. Die Götter des Stundenplans waren offensichtlich wild entschlossen, mir diese Fächer einzutrichtern, obwohl mir jedes Mal übel davon wurde. Diesen Kampf konnte ich nur gewinnen, indem ich mich weigerte, irgendetwas von dieser verhassten Materie zu verstehen, und aus purer Aggression durch jede Prüfung fiel. Gegen diese Strategie kam niemand an.
Dabei war ich durchaus keine schlechte Schülerin. Ich hatte einfach nur andere Interessen: Geschichte, Gemeinschaftskunde, Kultur – und vor allem Fremdsprachen. Zum Glück bewahrten meine guten Noten in diesen Fächern mich vor dem Sitzenbleiben.
Nach dem Abitur ging ich zur Armee, denn dort wurde ich sogar dafür bezahlt, eine Fremdsprache zu lernen. Bald war ich im Russischen (einer Sprache, die ich aus einer puren Laune heraus gewählt hatte) so gut, dass mir ein Reserve-Officers- Training-Corps-Stipendium angeboten wurde.a Also studierte ich an der University of Washington slawische Sprachen und Literatur und absolvierte meinen Bachelor-Abschluss mit Auszeichnung. Das Russische floss mir durch die Kehle wie warmer Sirup; meine Aussprache war so gut, dass manche Russen mich sogar für eine Muttersprachlerin hielten. Ich investierte viel Zeit in die Vervollkommnung meiner Sprachkenntnisse; je besser ich darin wurde, umso mehr Spaß machte mir das Lernen – und umso mehr Zeit nahm ich mir dafür. Mein Erfolg bestärkte mich in dem Wunsch, weiter zu üben, und so beherrschte ich die Sprache mit der Zeit immer besser.
Doch gerade als ich am allerwenigsten damit rechnete, wurde ich zum Leutnant der Fernmeldetruppe der amerikanischen Armee ernannt. Plötzlich erwartete man von mir, dass ich mich mit Funk-, Telegrafen- und Telefonschaltsystemen auskannte. Was für eine unerwartete Schicksalswende! Soeben noch himmelhoch jauchzend – ein Sprachgenie mit glänzenden Zukunftsaussichten – und jetzt auf einmal zu Tode betrübt: gestrandet in einer mir fremden technischen Welt, in der ich zwangsläufig verrotten musste wie ein alter Baumstumpf.
Scheiße!
Ich musste an einer Schulung in Elektronik teilnehmen, bei der Mathematik eine wichtige Rolle spielte und bei der ich als schlechteste Schülerin meiner Klasse abschnitt. Dann ging es ab nach Westdeutschland, wo ich als Zugführerin in der Fernmeldetruppe diente und tagtäglich aufs Neue erlebte, dass die Soldaten und Offiziere, die sich in technischen Dingen auskannten, das Sagen hatten. Sie waren die großen Problemlöser und trugen mit ihrer Arbeit dazu bei, dass die anderen ihre Mission erfüllen konnten.
Als ich über meine bisherige Karriere nachdachte, wurde mir klar, dass ich mich immer nur um meine Hobbys und Interessen gekümmert hatte, ohne für neue Fachgebiete offen zu sein. So hatte ich mich unabsichtlich in eine berufliche Sackgasse hineinmanövriert. Wenn ich in der Armee blieb, würde ich dort aufgrund meines fehlenden technischen Know-hows immer ein Mensch zweiter Klasse sein.
Aber wenn ich mich aus dem Militärdienst verabschiedete, was sollte ich dann mit meinem Abschluss in slawischen Sprachen und slawischer Literatur anfangen? Es gibt nicht viele freie Stellen für Übersetzer oder Fremdsprachenkorrespondenten, die Russisch sprechen. Außerdem würde ich dann mit Millionen anderen Bewerbern, die ebenfalls einen Bachelor-Abschluss hatten, um einfache Sekretärinnenjobs konkurrieren müssen. Ein Purist wäre vielleicht der Meinung gewesen, dass ich in meinem Studium und während meines Militärdienstes eine Menge gelernt hatte und daher eine viel bessere Stellung finden konnte; aber Puristen wissen nicht, wie schwierig der Arbeitsmarkt manchmal sein kann.
Zum Glück stand mir noch eine weitere – zugegebenermaßen ungewöhnliche – Option offen. Einer der großen Vorteile meines Militärdienstes bestand darin, dass mir noch G.I.-Bill-Gelderb für die Wiedereingliederung ins Berufsleben zur Verfügung standen, mit denen ich die Kosten für eine weitere Fortbildung decken konnte. Warum sollte ich mithilfe dieser finanziellen Unterstützung nicht das Unvorstellbare wagen und mich umschulen lassen? Würde ich es schaffen, mein Gehirn umzuprogrammieren, meine Mathematikphobie abzulegen und zum Mathegenie zu werden? Vom Technikfeind zum Technikfreak?
Ich hatte zwar noch nie gehört, dass jemandem so etwas gelungen war – erst recht niemandem, der eine so ausgeprägte Mathephobie hatte wie ich. Es gab nichts, was mir wesensfremder war als Naturwissenschaften. Andererseits hatten meine Kollegen beim Militär mir bewiesen, dass eine solche Umprogrammierung sich durchaus lohnte.
Ich begann, die Sache als Herausforderung zu betrachten – eine Herausforderung, der ich nicht widerstehen konnte.
Also beschloss ich, mein Gehirn umzutrainieren.
Es war nicht leicht. Die ersten Semester waren eine Achterbahnfahrt aus Angst und Frustration. Ich kam mir vor wie jemand, der sich mit verbundenen Augen durch die Welt manövrieren muss. Die meisten meiner jüngeren Mitstudenten hatten offenbar ein angeborenes Talent dafür, bei jeder Mathematikaufgabe auf Anhieb die richtige Lösung zu erkennen, während ich mir an den unbarmherzigen Mauern der Arithmetik den Kopf einrannte.
Doch irgendwann fiel auch bei mir der Groschen. Und dabei machte ich eine interessante Entdeckung: Mein Problem bestand teilweise darin, dass ich meine Energie falsch investiert hatte – ich hatte gewissermaßen versucht, ein Stück Holz hochzuheben, während ich darauf stand. Das konnte natürlich nicht funktionieren. Allmählich eignete ich mir kleine Tricks an: Ich lernte nicht nur, wie man lernt, sondern auch, wann man lieber damit aufhören soll. Ich machte die Erfahrung, dass es sehr hilfreich war, mir bestimmte Konzepte und Techniken einzuprägen. Und ich lernte auch, mich nicht zu übernehmen und mir viel Zeit zum Üben zu nehmen – selbst wenn einige meiner Studienkollegen ihren Abschluss dann vor mir schaffen würden, weil ich nicht so viele Kurse pro Semester belegte wie sie.
Allmählich lernte ich, wie man mathematische und naturwissenschaftliche Stoffe lernt. Von da an fiel mir das Studium leichter. Erstaunlicherweise ging es mir jetzt so wie vorher mit meinem Sprachstudium: Je besser ich darin wurde, umso mehr Spaß machte es mir. Und ich, die ich früher im Matheunterricht immer nur »Bahnhof« verstanden hatte, absolvierte jetzt einen Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik und später einen Magister-Abschluss in Elektrotechnik und Informatik! Schließlich promovierte ich sogar in Systemtechnik und eignete mir auf diesem Gebiet ein breites Hintergrundwissen an, das Thermodynamik, Elektromagnetik, Akustik und physikalische Chemie umfasste. Je weiter ich mit meinen Studien kam, umso besser wurde ich. Während meines Promotionsstudiums fielen mir die Einser nur so in den Schoß. (Na ja, in den Schoß vielleicht nicht gerade … Um gute Noten zu bekommen, musste ich nach wie vor etwas tun. Aber wenigstens wusste ich jetzt, was ich zu tun hatte!)
Inzwischen bin ich Professorin für Ingenieurwissenschaften und beschäftige mich damit, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Dieses Interesse ist daraus entstanden, dass die bildgebenden Untersuchungen, mit deren Hilfe wir die Funktionsweise unseres Gehirns erforschen, ohne Technik nicht möglich wären. Jetzt sehe ich viel klarer, wie und warum es mir gelingen konnte, mein Gehirn umzuprogrammieren. Und nicht nur das: Ich weiß jetzt auch, wie ich Ihnen zu effektiverem Lernen verhelfen kann – ohne die Mühsal und Frustration, die mich dabei ständig begleitet haben.1 Und als Wissenschaftlerin mit einem breiten Spektrum an Fachgebieten (Technik, Soziologie und Geisteswissenschaften) habe ich inzwischen ebenfalls erkannt, welche Kreativität nicht nur der Kunst und Literatur, sondern auch der Mathematik und anderen Naturwissenschaften innewohnt.
Wenn Sie (noch) nicht das Gefühl haben, gut in Mathematik und Naturwissenschaften zu sein, wird es Sie vielleicht überraschen, dass unser Gehirn für komplizierte Rechenvorgänge wie geschaffen ist. Solche Berechnungen führen wir schließlich jedes Mal durch, wenn wir einen Ball auffangen, uns im Rhythmus eines Songs wiegen oder unser Auto um ein Schlagloch herummanövrieren. Manchmal stellen wir komplizierte Kalkulationen an oder lösen schwierige Gleichungen, und uns ist dabei gar nicht bewusst, dass wir die Lösung, auf die wir mühsam hinarbeiten, bereits kennen.2 Denn eigentlich haben wir alle ein angeborenes Gespür und Talent für Mathematik und Naturwissenschaften. Wir brauchen uns nur den Fachjargon und die Arbeitsweisen anzueignen, die in jedem Land ein bisschen anders sind.
Während meiner Arbeit an diesem Buch stand ich mit vielen führenden Mathematik-, Physik-, Chemie-, Biologie- und Maschinenbauprofessoren sowie Experten in Pädagogik, Psychologie, Neurowissenschaften, Betriebswirtschaft und Medizin auf der ganzen Welt in Kontakt. Es verblüffte mich, wie oft diese weltbekannten Fachleute genau mit den in meinem Buch beschriebenen Methoden gearbeitet hatten, als sie sich ihre Fachkenntnisse aneigneten. Und diese Lerntechniken empfahlen sie auch ihren Studenten – doch weil diese Methoden manchmal widersinnig, ja sogar irrational zu sein scheinen, fiel es ihnen oft schwer, den Studenten deren Quintessenz zu vermitteln. Und da einige dieser Lern- und Lehrmethoden von »normalen« Lehrern nicht ernst genommen werden, war es diesen Spitzenpädagogen manchmal sogar peinlich, sie mir zu verraten; denn sie wussten nicht, dass viele andere Dozenten und Professoren von Weltrang mit ähnlichen Methoden arbeiten. Auch Sie können diese praxisorientierten Strategien, die ich teilweise von den besten Lehrern und Professoren der Welt übernommen habe, leicht erlernen und anwenden. Sie sind vor allem dann eine wertvolle Hilfe, wenn man unter Zeitdruck so intensiv und effektiv wie möglich lernen möchte. Und aus dem Erfahrungsaustausch mit Ihren Mitschülern oder -studenten werden Sie weitere hilfreiche Erkenntnisse gewinnen – denn diese Menschen verfolgen die gleichen Gedankengänge wie Sie und haben mit den gleichen Problemen und Einschränkungen zu kämpfen.
Denken Sie daran: Dieses Buch ist nicht nur für Mathematikkoryphäen, sondern auch für ausgesprochene Mathephobiker gedacht. Ich habe es geschrieben, um Ihnen das Erlernen mathematischer und naturwissenschaftlicher Kenntnisse zu erleichtern – egal, was für Zensuren Sie früher in diesen Fächern hatten und wie gut oder schlecht Sie sie zu beherrschen glauben. Ich möchte Ihnen mit meinem Buch einen Einblick in Ihre Denkprozesse ermöglichen, damit Sie verstehen, wie Ihr Gehirn lernt (oder Ihnen manchmal vielleicht auch einfach nur vorgaukelt, dass Sie etwas lernen, obwohl das in Wirklichkeit gar nicht stimmt). Das Buch enthält auch viele praktische Übungen, die Sie direkt auf Ihr Studium anwenden können. Wenn Sie bereits gut in Naturwissenschaften oder im Umgang mit Zahlen sind, werden Sie sich dank der Erkenntnisse, die Ihnen dieses Buch vermittelt, weiter darin verbessern können. Sie werden dadurch kreativer werden, Ihre Gleichungen noch eleganter lösen können – und mehr Spaß daran haben als je zuvor.
Und falls Sie felsenfest davon überzeugt sein sollten, kein Talent für Mathematik oder Naturwissenschaften zu haben, werden Sie das nach der Lektüre dieses Buches vielleicht anders sehen. Auch wenn Sie es kaum glauben können: Selbst für Sie besteht noch Hoffnung! Wenn Sie meine Tipps, die auf den neuesten Erkenntnissen der Lernforschung beruhen, beherzigen, werden Sie bald erstaunliche Veränderungen bei sich beobachten und vielleicht sogar eines Tages ganz neue Hobbys entdecken.
Auf jeden Fall werden Sie aufgrund der Entdeckungen, die Sie in diesem Buch machen, effektiver und kreativer arbeiten können – nicht nur in Mathematik und Naturwissenschaften, sondern bei fast allem, womit Sie sich beschäftigen.
Also – worauf warten Sie noch? Packen Sie es an!
2
Immer mit der Ruhe
Zu krampfhaftes Bemühen bringt Sie nicht weiter
Möchten Sie erfahren, wie man ein Ass in Mathematik und Naturwissenschaften wird? Dann schauen Sie sich einmal das folgende Foto an:
Der 13-jährige Magnus Carlsen (links) und das legendäre Schachgenie Garry Kasparow spielen beim »Reykjavik Rapid« im Jahr 2004 Blitzschach. In Kasparows Gesichtszügen malt sich das beginnende Entsetzen.
Der Mann auf der rechten Seite ist der legendäre Schachgroßmeister Garry Kasparow. Der Junge links neben dem Schachbrett ist der 13-jährige Magnus Carlsen. Soeben ist Carlsen im spannendsten Augenblick einer Blitzschachpartie (bei der man nicht viel Zeit hat, über seine Züge oder Strategien nachzudenken) aufgestanden und hat sich ein paar Schritte vom Schachbrett entfernt. Bei so einer Partie einfach wegzugehen ist ungefähr so, wie wenn man auf einem Drahtseil über die Niagarafälle balanciert und dabei plötzlich aus heiterem Himmel einen Rückwärtssalto vollführt.
Natürlich wollte Carlsen seinen Gegner mit diesem Verhalten nervös machen. Statt den jungen Stern am Schachhimmel mit ein paar wohlüberlegten Zügen auszutricksen, spielte der konsternierte Kasparow lieber auf Unentschieden. Aber Carlsen – eines der jüngsten Schachgenies der Geschichte – hatte seinen älteren Gegner nicht einfach nur mit Psychospielchen verunsichert. Wenn wir Carlsens Vorgehensweise analysieren, verstehen wir, was sich bei der Beschäftigung mit Mathematik und Naturwissenschaften in unserem Gehirn abspielt. Ehe wir näher darauf eingehen, wie es Carlsen damals gelungen ist, Kasparow psychisch fertigzumachen, muss ich Ihnen erst einmal ein paar wichtige Erkenntnisse über das menschliche Denken vermitteln. (Aber wir kommen noch auf Carlsen zurück, das verspreche ich Ihnen!)
In diesem Kapitel werden bereits einige der wichtigsten Themen meines Buches anklingen; also wundern Sie sich nicht, wenn Sie in Gedanken ein bisschen hinund herspringen müssen, um mir folgen zu können. Solche Gedankensprünge (sich zunächst einen Überblick über einen Lernstoff zu verschaffen und erst dann tiefer in die Materie einzusteigen) gehören übrigens ebenfalls zu den Lernmethoden, die ich Ihnen in diesem Buch vermitteln möchte!
UND JETZT SIND SIE DRAN!
Bringen Sie Ihr Gehirn auf Trab
Wenn Sie ein Kapitel oder einen Abschnitt in einem Buch aufschlagen, in dem es um mathematische oder naturwissenschaftliche Konzepte geht, sollten Sie dieses Kapitel erst einmal »überfliegen«: Schauen Sie sich nicht nur die Grafiken, Diagramme und Fotos an, sondern auch die Zwischenüberschriften, die Zusammenfassung und die Fragen zur Wissensüberprüfung am Ende des Kapitels (falls das Buch solche Fragen enthält). Vielleicht wird Ihnen das auf den ersten Blick widersinnig erscheinen (schließlich haben Sie das Kapitel ja noch gar nicht gelesen); doch dadurch stimmen Sie Ihr Gehirn auf den kommenden Lernstoff ein. Fangen Sie gleich jetzt damit an: Blättern Sie dieses Kapitel durch und werfen Sie einen Blick auf die Verständnisfragen am Kapitelende!
Sie werden staunen, wie hilfreich es ist, Ihren Stoff erst mal ein bis zwei Minuten lang durchzusehen, bevor Sie ihn gründlich durchlesen: Auf diese Weise können Sie Ihre Gedanken später viel besser ordnen. Sie schlagen gewissermaßen kleine neuronale Haken in die Wand, an denen Sie Ihre Gedanken aufhängen können. So kann man die Ideen und Konzepte leichter erfassen.
Fokussiertes versus diffuses Denken
Seit Anfang des 21. Jahrhunderts machen die Neurowissenschaftler enorme Fortschritte beim Verständnis der beiden verschiedenen neuronalen Netzwerke, zwischen denen unser Gehirn hin- und herschaltet: Zuständen hoher Aufmerksamkeit und einem entspannteren Ruhezustand.1 Wir wollen die Denkprozesse, die mit diesen zwei verschiedenen Netzwerken assoziiert sind, hier als fokussierten Denkmodus und diffusen Denkmodus bezeichnen. Diese beiden Modi spielen beim Lernen eine wichtige Rolle.2 Während Ihrer Alltagsaktivitäten springen Sie häufig zwischen diesen zwei Denkmodi hin und her. Dabei befinden Sie sich entweder im einen oder im anderen Modus, aber niemals bewusst gleichzeitig in beiden Modi. Offenbar kann der diffuse Denkmodus im Hintergrund in aller Ruhe an irgendetwas arbeiten, auch wenn Sie sich gerade nicht bewusst darauf konzentrieren.3 Manchmal springen Sie auch nur für einen ganz kurzen Moment in diesen diffusen Modus.
Das fokussierte Denken spielt für das Studium von Mathematik und Naturwissenschaften eine sehr wichtige Rolle, denn es geht Probleme direkt an, und zwar mit rationalen, analytischen und sequenziellen Methoden. Der fokussierte Denkmodus basiert auf dem Konzentrationsvermögen des präfrontalen Kortex, einer Hirnregion, die direkt hinter der Stirn liegt.4 Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Gegenstand richten, schaltet sich Ihr fokussierter Denkmodus schlagartig ein, wie die hellen, gebündelten Strahlen einer Taschenlampe.
Der präfrontale Kortex liegt direkt hinter der Stirn.
Aber auch diffuses Denken ist für das mathematische und naturwissenschaftliche Lernen wichtig. Denn im diffusen Denkmodus kommt uns manchmal ganz plötzlich eine neue Einsicht in ein Problem, mit dem wir uns schon seit Längerem herumschlagen. Dieser Denkmodus versetzt uns in eine Art Vogelperspektive, in der wir die größeren Zusammenhänge erkennen können. In den diffusen Denkmodus gerät man ganz automatisch, wenn man sich geistig entspannt und seine Gedanken einfach ziellos umherschweifen lässt. In diesem Zustand der Entspannung können sich verschiedene Hirnregionen miteinander verschalten und Ihnen wertvolle Erkenntnisse liefern. Im Gegensatz zum fokussierten Denkmodus scheint der diffuse Modus weniger mit einer bestimmten Hirnregion assoziiert zu sein; man muss sich das eher so vorstellen, dass er auf diffuse Weise über das ganze Gehirn verteilt ist.5 Oft entspringen die Erkenntnisse, die wir in diesem diffusen Modus gewinnen, vorherigen Denkprozessen im fokussierten Modus. (Schließlich kann man Ziegelsteine nur mit Lehm zusammenfügen; genauso funktioniert die Zusammenarbeit zwischen diffusem und fokussiertem Denkmodus!)
Lernprozesse entstehen aus einem komplexen Zusammenspiel verschiedener Hirnregionen, die abwechselnd »feuern«; dabei findet ein reger Informationsaustausch zwischen linker und rechter Gehirnhälfte statt.6 Wir schalten beim Denken und Lernen also nicht einfach zwischen fokussiertem und diffusem Modus hin und her; in Wirklichkeit ist dieser Prozess sehr viel komplizierter. Aber zum Glück brauchen wir uns nicht intensiver mit diesen physischen Mechanismen zu beschäftigen. Wir werden das Thema in diesem Buch aus einer ganz anderen Perspektive betrachten.
Der fokussierte Denkmodus – ein Flipperautomat mit vielen Bumpern
Um besser verstehen zu können, wie fokussierte und diffuse Denkprozesse ablaufen, wollen wir nun zur Abwechslung mal ein bisschen flippern. (Metaphern sind eine wertvolle Lernhilfe; damit kann man sich mathematische und naturwissenschaftliche Zusammenhänge wunderbar veranschaulichen!) Bei alten Flipperautomaten zieht man einen federbetriebenen Plunger zurück; dieser trifft auf eine Kugel, die dann auf den Flippertisch schießt und aufs Geratewohl von verschiedenen runden Gummibumpern abprallt, wie in der rechtsstehenden Abbildung gezeigt.
Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf ein Problem richten, zieht Ihr Gehirn den mentalen Plunger zurück und setzt einen Gedanken in Gang. Dieser Gedanke saust los und schießt wie die Flipperkugel in dem auf Seite 32 links abgebildeten Gehirn hin und her. Das ist der fokussierte Denkmodus.
Sehen Sie, dass die runden Gummibumper bei diesem fokussierten Modus sehr dicht beieinanderstehen? Dagegen sind die Bumper beim diffusen Denkmodus auf der rechten Seite der Abbildung weiter voneinander entfernt. (Wenn Sie diese Metapher noch weiter ausschmücken möchten, können Sie sich vorstellen, dass jeder dieser Bumper ein Neuronencluster ist.)
Die vielen dicht beieinanderstehenden Bumper im fokussierten Denkmodus erleichtern Ihnen das präzise Denken. Im Grunde konzentrieren Sie sich in diesem Modus auf einen Gegenstand, der im Nervengeflecht Ihres Gehirns bereits dicht verschaltet ist. Oft liegt das daran, dass Ihnen die Ideen und Konzepte, die diesem Thema zugrunde liegen, bereits vertraut sind. Wenn Sie sich den oberen Bereich des fokussierten Denkmusters genauer anschauen, sehen Sie, dass ein Teil der eingezeichneten Linie breiter ist – so wie ein ausgetretener Pfad. Diese breitere Linie zeigt, dass der fokussierte Gedanke hier einem Denkpfad folgt, mit dem Sie schon Erfahrungen gesammelt oder den Sie bereits eingeübt haben.
Glücklicher Zombie beim neuronalen Flipperspiel
Zum Beispiel kann man mithilfe des fokussierten Denkmodus Zahlen multiplizieren – aber nur dann, wenn man den Rechenvorgang der Multiplikation bereits beherrscht. Beim Erlernen einer Fremdsprache können Sie den fokussierten Modus dazu nutzen, die spanische Verbenkonjugation, die Sie letzte Woche gelernt haben, so lange einzuüben, bis sie Ihnen leicht von der Hand geht. Schwimmer können mithilfe des fokussierten Denkmodus beispielsweise ihren Brustschwimmstil analysieren, während sie üben, mit dem Oberkörper tief im Wasser zu bleiben, um auf diese Weise möglichst viel Kraft in die Vorwärtsbewegung ihrer Arme zu legen.
Beim Flipperautomaten trifft ein federbetriebener Plunger auf eine Kugel (die für einen Gedanken steht). Diese Kugel schießt dann auf den Flippertisch und prallt nach dem Zufallsprinzip von mehreren in Reihen angeordneten Gummibumpern ab. Die beiden Flipperautomaten in dieser Abbildung repräsentieren den fokussierten (links) und den diffusen (rechts) Denkmodus. Im fokussierten Modus konzentrieren wir uns intensiv auf ein bestimmtes Problem oder Konzept. Allerdings versuchen wir in diesem Modus manchmal irrtümlicherweise, ein Problem oder eine Aufgabe mit falschen Gedankengängen zu lösen, die sich in einer anderen Gehirnregion befinden als jene Ideen, die wir für die Lösung des Problems eigentlich brauchen würden.
Verfolgen Sie zum Beispiel einmal den oberen »Gedankengang«, an dem Ihre Flipperkugel im linken Bild zunächst entlangsaust. Diese Linie ist sehr weit von dem unteren Denkmuster im selben Gehirn entfernt und steht überhaupt nicht damit in Verbindung. Wie Sie sehen, folgt der obere Gedanke streckenweise einem breiten, ausgetretenen Weg. Das liegt daran, dass Sie vorher bereits ähnliche Gedanken hatten. Der untere Gedanke dagegen ist neu – ihm liegt kein breiter, ausgetretener Gedankenpfad zugrunde.
Im diffusen Denkmuster auf der rechten Seite können Sie die Dinge aus der Vogelperspektive betrachten. Dieser Denkmodus ist vor allem dann hilfreich, wenn man etwas Neues lernen will. Wie Sie sehen, erlaubt dieser Modus es Ihnen nicht, sich intensiv auf die Lösung eines bestimmten Problems zu konzentrieren. Trotzdem können Sie der Lösung damit näher kommen, weil die »Flipperkugel« Ihres Gedankens einen viel weiteren Weg zurücklegt, ehe sie gegen den nächsten Bumper prallt.
Immer wenn Sie sich auf etwas konzentrieren, sendet der für Ihr Bewusstsein und Ihre Aufmerksamkeitsregulation zuständige präfrontale Kortex automatisch Signale an Nervenbahnen entlang. Diese Signale verschalten verschiedene Hirnregionen, die etwas mit dem Gegenstand Ihrer Konzentration zu tun haben, miteinander. Dieser Prozess erinnert ein bisschen an einen Oktopus, der seine Tentakel in verschiedene Richtungen ausstreckt, um seine Umgebung zu erkunden und sich an allem, womit sie in Berührung kommen, festzusaugen. Jeder Oktopus hat nur eine bestimmte Anzahl Tentakel, mit denen er mit seiner Umwelt in Kontakt treten kann. Ebenso kann sich auch unser Arbeitsgedächtnis nur eine bestimmte Anzahl von Inhalten gleichzeitig merken. (Auf das Thema Arbeitsgedächtnis werden wir später noch näher eingehen.)
Oft »trichtern« Sie Ihrem Gehirn eine Aufgabe zunächst einmal ein, indem Sie sich auf einen Text konzentrieren – also beispielsweise ein Kapitel in einem Lehrbuch lesen oder die Notizen, die Sie sich während einer Vorlesung gemacht haben, noch einmal durchschauen. Daraufhin aktiviert der Oktopus Ihrer Aufmerksamkeit den fokussierten Denkmodus. Während Sie sich mit dieser Aufgabe beschäftigen, denken Sie konzentriert darüber nach und nutzen dabei die dicht beieinanderstehenden Flipperkugeln: Das heißt, Ihre Gedanken bewegen sich an Nervenbahnen entlang, die Ihnen bereits vertraut sind – sie befassen sich mit Dingen, die Sie schon kennen. Durch diese fest in Ihrem Gehirn verankerten Bahnen sausen Ihre Gedanken mit schlafwandlerischer Leichtigkeit hindurch und finden schnell eine Lösung. Doch in Mathematik und Naturwissenschaften kann eine Aufgabe schon durch eine winzig kleine Veränderung ganz andere Dimensionen annehmen. Dann wird die Lösung der Aufgabe schwieriger.
Warum Mathe und Naturwissenschaften oft schwieriger sind als andere Fächer
Das fokussierte Problemlösen in Mathematik oder anderen naturwissenschaftlichen Fächern ist häufig anstrengender als das fokussierte Nachdenken über Sprache oder Menschen.7 Vielleicht liegt das daran, dass die Menschen im Lauf ihrer jahrtausendelangen Evolution nicht mit mathematischen Ideen herumjonglieren mussten, die oft sehr viel abstrakter und verschlüsselter sind als die in unserer normalen Sprache formulierten Ideen.8 Natürlich können wir uns trotzdem mit mathematischen oder naturwissenschaftlichen Themen beschäftigen; nur machen die Abstraktion und Verschlüsselung diese Materie um einiges komplexer.
Was meine ich mit Abstraktion? Ganz einfach: Sie können auf eine im realen Leben existierende Kuh auf einer Weide zeigen und dieses Tier mit den Buchstaben K-u-h gleichsetzen, die auf dieser Seite stehen. Aber Sie können nicht auf ein im realen Leben existierendes Pluszeichen zeigen, dem das Symbol »+« entspricht – denn die dem Pluszeichen zugrunde liegende Vorstellung ist etwas Abstraktes. Mit Verschlüsselung meine ich, dass ein Zeichen oder Symbol für mehrere verschiedene Rechenvorgänge oder Ideen stehen kann, so wie das Multiplikationszeichen eine wiederholte Addition symbolisiert. Oder um auf unsere Analogie mit dem Flipperautomaten zurückzukommen: Durch die Abstraktion und Verschlüsselung der Mathematik werden die Bumper ein bisschen schwammiger – man braucht viel Übung, um sie zu härten und die Flipperkugel unserer Gedanken richtig davon abprallen zu lassen. Deshalb ist es in naturwissenschaftlichen Fächern besonders wichtig, unsere Neigung zur Aufschieberei (die uns beim Erlernen aller Fächer beeinträchtigt) in den Griff zu bekommen. Auch darauf werden wir später noch ausführlich zu sprechen kommen.
Zu diesen Problemen, die uns beim Studium naturwissenschaftlicher Fächer im Weg stehen, kommt noch eine weitere Schwierigkeit hinzu: der Einstellungseffekt. Dieser Effekt ist schuld daran, dass eine Idee, die Sie bereits im Kopf haben (oder Ihr allererster Gedanke zu einer Aufgabe oder einem Problem), Sie davon abhält, eine bessere Idee oder Lösung zu finden.9 Das haben wir bei dem fokussierten Flipperautomatenbild auf der linken Seite gesehen, bei dem der erste Flipperkugelgedanke in die obere Hirnregion wanderte, obwohl sich das für die Lösung geeignete Denkmuster im unteren Bildteil befand. Beim Einstellungseffekt blockiert unser erster Eindruck uns also gewissermaßen in unserem Denken.
Auf diese falsche Fährte geraten wir bei der Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Fächern besonders leicht, weil unsere erste intuitive Erkenntnis dabei manchmal falsch ist. Diese falschen alten Ideen müssen wir also erst einmal verlernen und uns neue Denkweisen aneignen.10
Über diesen Einstellungseffekt stolpern Schüler und Studenten sehr häufig. Das liegt nicht nur daran, dass unsere naturgegebenen Intuitionen uns auf diesem Gebiet manchmal in die Irre führen. Oft weiß man in naturwissenschaftlichen Fächern auch gar nicht so recht, wo man anfangen soll – zum Beispiel bei einer Mathematikaufgabe, die Sie als Hausarbeit bekommen haben: Verzweifelt quälen Sie sich damit herum und sind dabei oft weit von der richtigen Lösung entfernt. Warum? Weil die dicht beieinanderstehenden Bumper des fokussierten Denkens Sie von dem rettenden Gedankensprung in eine neue Hirnregion abhalten, in der möglicherweise die Lösung des Problems liegt.
Viele Studenten machen bei der Beschäftigung mit Mathematik und Naturwissenschaften einen großen Fehler: Sie springen sofort ins kalte Wasser, statt erst einmal schwimmen zu lernen.11 Mit anderen Worten: Sie stürzen sich blind auf ihre Hausaufgaben, ohne erst mal das Lehrbuch zur Hand zu nehmen, Vorlesungen zu hören, sich Onlinelektionen anzuschauen oder wenigstens mit jemandem zu reden, der sich auf diesem Gebiet auskennt. Damit ist der Misserfolg vorprogrammiert. Es ist, als lasse man seine Gedanken einfach ziellos im Flipperautomaten des fokussierten Denkens herumspringen, ohne darüber nachzudenken, wo die richtige Lösung liegen könnte.
Es ist also wichtig zu wissen, wie man richtige Lösungen findet – nicht nur bei mathematischen und naturwissenschaftlichen Aufgaben, sondern ganz allgemein im Leben. So können ein paar Recherchen, ein bisschen kritische Selbsterkenntnis, vielleicht sogar ein paar Selbstversuche Sie beispielsweise davor schützen, Ihr Geld (oder Ihre Gesundheit) einzubüßen, indem Sie Produkten vertrauen, die Ihnen mit vermeintlich »wissenschaftlichen« Heilungsversprechen angepriesen werden.12 Und ein paar mathematische Kenntnisse bewahren Sie womöglich davor, eines Tages Ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen zu können – eine Situation, die sich sehr negativ auf Ihr Leben auswirken kann.13
Der diffuse Denkmodus – ein Flipperautomat mit wenigen Bumpern
Denken Sie zurück an die Abbildung des Flipperautomaten, der den diffusen Denkmodus symbolisiert und bei dem die Bumper weit auseinanderliegen! In diesem Modus sieht man die Welt aus der Vogelperspektive. Sehen Sie, wie viel weiter ein Gedanke in diesem Modus wandern kann, ehe er auf einen Bumper trifft? Die Verbindungen liegen weiter auseinander – das heißt, Sie können blitzschnell von einem Gedankenkomplex zum anderen sausen, auch wenn dieser in weiter Ferne liegt. (Andererseits ist es in diesem Modus schwierig, präzise zu denken oder komplexe Gedankengänge zu verfolgen.)
Wenn Sie versuchen, ein neues Konzept zu verstehen oder eine neue Aufgabe zu lösen, gibt es noch keine neuronalen Muster, die Ihre Gedanken in die richtige Richtung lenken – keinen ausgetretenen Denkpfad, an dem Sie sich orientieren können. Vielleicht müssen Ihre Gedanken erst einmal weit umherschweifen, um eine mögliche Lösung zu finden. Dafür ist der diffuse Denkmodus genau richtig!
Sie können sich den Unterschied zwischen fokussiertem und diffusem Denken auch anhand einer Taschenlampe veranschaulichen. Diese Lampe kann man so einstellen, dass ein fokussierter Lichtstrahl tief in einen kleinen Bereich eindringt und ihn erhellt. Oder man kann sie diffuser einstellen, sodass sie einen breiten, aber dafür weniger hellen Lichtkegel wirft.
Wenn Sie versuchen, etwas Neues zu verstehen oder herauszufinden, müssen Sie Ihr präzisionsfokussiertes Denken ausschalten und sich in die diffuse »Vogelperspektive« versetzen – und zwar so lange, bis Sie eine neue, sinnvollere Vorgehensweise entdeckt haben. Wie wir gleich sehen werden, hat der diffuse Denkmodus seinen eigenen Kopf – man kann ihn nicht einfach an- und ausschalten wie eine Taschenlampe. Doch ich werde Ihnen gleich ein paar Tricks verraten, mit deren Hilfe Sie zwischen den beiden Denkmodi hin- und herwechseln können.
KREATIVITÄT ERFORDERT »ZIELLOSES« DENKEN
»Als ich erfuhr, dass es einen diffusen Denkmodus gibt, fiel mir auf, dass diese Denkweise in meinem täglichen Leben tatsächlich eine wichtige Rolle spielte. Zum Beispiel fielen mir meine besten Gitarrenriffs immer dann ein, wenn ich ›einfach nur ein bisschen auf meiner Gitarre herumzupfte‹, und nicht, wenn ich mich hinsetzte, um ein musikalisches Meisterwerk zu schaffen. (Dann brachte ich immer nur einfallslose, klischeehafte Songs zustande). Ähnlich ging es mir, wenn ich ein Referat schrieb, mir eine Idee für ein Schulprojekt überlegte oder eine schwierige Matheaufgabe zu lösen versuchte. Inzwischen halte ich mich an folgende Faustregel: Je krampfhafter man versucht, sich etwas Kreatives einfallen zu lassen, umso weniger kreativ sind die Ideen, die am Ende dabei herauskommen. Bisher habe ich noch keine einzige Situation erlebt, in der sich dieser Grundsatz nicht bewahrheitet hätte. Letzten Endes bedeutet dies, dass Entspannung ein wichtiger Bestandteil harter – und guter – Arbeit ist.«
Shaun Wassell, Informatikstudent im ersten Studienjahr
Warum gibt es zwei verschiedene Denkmodi?
Wozu haben wir diese beiden verschiedenen Denkmodi überhaupt? Möglicherweise hängt das mit zwei wichtigen Problemen zusammen, die Wirbeltiere im Lauf der Evolution lösen mussten, um zu überleben und ihre Gene an ihre Nachkommen weiterzugeben. Ein Vogel muss sich beispielsweise scharf konzentrieren, um kleine Körner vom Boden aufzupicken; doch gleichzeitig muss er den Horizont auch immer wieder nach Raubvögeln wie Falken oder Mäusebussarden absuchen. Wie kann er diese beiden verschiedenen Aufgaben am besten bewältigen? Natürlich durch Arbeitsteilung: indem sich die eine Gehirnhälfte stärker auf die fokussierte Aufmerksamkeit spezialisiert, die notwendig ist, um Futter aufzupicken, während die andere eher darauf ausgerichtet ist, den Horizont nach Gefahrenquellen abzusuchen. Wenn jede Hirnhemisphäre auf einen bestimmten Wahrnehmungsmodus spezialisiert ist, so kann das die Überlebenschancen erhöhen.14 Wenn Sie Vögel beobachten, werden Sie tatsächlich feststellen, dass diese Tierchen abwechselnd picken und mit ihren Augen den Horizont absuchen – als wechselten sie ständig zwischen fokussiertem und diffusem Denkmodus hin und her.
Beim Menschen gibt es eine ähnliche Arbeitsteilung: Die linke Gehirnhälfte ist eher auf gewissenhafte, fokussierte Aufmerksamkeit ausgerichtet. Außerdem scheint sie auch stärker auf logisches Denken und auf die Verarbeitung sequenzieller Informationen spezialisiert zu sein – Schritt eins führt zu Schritt zwei und so weiter. Die rechte Hirnhemisphäre scheint dagegen eher auf ein diffuses Abscannen unserer Umgebung, auf Interaktionen mit anderen Menschen und die Verarbeitung von Emotionen hin orientiert zu sein.15 Außerdem kann sie mehrere Wahrnehmungen gleichzeitig verarbeiten und größere Zusammenhänge erkennen.16
Dieses einfache Beispiel vermittelt Ihnen eine gute Vorstellung vom Unterschied zwischen fokussiertem und diffusem Denken. Angenommen, Sie sollen zwei Dreiecke zu einem Quadrat zusammensetzen. Wie Sie auf der linken Seite sehen, ist das eine ganz einfache Aufgabe. Wenn man Ihnen aber noch zwei weitere Dreiecke gibt und Sie auffordert, daraus ein Quadrat zu machen, verleitet Ihr allererster (falscher) Denkimpuls Sie dazu, die vier Dreiecke zu einem Rechteck zusammenzusetzen (siehe Abbildung in der Mitte). Das liegt daran, dass Sie inzwischen bereits ein fokussiertes Denkmuster gebildet haben und dazu neigen, sich weiterhin an diesem Muster zu orientieren. Es erfordert schon einen intuitiven, diffusen Gedankensprung, um zu erkennen, dass Sie die vier Dreiecke ganz neu anordnen müssen, um daraus ein Quadrat zu bilden (siehe Abbildung rechts).17
Diese Unterschiede in der Funktion der beiden Gehirnhälften vermitteln uns eine Vorstellung davon, warum zwei verschiedene mentale Verarbeitungsmodi entstanden sein könnten. Aber hüten Sie sich vor der Vorstellung, dass manche Menschen »linkshirnig« und andere »rechtshirnig« denken – wissenschaftliche Untersuchungen zeigen nämlich, dass das schlicht und einfach falsch ist!18 Inzwischen weiß man, dass beide Gehirnhälften am fokussierten und am diffusen Denken beteiligt sind. Um sich mathematische und naturwissenschaftliche Kenntnisse anzueignen und in diesen Fächern kreativ zu sein, muss man also sowohl seinen fokussierten als auch seinen diffusen Denkmodus stärken und regelmäßig nutzen.19
Untersuchungen zeigen, dass man sich, um bei der Lösung einer schwierigen Aufgabe weiterzukommen, erst einmal in den fokussierten Denkmodus versetzen und fleißig und konzentriert an der Aufgabe arbeiten muss. (Das haben wir schließlich schon in der Grundschule gelernt!) Aber das Interessante an der Sache ist: Oft spielt auch der diffuse Denkmodus beim Problemlösungsprozess eine maßgebliche Rolle, vor allem bei schwierigen Aufgaben. Doch solange wir uns bewusst auf ein Problem fokussieren, blockieren wir diesen Denkmodus.
Beim Tischtennis kann nur dann jemand gewinnen, wenn der Ball hin- und herfliegt.
ES LEBE DIE VERWIRRUNG!
»Nicht weiterzuwissen ist ein ganz normaler Bestandteil des Lernprozesses. Wenn ein Student nicht weiß, wie er an eine Aufgabe herangehen soll, kommt er häufig zu dem Schluss, dass er eben einfach nicht gut in diesem Fach ist. Vor allem intelligentere Studenten haben dieses Problem: Da sie ihr Abitur mit spielender Leichtigkeit geschafft haben, gibt es für sie keinen Grund zu glauben, dass dieses Nicht-weiter-Wissen etwas völlig Normales und Notwendiges ist. Aber beim Lernen tut man im Grunde nichts anderes, als sich durch Fragen und Probleme, die einen verwirren, hindurchzuarbeiten und einen Ausweg daraus zu finden. Wer seine Frage präzise und richtig formuliert, hat den Kampf schon zu 80 % gewonnen. Sobald Sie herausfinden, was Sie verwirrt, haben Sie sich die Frage wahrscheinlich schon selbst beantwortet!«
Kenneth R. Leopold, Distinguished Teaching Professor, Fakultät für Chemie, University of Minnesota
Problemlösung – egal, auf welchem Gebiet – erfordert häufig einen Wechsel zwischen völlig unterschiedlichen Denkweisen. Der eine Denkmodus verarbeitet die Informationen, die er erhält, und sendet die Ergebnisse dann an den anderen Modus zurück. Dieses Hin- und Herjonglieren von Informationen, während unser Gehirn auf eine bewusste Lösung hinarbeitet, spielt für das Verständnis aller Konzepte und die Lösung sämtlicher Aufgaben und Probleme eine wichtige Rolle – es sei denn, es handelt sich dabei um sehr banale Dinge.20 Die Ideen, die ich Ihnen hier vermittle, können Ihnen das Verständnis dafür, wie Lernprozesse in Mathematik und Naturwissenschaften ablaufen, sehr erleichtern. Doch wie Sie inzwischen wahrscheinlich bereits selbst ahnen, werden sie Ihnen auch in vielen anderen Fächern weiterhelfen – beispielsweise für Fremdsprachen, Musik oder beim kreativen Schreiben.
UND JETZT SIND SIE DRAN!
Wechsel von einem Denkmodus zum anderen
Hier kommt eine Denkaufgabe, die Ihnen den Wechsel vom fokussierten zum diffusen Denkmodus bewusst machen soll. Können Sie aus dem abgebildeten Dreieck ein neues Dreieck bilden, dessen Spitze nach unten zeigt, ohne dabei mehr als drei Münzen zu verschieben?
Wenn Sie sich geistig entspannen und Ihre Aufmerksamkeit frei umherschweifen lassen, ohne sich auf irgendetwas Bestimmtes zu konzentrieren, wird Ihnen die Lösung vielleicht am ehesten einfallen.
Manche Kinder können diese Aufgabe auf Anhieb lösen, während hochintelligente Professoren sich ewig damit abquälen und irgendwann aufgeben. Die Lösung wird Ihnen also leichter fallen, wenn Sie Ihr »inneres Kind« zum Leben erwecken. Übrigens: Die Lösung für diese und alle anderen »Und jetzt sind Sie dran!«-Aufgaben in meinem Buch finden Sie in den Fußnoten.21
Ein paar Worte zum Thema Aufschieberei
Viele Menschen neigen dazu, unangenehme oder schwierige Aufgaben auf die lange Bank zu schieben. An späterer Stelle werde ich noch ausführlich darauf eingehen, wie man dieses Problem in den Griff bekommt. Vorläufig brauchen Sie sich nur eines zu merken: Wenn Sie irgendetwas vor sich herschieben, können Sie in der Zwischenzeit nur oberflächliche fokussierte Denkprozesse ausführen. Außerdem erhöht sich dadurch Ihr Stressniveau, weil Sie wissen, dass Ihnen etwas Unangenehmes bevorsteht. Unter solchen Umständen erzeugt Ihr Gehirn lediglich schwache, fragmentierte neuronale Muster, die sich schnell wieder auflösen – kein gutes Fundament für die Lösung einer schwierigen Aufgabe. Vor allem bei der Beschäftigung mit Mathematik und Naturwissenschaften können dadurch gravierende Probleme entstehen. Wenn Sie sich erst in allerletzter Minute das Wissen für eine Prüfung einpauken oder Ihre Hausaufgaben schnell und flüchtig erledigen, kann keiner der beiden Lernmodi Ihnen bei der Erfassung schwierigerer Konzepte und Probleme helfen oder Gedankenverbindungen innerhalb des Lernstoffs herstellen, weil die Zeit dafür einfach zu kurz ist.
UND JETZT SIND SIE DRAN!
Kurze, intensive Konzentrationsphasen
Wenn Sie sich öfter dabei ertappen, dass Sie unangenehme oder schwierige Dinge auf die lange Bank schieben (und glauben Sie mir: Sie sind nicht der oder die Einzige …), möchte ich Ihnen einen Tipp geben: Stellen Sie Ihr Telefon ab und sorgen Sie dafür, dass kein Geräusch und nichts, was Sie sehen (auch keine Webseite), Sie ablenken kann. Dann stellen Sie einen Wecker oder eine Küchenuhr auf 25 Minuten und konzentrieren sich während dieser Zeit auf irgendeine Aufgabe. Machen Sie sich keine Gedanken darüber, ob Sie die Aufgabe in dieser Zeit fertigstellen können; konzentrieren Sie sich einfach nur auf die Arbeit daran. Sobald die 25 Minuten vorüber sind, gönnen Sie sich eine Belohnung: Surfen Sie im Internet, schauen Sie nach, ob in der Zwischenzeit Anrufe oder SMS gekommen sind, oder beschäftigen Sie sich mit irgendetwas anderem, wozu Sie gerade Lust haben. Diese Belohnung ist genauso wichtig wie die Arbeit selbst. Sie werden staunen, wie produktiv man in einer konzentrierten Arbeitsphase von 25 Minuten sein kann – vor allem wenn man sein Augenmerk auf die Arbeit selbst richtet und nicht darauf, damit fertig zu werden! (Auf diese unter dem Namen »Pomodoro-Technik« bekannte Methode werde ich in Kapitel 6 noch näher eingehen.)
Wenn Sie eine fortgeschrittenere Variante dieser Methode anwenden möchten, stellen Sie sich vor, wie Sie am Abend über die eine wichtigste Aufgabe nachdenken, die Sie an diesem Tag erledigt haben. Was wäre das wohl für eine Aufgabe? Halten Sie sie schriftlich fest. Und dann arbeiten Sie daran. Versuchen Sie, an diesem Tag mindestens drei der oben beschriebenen 25-Minuten-Arbeitsphasen zu absolvieren, und widmen Sie sich dabei der Aufgabe oder den Aufgaben, die Sie für am wichtigsten halten.
Schauen Sie sich am Ende dieses Arbeitstages an, was Sie alles von Ihrer Erledigungsliste abhaken konnten, und genießen Sie das Gefühl, etwas geleistet zu haben. Dann schreiben Sie sich ein paar wichtige Aufgaben auf, an denen Sie morgen arbeiten möchten. Dank dieser Vorbereitung kann Ihr diffuser Denkmodus jetzt schon anfangen, darüber nachzudenken, wie Sie diese Arbeiten am nächsten Tag am besten angehen sollten.
ZUSAMMENFASSUNG
• Unser Gehirn arbeitet mit zwei sehr verschiedenen Denkprozessen: dem fokussierten und dem diffusen Denkmodus. Es scheint immer wieder zwischen diesen beiden Denkmodi hin- und herzuspringen und entweder im einen oder im anderen Modus zu arbeiten.
• Es ist völlig normal, neue Konzepte oder Aufgaben verwirrend zu finden, wenn man sich zum ersten Mal mit ihnen beschäftigt.
• Beim Erfassen neuer Ideen oder Lösen neuer Aufgaben kommt es nicht nur auf die anfängliche Konzentration an, sondern auch darauf, unsere Aufmerksamkeit anschließend wieder von dem Stoff abzuwenden, den wir erlernen möchten.
• Der Einstellungseffekt bewirkt, dass wir bei der Lösung einer Aufgabe oder beim Verständnis eines Konzepts nicht weiterkommen, weil wir uns zu stark auf eine falsche Vorgehensweise fixieren. Durch den Wechsel zwischen fokussiertem und diffusem Denkmodus können Sie diesen störenden Effekt überwinden. Also denken Sie daran, in Ihrem Denken stets flexibel zu bleiben! Vielleicht müssen Sie von einem Modus zum anderen umschalten, um eine Aufgabe zu lösen oder ein Konzept zu verstehen. Ihre ersten Ideen zur Lösung einer Aufgabe können manchmal sehr irreführend sein.
PAUSE UND REKAPITULATION
Und nun schließen Sie dieses Buch und schauen Sie woandershin. Können Sie sich noch an die Hauptideen in diesem Kapitel erinnern? Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie nur wenig davon im Gedächtnis behalten haben – schließlich ist dies das erste Mal. Wenn Sie diese Technik weiter praktizieren, werden Sie bald Veränderungen in Ihrer Art zu lesen und Verbesserungen Ihres Erinnerungsvermögens feststellen.
VERTIEFEN SIE DAS GELERNTE
1. Woran erkennen Sie, ob Sie sich im diffusen Denkmodus befinden? Wie fühlt sich dieser Modus an?
2.