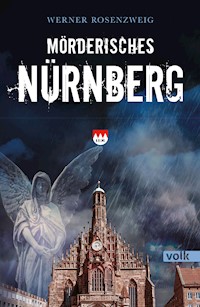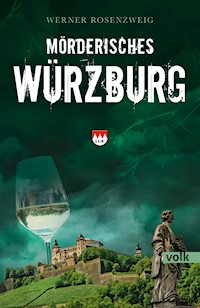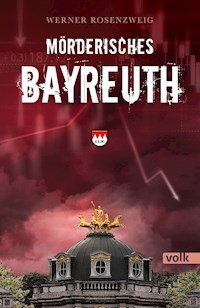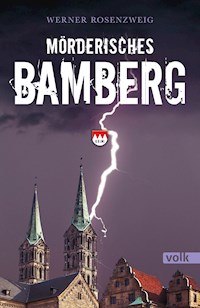Karpfen, Glees und Gift im Bauch. Erschder Röttenbacher Griminalroman – Frängisch gred, dengd und gmachd E-Book
Werner Rosenzweig
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Das kleine, mittelfränkische Dorf Röttenbach feiert die Einweihung seines neuen Lebensmittel-Frischemarktes. Doch plötzlich ist nichts mehr, wie es einmal war: Der zwielichtige Filialleiter handelt mit verbotenen Fluorchlorkohlenwasserstoffen. Dann sucht auch noch die Tschechen-Mafia das Dorf heim! Kurz darauf wird eine, in Plastikfolie verpackte Wasserleiche aus dem Breitweiher gezogen. Doch das ist erst der Anfang. Das mysteriöse Morden geht weiter. Zwei eingeborene Witwen, beide kurz vor ihrem 80. Geburtstag, deren Ehemänner der Herrgott längst zu sich geholt hat, nehmen sich der Sache an und ihre Ermittlungen auf. Sie kommen einem Umweltskandal globalen Ausmaßes auf die Schliche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Werner Rosenzweig
Karpfen, Glees
und Gift im Bauch
Erschder Röttenbacher Griminalroman Frängisch gred, dengd und gmachd
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2012
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.dnb.de abrufbar.
Handlung und Personen sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen
wären rein zufällig und unbeabsichtigt.
Copyright (2012) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Lektorat: Barbara Lösel, Nürnberg
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Inhalt
Röttenbacher Heimatlied
Röttenbach, du liegst im schönen Frankenland,
wer dich kennt, der ist von deinem Reiz gebannt.
Große Wälder rahmen deine Weiherketten ein.
Hier kann jeder leben und zufrieden sein.
Hier kann jeder leben und zufrieden sein.
Wo am Waldessrand so gelb der Ginster blüht,
unsre Ahnen haben sich darum bemüht,
ihre Besen machten Röttenbach bekannt.
Besenbinder heißen sie in Stadt und Land.
Besenbinder heißen sie in Stadt und Land.
Röttenbacher zogen immer in die Welt,
volle Huckelkörbe machten sie zu Geld.
Früher waren’s Weiherhenkeli und Kre,
heut sind’s Gartenblumen und Gesundheitstee.
Heut sind’s Gartenblumen und Gesundheitstee.
Heutzutag ist Röttenbach ein stolzer Ort,
wer hier länger lebte, zog nur ungern fort.
Viele Neue bauten sich hierher ihr Haus,
sie zog‘s aus der engen Stadt zu uns heraus.
Sie zog’s aus der engen Stadt zu uns heraus.
In die Zukunft wollen wir gemeinsam geh’n,
als Nachbarn und Freunde fest zusammen steh’n.
Jeder fühle sich hier wohl von groß und klein,
Röttenbach kann jedem teure Heimat sein.
Röttenbach kann jedem teure Heimat sein.
(Melodie: Oberfrankenlied)
Röttenbach
Das erste fahle Sonnenlicht kroch zögerlich über die sanften, bewaldeten Ausläufer des Steigerwalds und erzeugte ein silbriges Glitzern auf den Wasseroberflächen der zahlreichen Karpfenteiche. Feiner Dunst lag über den gespenstisch ruhigen Gewässern und die Reste der Nacht schlichen sich endgültig aus dem hohen Schilfbestand.
Die Natur schlief noch. Die Blässhühner hielten sich noch zwischen den Rohrkolben versteckt. Auch die Störche, Kormorane und Fischreiher ruhten noch, bevor sie später zur Jagd aufbrechen würden.
Lediglich der kleine Eisvogel saß bereits auf seinem Lieblingsplatz, einem dünnen Ast einer Erle, welcher weit über die Wasseroberfläche des Stockweihers hinein ragte. Der kleine Vogel richtete seinen spitzen, kräftigen Schnabel und die kleinen dunklen Augen starr auf das Wasser. Sein Bauchfedernkleid schillerte in einem satten Orange in der aufgehenden Sonne. Kopf und Flügel bedeckte ein kräftiges Eisblau. Seine winzigen, roten Füße klammerten sich fest um den dünnen Ast.
Auf die nahe Staatsstraße 2259, welche die kleine 4800-Seelengemeinde Röttenbach in zwei Hälften zerschnitt brach der werktägliche Berufsverkehr herein.
Auch die Motoren der großen Lastwägen auf dem Gelände eines großen Zentrallagers liefen warm. In den dicken Bäuchen der Lkws stauten sich die täglichen Auslieferungen. Die Fahrer schlürften das letzte Mal an ihrem Kaffee, rauchten ihre Zigaretten zu Ende und schwangen sich hinter ihr Lenkrad. Dann röhrten die Motoren, und die Brummis setzten sich langsam in Bewegung, um die Filialen im gesamten Landkreis mit dem nötigen Sortiment zu versorgen.
Die Busse der Linie 205 fuhren in beide Ortseingänge ein und nahmen die ersten Berufspendler auf. Später würden die Schüler folgen, welche die weiterführenden Schulen in Erlangen und Höchstadt an der Aisch besuchten. Langsam erwachte das Dorf und stellte sich auf einen neuen Tag äußerster Betriebsamkeit ein.
Etwa um das Jahr 1000 n. Chr. kamen die ersten Siedler auf der Suche nach Land in die waldreiche, hügelige Gegend. Sie rodeten Teile des Waldes und machten das Land urbar. Eine mühsame Arbeit. Weite Sumpfgebiete, welche auf den undurchlässigen Lettenschichten der Keuperstufe ruhten, ließen nur wenig ertragreiche Landwirtschaft zu. Im Laufe der Jahrhunderte kultivierten die Siedler die Sümpfe. So entstanden die vielen Weiherketten, welche auch heute noch der näheren Umgebung Röttenbachs ihren Charakter geben. Die Teiche liegen meist terrassenförmig an den flach abfallenden Hügeln. Der mannigfaltige Wechsel zwischen Sandsteinschichten und tonigen, wasserstauenden Schichten, das schwache Gefälle der Täler, die zahlreichen, zur Versumpfung neigenden Quellen und die für die Landwirtschaft nur bedingt tauglichen Böden waren für die Entwicklung und Erhaltung der Teichgebiete außerordentlich förderlich.
Bereits Kaiser Karl der Große erließ die Anweisung: »Auf unseren Gütern soll jeder Amtmann die Fischteiche, soweit vorhanden, erhalten und wenn möglich erweitern. Wo sie fehlen, aber doch sein könnten, soll man sie neu anlegen.«
Es vergingen aber noch einige hundert Jahre, bevor Röttenbach 1421 erstmals als selbstständige Seelsorgestelle urkundlich erwähnt wurde. Eine Linie der Truchseß von Pommersfelden nahm das Gebiet in Besitz und gründete Röttenbach.
Heute ist Röttenbach ein stolzer Ort. Schuldenfrei, mit einem geordneten Haushalt. Rings um den alten Ortskern ließen sich im Lauf der Jahre die »Neigschmeggdn« nieder und errichteten ihre protzigen Wohnhäuser. Meist zugezogene »Siemensianer«, die in der nahen Stadt Erlangen bei dem Großkonzern in Brot und Arbeit stehen.
Mit jedem neu ausgewiesenen Baugebiet geht der Anteil der alteingesessenen Röttenbacher immer weiter zurück. Der aktuelle Telefonbucheintrag offenbart 41 Familien mit dem Namen Müller. 39 Fuchs‘, 20 Amons, 15 Baumüllers, 14 Holzmanns, 11 Warters und 11 Wahls. Sie repräsentieren die Wurzeln der alteingesessenen Franken und sind der Garant für die Erhaltung der einheimischen Bräuche und Sprache.
Die Masse der zugezogenen »Preußen« kommt über einige wenige Grundkenntnisse der weichen, mittelfränkischen Aussprache niemals hinaus, will aber überall mitreden. So wie Frau B.: »Also mein Sohn, in der Klasse 4, meint auch, dass die Lehrerschaft durchaus schneller durch den Stoff des Lehrplans gehen könnte. Mein Junge langweilt sich so, müssen Sie wissen. Er ist einfach unterfordert. Na ja, er konnte auch bereits lesen, bevor er eingeschult wurde. Mein Mann legte richtigerweise äußersten Wert auf eine frühe Vorschulerziehung. Ich weiß, das kann man von den Kindern der einheimischen Bevölkerung nicht gerade erwarten, aber…«
Herr L. stieß ins selbe Horn: »Ich meine durchaus, dass das Kindergartenpersonal mehr auf Recht und Ordnung achten sollte. Eine deutliche Ermahnung zur rechten Zeit hat noch keinem Kind geschadet. Ich für meine Person werde das unmögliche Benehmen mancher einheimischer Rotzlöffel jedenfalls nicht mehr akzeptieren. Es kann nicht angehen, dass ein unerzogene Junge meiner äußerst sensiblen Tochter regelmäßig Furcht einflößt, indem er ihr ständig lautstark ins Ohr rülpst. Und erst diese Fäkaliensprache! Unmöglich!«
Frau S. schließlich, zog vor drei Jahren zu und ist eine sehr ehrgeizige, junge Frau: »Höher meine Damen Sopranistinnen! Höher! Höher! Das war noch kein zweigestrichenes C! Das müssen wir nochmals üben!« Besonders die zweiundfünfzigjährige Hausfrau Wahl ging ihr oftmals auf den Geist. »Frau Wahl, denken Sie doch bitte an Ihre Aussprache! Es heißt nun mal nicht ›Blummaschdogg‹, sondern ›Blumenstock‹. Singen Sie doch einfach so, wie es im Textblatt geschrieben steht, und das ›gell‹, am Ende des Satzes können Sie getrost weglassen! Das steht auch gar nicht da.«
Die persönlich Angesprochene nahm die Kritik, wie immer, nicht besonders ernst. »Wenns maana!«
Dennoch, die »Neigschmeggdn« und die Einheimischen kommen normalerweise gut miteinander aus. Was einerseits am Harmoniebedürfnis der Franken liegt und andererseits an der manchmal etwas diffizilen Kommunikation. Nicht immer verstehen die Zugezogenen, was die Einheimischen mit ihrer knappen, melodiösen Ausdrucksweise auf den Punkt bringen möchten. Zwar wirken Letztere oft spröde und brummig – wenn sie doch mal den Mund aufmachen – aber sie sprechen immer direkt an, was sie denken. Dies zwar manchmal eher deftig, aber dafür umso ehrlicher.
»Mach mer a weng unser Dier zu, Herr Nachber!«, ist eine durchaus höflich formulierte Bitte, die Tür zu schließen, wenn beispielsweise jemand eine Gaststätte betritt und die Tür offen stehen lässt.
Streit mögen sie nicht, die Franken. Im Gegenteil, sie hassen Streit. Am liebsten wollen sie in Ruhe gelassen werden. Wehe aber, sie werden in ihrem Seelenfrieden gestört, oder gar gereizt. Dann ist es vorbei mit ihrem Harmoniebedürfnis. Sprüche wie »Mier ham fei nonedd midanander gschusserd!« sind ein eindeutiges Warnzeichen. Sie deuten darauf hin, sich nun besser zurückzuziehen, wenn man denn ernsthaften Ärger vermeiden möchte.
Die rote Linie ist bereits weit überschritten, wenn sich der Franke zu Sätzen wie »Geh na her, Herr Nachber, diech haui ungschbidzd in Buudn nei« oder »Ward na, Freindla, dier weri scho zeign, wu der Bardl n Mosd hulld« hinreißen lässt und dabei beginnt, seine Ärmel hochzukrempeln. Zu solchen Extremsituationen kommt es allerdings äußerst selten. Die Einheimischen sind, wie gesagt, ein harmoniebedürftiges Völkchen. Echte Röttenbacher sind wendig und altfränkisch beharrlich zugleich. Was ihnen völlig abgeht, ist eine euphorische Selbstdarstellung. Dieses »Mir-san-Mir«-Getue, wie es weiter im Süden des Bayernlandes praktiziert wird, mag der Franke überhaupt nicht. Im Gegenteil, er stapelt tief, und sein Humor ist nicht feixend und Schenkel klopfend, sondern eher sarkastisch und trocken – sofern er überhaupt einen Humor besitzt.
Eine besondere Begabung haben die meisten einheimischen Hausfrauen. Nicht nur dass sie, wie alle Frauen, gerne tratschen. Sie können sich stundenlang über nicht anwesende Nachbarn unterhalten:
»Hasd dees scho midgrichd, Liesbedd, dass dera Maicharedd iehr Hanni sei neis Audo zammgfoahrn had?« »Wunnern däds mi ned, su ofd wie der bsuffn is. Der versaufd doch sei ganz Geld. Jedn Samsdooch hoggder drobn im Ring-Café und saufd si an Rausch oo. Die Maicharedd kann an wergli leid do.« »Ja, und dabei is su a anschdändiche Fraa. Die häld iehr Woar zamm.« »Genau, und iehr Kinner kumma aa immer su sauber daher. Und freindli grießn denn die immer!« »Wuher wassnd na du dees, mid dem Unfall?« »Die ald Holzmanni hads mer gsachd. Die waaß doch immer alles, was im Dorf bassierd. Gnaus waaßi aa ned! Um Himmels Willn iech will fei do aa nix gsachd ham, mid dem Unfall. Abber kennd ja sei, dasser bsuffn woar, der Hanni. Mer waaß ja nix Genaus, gell. Mer red ja bloß.«
»Ach, is dees schee do, bei uns, gell?« Die Röttenbacher lieben ihre Heimat. Kein Wunder, ihr schmuckes Dorf liegt inmitten des lieblichen Aischgrunds, der von dem Städtedreieck Nürnberg, Bamberg und Neustadt an der Aisch eingerahmt wird. Ein wahres Naturparadies, in dem die Welt noch in Ordnung ist. Ein Rutsch quasi, und man erreicht die alte Kaiserstadt Nürnberg und Forchheim, das Eingangstor zur Fränkischen Schweiz. Sieben fränkische Bierkeller liegen in Reichweite. Mit dem Fahrrad oder gar zu Fuß bequem erreichbar. »Wassd du dees scho, dass aufm Kaiserkeller in Forchheim des Schäuferla bloß vier Euro und vierzich Send kosd?« »Ja, und in der ›Frängischn Gasdschdubn‹ hamms jedn Donnerschdooch an ›XXL-Schnidzldooch‹. Fier fimbf Euro sechzich grigsd a Schnidzl, su groß wie a Abborddeggl.« Ja, das Preis-Leistungsverhältnis ist noch intakt, in der einheimischen Gegend. Man muss nur wissen wohin.
Neben der Tirschenreuther Pfanne und der Lausitz ist der Aischgrund eines der bekanntesten Teichbaugebiete Deutschlands, mit einer Fläche von circa 3.500 ha und ungefähr 6.000 künstlich geschaffenen Fischteichen. Manche größer, manche winzig klein. Anderswo selten gewordene Pflanzen fühlen sich im Aischgrund immer noch wohl. Störche, Reiher Kormorane, Rotmilane, Drossel- und Teichrohrsänger, Zwerg- und Schwarzhalstaucher genießen das reichhaltige Futterangebot in den Feuchtwiesen und in den zahllosen Fischteichen. Das Beste aber sind die Aischgründer Spiegelkarpfen, die in den Monaten mit »R« – also von September bis April – in Butterschmalz gebacken, oder »blau« gedünstet, auf die Teller der einheimischen Gaststätten kommen. Das wertvolle Eiweiß und die gesundheitsfördernden Omega-3 Fettsäuren spielen dabei eine eher untergeordnete Rolle. Der ausgezeichnete Geschmack des Fisches, wenn er aus dem siedenden Butterschmalz gezogen wird, ist es, der die Einheimischen wie auch die Städter aus Erlangen, Fürth und Nürnberg an die Tische der zahlreichen Wirtshäuser lockt.
Und auch sonst gibt es in Röttenbach fast alles: ein intaktes Vereinsleben mit großzügigen Freizeitangeboten, eine Vielzahl ortsansässiger Handwerksbetriebe, Geschäfte aller Art, Schulen, Ärzte, Kindergärten, diverse Gaststätten, Bäckereien und Metzgereien, ein Fitnesszentrum, eine Poststelle mit Videothek, einen Baumarkt, eine katholische und evangelische Gemeinde und vieles mehr. Nur eines gibt es nicht: einen Lebensmittel-Frischemarkt – und hier beginnt unsere Geschichte. Der frühere Einkaufs-Markt war zu klein, nicht mehr standesgemäß und nicht weiter ausbaufähig und wurde deshalb bereits vor Jahren geschlossen. Doch nun hieß es, die Gemeindeverwaltung verhandle mit einem interessierten Investor. Das würde sich aber noch hinziehen! Wer weiß, wie lange noch … Gemäß dem Motto: »Alles gehd, bloß die Fresch hubf’n« übten sich die Röttenbacher, wie immer, weiterhin in Geduld.
Verhandlungen
Wie so oft in den Vorjahren, waren die Weißstörche auch dieses Frühjahr wieder sehr früh aus ihrem Winterquartier zurückgekehrt. Die Nestsäuberung, hoch oben auf dem Schlot der ortsansässigen Brauerei Sauer erledigten sie bereits im Februar, als die Menschen, unten in den Straßen, noch gegen die Schneemassen dieses kalten und schneereichen Winters ankämpften. Schneeschieber waren längst zu einer ausverkauften Rarität geworden, und die Streusalzvorräte des Gemeindebauhofs waren aufgebraucht. Nestreinigung im Februar? Klar! Die Röttenbacher Störche überwinterten schon seit Jahren nicht mehr in Afrika. Warum auch, wenn der Nürnberger Tiergarten gerade mal 30 km Luftlinie entfernt liegt? Da hatten die Störche die gleiche Meinung, wie die Einheimischen: »Afriga had die Kadz gfressn!«
Im Nürnberger Zoo gab es täglich frisches Fressen. Das Vogelhaus bot Schutz und Wärme während der frostigen Tage und klirrend kalten Nächte. Zudem war man unter Seinesgleichen. Ende Februar, als die Sonne tagsüber immer kräftiger wurde und sich auch bei den Menschen die ersten, hoffnungsvollen Frühlingsgefühle einstellten, unternahm die Störchin die ersten Erkundungsflüge nach Röttenbach. Hoch oben, am Himmel kreisend, inspizierte sie aus der Ferne, erstmals nach dem langen, kalten Winter, ihr Nest. Es schien alles okay zu sein. Ein paar Tage später, um die Mittagszeit, landete sie mit ihrem Gemahl auf dem gemeinsamen Horst. Graziös bogen die beiden Großvögel, ihre schlanken Hälse nach hinten und stimmten mit ihren roten Schnäbeln ein aufgeregtes Geklapper an. Dann begaben sie sich an den Hausputz. »Die Schderch sen scho do!«, freuten sich die Fußgänger, unten in der Hauptstraße. Doch nachdem die Vögel das alte, verfilzte Moos, das feuchte und teils noch schneebedeckte Heu, sowie die Kotreste ihrer letztjährigen Aufzucht sorgfältig aus dem Astgewirr ihres Horsts entfernt und auf das steil abfallende Dach entsorgten, erhoben sie sich wieder in die Luft und kehrten zu ihrem Nürnberger Winterquartier zurück.
Jetzt, Ende April, hatten sie längst ihre Sommerresidenz wieder in ständigen Beschlag genommen und sahen hinab auf die lärmende und vor Abgasen stinkende Hauptstraße. Nichtsdestotrotz war ihr Domizil ein idealer Ausgangspunkt für ihre Ausflüge in die fetten Feuchtwiesen mit den unzähligen Fischteichen. Leckere Wasserfrösche warteten dort auf sie. Hunderte von neugierigen, unvorsichtigen Fischsetzlingen tummelten sich knapp unter der Wasseroberfläche. Lediglich die Konkurrenz der dreisten Fischreiher und der gefräßigen Kormorane nahm in den letzten Jahren deutlich zu. Ärgerlich! Die Störchin dribbelte nervös auf ihren langen dünnen Beinen und trat an den Rand des Horsts. Sie öffnete ihre Schwingen und stieß sich ab. Mit drei, vier kraftvollen Flügelschlägen gegen den Luftwiderstand gewann sie schnell an Höhe. Die lauen Aufwinde trugen sie höher und höher. Wie ein überdimensionaler Bohrer schraubte sie sich in den wolkenlosen, blauen Himmel Röttenbachs. Zweimal umflog sie ihr Nest und blickte auf ihren Lebensgefährten hinab. Dann überflog sie das Gemeindezentrum und drehte in Richtung Süden, auf die langgezogenen Weiherketten ab, welche sich bis nach Dechsendorf erstreckten.
Genau unter ihr, im Konferenzraum 1 des Rathauses saßen sich zwei Parteien gegenüber, welche unterschiedlicher nicht hätten sein können. Seit Wochen führten sie von Unterbrechungen geprägte Vertragsverhandlungen.
Auf der einen Seite des Tisches saßen Herr Raphael T. Eberle, Mehrheitsgesellschafter und Generaldirektor der Eberle Investment GmbH, aus Waiblingen, in der Nähe von Stuttgart. Ihm zur Seite saß Gustav Haeberle, sein Schwiegersohn und designierter Nachfolger. Raphael T. Eberle ging auf Ende sechzig zu, war aber körperlich und geistig noch total fit, was man ihm aufgrund seines Äußeren gar nicht so ansah. Er war ein fülliger Mann, sein Bierbauch wölbte sich wie eine Trommel auf seine kurzstämmigen Oberschenkel. Sein mächtiger Schädel war nahezu blank. In Höhe seiner Ohren zog sich nur noch ein dürftiger, weißer Haarkranz um seinen Hinterkopf. Dicke, fleischige, Ohrläppchen erinnerten an eine asiatische Buddha-Statue. Seine Hängebacken bestätigten diesen Vergleich. Ständig hielt er ein Stofftaschentuch, groß wie ein Geschirrtuch, in der Hand, welches er als Waffe gegen seine permanenten Schweißausbrüche einsetzte. Wenn er sich innerlich erhitzte, und dies geschah während der Vertragsverhandlungen in den letzten Wochen sehr häufig, nahm sein Kopf das tiefe Rot überreifer Tomaten an, und Schweißperlen, groß wie Kirschkerne, traten ihm auf Stirn und Kopfhaut. Seine emotional und gehetzt artikulierten Diskussionsbeiträge, sowie seine theatralisch übertriebene Gestik bewirkten dann jedes Mal tsunamiartige Wellenbewegungen auf seinem Hängebauch. Der asiatische Buddha verwandelte sich dann in das tobende und keifende Rumpelstilzchen der Gebrüder Grimm.
Rechts neben ihm saß sein Schwiegersohn. Ständig kaute er Tic Tac, welche er sich paarweise in seinen dünnlippigen Mund einschmiss. Das Auffälligste an Gustav Haeberle aber waren seine Augen. Immer waren sie in Unruhe. Die Augäpfel traten weit aus den Augenhöhlen hervor. Er trug ein rahmenloses Brillengestell mit extrem dicken Gläsern. Sein schmaler Mund war nahezu lippenlos. Seine Gestalt eher schwächlich, mit dem Ansatz eines kleinen Buckels. Alles in allem sah er aus wie ein Stummelschwanzchamäleon auf Madagaskar. Kurzum, Gustav Haeberle konnte man durchaus als einen unattraktiven Menschen bezeichnen. Seine blasse Haut, die weißen Augenlider und die mit Pomade, angeklatschte Frisur trugen zu diesem Erscheinungsbild bei. Seinem Reptilienmund war heute noch kein einziger »Piep« entsprungen. Dafür rollten seine Augen rastlos hin und her und registrierten jede kleinste Bewegung im Raum. Auf die Frage, ob er aus dem Schwäbischen stamme, meinte er: »Ha freile, do hend’s Se’s guad troffa! Aber saget se bloß, an was hend Se jeddz dees gmergd?«
Auf der anderen Seite des Tisches saßen die Repräsentanten und Verhandlungspartner der Gemeinde Röttenbach: Ludwig Gast, der erste Bürgermeister, sowie der Gemeindekämmerer Alois Holzheimer, im Dorf allgemein als »Holzi« bekannt. Ein echter Franke und bauernschlau.
Die wochenlangen, zähen Verhandlungen, in denen es um die Errichtung eines neuen Lebensmittel- Frischemarktes, eines sogenannten Vollsortimenters mit angegliederter Lagerhalle, ging, erreichten ihr Ende.
Die Verhandlungspartner einigten sich auch noch über den letzten offenen Punkt, die Anzahl der Kundenparkplätze. Susanne Amon, die Sekretärin des Bürgermeisters, saß bereits an ihrem PC und arbeitete die letzten, mündlich vereinbarten Änderungen, in die Vertragsdokumente ein. Im Konferenzzimmer 1 betrieben die beiden Vertragsparteien unterdessen höflichen Small Talk.
»Dess gfreit mi abber, Herr Gascht, däss mer doch no zu einer Einigung komme hän. Do müsse mer doch direkt no a Gläsle druf trinke und ufs Gschäftle anstoße«, schlug Raphael T. Eberle vor und wischte sich über seine schweißnasse Stirn. »Moinscht net aa, Guschtav?« Der Angesprochene zuckte zusammen und rollte mit den Augen.
»Hanoi, freili müsse mer do anstoße«, entfuhr es zischend seinem Reptilienmaul. Dann verdrehte er erneut die Augen und warf sich erneut zwei Tic Tac ein.
»Keine Sorge, meine Herren«, nahm nun der wortgewandte Röttenbacher Bürgermeister das Ruder in die Hand, »Frau Amon wird jeden Moment mit den fertigen Verträgen erscheinen, dann stoßen wir, wie sich das gehört, mit einem Gläschen kühlen trockenen Sekt an. Lassen Sie mich aber auch meine Zufriedenheit zum Ausdruck bringen, wobei ich natürlich in erster Linie die Interessen unserer Bürger und Bürgerinnen im Auge habe. Schon jahrelang wünschen sie sich einen modernen Lebensmittel-Frischemarkt, und nun steht dieses Ziel nach schwierigen, aber fairen Verhandlungen zeitnah vor der Tür. Ich danke Ihnen deshalb auch im Namen aller Röttenbacher. Sie waren geduldige und verständnisvolle Verhandlungspartner. Nur auf Eines muss ich wiederholt hinweisen, meine Herren. Der Vertrag wird erst dann rechtsgültig, wenn die Mehrheit des Gemeinderates grünes Licht gegeben hat. Hast du noch etwas anzumerken, Holzi?«, wandte er sich an seinen Kämmerer.
»Bassd scho«, entgegnete Holzi kurz und knapp. »Dees mid unserm Gmaarad grigsd du doch iesi hin, Ludwich. Der frissd der doch suwiesu aus der Händ«, fügte er verschmitzt lächelnd hinzu. Ludwig Gast wollte gerade darauf antworten, als sich die Tür öffnete und Frau Amon vier Sektkelche auf einem Tablett jonglierend herein trug. Unter dem rechten Oberarm hielt sie zwei Vertragsmappen eingeklemmt. Die Kohlensäure perlte munter in den kühl beschlagenen Gläsern. »Fürscht Metternich«, raunzte Raphael T. Eberle anerkennend, »a gescheides Trepfle. Furzdrogga!« Dann griff er nach dem Glas, welches fast bis zum Rand voll war. »Proscht, Herr Gascht. Proscht, Herr Holzi, nu emol ufs Gschäftle und Schluss mit Dischgeriera«
Nun fühlte sich auch der sonst so wortkarge Röttenbacher Kämmerer genötigt, dem Waiblinger Juniorchef ein paar freundliche Worte mit auf den Weg zu geben.
»Brosd, Gusdav, iech derf doch Gusdav zu der sogn? Dees had mi fei gscheid gfreid, dass mier zwaa uns do kennaglernd und uns aa so gud verschdand hamm. Edz schaud amol zu, dass iehr mid eierm Subermargd do rechdzeidi ferdi werd, und mier im Herbsd a gscheide Einweihungsfeier machen kenna. Dann less mer die Sau raus! Do haumer an Gscheidn drauf, gell? Mein lieber Mann, do kennder an Schies drauf lassn.«
Ludwig Gast sah seinen Kämmerer erstaunt an. »Mensch Holzi, soviel hast du das ganze Jahr über noch nicht von dir gegeben. Du entwickelst dich noch zum Kommunikator ersten Ranges.«
»Basd scho!«, bestätigte der Holzi erneut.
Das Baden-Württembergische Chamäleon verstand kein Wort, hatte aber das Gefühl, dass die freundlichen Worte des Franken von Herzen kamen und ihm galten. Seltsame Leute, diese Mittelfranken! Gustav Haeberle leerte sein Glas in einem Zug.
Die Störchin stand unterdessen unbeweglich, wie aus Stein gemeißelt, im flachen Uferbereich eines Karpfenweihers. Ihre kohlschwarzen Augen waren auf einen dicken Frosch gerichtet, der sich im Schilfbestand auf der Wasseroberfläche treiben ließ und sie mit seinen runden Kulleraugen ansah. Wie ein Speer schoss ihr spitzer, roter Schnabel in das Wasser, erfasste den chancenlosen Lurch und würgte ihn in ihren Kropf. Sie hatte für heute genug. Vollgefressen und zufrieden knickte der große Vogel kurz in den Beingelenken ein, stieß sich vom sumpfigen Weihergrund ab und schwang sich mit wenigen Flügelschlägen in die Luft. Drei Minuten später landete die Störchin auf dem gemeinsamen Nest und wurde von ihrem Gemahl mit freudigem Schnabelklappern begrüßt.
Drunten, aus der Ringstraße kommend, bog ein schwarzer Mercedes der S-Klasse mit Waiblinger Autokennzeichen nach links in die Hauptstraße ab und nahm einem Einheimischen, der in seinem zehn Jahre alten VW Golf unterwegs war, die Vorfahrt. Am Steuer der Luxuskarrosse saß ein blasses Chamäleon, welches mit den Augen rollte und Tic Tac kaute. Neben ihm auf dem Beifahrersitz saß ein asiatischer Buddha. Sein Kopf leuchtete wie eine reife rote Tomate.
Hubertus Sapper, der einheimische Golf-Fahrer, fluchte und stieg in die Eisen. »Ja verregg! Heh, du Orsch mid Ohrn, hasd ka Augn im Kubf«, rief er dem Mercedes nach. »Hasd dein Fiehrerschein in der Lodderie gwunna? Schau bloß, dassd ham kummsd zu deine andern Aliens, Sau-Breiß damischer und lass di bei uns nemmer bliggn, Orschgsichd, alds!«
Nun, dieser Wunsch blieb Hubertus Sapper verwehrt. Er konnte ja nicht ahnen, dass er in naher Zukunft erneut auf die baden-württembergischen Aliens treffen würde.
Er konnte sich lange nicht beruhigen und grummelte weiter vor sich hin. Kein Wunder, die Sonne brannte gnadenlos vom wolkenlosen, blauen Himmel. Es war viel zu heiß für diesen 28. April, 2011, und der einzige Luxus, den der alte Golf noch besaß, die Klimaanlage, war schon seit mehreren Wochen defekt.
»Dees is vielleichd a Greiz, mid dera Breißn-Baggaasch! Eigschberrd kerns alle, die Breißn-Zibfl!«
Kunni und Retta
Kunigunde Holzmann lebte seit ihrer Verehelichung, vor achtundfünfzig Jahren, in dem kleinen Einfamilienhaus, in der Kirchengasse, gleich gegenüber von Gerda Wahl, der fränkelnden Sopranistin, aus dem Kirchenchor von St. Mauritius.
Margarethe Bauer, Kunnis beste Freundin, hatte ihr Domizil gleich um die Ecke, in der Lindenstraße.
Die beiden kannten sich bereits seit dem Sandkastenalter und das lag zwischenzeitlich immerhin schon sechsundsiebzig Jahre zurück. Beide gingen stramm auf die achtzig zu, sahen aber noch sehr rüstig aus. Altersbedingt leiden sie dennoch an so manchen Zipperlein.
Die Holzmanns Kunni, wie sie liebevoll im Dorf genannt wurde, klagte häufig über Schmerzen in ihren lädierten Knien, so dass ihr weites Laufen immer schwerer fiel. Kein Wunder, bei ihrem Gewicht von fünfundachtzig Kilo und einer Körpergröße von gerademal einen Meter neunundfünfzig.
Die Bauers Retta hingegen lief immer noch wie ein Porsche Carrera, frisch aus der Fabrik. Bei ihr war es die Gicht, die sich immer stärker in ihren Fingergelenken ausbreitete. Im Gegensatz zu ihrer Freundin war Retta rank und schlank und konnte aus der Ferne betrachtet durchaus als attraktive Endfünfzigerin durchgehen. Nicht umsonst hatte Retta einen glühenden Verehrer: ihren Untermieter Dirk Loos, den zugezogenen Rentner aus dem Sauerland.
Natürlich hatten Retta und Kunni auch nicht mehr das feine Gehör ihrer Jugend. Hörgeräte kamen für die beiden nicht in Betracht. Solche Dinger trugen ja nur alte Leute.
Die beiden frönten seit Langem gemeinsamen Interessen. An oberster Stelle stand da die Leidenschaft für gutes Essen. Selbstredend kam da nur die deftige, fränkische Küche infrage. Von Sterneköchen und großen Tellern, auf denen hauchdünnes Carpaccio vom Wildwasserlachs mit Flocken von schwarzen Trüffeln in Balsamicoessig mariniert unter einem Blatt Salat versteckt ist, hielten sie absolut nichts. Auf der Hitparade ihrer Lieblingsspeisen stand seit Jahrzehnten »Schäuferla mit Glees«, der Ferrari unter den deutschen Schweinebraten, gefolgt vom »Gebackenen Aischgründer Spiegelkarpfen«. An dritter Stelle dominierten »Graudwiggerli«, serviert mit einer deftigen Rahmsoße und Kartoffelpüree. Das Kartoffelpüree, »Bodaggnbrei« genannt, musste zur Abrundung des Geschmacks unbedingt mit Majoran versetzt sein.
In den heißen Sommermonaten (aber wie oft kamen die schon vor?), hatten die beiden Röttenbacher Urgesteine dann gewöhnlicherweise doch eher einen Glusderer auf kalte Speisen. Presssack mit Musik, Obatzter, fränkischer Wurstsalat, oder eine Bauernplatte mit Dosenfleisch, geräuchertem Schinken, grober Leberwurst, Essiggurken, Zwiebeln und Tomaten waren da nie verkehrt.
Wenn die beiden honorigen Damen nicht gerade mit Essen beschäftigt waren, gingen sie ihrem zweiten Hobby nach: der Kriminalistik. Ihre Lieblingssendung war »Tatort«, wobei »Tatort« nicht gleich »Tatort« war. Besonders die Sendungen mit den Kommissaren Leitmayr und Batic liebten die beiden. Leitmayr war unterdessen auch nicht gleich Batic, und Batic nicht gleich Leitmayr. Da machten die beiden Damen ganz klare Unterschiede.
Während die Kunni Udo Wachtveitl in der Rolle des Kommissar Leitmayr über alles verehrte (»Mei had der a scheene Nasn, der lösd alle Fäll), hatte Retta eher ein Faible für den Schauspieler Nemec in der Rolle des Kommissar Batic.
Last, but not least interessierte die beiden Witwen jeglicher aktuelle Dorfklatsch. Kunni hatte vor Jahren das »Nordbayerisches Tageblatt« abonniert, Retta den »Fränkischen Tag«. Jeden Morgen beim Frühstück stürzten sich die beiden als erstes auf den Lokalteil. Wen interessierte schon die Griechenlandkrise oder ob die FDP in der Wählergunst bei fünf oder drei Prozent liegt? Wenn aber der fette, »Dahergschmeggde« breißische Kugelblitz Tatjana Rübensiehl und ihr »bohnaschdeggerder« Hans-Dieter, dieser äsige Körnerfresser, der aussah, wie der Tod von Forchheim, den lang ersehnten, neuen Supermarkt verhindern wollten und im Gemeindeblatt zu Protestaktionen aufriefen, spätestens dann waren die beiden Witwen auf 180.
Während Retta zwei Töchter hatte, die in den USA lebten, blieb Kunnis Ehe kinderlos. Als einzig näherer Verwandter verblieb ihr so ihr Neffe Gerald Fuchs, Sohn ihres bereits verstorbenen Bruders, Hans Fuchs. Gerald war Kommissar bei der Mordkommission in Erlangen. Vor sechs Jahren wurde er aus der Oberpfalz nach Franken versetzt und hatte sich ebenfalls in Röttenbach niedergelassen. Seitdem bewohnte er mit seiner Golden-Retriever-Hündin Terry eine Doppelhaushälfte in der Erlanger Straße. Mit seinen 43 Jahren war er immer noch Junggeselle. Dabei sah der Bursche recht passabel aus. Mit seinen ein Meter dreiundachtzig und seiner sportlichen Figur stellte er durchaus etwas dar. Aus seinem ovalen Gesicht, mit dem männlich kantigen Kinn strahlten zwei hellgrüne Augen unter buschigen Augenbrauen und langgebogenen Augenwimpern. Sein kurzer Bürstenhaarschnitt mit dem kräftigen Haar erinnerte sie stets an einen bekannten, amerikanischen Schauspieler. Kunni hoffte immer noch, ihr Neffe würde sich in seine Assistentin, Sandra Millberger, verlieben. Sie hatte sie zwar noch nicht persönlich kennengelernt, sondern nur gelegentlich Fotos von ihr in der Zeitung gesehen, aber der Eindruck, den Sandra bei ihr hinterlassen hatte, überzeugte sie. Auch ihr Neffe schwärmte stets von der guten Zusammenarbeit mit seiner Assistentin. Da war mehr dahinter. Das spürte Kunni Holzmann. »Der Gerald is bloß zu bleed, den erschdn Schridd zu machen«, konstatierte sie.
Ihre beiden Ehemänner hatten die Kunni und die Retta schon vor Jahren unter die Erde gebracht. Der Kunni ihr Schorsch wurde 82. Vor vier Jahren, es war Mitte Juni, meinte er, er müsse bis in die äußerste Spitze seines Kirschbaums klettern, um auch die weiter außen hängenden Früchte vor den gefräßigen Amseln zu retten. Ein morscher Ast knackte verdächtig unter seinen 105 kg Lebendgewicht. Es blieb nicht beim Knacken. Gerade als sich der Schorsch weit nach außen streckte, brach der Ast weg. Kunnis Mann hatte nicht die geringste Chance, sich noch irgendwo festzuhalten.
»Ja verregg…«, war sein letzter, erstaunter Ausruf, als er mit seinem Plastikeimer in die Tiefe stürzte. Die gepflückten Kirschen kullerten munter im Garten herum, während der Schorsch sein Leben aushauchte, als er nach seinem Sechsmetersturz mit dem Kopf hart auf der Pflastersteineinfassung aufschlug, welche den Stamm des Baumes umgab.
Kunni, die gerade in der Küche stand und Geschirr spülte, verfolgte aus dem Küchenfenster den Sturz ihres Gatten. »Alder Debb, wie ofd habbi dier scho gsachd, dassd in deim Alder nemmer auf den Bamm grabbln sollsd. Edz hasd dein Dreeg!«
Auch der Retta ihr Reser war längst zu Grabe getragen worden. Er war acht Jahre älter als seine Frau. Vor dreieinhalb Jahren war er mit seinem alten Fendt-Traktor, den Anhänger hinten dran, in den Wald aufgebrochen, um Holz zu machen. Warum sollte er das teure Heizöl zum Kamin hinausjagen, wenn es in seinem Wald Bruchholz in Hülle und Fülle gab? Reser liebte in der kalten Jahreszeit die mollige Wärme seines Kachelofens. Sie tat seinen alten Knochen richtig gut.
Der letzte Herbststurm hatte massenweise Bäume entwurzelt und Äste, so dick wie ein kräftiger Männerarm, abgerissen. Die lagen da einfach auf dem Waldboden herum. Von Zeit zu Zeit musste im Wald einfach mal sauber gemacht werden!
Fünf Stunden harte Arbeit hatte er hinter sich und seinen Anhänger beladen, als er sich endlich wieder auf den Heimweg machte. Von der körperlichen Anstrengung war er heftig ins Schwitzen gekommen. Um nicht zu sagen: Er schwitzte wie eine Sau. Die Soße rann ihm von seinem kahlen Schädel bis in die buschigen Augenbrauen, und am Hals entlang bis in den Kragen seines karierten Flanellhemdes.
Gnadenlos knallte die Sonne vom strahlend blauen Himmel, an dem nicht die kleinste Wolke stand. Lediglich weit im Westen verdunkelte sich der Horizont. Es schien sich ein Wärmegewitter zusammenzuziehen. Noch regte sich kein Wind. Die Luft war zum Schneiden dick. Ständig wischte sich der Reser mit dem Hemdsärmel über Augen und Stirn. Das passte ihm gar nicht. Er musste sich auf seinen Fahrweg konzentrieren. Gerade tuckerte er mit seinem alten Traktor und dem mit Holz schwer beladenen Anhänger auf einem engen Feldweg zwischen zwei Karpfenweihern dahin. Der Weg war nicht ganz ungefährlich. Es gab einige feuchte, weiche Stellen. Denen sollte er besser ausweichen. Wenn er nicht aufpasste, konnte sein Gefährt einsinken und stecken bleiben. Wenn das geschähe, na dann »Gute Nacht, Marie!«
Eine Bremse, einer dieser blutsaugenden Plagegeister, die sich gerne in der Nähe von Wasser aufhielten, schien keine Rücksicht darauf zu nehmen, dass sich der Reser auf seinen Weg konzentrieren musste. Angelockt durch den menschlichen Schweißgeruch umtänzelte sie brummend seinen Kopf.
»Sakra…. Scheißviech!«, fluchte er, »Hau ab, lass mer mei Ruh!« Doch der summende und schwirrende Blutsauger verstand Reser nicht. Mitnichten dachte das Insekt daran zu verschwinden. Im Gegenteil, der Schweißgeruch wurde immer intensiver, immer verlockender, und die Stechmücke wurde immer aufgeregter und aggressiver. Wenn da bloß nicht dieser fuchtelnde Arm wäre, der ständig nach ihr schlug. Beharrlich versuchte die Bremse erneut einen Landeplatz zu finden, um ihren Stechapparat durch die menschliche Haut zu bohren und sich an dem süßen Blut zu laben. »Zisch ab, Sarah«, fluchte der Reser erneut, »odder iech hau di zu Brei!«.
Der Plagegeist legte sich in eine enge Flugkurve und steuerte Resers ungeschützten Hals an. Der sah den Brummer im Sturzflug auf sich zukommen und die einmalige Gelegenheit, sich endgültig des lästigen Blutsaugers zu entledigen. Geistesgegenwärtig ließ er mit einem triumphierenden »Wardner, gleich habbi di, du Fregger«, das Lenkrad für einen kurzen Moment los, verfolgte konzentriert den Anflug der Bremse, klatschte beide Hände zusammen und verspürte Sekundenbruchteile später, wie der matschige Insektenbrei in seinen Handtellern klebte.
Unglücklicherweise hatte er durch diese wilde Aktion auch sein Todesurteil heraufbeschworen. Als er seine Hände vom Lenkrad nahm, genügten dem alten Fendt weniger als zwei Sekunden, um sich selbstständig zu machen. Die Vorderräder der Zugmaschine scherten im 90 Grad Winkel nach links aus und fraßen sich in die steile, weiche Böschung, welche schnurstracks auf die Wasseroberfläche des Fritzenweihers zuführte. Den Reser durchzuckte es siedend heiß, und er versuchte noch das Steuer herumzureißen.
Zu spät. Der schwer beladene Anhänger drückte von hinten nach und den Traktor unerbittlich in Richtung Wasser. Die Zugmaschine geriet außer Kontrolle, sank in den weichen Untergrund ein, kippte zur Seite, riss sich vom Anhänger los und überschlug sich.
»Jessesla!«, war das letzte Wort, welches der Reser erschrocken von sich gab. Dann wurde er aus seinem Sitz katapultiert und durchbrach, Kopf voran, mit einem satten Klatscher die braunen Wasser des Fischgewässers. Als er in den morastigen, schwarzen Bodenschlamm des Weihers einschlug, begrub ihn sein alter Fendt-Traktor unter sich.
Die traurige Nachricht, welche die Landpolizei der Retta wenige Stunden später überbrachte, quittierte die mit einer kernigen Aussage: »Je älder dass wern die Mannsbilder, desdo bleeder werns aa. Was muss denn der alde Gaul in seim Alder nu in Wald foahrn, um Holz zu huln? In unserer Schubfn hammer nu dreißg Schdeer rumkugln. Hädder mer beim Schdaubsaugn gholfn däder edz nu lebn.«
Widerstand
Nicht alle Röttenbacher wollten den neuen Lebensmittel-Frischemarkt. Allen voran Tatjana Rübensiehl. Die Rübensiehls waren vor fünf Jahren aus Lüdenscheid zugezogen. Wo die Stadt Lüdenscheid liegt, weiß in Röttenbach keine alte Sau. Irgendwo im Preußen-Land!
Ehemann Hans-Dieter, ein blasser Strich in der Landschaft, mit randloser Nickelbrille, schütterem Haupthaar und O-Beinen, durch die man eine ganze Kompanie Navy Seals schicken könnte, ohne dass Hans-Dieter dies bemerken würde, arbeitete als Diplom-Physiker bei Siemens. Zu Hause konnte er keinen Nagel gerade in die Wand schlagen. Mit seinen einen Meter achtundneunzig radelte er auf seinem Titan-Fahrrad täglich zu seinem Arbeitsplatz. Egal, ob es regnete, schneite, hagelte oder die Sonne schien. Im Winter, wie im Sommer. Im Frühling wie im Herbst. Nach wenigen Tagen muffelten seine Klamotten, die er nur wochenweise wechselte, wie eine fünfköpfige Iltisfamilie.
Seine Frau Tatjana wirkte neben ihm wie ein gestauchter Kugelblitz. Mehr als einen Meter achtundfünfzig hatte sie nicht an Höhe. Dafür ging sie mehr in die Breite. Dank ihres ausladenden Busens konnte sie ihre Schuhspitzen nur dann im Spiegel betrachten, wenn sie weit genug davon entfernt stand.
Die Rübensiehls waren in der Gemeinde hinreichend als »Körnerfresser« bekannt. Kein Wunder also, dass sich Tatjana im Bund Naturschutz Röttenbach-Hemhofen engagierte und es bei der letzten Vorstandswahl bis an die Spitze gebracht hatte. Seitdem wollte sie tagtäglich die Welt verbessern. Als sie davon hörte, dass im Gewerbegebiet, gleich hinter der FORMA ein neuer Supermarkt errichtet werden soll – mitten im Winterquartier der bedrohten Knoblauchkröte – sah sie rot. Sofort lancierte sie eine Anzeige im Gemeindeblatt und rief zu einer Gegenoffensive auf. Für den Abend des fünften Mai hatte sie alle interessierten Bürger und Bürgerinnen in das Nebenzimmer der Gaststätte Fuchs eingeladen und zur Gründung der Gegenoffensive »Röttenbach 21« aufgerufen.
Heute war es soweit. Fünfundzwanzig Gäste hatten sich eingefunden: Zwei Pressevertreter. Einer vom »Nordbayerisches Tageblatt«, einer vom »Fränkischen Tag«. Das Ehepaar Rübensiehl. Sieben Arbeitskollegen von Hans-Dieter, welche in den naheliegenden Ortschaften Neuhaus, Adelsdorf, Aisch, Heßdorf und Hannberg wohnten. Sechs Frauen – zusammen 618 Kilogramm - aus Tatjanas Weight-Watcher-Gruppe waren ebenfalls anwesend. Dann war da noch Johann Geldmacher, langjähriger Geschäftsleiter des FORMA-Supermarktes und sein Stellvertreter, Ambrosius Fuchs. Für Gerd-Dieter Stumpf, den stellvertretenden Vorsitzenden des Bund Naturschutz war es quasi eine Pflichtveranstaltung. Im Tiefsten seines Herzens war es ihm völlig egal, ob ein neuer Supermarkt gebaut wird, oder nicht. Die Knoblauchkröte war ihm im Prinzip auch egal – ein hässlicher Lurch.
Vier Wolfenbütteler Übernachtungsgäste, die auf der Durchreise waren, gerieten eher zufällig in die Gründungsveranstaltung, da in den zwei anderen Gastzimmern kein freier Platz mehr verfügbar war.
Den Abschluss bildete der alte, etwas spinnerte Jupp Hochleitner. Er war ständiger Gast bei allen öffentlichen Veranstaltungen in der Gemeinde. Ob der Kaninchenzuchtverein »Rüstiger Rammler« seine Jahreshauptversammlung abhielt, ob der KCR, der Karnevals Club Röttenbach, seine jährliche Weinfahrt nach Ipsheim veranstaltete oder der St. Mauritiuschor seine Sommerserenaden – Jupp Hochleitner war immer dabei. Er war Mitglied in fünfundzwanzig Vereinen, politischen Parteien, bei Stammtischen, oder sonstigen Bürgerinitiativen. Als er auch der örtlichen SPD beitreten wollte, wurde ihm die Mitgliedschaft verweigert, da er bereits langjähriges Mitglied des CSU-Ortsverbandes war. Die Roten und die Schwarzen verstanden sich so gut wie Hund und Katz. Jupp verstand seinerseits die Welt nicht mehr. »Dees aane had doch mid dem andern nix zu schaffn«, grummelte er, als sein Antrag abgelehnt wurde, »iech wolld doch bloß wegn eierm Schafkobfschdammdiesch beidredn. Brauchd iehr denn kann Brunzkardler?«
Nachdem alle Anwesenden mit Getränken versorgt waren, erhob sich Tatjana Rübensiehl von ihrem Stuhl und trat in die Mitte des Raumes. Sie sah sich um und wartete bis die Unterhaltungen aufhörten und sie die ungeteilte Aufmerksamkeit aller hatte. Dann erhob sie ihre Stimme:
»Liebe Freunde des Bund Naturschutz, liebe Gleichgesinnte, liebe Gäste aus Nah und Fern.« Sie ließ ihren Blick zu den Wolfenbütteler Gästen schweifen. »Ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu unserer heutigen Gründungsveranstaltung von ›Röttenbach 21‹ gekommen sind und begrüße Sie auf das Allerherzlichste. Bestätigt mir Ihre Anwesenheit doch, dass auch bei Ihnen ein starkes Interesse vorliegt, diesem Wahnsinnsbau von einem Supermarkt inmitten eines einzigartigen Biotops, einer außergewöhnlichen Naturlandschaft, letztlich in quasi letzter Minute den Garaus zu machen. Es ist eine Sünde, mit welcher Ignoranz der Röttenbacher Gemeinderat dieses Bauprojekt genehmigt hat. Eine Sünde, was rede ich, eine Verschwörung gegen die Natur, wie wir alle wissen.«
Sie legte eine Pause ein und sah sich um. Als kein tosender Beifall einsetzte, fuhr sie fort. Jupp Hochleitner rülpste und bestellte sich bei der Bedienung sein zweites Erdinger Weizen und einen doppelten Williams-Christbirne.
»Wie wir nunmehr alle wissen, plant die Gemeindeverwaltung den Bau eines gigantischen Supermarktes mitten im Winterquartier – dem einzigen in dieser Gegend – der vom Aussterben bedrohten Knoblauchkröte, welche der Familie der Europäischen Schaufelfußkröte zugehörig ist. Das ist ein Skandal ohnegleichen! Die Knoblauchkröte benötigt die lockeren, sandigen Böden, die im vorgesehenen Baugebiet noch vorhanden und in unserer Region wirklich einzigartig sind. Mit ihren scharfkantigen, verhornten Auswüchsen an den Fußsohlen kann sich die Knoblauchkröte sehr schnell in den lockeren Boden eingraben und somit ihr Winterquartier beziehen, bevor sie im Frühjahr wieder ihre Laichgebiete im Wasser aufsucht.«
»Jawoll, suu lassi mier dees eigeh«, rief Jupp Hochleitner dazwischen, »alle Breißn ghern ins Wasser!«
Tatjana Rübensiehl überhörte geflissentlich diesen unqualifizierten Zwischenruf und fuhr unbeirrt fort: »Seien wir doch ehrlich zu uns selbst! Brauchen wir noch einen weiteren Supermarkt der Superlative? Nein, brauchen wir nicht! Wir haben bereits ausreichend Märkte in unserer unmittelbaren Umgebung. In Hemhofen, in Heßdorf, in Adelsdorf!«. Dabei fuchtelte sie mit den ausgestreckten Speckwurstfingern ihrer rechten Hand in der Luft herum und setzte irgendwo zwischen einer Deckenleuchte und einem präparierten Hechtkopf, der grimmig von der Wand glotzte, einen imaginären Punkt. »Alle die genannten Märkte sind von Röttenbach aus in kürzester Zeit mit dem Fahrrad erreichbar.« Hans-Dieter klatschte seiner Frau frenetisch Beifall. »Ist es die Sache wert, dass wir die Knoblauchkröte – den Lurch des Jahres 2007 – zum Tode verurteilen? Keineswegs!«, beantwortete sie sich ihre eigene Frage. »Kröten sind wertvolle Tiere«, führte sie aus. »In China haben sie wiederholt durch fremdartiges Verhalten rechtzeitig vor Erdbeben gewarnt und somit Tausenden von Menschen das Leben gerettet. Selbst die mexikanischen Indianer verehren Kröten als Überbringer von Botschaften aus der Unterwelt.«
Jupp Hochleitner hatte ganz genau hingehört und rief begeistert: »Verregg, der Konfuzius woar a Frosch und der Winnetou a Hailicher!«
Hans-Dieters Arbeitskollege aus Neuhaus war kurz eingenickt und ließ im Halbschlaf einen so gewaltigen Furz, dass er davon aufwachte. Er hatte davon geträumt, ein Kilogramm Sauerkraut alleine gegessen zu haben. Peinlich berührt sah er sich in der Runde um und lächelte Tatjana Rübensiehl zu, als ob nichts geschehen wäre. Mit seiner linken Hand fächelte er heimlich hinter seinem Rücken herum, um den intensiven Geruch möglichst schnell in der Luft zu verwirbeln. Jupp Hochleitner rümpfte die Nase. Außerdem langweilte er sich. »su a alder Saubär«, empörte er sich, »furzd do rum wie die Kuh im Schdall.«
Was hatte er mit der Knoblauchkröte und der Familie der Europäischen Schaufelfußkröte zu tun? »Die gänga mier am Orsch vorbei wie a Bäggla Reisbrei zwischen dreia und halba siema. Do binni, maani wu neigradn! Lauder Freschfedischisdn, Daabschwädzer und Xsundheidsabosdl. Schdingn dennas wie a alde Odlgrubn«, ging es ihm durch den Kopf.
Er hatte zwischenzeitlich sein drittes Weizenbier, kombiniert mit drei Williams-Christbirnen, intus. Seine Blase drückte. Er erhob sich ächzend und machte sich auf den Weg zur Toilette. Tatjana Rübensiehl sah ihn vorwurfsvoll an.
»Geh bloß schnell zum Biesln. Machd ner weider. Bin gleich widder do«, erklärte er und schlurfte aus dem Raum.
Nachdem Jupp Hochleitner sich mühsam die Treppe hinunter gequält und die Männertoilette betreten hatte, verließ Alois Holzheimer, der Gemeindekämmerer, gerade eine der Toilettenkabinen.
»Servus Holzi«, begrüßte ihn der Jupp, »do inna schdingds ja schlimmer als drobn bei die Kernerfresser.«
»Wennsd maansd«, antwortete der Kämmerer leidenschaftslos, während er sich die Hände wusch.
Jupp verschaffte seiner Blase stöhnend Erleichterung. Sein Blick fiel auf einen Spruch, der an die Wand gekritzelt war, und las ihn laut vor:
»Pinkel hoch und pinkel quer,
Pinkel hin und pinkel her,
Doch halte deinen Strahl ganz dicht,
Und pinkel auf den Boden nicht!«
»Hasd dees scho glesn, Holzi?« Dann fiel Jupp Hochleitners Blick in die Toilettenkabine, welche Alois Holzheimer gerade verlassen hatte. »Deen Schbruch häsd der mergn solln. Hasd ja mid deiner Schbridzbisdoln den ganzn Abborddeggl vullgmachd!«
Doch der Gemeindekämmerer gab keine Antwort mehr. Er hatte die Herrentoilette mit dem Gruß »Mer sichd si« bereits verlassen.
Der Toni ist wieder da
Seit dem Tod ihrer Ehegatten bewirtschafteten die beiden Witwen Kunni und Retta ihre kleinen Anwesen allein. Retta Bauer hatte noch einen Untermieter, einen Dirk Loos, zugezogener Rentner aus dem Sauerland, bei sich aufgenommen, dem sie das obere Stockwerk vermietet hatte. Dirk war ein netter und hilfsbereiter Kumpan und zahlte die Miete immer pünktlich. Lediglich sein gelegentlich noch aufflackernder Sexualtrieb ging ihr manchmal auf den Wecker. Ständig wollte er ihr dann an die Wäsche.
Kunni hatte da ihre eigene Meinung dazu: »Mier kummd ka Mannsbild mehr ins Haus! Su a alder, geiler Bogg, dei Dirg! Na ja, wenn aner scho Dirg haßd! A Breißnbeidl hald!«
Gerade saßen die beiden bei Kunni Holzmann in der Küche. Trotz vorgerückter Stunde verbreitete frisch gebrauter Kaffee seinen aromatischen Duft im gesamten Erdgeschoß. Auf dem Küchentisch stand ein Rhabarberkuchen, den Kunni am Vormittag gebacken hatte. Auch eine kleine Glasschale mit frisch geschlagener Sahne stand auf der sechzig Jahre alten Brokattischdecke . Von der Wand grüßte ein Hochzeitsfoto von Kunni und Schorsch, welches in einem goldfarbenen Messingrahmen gehalten wurde. Die beiden Witwen bereiteten sich geistig auf den neuesten Tatort vor: »Viktualienmarkt in Flammen«. Aber noch war Zeit für einen kleinen Tratsch.
»Hasd dees scho gherd«, eröffnete die Retta die Unterhaltung, während die Kunni ihre Tasse mit dem schwarzen Gebräu füllte, »der Toni is widder da.«
»Was fier a Froni?«, erkundigte sich die Kunni, der eine Froni in keinster Weise bekannt war. Sie ärgerte sich jedes Mal, wenn es um Leute ging, die sie nicht kannte, und sie kannte fast alle alteingesessenen Röttenbacher.
»Der Toni«, wiederholte die Retta eine Nuance lauter, »ned Froni! Iech kenn ieberhabd ka Froni.«
»Iech ebn aa ned«, bestätigte die Kunni. »Was fier an Toni maansdn na?«
»Iech maan den Welleins Toni, der vor – wie lang is dees edz her? fimbf Joahr derfds scho her sei –nach Kiena ausgwanderd is, zu die Kieneesn, die mid die Schlidzaugn.«
»Ach, den mannsd du. Dees is doch nu kaa fimbf Joahr her, hechsdns drei.«
»Ah babberlabab. Mindesdens fimbf Joahr, wenn ned nu mehr. Der had doch seinerzeid im Loddo an Fimbfer mid Zusadzzahl ghabd und achzichdausend Euro gwunna. Iech waas dees nu genau, weiler seiner Mudder damals ieberhabd nix abgebn had, der alde Schlagg.«
»Schdimmd!«, bestätigte die Kunni, »edz wus des sagsd, fällds mer aa widder ei. Sei Mudder woar doch damals su grang gwesn.«
»Edzerdla mach abber an Bungd!«, entsetzte sich die Retta. »Grang gwesen! Dassi fei ned lach! Gschluggd hads wie a Schbechd! Die woar doch den ganzn Dooch bsuffn. Verschdehsd mi? Vull wie a Haubidzn! Abgfilld bis zum Schdehgrogn!«
»No woahrscheinli, weil’s ihr Buu so gärcherd had! Der had doch damals sei Geld, dees wu er bei der FORMA verdiend had, mid lauder su Schiggsn in der Disgo aufn Kubf ghaud. Du wassd scho, die Weiber damols, die den ganzn Dooch mid Zigareddn in ihre Schlebbern rumgloffn sen. Den ganzn Dooch hams nix zu du ghabd. Jede an mordsdrum Orsch wie a Brauereigaul. Kwalmd hams alle wie die Schlööd und ghusd, ghusd hamms sochi der, wie hunnerd Asdhmagrange nach an Maradonrenna. Su had die Sach damals ausgschaud.«
»Jedenfalls hadder bei der FORMA aufghörd, der Debb«, fuhr die Retta fort, »wie er dees Geld im Loddo gwunna ghabd had. Dabei had deer bei der FORMA su an dolln Dschobb ghabd. Der hädd si sei Händ nemmer dreggich machen müssn. Da kündichd des Debberla und wanderd nach Kiena aus. Zu dera Baggaasch dadrübn, die ned amol mid Messer und Gabl essn kenna, wie sich’s gherd.«
»Genau«, gab ihr die Kunni Recht, »und verschdeh dusd’es aa ned, die sprechn ja aa ka Hochdeidsch, so wie mier! Und du sagsd, der is widder da? Hadder wohl sei ganz Geld verjubld, dord driebn?«
»Dees waaßi ned«, entgegnete die Retta, »sei Mudder, die alde Welleini, hads mer hald derzähld, dasser widder da is. Ogebn hads wie zeah naggerde Necher.«
»Warum edz dees?«, wollte die Kunni wissen.
»Weil er angeeblich der Gschäfdsfiehrer vo dem neia Subermargd wird, der im Indusdriegebied gebaud wern soll. ›Iech hab scho immer gwissd, dass mei Buu amol groß rauskummd‹ hads gsachd, und dass iehr Toni su a scheene, kienesische Freindin midbrachd had. Die soll viel schenner als alle Röttenbacher Weiber sei, hads gmaand.«
»Edz heer abber auf«, entrüstete sich die Kunni, »deer alde Schlagg soll Gschädsfiehrer wern? Der is doch bleeder wi die Nachd finsder!«