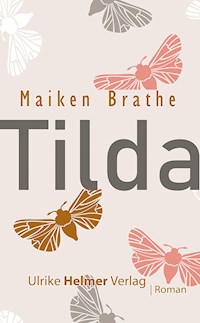16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ulrike Helmer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Edith ist frisch verwitwet und glücklich. Endlich Zeit, ihre Träume zu erfüllen, ohne dass ihr Mann sie bevormunden kann. Doch da ist noch Ediths Sohn Klaus. Der übernimmt die Attitüden seines Vaters, und das Schlimmste: Klaus fühlt sich pudelwohl im Hotel Mama! Hilfe kommt von Ediths neuer Freundin Kim, die so ganz anders ist als die Frauen, die Edith bisher kannte. Bei Waldspaziergängen mit ihren Hunden schmieden die beiden Frauen Pläne, Klaus aus dem mütterlichen Nest zu scheuchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Ähnliche
Maiken Brathe
KLAUS MUSS RAUS
Roman
ULRIKE HELMER VERLAG
ISBN (eBook) 978-3-89741-922-3
ISBN (Print) 978-3-89741-462-4
© 2022 eBook nach der Originalausgabe
© 2022 Ulrike Helmer Verlag, Sulzbach a. Taunus
Alle Rechte vorbehalten Covergestaltung: Atelier KatarinaS / NL unter Verwendung eines Fotos von © fotograf-halle.com / Adobe Stock
Ulrike Helmer Verlag Klosterhofstr. 3, 65843 Sulzbach a. Taunus
E-Mail: [email protected]
www.ulrike-helmer-verlag.de
Für alle Hundemenschen und Meerjungfrauen
Kapitel und Versuch #1: mit Worten
Heinz ist tot. Jetzt muss nur noch Klaus verschwinden. Ich weiß, das ist mein einziger Ausweg. Kim hat zu mir gesagt: »Edith, wenn du deinen Sohn loswerden willst, dann darfst du keine Zeugen haben und niemandem vertrauen.« Recht hat sie. Kim vertraue ich. Sonst niemandem.
Im November vor drei Monaten habe ich sie kennengelernt. Da war mein Mann fast ein Jahr hin. Wir trafen uns im Wald neben unserer kleinen Stadt, die mir vorkommt, als ende sie immer und überall an einer Autobahn, einem Fluss, einer Baumschule, eingesperrt bis auf diesen einen Weg durch das Wäldchen, durch das man in die Marsch gelangen und eine Ahnung davon bekommen kann, was Weite ist.
Es dämmerte bereits am Nachmittag und der Nebel verwob die kahlen Bäume zu einer grauen Wand. Es fühlte sich gut an, allein, abseits auf der Lichtung zu stehen. Sich abseits fühlen, kenne ich mein Leben lang. Aber ich bin nicht mehr allein, seit Paulchen da ist.
Als Kim und ich uns trafen, lebten mein Hund und ich erst wenige Wochen zusammen. Paulchens Hintern guckte aus einem der vielen Kaninchenlöcher, die den aufgeweichten Boden der Lichtung perforierten. Den ganzen Vormittag hatte es geregnet. Es war noch immer das Geräusch der Tropfen zu hören, wie sie auf die Blätter fielen, die sich unter ihnen neigten und sie von sich abgleiten ließen – ein sanftes melodisches Trommeln, so kam es mir vor. Wenn doch auch alles so leicht von mir abfiele, hatte ich gedacht und nach meinem Kleinen Ausschau gehalten.
Im Tierheim hatten sie mir damals nicht erzählt, dass Zwergpudel gerne jagen. Aber geändert hätte das nichts. Als Paulchen mich mit seinen schwarzen Knopfaugen über der ergrauten Schnute durch die Gitterstäbe des Zwingers anschaute, wusste ich, er ist genauso verloren wie ich.
Hier im Wald in Aktion bewundere ich den Kleinen täglich neu für seine Begeisterung, Ziele zu verfolgen, ohne einen Erfolg zu erwarten. Nie hat er etwas gefangen, jagt nur einem Traum hinterher. Der Versuch ist Belohnung genug.
Trotz der Kälte setzte ich mich an dem Novembertag auf die Bank am Rande der Lichtung und streckte die Beine aus. Ein Specht hämmerte irgendwo in einer Baumkrone. Mit geschlossenen Augen sog ich den Duft des Waldes ein, roch die Mischung aus Holz, Moder und letztem Blütenzauber, obwohl ich mir den wohl eher einbildete, und ließ meine Gedanken treiben. Nach einer Weile lauschte ich, hielt den Atem an. Irgendetwas stimmte nicht. Die Vögel waren verstummt, kein Rascheln im Unterholz zu hören. Ein seltsames Geräusch, etwas knackte, ich riss die Augen auf … Da sah ich es! Das Ungeheuer! Und Paulchen! Paulchen in seinem Maul! Nur ein leises Gurgeln hörte ich und fing an zu schreien und zu schreien! Kalter Schweiß überlief mich, alles brannte, die Augen, die Lunge! Ich konnte einfach nicht aufhören zu schreien! Mein Liebling! Nur noch die Beine lugten unter den sabbernden Lefzen hervor! Das Ungeheuer war riesig, schwarz und, wie ich nun begriff, auch ein Hund. Was nichts daran besser machte.
Ich versuchte loszustürmen, aber der Schock fesselte mich an die Bank. Die Beine tonnenschwer, konnte ich nicht einmal die Hand heben, realisierte, dass selbst meine Schreie nicht nach draußen drangen. Wie lang können Sekunden dauern? Wartestunden am Krankenlager, Albtraumnächte am Bett des Kindes, lautlose Stunden nach dem Blick auf Heinz.
Ein Schnauben und Keuchen drang an mein Ohr. Am Rande meines Blickfelds erschien ein dürres Männchen in Jogginghose und Regenmantel. Beides schlackerte um seine dünnen Extremitäten. Die windige Gestalt sah wie ausgetrocknet aus. Reflexartig dachte ich, die Vogelscheuche vom benachbarten Feld sei hierher geflohen. Verrückt, was die Gedanken alles mit dir machen, wenn der Körper nicht ablenken kann. Ich schaffte es nicht einmal, den Kopf zu wenden. Aus den Augenwinkeln sah ich das Männlein winken, die Lippen Worte formen, ohne dass ich sie verstand. Dann ließ mich mein Bleigespenst los und ich sprang auf, kämpfte mich zu dem Riesenhund, die kalte Luft brannte in meiner Lunge, während hinter der Bank ein paar Tauben aufstoben, hörte das typische flappende Geräusch ihrer Flügel, ohne sie zu sehen. Die Sinne geschärft. Den Modus auf Urinstinkt. Die Angst um Paulchen trieb mich an, schneller zu laufen, dem Bleigespenst zum Trotz, zum Monster, zu einer Dogge, wie ich heute weiß, schwarz wie die Nacht, schwarz wie der Teufel. Ich war immer noch in einem Albtraum gefangen und kam im regennassen Gras kaum von der Stelle. Das Ungeheuer schnaubte – aus seinem Maul ragten nun nur noch Paulchens Pfoten hervor –, ich hastete einen weiteren Schritt nach vorne, versackte mit dem Fuß in einem Kaninchenbau und stürzte auf den schwammigen Boden, das Gesicht landete im Modder. Etwas Sämiges umschloss meinen Mund und als ich den Kopf wieder hob, pappten mir vergammelte Blätter an der Wange, während Schmodder meine Augen verklebte. Ich wischte sie blank, meine Tränen halfen dabei, und dann erblickte ich sie. Die Fremde. Die Frau in Schwarz. Nur von Weitem hatte ich sie bisher gesehen, einen grauweißen Terrier immer an ihrer Seite. Mit beiden Händen stemmte sie das Maul der Dogge auf, während der struppige Terrier bellte. Hätte sie einen Laut von sich gegeben wie etwa der Hulk aus einem von Klausʼ Actionfilmen, ich wäre nicht erstaunt gewesen. Ich starrte erst sie an, dann die gelben Zähne des Ungeheuers und Paulchens Pfoten, die sich nicht mehr rührten. Nach einer Zeit, die mir vorkam wie Stunden, plumpste mein Liebling endlich aus dem Maul. Ich dachte, er wäre tot! Ich lag immer noch am Boden, nur das Gesicht aus dem hohen Gras erhoben. Alles in mir pochte, mein Herz in der Brust, der Lunge, in den Schläfen. Es will raus, dachte ich, zerspringen. Paulchen tot und das Leben pulsiert in jeder meiner Zellen? »Lass es umgekehrt sein!«, betete ich und sank mit dem Gesicht zurück in den Matsch.
Eine raue Zunge kitzelte mich am Ohr. Ich hob den Kopf. Hustend richtete ich mich auf, spuckte Erde aus, zog meinen Liebling an die Brust. Auch wenn ich fror, die Kleidung nass und dreckig war, war es ein wundervoller Moment. Paulchen leckte mein Gesicht. Er war selbst klitschnass, putzte aber mich, sein Frauchen. Den Rat des TV-Hundetrainers ignorierte ich geflissentlich, der in der letzten Sendung dazu angehalten hatte, tierisches Verhalten mit gleichem zu spiegeln. Zumal Paulchen nicht nass vom Regen, sondern nass vor Doggenspucke war. Eine zweite Zunge gesellte sich dazu. Die zierliche weißgraue Terrierdame übernahm mein anderes Ohr. Anstatt die vereinten Bemühungen zu würdigen, wehrte ich perplex die fremde Hündin ab, die enttäuscht Sitz machte. Als ich mich umsah, immer noch am Boden, Paulchen an mich gepresst, erkannte ich nur den unteren Teil des schwarzen Mantels, der auffallend große Knöpfe trug und ausladend um die Knie seiner Trägerin wippte, als wäre im Saum ein Hula-Hoop-Reifen eingenäht. Ich reckte den Kopf, auch wenn der Nacken schmerzte. Das erste Mal sahen wir uns in die Augen. Neben ihr erschien der Schädel des Monsters.
»Brutus ist eigentlich ganz lieb«, sagte die Fremde mit einer warmen, tiefen Stimme und tätschelte den Riesenhund. »Ich kenne ihn schon, seit er so klein ist.« Sie zeigte auf ihre Stiefelhöhe.
Dann schloss die Vogelscheuche zu uns auf. Der schwarze Mantel schwang hektisch um die Beine der Fremden, als sie sich dem Mann zuwandte. Die Terrierhündin kläffte wütend.
»Frank! Hätte der Pudel auch nur einen Kratzer abbekommen, dann hättest du dich gleich in eine deiner Kisten legen können, und zwar für immer!«, zischte sie den Doggenbesitzer an.
Ein Schauer lief über meinen Rücken und ich presste Paulchen noch enger an mich. Anscheinend fehlte ihm tatsächlich nichts. Aber wie hatte die Frau das bereits wissen können?
»Schon gut, Kim«, stammelte das dürre Männchen und pulte mit den Fingern am Rand seines Ärmels.
Paulchens Retterin hielt mir die Hand hin. Nach kurzem Zögern ließ ich mich auf die Beine ziehen. Meine Tränen flossen, ohne dass ich es kontrollieren konnte. Der Mann, der Frank hieß und Menschen sonst eher in Löcher verfrachtete, als ihnen herauszuhelfen, packte die Dogge am Halsband und schaute auf seine Füße. »Grube«, murmelte er in den weiten Kragen seines Regenmantels. Unfreiwillig musste ich grinsen. Ein Bestatter namens Grube. Haha. Während die Frau mich zur Bank führte, zog die Vogelscheuche Brutus hinter sich her. Die Dogge hatte nur Augen für seine Bezwingerin. Erst am Rand der Lichtung würdigte sie ihr Herrchen eines Blickes, als es ihr ein Leckerli hinhielt.
Wir setzten uns auf die Bank und schwiegen. Die Fremde starrte auf die Lichtung. Mein schmerzender Nacken zwang mich ebenfalls dazu, wobei ich verstohlen die Stiefel meiner Sitznachbarin musterte, in der Hoffnung, bald auch den Rest in Augenschein nehmen zu können. Während in mir Angst und Dankbarkeit mit Neugier um die Oberhand rangelten, tobten unsere Hunde unbeschwert über die laubbescherte Wiese, als wäre heute just der schönste Tag. Damals erkannte ich noch nicht, dass es auch einer meiner schönsten war. Denn es war der Tag, an dem Kim in mein Leben trat.
»Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday, liebe …« Wie soll ich mich nennen? Liebe Versagerin? Liebe Unsichtbare? Liebe Mama? Liebe Güte, was habe ich aus meinem Leben gemacht? Oder machen lassen …
Ich sitze allein an meinem neunundfünfzigsten Geburtstag in der Küche. Das heißt, nicht ganz allein. Unter der Küchenbank schnarcht Paulchen und zuckt im Traum mit den Pfoten, die über die Küchenfliesen schaben. Ich habe ihm ein flauschiges Bett gekauft für arthritische Hunderücken, Memoryschaum unter dem mit Comic-Knochen verzierten Stoff. Aber vielleicht will Paulchen sich gar nicht erinnern. Ich möchte das Erinnern auch gerne abstellen.
Es ist mein erster Geburtstag ohne Torte, ohne Blumen und ohne Heinz. Der erste Februarmonat allein. Die elf Monate davor habe ich bereits ohne Heinz hinter mich gebracht. Meine Lesebrille beschlägt beim Weinen, und ich lege sie auf den Küchentisch. Während all der heinzlosen Tage blieben meine Augen trocken, aber seit dem Vorfall mit der Dogge reicht ein toter Käfer im Windfang, um meine Schleusen zu öffnen. Ich fahre die Konturen der Brille nach. Ein schlichtes Modell. Es ist die schwarz umrandete Sehhilfe, die meinem Vater gehört hatte. Immer wenn ich sie trage, fühle ich seine Finger in meinem Gesicht, auch wenn mir nun in die Nase gekniffen wird und nicht in die Wange, wie er es immer tat, wenn er mich lachend vorlaut schimpfte und mich anschließend durchkitzelte. Heinz fand immer, ich solle die Brille richten lassen. Ich log, sagte, das habe ich schon erledigt, und wandte mich ab, wenn ich sie abends abnahm, damit er die Druckstellen nicht sah. Heinz löschte eh meist das Licht, sobald er im Bett lag, und ich tastete mich im Dunkeln durchs Zimmer. Mit den Jahren ging das auch blind. Ich kenne jeden Schritt, jede Kommodenkante. Schon lange muss ich nicht mehr tasten.
Als mein Vater starb, hörte meine Kindheit auf, obwohl ich noch keine zehn Jahre alt war. Ich fuhr noch einstellig. Als Vater starb, versteinerte Mutter. Sie stieß mich weg, es gab keine zärtlichen Berührungen mehr und ich bekam das Gefühl, schuld an Vaters Tod zu sein. Nächtelang grübelte ich darüber nach, womit ich sein Herz so sehr beschwert hätte, dass es stehen blieb. Ich war nicht einmal bei ihm gewesen. Mutter auch nicht. Nur eine Frau namens Natascha, wie die Polizei berichtet hatte, und als kleines Mädchen kam ich zu dem Schluss, dass ich meinen Vater nie hätte allein lassen dürfen. Es war meine Schuld! Das ist meine Schuld, die ich immer noch spüre. Auch wenn mir klar ist, dass die Frau namens Natascha sich nicht nur in die Wange hat kneifen lassen. Seit Vaters Tod mied Mutter meine Gegenwart, und ich gab es mit der Zeit auf, das ändern zu wollen.
Je älter ich wurde, desto mehr dachte ich an Flucht. Hatte meinen Schulranzen immer parat, um ihn in Windeseile zu leeren und Kleidung und Proviant hineinzustecken. So manches Butterbrot verschimmelte in den verborgenen Tiefen meines Schrankes. Die Jahre vergingen und die einzige Option zur Flucht, die sich mir damals bot, hieß Heinz. Wir heirateten, als ich achtzehn Jahre jung war. Heinz war zwanzig Jahre älter, ein richtiger Mann wie Papa und bestens als Komplize mit eigenem Fluchtauto geeignet. Er verführte mich, vor allem führte er mich aber hinaus aus Mutters beklemmender Ablehnung.
Klaus wurde in Heinzʼ sonnengelbem Opel Kadett gezeugt. Vielleicht ist Klaus deshalb später Postangestellter geworden. Gelb steht ihm gut. Es war ihm sozusagen in die Wiege gelegt. Als ich nach meinem ersten Geschlechtsverkehr nach Hause kam, begriff Mutter sofort, was los war. An der Kleidung kann es nicht gelegen haben. Den Rock hatte Heinz nur nach oben geschoben, die Brüste durch die Bluse geknetet. Vermutlich wusste Mutter es, weil der gelbe Opel eine verstörte Edith ausgespuckt hatte. Wenn ich mich daran erinnere, sehe ich mich als separate Person. Sehe nicht Mutters Gesicht, die steile Falte zwischen ihren Brauen, spüre nicht Heinzʼ feuchte Hand an meiner Wange. Schaue mir wie einer Statistin in einem Samstagabendfilm zu. Klein Erna und der Kavalier. Wie ein alter Schinken aus den Fünfzigern. Als die Leute es noch lustig fanden, wenn Männer blutjunge Frauen in prekäre Situationen brachten. Das Bleigespenst regelte den Rest.
Es gab nur drei Verabredungen. Die vierte fand bereits statt, um das Aufgebot zu bestellen. Nach meiner Vermählung trennten sich Mutters und meine Wege für immer. Ihr Tod vor ein paar Jahren berührte mich nicht. Wir hatten uns bereits seit Vaters Tod verloren.
Ich sehe aus dem Fenster oberhalb des Spülbeckens. Frauenfreuden mit Ausblick, so hatte Heinz das bei der Küchenplanung genannt. Wenn ich irgendwann weiß, was Frauenfreuden sind, werde ich darüber nachdenken, welchen Ausblick die haben sollten. Die Straßenlaternen spenden etwas Licht. Die Nachmittage sind immer noch zeitig dunkel. Ich bin froh, dass die neuen Nachbarn schräg gegenüber ihren Vorgarten mit Solarlampen bestückt haben. Die leuchten im Winter zwar kaum, aber verbreiten immerhin einen Hoffnungsschimmer. Ab und an strahlen die Scheinwerfer der Fleurop-Lieferwagen die Häuserwände an. Wenn ich in der Küche geblendet werde, fühle ich mich wie ertappt. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Fleurop nutzt an verkaufsintensiven Tagen wie Valentins- oder Muttertag unsere Anliegerstraße als Abkürzung. Frau Reineke, die ebenfalls vis-à-vis wohnt, hat schon mehrfach Beschwerde bei der Polizei eingelegt.
Das Haus neben Frau Reinekes steht seit Monaten leer. Die Rollos sind herabgezogen, sonnenvergilbt. Weiß, das zu Gelb wurde. Auf der Fensterbank lehnt ein vertrockneter Benjamini an der schmutzigen Fensterscheibe wie ein Kind, das die Wange ans Glas drückt und sich langweilt, weil es drinnenbleiben muss. Die meisten Blätter hängen noch verdorrt an den Zweigen. Ab und an fällt eines ab, ohne dass ich es mitbekomme. Sie säumen den unteren Rand des Rahmens. Vorher hat dort die Frau Witte gewohnt. Eine riesige, schöne Frau mit großen Händen und Füßen, etwas älter als ich. Ich starrte sie immer an, wenn ich sie sah. Wie kann so viel Mensch so attraktiv sein? Wenn wir nebeneinanderstanden und uns unterhielten, tuschelten und kicherten die vorbeilaufenden Schulkinder. Die Riesin und die Zwergin. Frau Witte lehnte sich stets an den Gartenzaun, die Knie eingeknickt, den Oberkörper vorgebeugt, um die Distanz zwischen uns zu verringern. Trotzdem musste ich zu ihr aufschauen und tat es gerne. Sie erzählte mir von ihrem Eskapismus. Ein Wort, das ich mir erst mit einer Internetrecherche entschlüsselte. Das Abtauchen in fiktive Welten, in Romane, die ihr der Bertelsmann-Buchclub vorschlug. Wegen ihr begann ich mit dem Lesen. In den vielen Jahren unserer Nachbarschaft überquerten Liebesgeschichten, Biografien, Klassiker und Krimis das holprige Pflaster unserer Straße.
Irgendwann war Frau Witte plötzlich fort. Ihr Mann hat nie darüber gesprochen, nichts erzählt. Auch die Polizei war nicht da, es schien alles in Ordnung zu sein. Ab da gab es keine Gründe mehr für mich, die Seite zu wechseln. Kein Alibi, nach ihrer großen Hand zu greifen und ein Buch für meine Flucht aus der Wirklichkeit zu erhalten oder ihr einen Krimi zurückzubringen. Herr Witte hat sie ermordet!, durchfuhr mich die Erkenntnis eines Tages. Heimlich, mit rasendem Herzen, suchte ich den Nachbarsgarten nach einem neu angelegten Beet ab, ohne fündig zu werden. Ich wollte im Haus nachsehen und Hinweise finden, eine lose Diele vielleicht oder eine neue Zwischenwand (die Häuser der Straße waren schließlich identisch gebaut). Einen Schlüssel hatte sie mir schon lange anvertraut, er brannte in meiner Tasche, aber die Angst vor Entdeckung lähmte mir die Glieder. Frau Hansen aus unserer Straße erzählte von Frau Wittes Verwandten in Amerika. Ich glaubte das nur allzu bereitwillig und schäme mich heute dafür. Würde jemand nach mir fragen, falls Klaus mich von der Bodenleiter geschubst hätte? Aber warum sollte er? So dumm ist er nicht.
Herr Witte ging vor zwei Jahren in eine Tagespflegestelle. »Vorübergehend«, betonte er und ließ alles daheim so, wie es war. Sein Umzug ins Pflegeheim vollzog sich fließend. »Vorübergehend«, wie er Frau Reineke telefonisch mitteilte und wie sie voller Stolz allen Nachbarn über den Gartenzaun zutrug. Die Auserwählte, die Siedlung zu informieren. Frau Wittes Schlüssel versteckte ich im Putzschrank, einem der sichersten Orte im Haus. Jeden Tag dachte ich an sie, wollte nachsehen, Indizien suchen. Doch Heinz wurde krank, und ich schaffte es nicht, so vieles nicht mehr. Es dauerte lange, bis er sich wieder erholt hatte, und danach erholte sich der Benjamini im Fenster nicht mehr. Ich habe immer noch ein Buch von Frau Witte. Ein gebundenes Exemplar vom Bertelsmann Club.
Es hat den ganzen Tag geschneit, nicht ungewöhnlich für Mitte Februar, deshalb haben Meiers und Hansens bereits am Mittag aufgegeben, die Bürgersteige freizuschippen. Nur Frau Reineke tritt jede halbe Stunde in ihren gelben Gummistiefeln und einem dunklen Pelzmantel vor das Haus und schabt auf den Gehwegplatten herum, als erwarte sie jemanden zum heutigen Valentinstag. Einen Funken Bewunderung habe ich für sie. Sie ist so alt, wie Heinz jetzt wäre, wird im Sommer achtzig. Eine zähe, alte Frau, behände, obwohl sie einen Körper wie ein Regenfass hat. Wie viele Tiere wohl für den Mantel sterben mussten!
Nach den Geburtstagstränen folgt die Schere. Ich sitze am Tisch und greife mit beiden Händen in meine vollen Haare. Graue Locken, schwarze Restpigmente, als gäbe es etwas zu erinnern. Ein reibendes Geräusch, als ich sie abschneide.
Heinz liebte meine langen Haare, gefasst zu einem Knoten, den nur er abends im Bett lösen durfte. Ließ er das Licht an und klopfte aufs Laken, während er aufrecht im Bett wartete, stolperte ich im Hellen zur Kante und setzte mich. Mit beiden Händen fasste Heinz in meine Lockenpracht, presste sein Gesicht hinein und roch an mir mit leisem Summen. Dann wusste ich, ich würde morgen wieder in Kamille baden müssen.
Meine Locken bedecken den Tisch und fallen sacht zu Boden wie der Schnee vor dem Fenster, während ich weiter an meinem Kopf herumsäbele. Als ich die Kühlschranktür klappen höre, schrecke ich auf und lasse die Arme sinken. Das grelle Licht der praktischen Leuchtstoffröhre an der Decke blendet mich für einen Moment. Praktisch. Ein Lieblingswort von Heinz.
»Keine Salami da?«
Klaus dreht sich nicht zu mir um, während er spricht und die Fächer absucht. Die Kälte des Kühlschranks strömt mir entgegen. Mit links zieht Klaus ein Bier aus der Kühlschranktür, während er in der benachbarten Küchenschublade rechterhand nach einem Flaschenöffner fummelt.
»Wenn du morgen einkaufst, bring noch Bier mit.«
Erst jetzt merke ich, dass Paulchen nicht mehr schnarcht. Es kommt mir so vor, als wäre der Hund gar nicht da. Als ich mich vorbeuge, um unter die Bank zu blicken, schaut mein Kleiner mir direkt in die Augen. Er sitzt in der Küchenecke, mit dem Rücken nach hinten. Wenn Klaus im Raum ist, macht der Hund sich unsichtbar. Immer wieder fällt mir das auf. Vielleicht hat er schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht, überlegte ich am Anfang. Aber bisher mag er nur Klaus nicht. Oder eben Männer, die mit Carrera-Autos spielen oder Salami essen oder Bier trinken oder die Füße aneinanderreiben, was einen seltsamen Ton macht, der immer lauter wird, je mehr man ihn zu ignorieren versucht.
»Wenn Sie sich für einen Tierheimhund entscheiden, bedenken Sie, dass Sie eine unbekannte Leidensgeschichte mit ins Haus einladen«, hatte der TV-Trainer gesagt und mich am Anfang verunsichert. Ob ich meiner Entscheidung gewachsen sei? Aber Paulchen hilft mit: Er geht Klaus aus dem Weg.
Mir abgewandt starrt Klaus, so vermute ich, aus dem Fenster. Er hat die Flasche angesetzt und trinkt. Das Gluckern des Biers erinnert mich an die Töne, die Paulchen macht, wenn er erst auf einer Wiese grast und sich anschließend übergibt. Die kahle Stelle an Klausʼ rotblondem Hinterkopf ist wieder etwas größer geworden. Vermutlich hat er das nicht einmal bemerkt. Ob ihn die beginnende Glatze stört? Ist ihm bewusst, dass er heute am Valentinstag niemandem Blumen geschenkt hat? Keiner Geliebten. Nicht einmal seiner Mutter. Mit den Jahren sieht er Heinz immer ähnlicher. Ich muss schlucken bei dieser Erkenntnis. Bevor ich weiter darüber nachdenke, kehre ich mit den Armen die Haare auf dem Tisch zusammen.
»Ich …« Soll ich ihn daran erinnern, dass ich heute Geburtstag habe? Das weiß er doch. Als kleiner Junge hat er mir Briefe gemalt. Mama stand da, und die Beste, in ungelenken Buchstaben, mit einem krakeligen Herzen daneben. Einmal hat er sich mit einem Nachbarsjungen gestritten, weil der behauptet hatte, der Valentinstag sei für alle und nicht nur für Klausʼ Mama erfunden worden.
Ich betrachte die abgeschnittenen Locken. Heinz hätte das nie toleriert. Noch dazu in der Küche. Nun kann er nicht mehr summen, es sei denn, er presst sein Gesicht in die Haare auf der Platte. Dass er ohnehin nicht mehr summen kann, ist nebensächlich. Kein Summen mehr. Ich betrachte Klausʼ Rücken. Nein, ich sage nichts. Vermutlich würde er sich schlecht fühlen, weil er meinen Geburtstag vergessen hat. Schuldgefühle will ich ihm nicht machen. Um Gottes willen! Mit Schuldgefühlen kenne ich mich aus. Die mute ich meinem Kind nicht zu.
Geräuschvoll stapft Klaus nach oben. Das Do-not-disturb-Schild klappert am Griff seines Kinderzimmers im ersten Stock. Selbst hier unten im Erdgeschoss höre ich seinen Fernseher lärmen. Draußen fällt weiter der Schnee. Zumindest ahne ich das, denn hier drinnen trägt die Welt das Tarnkleid meiner braunen Küche. »Braun, das ist zeitlos und gefällt ewig!«, hatte Heinz prophezeit, als ich in sein Elternhaus gezogen war. Das fanden wohl auch schon seine Eltern. Seit den Siebzigerjahren hatte sich im Haus nichts verändert, bis Heinz nach Renteneintritt die Küche renovieren ließ. Das helle Braun wich einem dunklen.
Paulchens Zunge kitzelt mich an dem schmalen Streifen nackter Haut zwischen Socke und Hosenbein. Ich lächle, greife unter die Bank und erwische sein Ohr. Nachdem ich ihn zärtlich gekrault habe, kehre ich meine Locken zusammen, werfe sie in den Mülleimer unter der Spüle und betrachte mein Spiegelbild in der Fensterscheibe. Reflexartig presse ich die Hände auf meinen gerupften Kopf. Einzelne Büschel stehen ab, stellen sich trotz meiner Versuche, sie zu plätten, immer wieder auf. Immer und immer wieder. Ein Teil von mir will sich nicht länger anpassen.
Seit meiner Begegnung mit der Dogge und dem matschigen Boden hielt ich tagtäglich Ausschau nach der schwarz gekleideten Frau. Die Sorge, dem Hundemonster erneut und ohne Beistand zu begegnen, ließ mich stets mit Herzklopfen den Wald betreten. An der Art, wie Paulchen den schmalen Pfad, der vom öffentlichen Parkplatz zum Waldrand führt, entlangtrippelte, erkannte ich schon, ob ich Kim und ihre Terrierhündin treffen würde. Schnupperte er ausgiebig an den markierten Heckenbegrenzungen rechts und links, war die Hündin noch nicht da gewesen. Klebte seine Nase hingegen auf der Erde und er düste hektisch umher, beeilte ich mich, hinterherzukommen.
Kim hob manchmal die Hand, wenn sie mich von Weitem sah. Meist blieb sie einfach stehen, als wartete sie nur auf ihre Hündin. Die steckte gern bis zur Hüfte in einem Erdloch, sodass sie uns selten bemerkte, während Paulchen mich an einer stramm gespannten Schnur hinter sich herschleppte. Oft hechelte nicht nur Paulchen, wenn wir Kim erreicht hatten. Sie beugte sich vor, während ich nach Luft schnappte, und schnallte den Pudel ab. Jedes Mal merkte ich es zu spät und erschrak, wenn die Rollleine sich mit einem zischenden Laut aufspulte und der Verschluss schmerzhaft an meine Finger schoss.
Beim ersten Treffen auf der Lichtung hatten wir uns einander so förmlich vorgestellt, als seien wir auf dem Begräbnis eines gemeinsamen Bekannten. Angesichts meiner Erdnähe und der Todesangst um Paulchen fand ich den Vergleich ganz passend.
»Edith Muffel und Paulchen«, hatte ich aus dem Morast geflüstert und ein Grinsen erwartet, das ausgeblieben war.
»Wenn du den Namen Muffel nicht magst, kannst du ihn ändern lassen.«
Das Blut schoss mir in die Wangen. Kim musterte mich. »Okay, Edith, du magst ihn nicht. Dabei klingt er ganz niedlich.« Sie wies auf den Terrier, dessen Ohr gerade ausgiebig von Paulchen geleckt wurde. »Das ist Tuuli. Ich heiße Kim Müller. Müller wie Smith.« Sie lächelt immer noch, und mein Herz flatterte ein bisschen, weil ihr Lächeln so überraschend aufgetaucht war wie ein Klaus im Waschkeller. »Müller ist so gewöhnlich, den Namen könnte ich auch ändern lassen«, fuhr sie fort. Ich betrachtete die zarten Falten um ihre Augen. Ich schätzte sie auf Ende dreißig, Anfang vierzig. Unfassbar jung, wie ich fand, wenn man wie ich auf die sechzig zugeht. Das Du, das so selbstverständlich über Kims Lippen kam, gehöre zum alltäglichen Umgang bei Leuten mit Hunden, wie ich von ihr erfuhr, und sei so gewöhnlich wie die gemeinsamen Spaziergänge und die Entrüstung über Mountainbiker in Parkanlagen, oder dass man sich mit einem Leckerli oder Kotbeutel aushilft, wenn die eigenen verbraucht sind. »Edith, das sind Hundemenschen«, sagte Kim und lächelte. Da Paulchen und ich bisher bei unseren Runden jeden Kontakt gemieden hatten, wusste ich das nicht. Kims Du fühlte sich im ersten Moment wie ein besonderes Geschenk an. Exklusiv. Nur für mich. Dabei gehört es zum Einmaleins der Hundemenschen, das sie mir bis heute beibringt. Und anderes. Quasi alles, was gewöhnlich ist im Umgang mit Menschen.
Kim ist alles andere als gewöhnlich. Obwohl sie oft schweigt, beginnt sie fast jeden Satz an mich mit meinem Namen.
»Edith, vertraue Paulchen ein bisschen. Der läuft dir nicht weg«, »Edith, du siehst traurig aus. Was ist los?«
In den letzten drei Monaten habe ich meinen Namen öfter gehört als in den vergangenen vierzig Jahren Ehe. Vierzig Jahre hatte ich das Gefühl, ich spiele etwas vor. Wenn ich den Tisch deckte, Essen kochte, abräumte, fühlte ich mich wie in einer Rolle. Ungelernt wie ich war, eine Laiendarstellerin. Mich filmte eine unsichtbare Kamera, ich wurde beobachtet, begutachtet. Regieanweisungen vom Schauspielkollegen Heinz, der nie zufrieden war mit der Amateurin an seiner Seite. Die Kartoffeln zu fest, der Kuchen zu weich, die Salamistullen ohne Beilage. Selbst wenn ich die Zubereitung übte, Rezepte studierte, die guten, teuren Essiggurken kaufte, war alles nur zweite Wahl in meiner stümperhaften Hand. Ein Film, der vierzig Jahre auf jedem Programm meines Lebens lief, egal wohin ich zappte. Meine Hand auf der Fernbedienung, ein hilfloser Akt der Rebellion. Ich will das nicht mehr.
Apropos vierzig. Bald ist es bei Klaus so weit. Mit vierzig Jahren muss er endlich ausziehen. Es wird Zeit.
Klaus war dagegen gewesen, dass ich mir einen Hund hole. Ich verstand seine Eifersucht, die Wut. Schob es auf die Trauer, denn schließlich war sein Vater erst seit ein paar Monaten tot. Und auch wenn ich mich bemüht habe, seinen Schmerz durch Liebe und Salamistullen zu mildern, keimte zugleich meine alte Kindheitssehnsucht auf, einen Hund an meiner Seite zu wissen.
Der Gang zum Tierheim war spontan. Eigentlich wollte ich zum Schlachter, bog aber wenige Meter vorher ab und wanderte fünf Kilometer bis ins Industriegebiet, wo das Heim lag. Nicht arbeitende Witwen waren dort als Hundemuttis mehr als willkommen und ich kann mich nicht erinnern, wann ich jemals willkommen gewesen wäre.
Die Wahl fiel leicht: Der schwarze Pudel, um die Schnauze ergraut, entschied sich für mich, nicht umgekehrt. Paulchen war in einem Sack an einer Raststätte entsorgt worden. Ein Straßenreiniger hatte den Müllbeutel geöffnet und das halbverhungerte Tier gerettet. Vermutlich hat Paulchen seitdem, so die Tierheimpflegerin, eine große Begeisterung für Menschen in orangenen Warnwesten. Nur bei Klaus macht er eine Ausnahme. Den findet er in allen Farben blöd.
Mit jedem gemeinsamen Spaziergang der letzten Wochen verließ mich ein Stückchen Angst, etwas falsch zu machen. Kim bestärkte mich. Und ich verlor meine Scheu vor ihr. Durchstiefelten wir den November noch schweigend, wagte ich mich im Dezember, sie mit belangloser Plauderei auszuhorchen. Erfolglos. Kim blieb geheimnisvoll. Das Einzige, was sie mir verriet, war, warum ihr Hund Tuuli hieß. Der Name ist Finnisch und heißt Wind … nach dem, womit sich das Hündchen bemerkbar machte, als sie Tuuli von der Pflegestelle abgeholt hatte. Sie kam aus einer Tötungsstation im Ausland. Das war alles, was ich erfuhr.
Demnach hätte ich Paulchen Kuschel nennen müssen, habe aber im Internet keine passende Übersetzung gefunden. Fürs Umbenennen ist es inzwischen eh zu spät.
Der Januar war neben Schneeregen und unangenehmen Temperaturen gespickt mit leichten Unterhaltungen, Anfang Februar aber hat mich eine Neugierde erfasst, die ich immer noch kaum zügeln kann. Ich weiß nichts und will doch alles über Kim erfahren! Sie ignoriert meinen Wissensdurst. Seit ich die Scheu überwunden habe, flattern meine Fragen wie ein bunter Konfettiregen auf sie herab. »Wo leben deine Eltern? Wartet zu Hause niemand auf dich? Dein Mann? Warum musst du nicht arbeiten? Was hast du gelernt? Warum haftet dir eine Traurigkeit an, obwohl du so mutig bist?«
Kim erzählt nichts von sich, fegt meine Fragen weg, ruhig und gleichmäßig, wie die alte Frau Reineke jeden Morgen um sechs Uhr den Bürgersteig mit ihrem Besen kehrt, was mich genervt mein Gesicht ins Kissen pressen lässt.
»Sagst du immer, was du denkst?«, frage ich, ein neuer Versuch, etwas über sie zu erfahren und um ihre Bemerkung zu verdauen, dass ich eine Gluckenmutter sei.
»Edith, das ist meine große Freiheit. Dass ich niemanden mehr verletzen kann«, antwortet Kim und sieht in die Ferne.
An diesem Tag ist es anders. Der Schnee dämpft unsere Schritte. Ich liebe das knirschende Geräusch der brechenden Eiskristalle unter meinen Füßen. Verstohlen betrachte ich Kims Profil aus den Augenwinkeln. Außer zur Begrüßung hat sie bisher wie so oft die meiste Zeit geschwiegen. Die Hunde toben durchs Unterholz. Der Geruch von Erde mischt sich mit der klaren Luft. Auch wenn es bereits dunkel ist, drosseln Paulchen und Tuuli nicht den Lauf; gefrorene Äste knacken unter ihren Pfoten, während sie durch den diffusen Schimmer springen, den der Mond auf den Untergrund wirft. In der Ferne hüpft ein Licht auf und ab und entpuppt sich als die Stirnlampe eines Joggers. Erleichtert sehe ich, dass Paulchen mit Tuuli einem Eichhörnchen hinterherjagt und die orangene Warnweste des Läufers nicht zur Kenntnis nimmt. Beim Gehen tippt Kims Mantel bei jedem Schritt an mein Bein. Ein Kribbeln macht sich in mir breit und ich widerstehe der Versuchung, den Knopf zu berühren, der ihre Manteltasche ziert. Ich schiele zu Kim hinüber. Sie hat ein schönes Profil, hohe Wangenknochen, ein markantes Kinn, die glatten dunklen Haare sind im Nacken zusammengebunden. Eine schöne Frau‚ vielleicht zu schön für Klaus. Aber gibt es das? Zu schön für jemanden zu sein? Als ich tief einatme, schneidet mir die Kälte in die Lungen.
»Ich –«
»Edith, warum hast du dir die Haare abgeschnitten?« Kim dreht nicht den Kopf zu mir, als sie spricht, ihr Blick bei den Hunden. »Du hattest schöne Locken.«
Die Worte hallen in mir nach, ich konzentriere mich einen Augenblick auf das Knirschen von Kims Stiefeln.
»Das Summen.« Ich fixiere meine Schuhspitzen, die den Schnee aufstieben lassen. »Ich musste beim Haare bürsten immer an das Summen denken. Jetzt ist es weg.«
Kim bleibt stehen und berührt mich am Arm.
»Edith, die neue Frisur sieht toll aus.«
»Ich … ich habe einen Sohn.« Ich spüre, wie meine Kiefer sich verkrampfen. Sosehr ich auch dagegen ankämpfe, die Muskeln lösen sich nicht. Selbst als ich sie mit den Fingern massiere, bleibt mein Gesicht versteinert. Kim hält mich bestimmt für senil! Das Summen! Was soll sie damit anfangen? Ich habe ein Sohn, warum habe ich das gesagt? Mit geschlossenen Augen versuche ich, einen klaren Gedanken zu fassen. Als ich sie wieder öffne, lächelt Kim mich an.
»So schlimm?«
»Nein!« Mein lauter Ton überraschtunsbeide. »Es ist nur …«, flüstere ich jetzt, »vielleicht magst du ihn ja kennenlernen.« Ich versuche, ebenfalls zu lächeln, doch da ist nur eine Grimasse, ich spüre das. Kim mustert mich immer noch.
»Edith, kein Interesse. Ich mag Frauen.«
Ein telefonierender Mann kommt uns mit einem gefleckten Hund entgegen. Ich kann kaum sein Gesicht unter der breiten Krempe des Hutes erkennen. Der Hund hält für einen Moment inne, als er uns sieht, flüchtet dann ins Unterholz. Der Mann nickt Kim zu, als er uns passiert, und sie hebt kurz die Hand, lächelt.
»Piet Bremer, netter Mann, war mal Kommissar.«
Nach ein paar Metern drehe ich mich um und sehe, wie das Fleckentier mit eingezogenem Schwanz wieder zu seinem Herrchen aufschließt. Die tiefen Stapfen im Schnee verraten, was für eine Kraftanstrengung dieser Umweg für den kniehohen Hund gewesen sein muss. Umwege kosten immer Kraft. Ich muss mich beeilen, um Kim einzuholen.
»Edith, das war Carmen. Aus dem Tierschutz. Eine Spanierin. Sehr verängstigt, aber Piet sehr ergeben. Seit drei Jahren sind sie zusammen.«
»Kennst du alle hier im Wald?«
Warum habe ich geflüstert?
Unsere Schritte sind im Gleichklang. Ich passe mein Tempo Kims an, auch wenn meine Lunge sticht und ich Sorge habe, auszurutschen.
»Wie lange lebst du schon hier?«
Kim ist stehen geblieben, und ich zwinge mich, zu Atem zu kommen, ohne mich kurz an ihr abzustützen. Sie mag Frauen. Nicht, dass sie denkt …
Die Hunde tollen heran und fordern einen Keks ein. Kim lässt sie Sitz machen und zu meinem Erstaunen folgt Paulchen Tuulis Beispiel.
»Mithilfe einer positiven Verknüpfung wie etwa einem Leckerli lernt der Hund die Grundkommandos selbst im Alter«, wiederholt der TV-Trainer in meinem Kopf. Gilt das auch für Menschen? Hat Klaus deshalb so starkes Sitzfleisch in seinem Elternhaus? Weil mein Essen ihm zu gut schmeckt?
Unser Dachboden ist zum Hobbyraum ausgebaut, vertäfelt und mit einem grünen Teppich versehen, der noch aus den Siebzigerjahren stammt und den gesamten Grundriss des Hauses überspannt. Ausgefranst und faserig ist er an den Rändern, vor allem an der Lukenkante zur Leiter. Stundenlang saß Heinz immer in seinem Reich und ließ die Autos seiner Carrerabahn kreisen, später auch in Klausʼ Gesellschaft. Aber erst, als der Junge alt genug war, um nichts kaputtzumachen. Wie oft musste ich die steile Leiter hochklettern und das weinende Kind aus Heinzʼ Griff befreien, wenn er ihn wie einen Schädling von der Plastikbahn gepflückt hatte. Dabei wollte der Kleine bloß, was die meisten Kinder möchten: spielen. Das ist doch ein Spielzeug, habe ich gedacht, die ersten Male auch laut. Aber Heinz ist mir über den Mund gefahren, hat seinen Sohn von der Bahn gezerrt und uns des Dachbodens verwiesen. Oft kletterte ich mit dem Kind im Arm die Leiter hinab und als Heinz eines Tages aus Brettern eine Luke gebaut hatte, mit der er uns aussperren konnte, war ich nicht traurig darum.
Als Klaus ein Teenager war, durfte er seinem Vater Gesellschaft leisten und als Heinz in Rente ging, verbrachten beide in trauter Zweisamkeit jede freie Minute auf dem Dachboden. Die Luke wurde wieder abgebaut, mein Mann fand es mühselig, sie öffnen zu müssen, um nach mir zu rufen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, war Carrera vermutlich die einzige Schnittmenge zwischen Vater und Sohn, wenn ich mich nicht dazurechne.
»Edith, woran denkst du?«
»Was?«
»Du hast gerade eine Menge Grimassen geschnitten.«
Ich huste und Kim klopft mir auf den Rücken. Sanft, eher symbolisch. Aber es hilft.
»Also, wie lange wohnst du hier?«
»Einundvierzig Jahre.«
Stunden verbrachten Heinz und Klaus im Hobbyraum und ließen die Spielzeugkarren kreisen. Das ging Jahre so. Bis dank ihrer Sammelleidenschaft, geplünderter Ersparnisse und meiner unfreiwilligen Sparurlaube im heimischen Garten (mit der alten Frau Reineke am Gartenzaun) die Carrera-Anlage vom Kinderspielzeug zum Eldorado oder besser gesagt, zum Mekka, zum Olymp, wenn nicht gar ein mit Plastikschienen durchzogener Garten Eden geworden war. Heinz lud die Lokalzeitung ein, um darüber zu berichten. Und weil der Redakteur ein ehemaliger Schüler von ihm war, widersprach der nicht. Zu meiner Überraschung wurde sogar das Fernsehen auf Heinzʼ Sammlung aufmerksam, irgendein Privatsender. Das ganze Haus hatte ich geschrubbt, die Fenster geputzt, damit niemand nachher behaupten konnte, ich würde meine Familie vernachlässigen. Es reichte, wenn Frau Reineke das erklärte.
Ich wäre auch gerne Auto gefahren. Ein eigenes habe ich mir immer gewünscht. Ein echtes, kein Spielzeug. Zum Wegfahren ins Blaue, ans Meer, in die Weite. Das wahre Frauenglück. Raus aus dem Trüben, aus allen Begrenzungen. Doch Heinz weigerte sich, mir den Führerschein zu bezahlen. Ich argumentierte, er könne mir das Geld leihen, ich suche mir eine Arbeit. »Dann vernachlässigst du deine hier. Schau dich an«, konterte er, »es geht uns doch gut.«
»Edith, geht es dir gut?«
Schon wieder bin ich stehen geblieben, ohne es zu merken. Alle drei schauen mich jetzt an: Kim, Tuuli und Paulchen.
»Warum trägst du immer dunkle Kleidung?«
Senile Frauen fragen so etwas. Gedankenpotpourri.
Kim antwortet nicht, sondern hakt sich bei mir unter und hält mich dadurch fest. Etwas holpert in mir, das Atmen fällt schwer. Seit über einem Jahr hat mich kein Mensch mehr berührt, abgesehen vom zahlreichen Händeschütteln bei Heinzʼ Beerdigung.
Ein eigenes Auto wäre gar nicht so fern. Seit vier Jahrzehnten sammle ich das Geld, das ich in der Schmutzwäsche finde. Früher war ich erfolgreicher: Heinz hatte oft sogar Scheine in seinen Hosentaschen. Wenn die alte Kaffeedose in der Küche voll ist, tausche ich die Münzen in Papiergeld und lege es in Vaters alte Aktentasche unter mein Bett. Sie ist neben seiner Brille das zweite Erinnerungsstück an ihn.
Als wir am Ende des Waldes angelangt sind, nimmt Kim Tuuli an die Leine und weist auf das angrenzende Feld. Der Wanderweg, an dessen Beginn wir stehen, erstreckt sich über die Bundesstraße hinweg bis zur Marsch. Der Schnee ist hier nahezu unberührt und unsere Schritte hinterlassen tiefe Abdrücke. (Müsste es nicht Eindrücke heißen? Wir sinken doch ein und nicht ab.) Die Rehe am Horizont entgehen Paulchen und ich bin froh, dass mein Hund nichts mit Kims ausgestrecktem Arm anfangen kann. Er folgt lieber Tuuli. Die Rollleine spannt sich unter seinem Zug, während er tapfer durch das gefrorene Hindernis stapft. Der Schnee, eine weiße Wand für beide. Neidisch betrachte ich die Hunde, die sich durch Hindernisse nicht beirren lassen.
»Einundvierzig Jahre schon«, wiederholt Kim, »länger, als ich lebe. Edith, da musst du doch viele Leute hier kennen.«
Ich zucke mit den Schultern. Viele kennen mich. Oder besser gesagt, sie glauben, mich zu kennen. Frau Reineke allen voran. Die Hansens und Meiers. Und die alten Kollegen von Heinz, die ich manchmal in der Stadt treffe. Früher auch ein paar ehemalige Schüler von ihm. Ich grüße immer brav zurück, wenn mich jemand anspricht, aber seit Heinzʼ Tod grüßt eh kaum wer. Vielleicht hätte mein Mann anders sterben sollen. Unsere Stadt ist ein Dorf, wenn es um Tratsch geht. Bei einer anderen Art des Ablebens wäre es niemandem peinlich gewesen, mir weiterhin Hallo zu sagen. Ausgerechnet ein aufsässiger Ex-Schüler von Heinz stellte offiziell die Todesursache fest und brach die Diskretion. Wenn ich mich recht erinnere, hatte Heinz ihn auch während seiner Schulzeit immer als tratschig beschrieben. Als Sabbeltasche.
»Möchtest du nach dem Spaziergang einen Kaffee bei mir trinken?« Habe ich das gerade wirklich gefragt?
Ein Schwarm Krähen fliegt über uns hinweg. Tuuli spitzt die Ohren, während Paulchen gleichmütig weiterstapft. Seit einer Weile habe ich die Vermutung, dass er nicht mehr so gut hört und sieht. Kim legt den Kopf in den Nacken, lacht lautlos, genießt das flatternde Spektakel. Ihre Augen blinzeln, ihr Mund ist geöffnet und ich bewundere, dass sie keine Angst hat, ein Vogel könne beim Hinwegfliegen sein Geschäft über ihr erledigen. Das ist es wohl, was uns unterscheidet. Die fehlende Angst. Gibt es ein Wort dafür? Ist nichtvorhandene Angst automatisch Mut? Ich denke nicht. Ich will nicht mutig sein. Ich will nur einfach keine Angst mehr haben, etwas falsch zu machen. Falsch zu sein.
Kim senkt den Kopf, streift sich eine Strähne hinter das Ohr und lächelt mich an. »Heute nicht, Edith. Ein anderes Mal komme ich gerne mit.«
Da hatte ich meine Frage bereits vergessen.
Ich mag Frauen, hatte Kim gesagt. – Ich mag Frauen? Was soll das bedeuten? Ich mag auch Frauen. Während ich in der Nacht an die Decke starre, geistern mir Kims Worte durch den Kopf. Ich kann nicht schlafen, höre Klaus durch die Zimmerwand schnarchen. Keine gute Idee, ein Kinderzimmer direkt neben das der Eltern zu planen. Aber wer weiß, vielleicht schnarchten Kinder damals nicht so laut. Die Rollläden sind heruntergefahren und ich liege in totaler Dunkelheit. Die Schemen, die ich sehe, sind Einbildung. Heinz nannte sie immer »deine Spinnereien«. In Gedanken laufe ich das Schlafzimmer ab. Den Weg von der Tür zum Bett. Strenge ich mich an, erkenne ich etwas: einen Schatten, einen Umriss. Etwas ist neu. »In totaler Dunkelheit können keine Schatten sein«, höre ich Heinz belehrend. Doch, Heinz, du bist meiner, auf der Seele.
Nach seinem Tod habe ich die Kleinmöbel herausgeräumt: den Stuhl, auf dem er saß und sich die Fußnägel schnitt, den Metallständer für seinen Anzug, der selbst bei Tag wie ein Geist aussah, die Kommode mit seiner Unterwäsche und den Socken.
Ich mag Frauen, hat sie gesagt. Ich glaube, ich mag doch keine Frauen. Frau Reineke zum Beispiel, aber die mag niemand. Außer Heinz vielleicht, der mochte sie. Manchmal denke ich, Heinz wäre der passende Hintern für Frau Reinekes Eimer gewesen. Und die sah das wohl ähnlich. Jetzt kommt sie nicht mehr so oft, aber als Heinz noch lebte, piesackte sie mich mit ihren goldumränderten Schüsseln voll selbstgebackener Leckereien für die Männer des Hauses, wie sie vor meiner geöffneten Haustür posaunte, damit es jeder in der Nachbarschaft hörte. Piesacken stammt übrigens von dem alten Wort für Ochsenziemer, mit dem man früher bestrafte. Ein getrockneter, verdrehter Bullenpenis. Steht jedenfalls im Internet. Genauso eklig fand ich Frau Reinekes Fresskörbe. Alle Jahre meiner Ehe garnierte sie ihre Stollen und Stullen mit Sticheleien für mich, der Hausfrau in Anführungszeichen, als bekäme ich meine Familie nicht satt. Von wegen! Sie hätte Heinz mal nackt sehen müssen! Ein Bauch wie eine Trommel. Und Klausʼ Hemd spannt auch seit Jahren, wenn er mal eines trägt und nicht immer nur diesen Jogginganzug. Das gefällt doch keiner Frau.
Der Hundetrainer im Fernsehen hat vor ein paar Tagen gesagt, man müsse »den Liebling öfter mal ignorieren«, dann lerne er, auf einen zu hören. »Unberechenbar sein.« Auch Heinz hatte das gewusst.
Jemand hupt. Das wird morgen in der Straße für Gesprächsstoff sorgen. Ich muss lächeln, drehe mich zur Seite und starre ins Dunkel, stehe auf und ziehe den Rollladen hoch. Aber ich sehe niemanden.
Etwas lernen sei Luxus, das bräuchte ich nicht, hatte Heinz behauptet. Damals gab es noch keine Hundetrainer im Fernsehen. Generell hintertrieb Heinz mein Streben nach Bildung und Mobilität. So gerne hätte ich den Führerschein gemacht. »Mit dem Rad bleibst du in Form«, lautete Heinzʼ Antwort, während er an mir rauf- und runterschaute: »Und deine Figur auch.«
Ikebana, die japanische Kunst des Blumenarrangierens, an der Volkshochschule war das Maximum. Rikka, neun Hauptlinien, Moribana, Shoka. Oder Nageire, mit den drei Hauptlinien Shin, Soe und Tai. Heinz, Klaus und ich. Shin und Soe dürfen dabei auf keinen Fall den Vasenrand berühren. Freies Arrangement. Nur ich ecke an.
Gerne hätte ich studiert. Vielleicht was mit Literatur. Lesen macht mir Spaß. Aber dafür braucht man Abitur. Heinz meinte am Anfang unserer Ehe, Klaus sei ja bald da, wie sähe das aus, wenn ich hochschwanger in den Abiprüfungen säße. Als ich nach der Geburt das letzte Schuljahr nachholen wollte, sagte er, Klaus sei ja jetzt da, wie sähe das aus, wenn ich stillend in den Prüfungen säße. Danach habe ich nicht mehr gefragt. Ich liebe meinen Jungen. Er ist selbstbewusst, das ist großartig, und er kann sich begeistern, das ist gut. Aber ich habe das Gefühl, ich stille ihn immer noch. Er saugt die Energie aus mir heraus. Ich fühle mich nicht in der Lage, ihm zu sagen, er müsse gehen. Dabei ist es höchste Zeit. Ich verstehe deine Trauer, möchte ich sagen. Papa war dein Vorbild, dein Idol. Aber Papa ist tot. Ein Jahr jetzt schon. Das Leben geht weiter und deines sollte anfangen. Mit Worten wollte ich ihn überzeugen, seinen eigenen Weg zu gehen. Er passt auf mich auf, erklärt er immer. Er sollte lieber auf eine Schar Kinder aufpassen und darauf, dass seine Frau genug Zeit hat, ihre Träume zu verwirklichen.
Die Klospülung rauscht nebenan. Ich höre die Tür klappen. Klaus fehlendes Schnarchen ist mir nicht aufgefallen – was bin ich für eine Mutter –, aber dass ich jetzt keinen laufenden Wasserhahn höre. Er hat sich die Hände nicht gewaschen. Ich drehe mich wieder auf den Rücken und starre zur Decke. Das mag keine Frau, Klaus! Ich muss morgen mit ihm reden.
Statt Schäfchen stelle ich mir Frauen vor, die über ein Gatter hüpfen. Nicht wie die Athletinnen beim Hürdenlauf, sondern wie kleine Mädchen, die über Pfützen springen. Ich mag Frauen, hat Kim gesagt. Mit einem Bauchklatscher landet Frau Reineke in der Pfütze. Ich mag Frauen … Mutter springt in der Dunkelheit und stürzt bäuchlings über Frau Reineke. Sie beginnen, im Schlamm miteinander zu ringen. Schwarzer, sämiger Morast auf ihren Körpern. Das Weiße ihrer Augäpfel blitzt aus verzerrten Gesichtern. Nein. Ich glaube, ich mag keine Frauen.
Sechsminuteneier, auf die Sekunde. Eier vom Biobauern, die Schale weiß, denn die braune erinnert Klaus an Kacke. Über mir höre ich die Dusche rauschen und zähle von vierzig herunter. Vierzig scheint für mich eine magische Zahl zu werden. Zweiunddreißig. Der Frühstückstisch ist fertig, nur ein Gedeck, ich habe keinen Hunger. Achtundzwanzig, Klausʼ Zimmertür fällt krachend ins Schloss. Eine Überschwemmung im Bad, jedes Mal. Ich werde mit seinen gebrauchten Handtüchern nachher den Boden feudeln. Siebzehn. Nachdem ich die Brötchen in den Korb gelegt habe, gieße ich uns Kaffee ein. Rabenschwarz für mich. Seinen trinkt er mit Zucker. Drei Würfel. Weiße. Die braunen mag er nicht. Das Do-not-disturb