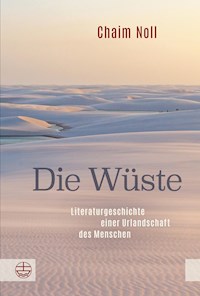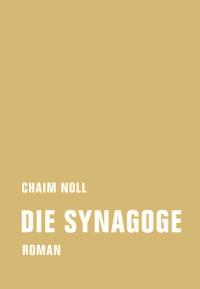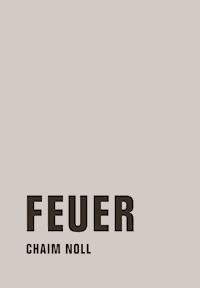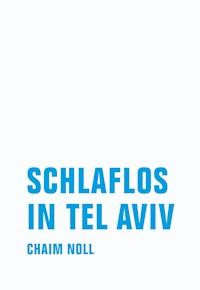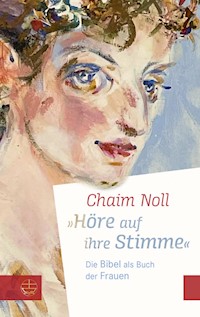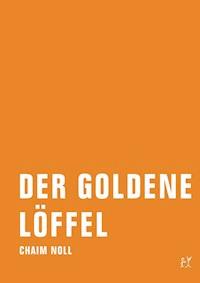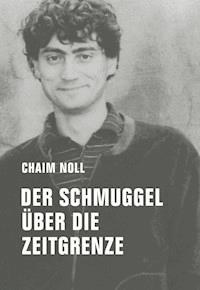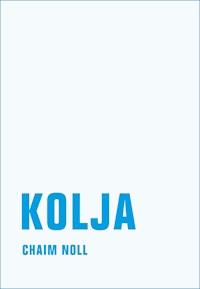
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Was bedeutet es für den aus Italien eingewanderten Alessandro, dass sich die jüdische Abstammung seiner Mutter nicht klären lässt? Warum ändert der Krieg Michaels Verhältnis zu Henry James grundlegend? Und warum ist in der Wüste mitten im Sommer Weihnachten? Und Kolja? Der stammt eigentlich aus Russland und fällt im Kampf für seine neue Heimat. Was passiert jetzt mit seinem Leichnam? Chaim Noll erzählt mitreißend und in schöner Sprache kleine Begebenheiten und große Lebensgeschichten. In seinen Erzählungen entwirft er ein Portrait der heutigen israelischen Gesellschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Neuer Artikel
Neuer Artikel 1
Chaim Noll
Kolja
Geschichten aus Israel
Kolja
Nikolaj R., einundzwanzig, Sergeant in einer Elite-Einheit, fällt im Libanon. Er war erst wenige Jahre zuvor aus Russland eingewandert. Eine Tageszeitung macht Vater und Schwester ausfindig, die in einer notdürftig ausgebauten Garage in Tel Aviv leben. Bilder der ärmlichen Unterkunft zusammen mit der Geschichte von Koljas Leben und Tod auf einer Doppelseite. Am nächsten Tag berichtet die Zeitung, Kolja hätte sich, wenige Wochen bevor er fiel, um finanzielle Unterstützung an das Verteidigungsministerium gewandt – vergebens.
Der Bericht löst eine Flut von Leserbriefen und landesweite Empörung aus. Eine andere Tageszeitung bringt in Erfahrung, dass Nikolajs christliche Mutter weiterhin in der Stadt Krasnodar in Russland lebt. Sie sei mit Koljas Einwanderung nach Israel nicht einverstanden gewesen und habe sich darüber mit ihrem jüdischen Ehemann zerstritten, der dem Sohn nach Israel gefolgt sei. Schlagzeile: »Ich hätte nicht erlauben dürfen, dass er dort hingeht!«
Die Mutter verlangt Koljas Beerdigung in Russland. Überführung des in eine israelische Fahne gehüllten Sarges auf Kosten des Verteidigungsministeriums. Vor dem Abflug Trauerfeier in Tel Aviv, auf der Koljas ehemaliger Kommandeur erklärt: »Er wollte einer von uns sein«. Israelische Zeitungen kritisieren, dass auf der Trauerfeier Vertreter von Regierung und Armeeführung fehlen. Vater und Schwester kehren mit dem Sarg nach Russland zurück. Die Mutter in einer russischsprachigen Zeitung: »Was sollen sie dort ohne Kolja?«
Am nächsten Tag Zeitungsfotos von Koljas Beerdigung auf dem Friedhof der russischen Stadt Krasnodar. Die Mutter hat die israelische Fahne vom Sarg entfernen lassen. Die Trauergemeinde steht zwischen christlichen Holzkreuzen, auch einige Offiziere der israelischen Armee sind auf den Bildern zu sehen, die den Sarg begleiten.
Eine hebräische Tageszeitung enthüllt: Vater und Schwester lebten nur deshalb in Armut, weil sie die ihnen als Neueinwanderer zustehende staatliche Unterstützung an die Mutter nach Russland schickten, die dort von dem Geld ein Haus baut. Fotos dieses Hauses in den hebräischen Zeitungen. Fernsehberichte, tagelange Empörung der israelischen Öffentlichkeit. Die russischsprachigen Zeitungen werfen den hebräischsprachigen vor, sie würden den Fall zu einer Kampagne gegen die russischen Einwanderer nutzen.
Wenige Tage darauf fällt Koljas Freund Danny, ein in Israel geborener Soldat, im Libanon. Das Zusammentreffen der beiden Todesfälle erregt landesweite Teilnahme. Aus Russland telefoniert Koljas Vater mit Dannys Mutter in Haifa, das Gespräch wird am nächsten Tag an beiden Orten für Presse-Fotografen nachgestellt, die Fotos erscheinen in allen Zeitungen, hebräisch- wie russischsprachigen. Dannys Mutter bittet Koljas Familie, an Dannys Beerdigung teilzunehmen, da die beiden eng befreundet waren. Nach einigem Zögern ist Koljas Mutter bereit, mit Mann und Tochter nach Israel zu fliegen.
Die Mutter wird am nächsten Tag auf dem Ben-Gurion-Flughafen wie ein Staatsgast empfangen. Koljas und Dannys Kameraden in Uniform als Ehrenspalier. Vertreter der Regierung, derArmeeführung, der Medien umringen die überraschte Frau. Fotoszeigen sie, gekleidet als russische Bäuerin, in Tränen. Fotos von ihrer Teilnahme an Dannys Beerdigung. Einige Tage später eine kleine Notiz: Mutter wünscht Rückführung von Koljas Leiche nach Israel, um ihn auf dem russisch-orthodoxen Friedhof in Jerusalem beisetzen zu lassen.
Nächte mit Henry James
Michaels Eltern, in der dritten Generation in England, erfolgreich im Immobilien-Geschäft, haben eine verzeihliche Schwäche. Seit sie bei verschiedenen Vermittlungen und Verkäufen die Bekanntschaft hochgeborener Personen gemacht haben, verehren und bewundern sie die englische Aristokratie. Sie träumen sogar davon, eines Tages selbst in diesen Stand erhoben zu werden. In England ist dergleichen denkbar, auch für Juden, wenn sie sehr reich sind und sich um das Gemeinwesen verdient gemacht haben. In der Synagoge, die Michaels Eltern am Shabat besuchen, gibt es eine Lady Pamela Fishman-Lubetzki, die Witwe des Industriellen Sir Moses Fishman, und die Vorstellung, eines Tages selbst einen derart aristokratischen Namen zu führen, scheint ihnen der Gipfel irdischer Erfüllung.
Im Haus von Michaels Eltern finden sich ein paar Gebetbücher und Bibeln, sonst ist die Bibliothek durchweg britisch, mit verschiedenen Shakespeare-Ausgaben und viel Byron, Shelley, Keats und Wordsworth, Alexander Pope und Lord Tennyson, Jane Austen, Virginia Woolf und T. S. Eliot. Auf Anraten der Eltern begann Michael englische Literatur zu studieren, gleichzeitig mit Jurisprudenz, um einen guten Stil des Ausdrucks zu erwerben. In England komme es auf Sprache und Akzent eines Menschen an, erklärte der Vater, bei den ersten Worten, die jemand spricht, höre man heraus, welcher Gesellschaftsklasse er angehört.
Nachdem Michael ein Jahr lang englische Literatur und Jura studiert und sich auf diese Weise für ein Leben in der Londoner City vorbereitet hatte, fuhr er mit einer Gruppe derYoung UnitedSynagogue nach Israel. Auch die anderen Familien in der Gemeinde schickten ihre Kinder auf diese Reise, der Rabbi, ein begeisterter Zionist, rief jedes Jahr dazu auf. Ein wenig war es wohl auch eine Frage des Geldes, eine Gelegenheit zu zeigen, dass man es hatte. Die Reise war teuer, sechs Wochen kreuz und quer durch das schwierige Land, von Naharia im Norden bis in die Wüste Negev im Süden. Michael war einer der Ältesten in der Gruppe und spielte eine gewisse Rolle während der Tour. Der junge Israeli mit Maschinenpistole, der sie überall begleitete, ein ehemaliger Korporal der Armee, freundete sich mit ihm an.
Diese Freundschaft bedeutete Michael viel. Er hatte den jungen Israeli – mit Namen Lior – vom ersten Tag an bewundert. Lior war ungebildet und unerzogen für Londoner Verhältnisse, achtete wenig auf seine Kleidung, brüllte laut, wenn man hätte leise sprechen sollen, sein Englisch war schauderhaft. »Sorry, that my English is so lousy«, sagte er am ersten Tag zu Michael, aber er sah nicht aus, als ob es ihm viel ausmachte. Er war der Gruppe als Wächter zugeteilt, ein Ferien-Job, ehe er im Herbst auf die Universität in Haifa gehen wollte, um etwas Technisches zu studieren.
Lior war unheimlich stark im Wegstecken, wie Michael fand, er wirkte fast unverwundbar. Nicht im körperlichen Sinn – erhatte eine Narbe am rechten Oberarm, gleich unter dem Schultermuskel, eine helle Kerbe in der braunen Haut, ein Streifschuss, wie er erklärte – aber in einem seelischen. Er war durch nichts zu entmutigen oder zu erschrecken. Immer wieder, bei den tausend Schwierigkeiten dieser Reise, wenn der englische Reiseleiter verzweifelte, fand Lior eine Lösung. Er war in Wirklichkeit der Boss und Michael sein Assistent. Er zeigte Michael, wie seine Maschinenpistole funktioniert, eine kleine Uzi. Mit einem solchen Freund konnte nichts schief gehen, fand Michael, mit so einem kam man überall durch.
Michael lernte Liors Eltern und Geschwister kennen, man lud die englischen Jugendlichen zum Shabat-Essen in israelische Familien ein, auch das gehörte zum Programm der Tour. Lior hatte drei Schwestern, eine war nur wenig jünger als Michael, die beidenanderen sechzehn und vierzehn, und diese drei Mädchen – die ihm allesamt schön erschienen wie Königin Ester in der Brautnacht – benahmen sich nicht besser als ihr Bruder. Sie brüllten, gestikulierten wild, fielen den Eltern ins Wort und lachten so viel, wie Michael noch niemals Menschen hatte lachen sehen. Die Eltern kamen selten zu Wort. Sie saßen am Tisch und betrachteten ihre lauten Kinder mit verliebten Blicken. Die Familie war nicht religiös, man sprach am Shabat Kidush und Segen, aber dazu lief das Radio, klingelten Telefone, fast immer redete eins der Mädchen, Lior oder auch die Mutter in ihr Handy, ohne deswegen das Essen zu unterbrechen oder vom Tisch aufzustehen.
Im nächsten Jahr kam Michael wieder, diesmal ohne Reisegruppe. Das Geld stammte teils von seiner Großmutter, teils hatte er selbst es verdient, worauf er sehr stolz war. Er verliebte sich in Liors neunzehnjährige Schwester in dem Augenblick, als sie ihn vom Flugplatz abholte, er verliebte sich hoffnungslos, ohne noch für irgendetwas anderes Augen zu haben, als sei er extra deswegen nach Israel geflogen, als hätte er den ganzen verregneten Londoner Winter auf diesen Augenblick gewartet. Sie war mit ihrem Bruder zum Flughafen gekommen, der zu diesem Zweck das väterliche Auto benutzen durfte. Die drei fuhren in sinkender Abendsonne auf einer Straße unter Palmen der Stadt entgegen, nie hatte Michael etwas Schöneres erlebt. Liors Schwester war nicht mehr, wie voriges Jahr am Familientisch, ein lauthals lachendes Mädchen, sie war eine junge Frau, wissend, erfahren und schön wie im Märchen. Sie diente seit einem halben Jahr bei der Armee.
Es war eher ein Schreibtisch-Job, wie sie sagte. Sie saß im Oberkommando an einem Computer, aber sie trug die grüne Uniform, die knapp sitzende Hose, in der man ihre langen Beine sah und den süßen Hintern, und Michael konnte die Augen nicht von ihr lassen, von ihrem dunklen Gesicht, ihren glänzenden schwarzen Locken, ihren feinen, energischen Händen. Mit diesen Händen fuhr sie durch sein blondes Haar, wenn sie miteinander schliefen. Schonend wurden die Eltern ins Bild gesetzt. Die Großmutter schickte Geld, und im Herbst kehrte Michael nicht nach London zurück, sondern studierte in Tel Aviv.
Im Frühjahr wurde er israelischer Staatsbürger. Im Herbst ging er zur Armee, inzwischen fast einundzwanzig, daher zogen sie ihn nur noch für ein Jahr. Im Sommer hatten die Eltern einen letzten Versuch unternommen, waren persönlich in Tel Aviv erschienen, um ihren Sohn zur Rückkehr zu bewegen. Sie waren jedoch dem Hausvorteil der künftigen Schwiegereltern unterlegen – inzwischen galt es als abgemacht, dass die jungen Leute heiraten sollten – und dem Starrsinn der englischen Großmutter, die ihrem Enkel weiter Geld schickte, obwohl sie von der Familie beschworen worden war, es nicht zu tun: man hatte gehört, dass solche Fälle von Ausreißertum fast immer an der Geldfrage scheiterten.
Michael wurde nach Gaza kommandiert, als die zweite Intifada ausbrach. Er schlief abends beim Knattern der Kalaschnikows ein, mehrmals wurde seine Basis von Granatwerfern beschossen, er erlebte mit, wie ein Soldat, mit dem er im selben Zimmer schlief, einen Splitter in die Hüfte bekam und per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Quittegelbes Licht beleuchtete die Szene: den Verletzten auf seiner Trage, das Blut auf dem Schotter des Fahrwegs, den Hubschrauber auf dem kleinen Landeplatz. Er lernte unter diesen Umständen schnell Hebräisch, sprach es, redete es mit den anderen mit, aber wenn es ans Lesen ging, blieb er beim Englischen. Er las viel in diesen Nächten, während draußen geschossen wurde, am liebsten die Penguin Classics oder Penguin Popular Poetry oder dergleichen, gute englische Literatur, die er von seinem Studium kannte und die immer eine beruhigende Wirkung auf ihn hatte.
In der Nacht, in der sein Zimmergenosse den Granatsplitter abbekam, las er Henry James. Dieser Schriftsteller hatte ihn schon an der Universität Tel Aviv beschäftigt, seine Professorin, eine Amerikanerin, arbeitete über ihn und wollte Michael gewinnen, seine Magisterarbeit über ihn zu schreiben. Er konnte nicht schlafen, niemand im Zimmer schlief, von draußen waren Schüsse zu hören, sie warteten auf Nachricht aus dem Krankenhaus. Er hatte sich auf dem grünen Armeeschlafsack ausgestreckt und las Henry James. Er las, wie der junge Paul Overt das Haus von Lady Watermouth betritt und hinter der Glastür einige Gentlemen auf dem Rasen sitzen sieht, unter alten Bäumen, in Gesprächen »gesellig und langsam, wie es angemessen war und natürlich an einem warmen Sonntag Morgen«, und wie der junge Paul sich in Marian Fancourt verliebt, wie er diesem tiefen Gefühl in langen Gesprächen mit seinem Freund, dem Schriftsteller Henry St. George, Ausdruck verleiht, und das Mädchen schließlich doch nicht heiratet, weil er sich im entscheidenden Moment nicht zum Handeln entschließen kann, weil er sich zu einem generellen Verzicht gegenüber dem Leben durchgerungen hat oder aus einem ähnlich hochherzigen Grund.
Michael las diesmal ohne die sonstige Ruhe, er las, als warte er auf etwas, mit wachsender Nervosität. Auch die anderen Figuren bei Henry James waren verfeinert, von sicherer Kultur, gut gekleidet, dezent, von unnachahmlicher Zurückhaltung in ihren Dialogen. Es gab keinen quittegelb ausgeleuchteten Hof zwischen Militärbaracken, keine Einschläge von Granaten, kein Gebrüll. In einer anderen Geschichte ließ der junge Winterbourne das Mädchen Daisy, in das er sich verliebt hatte, mit einem italienischen Verehrer im nächtlichen Colosseum herumspazieren, bis sie sich ein Fieber zuzog und starb. Er hielt es für unwürdig, sich in ihre Angelegenheiten zu mischen oder überhaupt zu viel Engagement im Umgang mit anderen Menschen zu zeigen, er war sich auch nicht sicher, ob er sie wirklich liebte oder, falls er sie liebte, ob diese Liebe Folgen haben dürfe … Hier legte Michael den Band beiseite. Während von draußen Schüsse, das Heulen einer Sirene zu hören war, das scharfe, beruhigende Schlattern der Rotorblätter sich nähernder Hubschrauber, versuchte er herauszufinden, was ihn an der Lektüre störte. Er hatte die Geschichte schon früher gelesen, sie hatte ihm gefallen, er hatte eine Seminararbeit über eine ihrer stilistischen Besonderheiten geschrieben.
Seine Freundin rief ihn an, irgendwann in der Nacht, wie sie es immer tat. Michael ging hinaus auf den Korridor, um ungestört mit ihr zu reden, und vergaß sein Unbehagen über Henry James. Doch das Studium der englischen Literatur gab er auf, kaum dass er von der Armee an die Universität zurückgekehrt war, zum großen Bedauern seiner Professorin.
Brot
Eines Morgens, als ich im Garten die weiße Katze fütterte, kam ein Mann auf mich zu, ein schlanker Mann mittleren Alters mitStirnglatze und großen, leuchtenden Augen. »Ich habe Siedeutsch sprechen hören!«, rief er begeistert. In seinem Gesicht war ein Lächeln, als sei die Begegnung mit mir ein glückbringendes Ereignis. Mit wem hatte er mich sprechen hören? Mit der Katze? Sie war trächtig und hatte unter unserem Fenster miaut, seit drei oder vier Tagen ging ich im Morgengrauen hinunter und fütterte sie. Das Haus schlief noch, es mochte nicht später sein als sechs. Der Mann fragte, ob wir Deutsche wären. Er hätte uns in letzter Zeit öfter hier gesehen.
»Juden«, sagte ich.
»Aber aus Deutschland?«
»Ja.«
»Und da kommen Sie hierher?«
»Warum nicht? Es ist schön hier. Das Meer rauscht, die Sonne steigt auf hinter Palmen …«
»Aber Sie können doch dieses Land nicht mit Deutschland vergleichen!«
»Alles kann man vergleichen. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis … Kennen Sie das? So sagt ein berühmter deutscher Dichter.«
Der Mann hatte ein hageres, vergrämtes Gesicht, das stark gebräunt war, wie die Gesichter der meisten Leute hier, und dadurch gesund und lebensfroh wirkte, trotz des grämlichen Ausdrucks, sozusagen wider Willen gesund, wider Willen froh. Hinzu kam, dass er lächelte, als er mich deutsch sprechen hörte und deutsche Dichter zitieren, lächelte wie ein Kind, selig vor Vergnügen.
»Hören Sie«, sagte er mit gesenkter Stimme, als gälte es eine Schicksalsfrage, »Sie wollen doch nicht etwa bleiben?«
»Doch«, gab ich zurück, »das ist unsere Absicht.« Und ich erzählte ihm, während die weiße Katze frühstückte und um meine Beine strich, dass wir gekommen wären, meine Frau, die Kinder, auch der Schwiegersohn, um hier zu leben.
»Das werden Sie sich noch hundertmal überlegen!« rief er. »So redet jemand, der das Land nicht kennt. Ich komme aus Wiesbaden, wo ich achtundzwanzig Jahre gelebt habe, seit Anfang der Sechziger. Eigentlich bin ich aus Rumänien. Ceauşescu – das wissen Sie sicher nicht – hat uns die Ausreise erlaubt, man konnte gehen, wohin man wollte. Ceauşescu war nicht so schlecht, wie alle sagen. Zu uns war er gut.« Er sprach weiter, die großen Augen auf mein Gesicht geheftet. Sie waren hellbraun, und wenn er sich ereiferte, leuchteten sie golden, in genau der Farbe, die in meiner Kindheit die Malzbonbons hatten. Die meisten rumänischen Juden wären nach Israel gegangen, sagte er, aber seine Eltern nicht, wofür er ihnen bis heute dankbar sei. Dadurch hätte er eine »vernünftige Erziehung« erhalten. Die Eltern waren in Wiesbaden gestorben, und er hatte geheiratet, eine israelische Frau, dunkel, temperamentvoll: der größte Fehler seines Lebens.
»Ich bin ein Jude!«, rief er, »ja, das weiß ich, ich habe es nie geleugnet. Aber diese Leute hier, diese schrecklichen Leute! Leben Sie erst mal einige Zeit in diesem Land, dann werden Sie sehen. Die Marokkaner, laut, rücksichtslos, sie brüllen Tag und Nacht auf der Straße herum. Meine Nachbarn sind Russen, haben Sie schon mal neben Russen gewohnt? Jede Nacht dieser Krach, sie trinken, singen, spielen Ziehharmonika, ich habe die Russen schon in Rumänien nicht ausstehen können … Hundertmal habe ich sie gebeten, leiser zu sein, aber die Leute hier hören nicht mal zu! Wenn Sie in ein Geschäft gehen und fragen, die antworten nicht mal! Die drehn sich nicht mal um! Wiehöflichsind die Verkäuferinnen in Deutschland! Bitte sehr, danke sehr …«
Er deutete Knickse und Verbeugungen an, als sei er ein junges Mädchen, das in einem Laden bedient. Dabei verwandelte er sich, schauspielerte, seine Augen leuchteten groß und golden. Ich begann, ihn mit Interesse zu beobachten.
»Wie Luft wird man hier behandelt«, sagte er, und der Groll kehrte in seine Stimme zurück, »niemand grüßt, niemand sagt Danke. Und ich kann ihr Zeug nicht essen. Ich muss oft nach Deutschland fliegen, ich bekomme dort eine Rente und muss alle paar Monate hin, mich auf den Ämtern zeigen … Können Sie hier essen? Immer, wenn ich aus Deutschland komme, bringe ich mir zu essen mit, Brot, einen ganzen Koffer voll Brot. Und Eier. Man kann ihre Eier nicht essen. Sie machen Milchpulver in den Käse. Wenn ich mich erinnere, die Käsetheke in unserem Supermarkt in Wiesbaden, Dutzende Sorten, aus Frankreich, Italien, Holland, ach, was sage ich, Hunderte …«
Er sah mich an, über den goldenen Augen war seine hohe Stirn bewegt, wie zerrissen. Im Reden beugte er sich über die sauber geschnittene Hecke, die uns trennte. Er hatte den Vorgarten nicht betreten, blieb respektvoll draußen, während ich mit der Katze hinter der Hecke stand.
»Ich hätte keine Israelin heiraten dürfen. Nach dem Tod meiner Eltern habe ich mich einsam gefühlt … Sie versteht mich nicht. Sie wird wütend, wenn ich ihr sage, wie schrecklich die Leute hier sind. Sie lacht, wenn ich mir Brot aus Deutschland mitbringe, richtiges Schwarzbrot, richtiges Brot … Es war mein größter Fehler, dass ich diese Frau geheiratet habe. Ich kann hier nicht leben. Ich schlafe nicht, trotz Ohropax, weil sie so laut sind. Ja, ich bin a Jid, ja, ein Jude, aber hier fange ich an, mein eigenes Volk zu hassen …«
Sein Gesicht war fein, mit regelmäßigen, etwas pedantischen Zügen, in seinen goldbraunen Augen standVerzweiflung. Er sprach fließend Deutsch, fehlerlos, nur manchmal suchte er nach einem Wort.
»Sie werden noch an mich denken«, rief er, bevor er ging. Es klang fast drohend. Ich sah ihn bald wieder, schon am nächsten Morgen. Er fühle sich verpflichtet, sagte er, mich zu warnen. Demnächst reise er wieder nach Deutschland, und diesmal werde er nicht zurückkehren, nein, er hätte genug. Er werde dort bleiben und sich von seiner Frau scheiden lassen.
»Haben Sie keine Kinder?«, fragte ich.
»Zum Glück nicht.«
Doch Monate später sah ich ihn immer noch, jeden Morgen lief er hinunter zum Meer, in der goldenen Morgensonne, hinunter zum Strand, wir winkten uns zu, aber sprachen nur noch Grußworte, ein paar Worte Deutsch über die Hecke, die weiße Katze hatte längst Junge geworfen, immer noch sah ich ihn, immer mit dem gequälten Ausdruck im Gesicht, bis wir eines Tages die Katzen nahmen, unsere Sachen packten und weiter südwärts zogen.
Auf der anderen Seite des Zauns
»Es hat keinen Sinn, eine Geschichte zu erzählen, die man nicht selber erlebt hat oder wenigstens erlebt haben könnte«, so ungefähr drückte er sich aus. Ein Student hatte wissen wollen, was seiner Meinung nach eine gute Geschichte ausmache. Die Antwort war wenig erhellend, der Student gab sich nicht zufrieden. »Woher weißt du«, fragte er, »ob du eine Geschichte hättest erleben können? Wir alle können alles Mögliche erleben, gerade heute.«
Er duzte seinen Lehrer, weil er Hebräisch sprach, und diese Sprache keine andere Anredeform kennt. Sein Hebräisch klang unbeholfen, er war noch nicht lange hier. Trotzdem besuchte er Seminare der Abteilung Hebräische Literatur, auf die Gefahr hin, dass er nicht allzu viel verstand.
»Innerhalb gewisser Grenzen …«, erwiderte der Alte. »Überall gibt es Grenzen, ihr werdet bald sehn. Lasst euch bloß nicht erzählen, wir lebten in einer ›grenzenlosen Welt‹ …« Er saß unter den Studenten, weißhaarig, schnurrbärtig, sein Gesicht war von der Sonne verbrannt, hatte tiefe Furchen und einen mürrischen Ausdruck. Er war auf einem Kibuz groß geworden, und Kibuzniks haben ruppige Manieren. In den Augen eines gut erzogenen jungen Amerikaners jedenfalls. Der Student war ein gut erzogener junger Amerikaner, seine Gesichtshaut rosig, sein Lächeln freundlich. Der Alte sah ihn mit leicht zusammengekniffenen Augen an. Er hatte nie wirklich verstanden, wozu die Studenten in seine Vorlesung kamen.
»Ich kann nur von unserem Land sprechen«, sagte er. »Vielleicht ist es bei euch anders. Hier gibt es Zäune, die das Leben unterteilen. Ein Zaun zwischen Juden und Arabern. Einer zwischen religiösen und nicht-religiösen Juden. Auch bei den Arabern: zwischen denen, die Christen, und denen, die Moslems sind. Zwischen Juden, die aus Europa kommen, und solchen aus Nordafrika. Zwischen beiden zusammen, wenn sie hier geboren wurden, und den Russen, die grad eingewandert sind. Zwischen allen Juden, die hier leben, ob ashkenasisch, sefardisch oder russisch, und den Juden, die nicht hier leben … Sichtbare Zäune, manchmal aus Beton, mit Stacheldraht. Oder unsichtbare, die man erst spürt, wenn man zu nahe rangetreten ist. Ich stehe auf meiner Seite des Zauns, nicht auf der anderen. Ich habe mich immer gescheut, Geschichten von der anderen Seite des Zauns zu erzählen.«
Er sah, dass er nicht verstanden wurde. »Es wäre nicht aufrichtig«, sagte er und legte viel Nachdruck in dieses Wort. Aufrichtigkeit war das Wichtigste für ihn. Auch in seinen Büchern zeichnete er solche Figuren, handfeste, gradlinige Charaktere, die auf dem Land lebten, wie er er selbst, laut und lebhaft waren wie er. »Eine Geschichte muss aufrichtig sein«, sagte er und sah dem jungen Amerikaner mitten in die Augen. »Keine Finten beim Erzählen, keine krummen Wege …« Der Amerikaner, obwohl er sich über den fast wütenden Blick wunderte, gab ihn ruhig zurück.
Das schien den Alten zur Besinnung zu bringen. In letzter Zeit spürte er, dass man ihn nicht mehr so gut verstand. Er schrieb für Zeitungen, er hatte immer gern für Zeitungen geschrieben. Da gab es sofort ein Echo. Wie hier bei den Studenten. In letzter Zeit blieb es manchmal aus.
»Okay«, sagte er, »ich will versuchen … Da war eine Geschichte neulich, ein Bombenanschlag. Ein Anschlag, der im letzten Augenblick verhindert wurde. Oder fast verhindert wurde. An einer Bushaltestelle im Norden, wo viele Araber leben. In Dörfern, manche christlich, manche muslimisch. An dieser Bushaltestelle beobachtete ein junger Araber einen anderen jungen Araber, der ihm, wie er später sagte, ›nicht gefiel‹. Er erklärte das nicht weiter. Er ging hin und sprach ihn an. Das ist das Erste an der Geschichte, was ich nicht verstehe. Würdet ihr jemanden ansprechen, der euch nicht gefällt? Unser junger Araber sah aus wie ein Falke, mit scharf gebogener Nase und großen, spähenden Augen. Er war auch kühn wie ein Falke. Er ging zu dem anderen hin und fragte ihn nach der Uhrzeit, um ein paar Worte von ihm zu hören, und der andere tat ihm den Gefallen und sprach. Und an dem Arabisch, das er sprach, erkannte unser junger Falke, das der andere ein Fremder war, ein Palästinenser, und er dachte sich seinen Teil und handelte.
Von einem Juden – denn es standen auch Juden an der Haltestelle – wäre der Palästinenser vermutlich nicht als solcher erkannt worden. Sie hätten ihn für irgendeinen Araber gehalten, für einen Hiesigen aus den Dörfern ringsum. Aber unser junger Falke sah und hörte, was ihnen verborgen blieb. Er nahm sein Mobiltelefon, ging ein paar Schritte weg und rief die Polizei. Dann blieb er an der Haltestelle stehen. Und das ist das Nächste, was mir vollkommenunbegreiflichist: dass er stehen blieb und nicht weglief. Er blieb, bis die Polizei kam, und zeigte ihnen den Palästinenser, wies mit der Hand auf ihn, mit ausgestrecktem Arm, und rief das allgemein gefürchtete Wort Mekabel, Terrorist. Daraufhin rannten die Leute, die an der Haltestelle warteten, so schnell sie konnten in alle Richtungen auseinander …
Als der Palästinenser sah, dass Polizisten auf ihn zukamen, große, bullige Kerle mit gezückten Pistolen, zündete er seine Bombe. Er wurde in Stücke gerissen, auch der Polizist, der ihn packen wollte. Ein weiterer Polizist wurde verletzt. Zwei Tote, aber bei Weitem nicht so viele, wie wenn sich der Attentäter in einem vollen Bus in die Luft gesprengt hätte. Auch unser junger Falke, der in der Nähe stand – denn er wollte den Polizisten seinen Mann zeigen – bekam Splitter der Bombe ab, flog ein Stück durch die Luft, landete unsanft. Ein Splitter traf seinen Bauch, ein anderer seinen Hals, er hat dort für den Rest seines Lebens, wie die Zeitungen schrieben, eine zwölf Zentimeter lange Narbe. Auch sein linker Arm war gebrochen, er war schrecklich zugerichtet, von Kopf bis Fuß.
Trotzdem wurde er verhaftet und ins Gefängnis gebracht, in die Krankenabteilung, weil ihn die Polizei zunächst für den Komplizen des Attentäters hielt. Erst am nächsten Tag stellte sich heraus, was er wirklich getan hatte: Man ermittelte den Anruf, rekonstruierte die Geschichte. Unser junger Falke wurde nach Haifa ins Krankenhaus geflogen und über Nacht zum Helden des Landes. Er war siebzehn und ging noch zur Schule. Manzeigte ihn im Fernsehen und sämtlichen Zeitungen. Der Staatspräsident ließ sich an seinem Krankenbett fotografieren, derInnenminister überreichte ihm eine Urkunde. Eine jüdische Organisation in Amerika bot ihm ein Stipendium an, für die Universität. Man hielt ihm Mikrofone hin, veröffentlichte, was er sagte.
Und was sagte er? Zunächst angenehm klingende Dinge. Dass er getan hätte, was er tun musste. Dass es hinterhältig und feige sei, ahnungslose Leute in Bussen in die Luft zu sprengen. Doch als man ihn fragte, ob er es ›aus Liebe zu seinem Land‹ getan hätte, schüttelte er den Kopf. Er tat den Journalisten weder den Gefallen, Israel ›sein Land‹ zu nennen, noch den, etwas gegen Israel zu sagen. Ob er sich einen eigenen Staat wünsche, fragte ein schwedischer Reporter, einen eigenen Staat für die in Israel lebenden Araber? Wieder schüttelte er den Kopf. Er sei in seinem Dorf zu Hause, bei seinen Leuten. Dort lebe seine Familie. Ich will nicht, sagte er, dass irgendein Fremder kommt und den Bus in die Luft sprengt, in dem meine Eltern, meine Brüder oder andere Verwandte aus meinem Dorf sitzen könnten.
Und nun bekenne ich euch offen«, sagte der Alte, »dass ich diesen Jungen nicht verstehe. Sicher hat dieses Denken Tradition, sicher hat es seine Gründe … Ich kann versuchen, es zu verstehen. Dennoch bleibt diese Weltsicht fern von allem, was ich selbst empfinde und denke. Jedenfalls fern genug, dass ich eine Scheu fühle, mich in ihn hineinzuversetzen, wie sich ein Schriftsteller in seine Figuren hineinversetzt. Ob ich ihn für seinen Mut bewundere oder nicht – er bleibt auf der anderen Seite des Zauns. Ich kann ihn, wenn ich aufrichtig bin, nicht verstehen.«
Er nahm das Schweigen der Studenten hin und stand auf. Raffte seine Papiere zusammen, seinen Hut, die Uhr, die vor ihm auf den Tisch gelegen hatte, und wollte gehen.
»Ich kann ihn ganz gut verstehen«, sagte der Amerikaner. »Was soll daran schlecht sein, wenn man bei Gefahr zuerst an die eigenen Leute denkt?«
»Okay«, erwiderte der Alte, »wenn du ihn verstehst, dann schreib du die Geschichte.«
Die Studenten sahen ihn abwartend an.
»Lies sie beim nächsten Mal vor«, sagte er. »Mal sehen, ob es dir gelingt … Lies sie uns vor, und wir reden darüber.« Mit einem gewissen Ernst nickte er dem Amerikaner zu, ehe er seinen ausgeblichenen Hut aufsetzte, um hinauszugehen, auf den Campus, ins Licht, unter freien Himmel.
Osama
Das Hausbau-Projekt war seit Jahren in Arbeit, bei örtlichen Behörden und staatlichen Stellen, es schien durchweg vernünftig, bis ins Detail geplant, allein der Vertrag war dreiundvierzig Seiten lang. Ich unterschrieb ihn im Büro einer Rechtsanwältin in Tel Aviv, die von der Siedlergemeinschaft mit der Wahrnehmung unserer Interessen beauftragt war. Ein Bauunternehmer wurde gefunden, der das Projekt zu dem Preis, den wir vorschlugen, in Angriff nahm. Es sollten zunächst dreißig Häuser sein, alle vom selben Architekten-Team entworfen, so dass die Siedlung einen gemeinsamen Kanon hatte, dennoch jedes Haus verschieden, nach Wunsch der einzelnen Familien.
Der Bauunternehmer fing vielversprechend an. Dann kam es zu Unterbrechungen. Er war in Geldschwierigkeiten, hieß es, deshalb hatte er den Auftrag zu unseren Bedingungen angenommen. Die Intifada brach aus, die Preise stiegen. Alle Preise, auch solche, an die man meist nicht denkt, für Beton, Stahlträger, Holz. Der Bauunternehmer hatte den Vertrag zwei Jahre zuvor unterschrieben, als alles noch billiger war. Er verlangte Geld, immer wieder Geld, es verschwand bei ihm wie in einem Schwamm, dennoch konnten wir nicht verhindern, dass er bankrott ging oder in ernsthafte Schwierigkeiten geriet, wir erfuhren es nie genau. Er brachte die Häuser nicht zu Ende, hörte irgendwann auf zu bauen, und die, deren Häuser nicht beendet waren, mussten sehen, wie sie zu Ende kamen.
Wir hatten Glück, unser Haus wurde gerade noch fertig. Bei anderen sah es weit schlimmer aus. Unser Haus stand, hatte Strom, Wasser, Telefon, nach langen Kämpfen mit der jeweiligen Behörde. Wir zogen ein, obwohl es immer noch unverkleidete Steckdosen gab, ein paar nicht verfugte Fliesen, vergleichsweise Kleinigkeiten. Der Bauunternehmer fand kaum noch Arbeiter, seine Geldknappheit zwang ihn, statt der Rumänen oder Araber aus dem Norden, mit denen er angefangen hatte, illegale Arbeiter auf die Baustelle zu holen, Palästinenser aus Gaza und Hebron. Sie waren billiger als die Rumänen oder die Araber aus dem Norden, aber sie kamen nicht immer. Wenn es wieder einen Anschlag gegeben hatte, und die Übergänge geschlossen waren, lag die Baustelle verödet zwischen Haufen von Bauschutt und Unrat. Tagelang geschah nichts. Die, deren Häuser erst halb fertig waren, wurden nervös, telefonierten mit der Anwältin, hielten lange Reden in der Siedlerversammlung, boten heimlich Geld, damit er weitermachte.
Direkt vor unserem Neubau standen die Baracken, in denen die Palästinenser übernachteten. Es war verboten, dass sie über Nacht blieben, sie waren illegal hier, ohne Arbeitserlaubnis. Sie hatten ein Auto, einen kleinen Kombi, in den sich sechs Leute quetschten, dieses Auto stand auf unserer Seite. Sie kamen im Morgengrauen über die »Grüne Linie«, trafen sich beim Autound fuhren her. Sie waren jung und nahmen hin, wie der Bauunternehmer sie behandelte. Sie erzählten, dass sie alle zu einer Familie gehörten, allesamt Brüder, Vettern, Onkel und Neffen waren. Ihr Anführer war ein gedrungener, bulliger Mittzwanziger, der sich Samy nannte.
Wir kannten auch die Polizeichefin unseres Distrikts, eine Mutter von fünf Kindern, Tochter von Westbank-Siedlern, die bei der Armee eine Blitzkarriere gemacht hatte wegen ihrer organisatorischen Fähigkeiten. Sie ist mit unserer Tochter befreundet und kam uns eines Abends besuchen. Sie war wie immer in Eile und erklärte, kaum aus dem Auto gestiegen, dass sie gleich wieder abfahren müsse. Aber so viel Zeit hatte sie doch, einen Blick auf die Baracken zu werfen und die Arbeiter zu begrüßen, die eben Feierabend machten und vor den Wellblechhütten saßen. Sie schien einige zu kennen, winkte ihnen zu, ging sogar kurz zu ihnen hinüber, und die Jungs standen auf wie früher Schulkinder aufstanden, wenn die Lehrerin in die Klasse kam, und umringten sie. Wie immer war es Samy, der sprach. »Er ist ein guter Mann«, sagte die Polizistin, als sie in Eile eine Tasse Tee mit uns trank. »Ich kenne ihn seit Jahren. Manchmal gebe ich ihm einen Tipp, wenn die Border Police eine Razzia plant.«
Irgendwann erfuhren wir, dass Samy nicht Samy hieß, sondern Osama. Er versuchte, diesen Namen vor uns zu verheimlichen – wegen Osama bin Laden, der damals der Schrecken des Westens war. Die Arbeiter versuchten überhaupt, einen guten Eindruck zu machen. Am Unabhängigkeitstag hatten sie eine kleine israelische Flagge am Auto wie viele hier. Eines Abends rief mich Samy an, ich solle auf die Baustelle kommen, mir ansehen, wie er das Haus verputzt hatte. Es war ein farbiger Putz, ein schönes, südliches Rot. Samy hatte den Putz mit Geschick aufgetragen, in großen, regelmäßigen Schwüngen. Ich war begeistert, als ich es sah. Er hatte es so gut gemacht, dass ich ihm auf der Stelle einen Hunderter gab.
Osama schien seinen Namen nicht zu mögen, wie wenn ein Deutscher oder Österreicher Adolf heißt. Ich hörte den Namen an manchem Tag zehnmal und öfter, von Nachbarn oder Osamas Brüdern und Cousins, und wurde doch nie das Gefühl los, das ich beim ersten Hören empfunden hatte, eine Mischung aus Erschrecken und Belustigung, ein an sich unbegründbares, sinnlosesGefühl, denn außer dem Namen gab es keine Gemeinsamkeit zwischen ihm und Bin Laden. Obwohl Osama und die anderen gut arbeiteten, kam der Bau zu keinem Ende. Der Bauunternehmer benutzte die halbfertigen Häuser als Druckmittel gegen die Siedlergemeinschaft. Er gab die Schlüssel nicht her, unter dem Vorwand, irgendeine Kleinigkeit sei nicht fertig, um dann wieder mit seinen Verhandlungen um Geld anzufangen, seinen nachträglichen Versuchen, den Preis hochzutreiben.
Manchmal dachte ich darüber nach, wie viel Macht dieser Mensch über uns gewonnen hatte, über unseren Alltag, unsere Verhältnisse, unser weiteres Leben. Ich war ihm ein paar Mal begegnet: ein großer, brünetter Mann, noch jung, mit Goldrandbrille und Händen wie Schaufeln, er packte einen Arbeiter am Kragen und schüttelte ihn, er brüllte, stampfte mit den Füßen, trotzdem kam der Bau nicht voran. Er fuhr mit einem silbrig glänzenden Jeep auf dem Bauplatz herum und rief Kommandos aus dem Fenster, er telefonierte mit zwei Mobiltelefonen gleichzeitig, berief Sitzungen ein, saß breitbeinig auf einem Stuhl, trug seine Forderungen vor. Er verlangte mehr Geld von der Siedlergemeinschaft, die Preise der Baumaterialien wären gestiegen, er fuhr ab, als wir nicht nachgaben, und am nächsten Tag stand die Baustelle still.
Niemand kam gegen ihn an. Die Anwältin reagierte nicht mehr, weder auf Anrufe, noch auf Briefe. Der Ingenieur, von uns dafür bezahlt, dass er den Bauunternehmer überwachte, ließ sich am Telefon verleugnen. Unsere erwachsenen Kinder, die eigene Häuser hatten, betrachteten uns voller Mitleid. Freunde, deren Besuch in unserem Haus wir unter immer neuen Vorwänden verschieben mussten, sprachen Formeln, die wie Beileid klangen. Schon vor Wochen hatten wir alles gepackt, wir saßen auf Kisten und Koffern, aßen aus Konservendosen, schliefen in Schlafsäcken.Aber irgendwann war das Haus soweit fertig, dass die Bauabnahme durch einen Angestellten der Gebietsverwaltung möglich wurde, und kaum war dies geschehen, zogen wir ein. Wir ließen die Möbel von Osama, seinen Vettern und Brüdern tragen, es ging schnell, musste schnell gehen, denn am nächsten Tag flog ich ins Ausland.
Als ich zurückkam, hatte sich meine Frau ein paar Mal von Osama helfen lassen. Er arbeitete rasch, sein rundes Gesicht hatte eine gleichbleibende Ausstrahlung von guter Laune. Er arbeitete auch nach Feierabend, wenn die anderen vor den verkommenen Baracken saßen und Wasserpfeife rauchten, was er missbilligte. Er nannte das Rauchen Bajah, Problem.
»Stoff?«, fragte ich.
Er wiederholte mit bedenklicher Miene: »Es ist nicht gut. Ein Problem.«
So begann er, von sich und seinen Brüdern und Cousins zu erzählen, von den Hintergründen ihres Hierseins, von ihrem Kontrakt mit dem Bauunternehmer. Er verbarg nicht länger, was wir längst wussten: dass sie illegal arbeiteten, ohne schriftlichen Vertrag, vollkommen rechtlos. Er gab diese Geheimnisse preis, so wie er eines Tages aufgehört hatte, seinen Namen zu verbergen. Sie kamen aus einem Dorf bei Hebron. Die Border Police ließ sie ein, man kannte sie, wusste, dass der Bauunternehmer ohne sie die Häuser nicht fertig bekam, wusste auch, dass Dutzende Menschen von dem Geld lebten, das sie hier verdienten. Doch am Abend sollten sie zurückfahren, zwei Stunden von hier bis in das Dorf hinter Hebron, falls es nicht noch länger dauerte, weil sie am Kontrollpunkt zu warten hatten.
Eines Tages erzählte Osama, als wieder eine Schließung drohte – in Ashkelon waren Qassam-Raketen eingeschlagen –, dass ihnender Bauunternehmer Geld schuldete, viel Geld. Er schulde ihnen zusammen, ihrem Clan, ihrer Familie, rund zwanzigtausend Dollar. Für sie eine ungeheure Summe. Der Bauunternehmer vertröste sie Woche um Woche. Wie er uns um unser Geld betrog, indem er es nahm, und dann nicht arbeitete, so betrog er Osama und die anderen Arbeiter, indem er sie arbeiten ließ und nicht bezahlte. Er betrog beide Seiten. Sie wollten bleiben, sagte Osama, so lange hierbleiben, bis der Bauunternehmer zahlte. Während er sprach, wässerte ich den Garten. Die Dämmerung fiel, Osama verabschiedete sich, ich ging in mein Studio, um die E-Mails zu lesen. Gegen zehn schaltete ich den Computer aus und wollte schlafen gehen. Mein Weg vom Studio ins Wohnhaus führt durch einen Patio, der eine Öffnung zur Straße hat. Der Patio lag in flackernd blauem Licht. Ich blieb stehen und starrte auf die Straße. Drei oder vier Jeeps standen vor den Hütten der Palästinenser, das blaue Licht kam von ihren Rundumleuchten. Soldaten, die Maschinenpistole im Anschlag, warteten neben den Türen, aus denen Osama und die anderen langsam heraustraten. Meine Frau erschien, beunruhigt wie ich.
Ein Offizier sah uns und rief: »Alles in Ordnung bei euch?«
»Was ist los?«, fragte ich.
»Wir holen ein paar Hebroner.«
»Aber das sind gute Leute«, sagte meine Frau.
»Trotzdem dürfen sie nicht bleiben. Es ist gegen das Gesetz.« Er drehte uns den Rücken zu wie jemand, der alles gesagt hat, was zu sagen ist. Die Arbeiter wurden vor der mittleren Wellblechhütte aufgereiht, im Scheinwerferlicht eines Jeeps. Dort standen sie lange, während die Soldaten ihre Papiere ansahen, rauchten und telefonierten Auch der Offizier telefonierte, er gab Namen durch und jemand sagte ihm, was mit jedem Einzelnen zu geschehen hatte. Der Jeep richtete sein Licht auf die Männer, Gerede erfüllte die Luft, ein Hin und Her von Fragen, Erklärungen, Anschuldigungen gegen den Bauunternehmer. Das Gerede zog sich hin, steigerte sich zu lautstarken Diskussionen, einige Male zu Gebrüll. Darüber schlief ich ein.
Später in der Nacht Erwachen. Draußen Stille. Ich ging in den Patio und sah hinaus auf die Straße. Über der Wüste ein Nachthimmel mit herrlichen Sternen, schräg schwamm die Mondbarke auf dem samtigen Blau. Die Baracken still, umgeben von Schutt, rostigem Eisen, Betonklumpen, Styropor, Lebensmittelresten, verwesenden Matratzen, Plastiktüten. Der Kadaver eines Kühlschranks lag in einer Lache grünlichen Wassers, das aus einer Baracke quoll. Es war der schmutzigste Ort, den ich je gesehen hatte. Wir sind Europäer, vergleichsweise harmlos. Zur Sauberkeit erzogen, von Kindheit an vor Krankheitserregern und Ungeziefer gewarnt. Uns fiel nichts anderes ein, als Beschwerden an die Gebietsverwaltung zu schreiben und möglichst viele Katzen zu halten, damit die Ratten, Skorpione, Schlangen nicht zu uns herüberkamen, die paar Dutzend Meter, die uns von den Baracken trennten.
Die Stille war betäubend. Sie verbarg nichts, gab alles preis, was ich bei Tag nicht verstand. Auf unsere Beschwerden antwortete niemand. Der Bauunternehmer war am Rande des Bankrotts, alle hofften, er würde irgendwann die letzten Häuser zu Ende bringen. Vorher lohne es nicht, die Baustelle aufzuräumen, sagten die Zuständigen, wenn ich sie nach vielen Versuchen am Telefon erwischte. Osama und die anderen Arbeiter kamen ein paar Tage nicht, einige sahen wir überhaupt nie wieder, die Baustelle lag still. Aber eines Morgens war Osama wieder da, sein rundes Gesicht strahlte wie immer, auch sein dünner Cousin Ali war da, dessen älterer Bruder und noch ein paar, die wir kannten. Sie waren da, als wäre nichts gewesen, kein blaues Licht in der Nacht, kein An-der-Wand-Stehen, umringt von Soldaten.
Wir pflanzten einen Feigenbaum an diesem Abend. Osama kam, um zu helfen. Er schlug mit der Spitzhacke in die steinharte Wüstenerde, damit ich leichter graben konnte. Osama und seine Brüder hatten einen Teil des ihnen zustehenden Geldes erhalten, daher arbeiteten sie weiter. Während er sprach, beschlich mich die Ahnung, dass der Bauunternehmer an jenem Abend die Border Police gerufen hatte, um die Arbeiter und ihre Forderungen ein paar Tage los zu sein, doch ich behielt den Verdacht für mich. Falls es so war, wusste Osama es ohnehin. Er sprach nicht von der vorübergehenden Festnahme, sie schien zu alltäglich, um viele Worte deswegen zu machen.