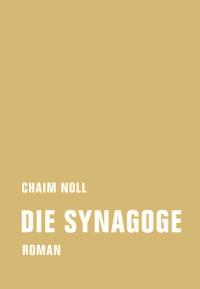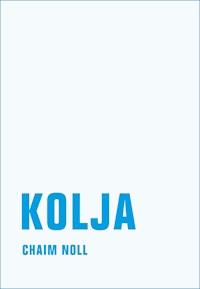Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Schlaflos in Tel Aviv" versammelt Erzählungen aus mehr als fünfundzwanzig Jahren, realistische und fantastische, über Begegnungen und Begebenheiten. Chaim Noll erzählt u.a. von einem Schuljungen in Berlin, der versucht, sich Geld für eine Fahrkarte zu erbetteln, einem jungen Israeli, der das erste Mal nach Deutschland fliegt, dem Diebstahl eines Pelzmantels, der sich Jahrzehnte später als ein Segen erweist, einem Schriftsteller, der an seinem Verlag verzweifelt und überall schwarze Hunde sieht, einer alten Dame, die trotz der Verfolgung ihrer Familie in der Stalinzeit Kommunistin geblieben ist, dem Mord an einem Ikonenhändler aus Russland, der einen Antiquitätenhändler schwer erschüttert, einem ehemaligen Minister aus Afghanistan, dem im Exil kein Neuanfang zu gelingen scheint, und dessen Sohn, der vom Krieg gezeichnet ist. Nolls klarer Blick auf die Menschen prägt diesen Band. Zugleich spiegelt sich in den Geschichten sein bewegtes Leben in der DDR, im West-Berlin der Achtziger- und frühen Neunzigerjahre und sein Leben in Israel heute.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Chaim Noll
SCHLAFLOS IN TEL AVIV
Kein Geld
Drei halbkreisförmige Treppenstufen abwärts, ein paar Schritte über gelbe Blätter. Der Tag überraschend warm. Mitte Oktober, blau flimmernde Luft. Die Tage davor waren bewölkt und düster – ein Wetter, das er hasst. Die Erleichterung ist so groß, die Wärme so wunderbar, dass man sich ausziehen muss. An seinem rechten Arm hängt die Tasche, er zerrt erst den linken Arm aus der Jacke, nimmt die Tasche in die andere Hand, zieht die Jacke ganz aus. Eine Krähe, ein paar Meter vor ihm auf dem Straßenpflaster, wirft einen kurzen Blick auf ihn, sieht keinen Grund zu fliehen.
Schritte auf einem Weg, den er auswendig kennt … Geh gerade, Konrad, hört er seine Großmutter sagen, und wie immer, wenn er seinen Namen hört oder geschrieben sieht, kommt es ihm vor, als könne es nicht wirklich sein Name sein. Am Supermarkt vorbei. Durch die Scheiben sieht er Gestalten im künstlichen Licht ihre Wagen schieben. Eine alte Frau mit Hund kommt ihm entgegen, in dieser Gegend sind immer alte Frauen mit Hunden unterwegs. »Charly!«, ruft eine dünne Stimme, als der Hund an seinem Hosenbein schnuppert, ein winziger Hund mit nasser Nase und silbrig braunem Fell, das ihm über Rücken und Augen fällt wie Kaskaden von Wasser.
»Er tut dir nichts!«, sagt die alte Frau.
Tut dir nichts. Sie hat ihn mit Du angeredet. Wie ein Kind. Er weiß, dass er älter wirken könnte, wenn er sich ruhiger bewegen würde, langsamer, lässiger. Oder vielleicht nicht das. Aber irgendwie anders, wie man sich eben heute bewegt. Er hat einen Freund, Sebastian, der sich bewegt und lächelt wie die Leute in Filmen, alles so macht, wie es sein muss, an dem alles sitzt und passt. Immer die richtigen Klamotten, die Musik, die man jetzt hört. Die Mädchen sind hinter Sebastian her, finden ihn »süß«. Er denkt an ihn, wenn er eine Tasse vom Tisch fegt, ohne zu wissen, wie es dazu kam, wenn er mitten im Schritt merkt, dass er mit hängendem Kopf über die Straße geht.
Hinter dem Supermarkt beginnt ein gewundener Weg, mit hellem Sand bestreut. Erinnert an Strand und Meer. Der Weg führt durch einen Park, der gestern trostlos aussah, heute bezaubernd. Gelbe Blätter, sanft leuchtend. Er hat Lust, vom Weg mitten in diese Blätter zu springen, zu rennen, über den Rasen, auf dem ein goldener Schimmer liegt, letzter Hauch des Sommers. Ihm fällt ein, dass er nach Hause muss, die Tasche auspacken, Mathematikbuch aufschlagen, Kapitel über Quadratfunktionen. Die Mathematikarbeit morgen ist entscheidend für die Abschlusszensur. Er soll sich vorher ausschlafen, sagt sein Vater.
Die Blätter auf dem Parkweg rascheln verlockend. Er stößt mit dem Fuß hinein, lässt sie wirbeln, übersieht einen Mann im gefährlichsten Alter, Hut, rosiges Rentnergesicht. Zusammenstoß. Sie stehen sich einen Atemzug lang gegenüber. Er sieht die Wangen des Mannes bibbern, sich aufplustern. Wartet nicht länger, schiebt sich an ihm vorbei, hört noch »Kannst du nicht aufpassen …«, sich entfernendes, halblautes Gezeter. Vor ihm der S-Bahnhof, gelber Klinker, grüne Blechdächer – wie ein kleines Schloss, eine Ritterburg. In der Kaiserzeit hat man so gebaut, sagt seine Großmutter. Sie ist in der Kaiserzeit geboren. Es war eine schöne Zeit, behauptet sie – in der Schule lernen sie was anderes. Dann lebte sie eine Weile im Ausland, weil in Deutschland Krieg war. An einem unverhofft schönen Tag denkt man rascher und leichter als sonst. Wenn er seine Oma besucht, trinkt er Kaffee mit ihr. Nach der zweiten Tasse kommen verrückte Einfälle, er schreibt etwas, was aussieht wie ein Gedicht. Zeigt es niemandem. Manchmal schreibt er gute Aufsätze. Der Sonnenschein des Oktobertags hat keine Kraft. Die Sonne, ein ferner Stern, sinkt langsam ab, ein schwacher Lichtstreif im Grün der Dächer des S-Bahnhofs.
Auf dem Rondell vor dem Eingang parken Autos, bunt, staubig, gelbe Blätter auf Kühlerhauben. Er greift in die Hosentasche nach der Monatskarte. Die Karte ist in der hinteren Tasche oder in der linken. Ein Mädchen mit rotem Haar geht vorbei, rasch drückt er die Wirbelsäule durch, damit er so groß aussieht, wie er ist … Wenn nicht dort, dann in der Jacke. Er fühlt etwas wie Panik aufsteigen. Die Karte ist nicht in der inneren Jackentasche. Wo könnte sie sonst sein? Münzen für den Automaten … Keine Tasche klimpert, überall stiller Stoff. In der Hemdtasche ist ein Zwanzigmarkschein, ein Geschenk von Oma. Den wird er wechseln lassen und eine Fahrkarte kaufen.
Der Wind hat gelbe Blätter bis auf die Fliesen der Bahnhofshalle geweht. Warten, bis jemand kommt. Die Leute bleiben nicht gern in einer leeren Bahnhofshalle stehen und zücken ihr Portemonnaie, aber er wird seine Lage erklären. Entschuldigen Sie, ich habe kein Kleingeld, können Sie mir diesen Schein wechseln? Wieso eigentlich: Entschuldigen Sie? Warum muss man sich ständig entschuldigen? Er tastet, gerät in Panik, weil es in der Brusttasche nicht knistert wie es müsste. Er knöpft sie auf, fährt mit der Hand rein. Leer. Das Geld ist nicht da. Natürlich nicht. Jetzt fällt es ihm ein. Der Schein ist in dem Hemd, das er gestern anhatte. Ganz sicher. Er erinnert sich, dass er das Hemd gestern Abend im Keller vor die Waschmaschine geworfen hat. Nicht so schlimm, wenn der Schein mitgewaschen wird, man hängt den Geldschein hinterher auf die Leine und bügelt ihn. Aber der Schein ist nicht da. Er steht hier, ohne ihn. Ohne Geld.
Schwarzfahren. Erwischen sie mich, notieren sie meine Adresse und schicken einen Strafbescheid. Er ist schon mal beim Schwarzfahren erwischt worden, »im Wiederholungsfall«, hatte der Uniformierte gesagt, wird es der Schule gemeldet. Na und? Wäre trotzdem blöd. Schade um das Geld. Dann lieber gleich ein Taxi nehmen, ins Haus gehen, seine Mutter gibt dem Fahrer das Geld. Sie wird erschrecken wie immer, wenn etwas Außergewöhnliches geschieht. Er ist noch nie mit dem Taxi von der Schule nach Hause gefahren. Am Abend muss er sich dann einen Vortrag anhören, über Geldverschwendung und »Jugendliche«, die »ihre sieben Sinne nicht beisammen haben«. Sein Vater hält gern Vorträge … Welcher Tag ist heute? Donnerstag. Er sieht die offene Garagentür wie jeden Donnerstag, die leere Garage. Die Mutter ist donnerstags immer bei irgendwelchen Freundinnen zum Tee.
Das Licht der Bahnhofshalle verändert sich, eine Spur Schatten von dort, wo der Park golden ins Dunkel schimmert. Vor dem lichten Hintergrund nicht gleich zu erkennen, erscheint ein Mann. Nähert sich. Jetzt nicht groß überlegen, zwei entschlossene Schritte auf den Mann zu – der Mann weicht sofort zurück – und freundlich sagen: »Entschuldigen Sie, könnten Sie mir das Geld für eine Fahrkarte borgen? Ich gebe es Ihnen natürlich zurück.«
Der Mann zögert im Schritt, sieht ihn über die Schulter an.
»Ich gebe Ihnen meine Adresse. Eine Mark brauche ich, mehr nicht. Ich habe es eilig.«
Das war dumm. »Ich auch«, sagt der Mann im Vorbeigehen, schon auf der Treppe. Konrad glaubt von hinten zu sehen, dass er sich über seine schlagfertige Antwort freut: »Ich auch«.
Entschuldigen Sie – so kann man nicht anfangen. Hört sich ängstlich an, und wer Angst hat, ist irgendwie verdächtig. Siegessicherauftreten. Grinsen. Alles nur Spaß. Der Nächste, wieder ein Mann.
»Können Sie mir eine Mark borgen? Ich habe mein Geld zu Hause vergessen. Ich gebe Ihnen meine Adresse …«
Der sagt gar nichts, sieht ihn nicht mal an, geht weiter, gebügelte karierte Hosen, weinroter Pullover, Markenzeichen auf der linken Brust. Teures Rasierwasser. Verschwindet auf der Treppe, oben fährt donnernd der Zug ein, hält kurz, inzwischen der zweite, den Konrad halten und abfahren hört. Das Geräusch der zuschnappenden Türen, Rollen der Räder auf den Gleisen. Stille.
So viel Theater um das bisschen Geld.
Es ist ein Spiel. Unvorhergesehene Situationen sind dazu da, dass man aus ihnen lernt. Eine junge Frau. Er macht einen Schritt, sie gleich drei, entschwindet, ehe er sein »Ich brauche …« zu Ende gesprochen hat. Ihr Schritt auf der Treppe verrät eine Angst, die ihm schmeichelt. Vor einem kleinen Jungen läuft man nicht weg. Die Schritte auf der Treppe werden erst ruhiger, als sie oben Licht sieht, freien Himmel, den Bahnhofsvorsteher, trapp-trapp-trapp, in Sicherheit. Wie ist das eigentlich: Ist Betteln erlaubt? Hat jeder das Recht zu betteln? Oder braucht man dazu eine Genehmigung?
Er ist kein richtiger Bettler. Er wird heute Abend am Tisch sitzen, viel essen, sein Appetit wird größer sein als sonst. Er wird in seinem Zimmer quadratische Gleichungen lösen, ab und zu lachen, wenn ihm das erschrockene Gesicht der jungen Frau einfällt. Die Formel »Ich brauche eine Mark« ist zu ruppig für Frauen. Den Siegessicheren wird er nur noch bei Männern geben. Bei Frauen besser die Frageform: »Könnten Sie mir vielleicht …«
Frauen haben eher Mitleid als Männer. Ein Mann im Elend rührt sie. Er fährt sich mit der Hand ins Haar, wirft die Locken überder Stirn in die Höhe, steht kerzengerade. Ist nicht schmächtig, sondern schlank, nicht fehl am Platz, sondern interessant. Sebastian sieht hübsch aus, aber ich sehe gefährlich aus. Und gefährlich ist irgendwie besser. Nicht jeder Mann im Elend rührt Frauen, aber ein gefährlicher. Das ist ganz logisch.
Wieder eine Frau. Eine ältere. Graue Kurzhaarfrisur, Rock, Windjacke, leichter Schritt. Hat wahrscheinlich Kinder in seinem Alter, kann nachfühlen, wie man in diese Lage kommt. Irgendwo hat er das gelesen, in einem Buch über den Krieg, über versteckte Juden: »Ich habe diesem jungen Mann einfach helfen müssen, ich dachte daran, dass er mein Sohn sein könnte.« Achte auf die Frageform. »Guten Tag.«
Atemholen. »Können Sie mir vielleicht eine Mark geben?«
Sie hört ihn zu Ende an, seine Geschichte vom vergessenen Kleingeld, ist stehen geblieben, in der Hand hält sie ihren Fahrschein. Keine Spur von Erschrecken. Sie fragt: »Bist du Deutscher?«
Ihre Augen, hell, mustern ihn ungeniert, von Kopf bis Fuß. Er erwidert den Blick. Findet keine Furcht, nur kühles Abwarten. »Ich bin natürlich bereit, Ihnen meine Adresse …«
Die Frau sieht ihn nach wie vor an. Fragt noch einmal, zweifelnd: »Du bist Deutscher?«
»Ja.«
»Du siehst nicht so aus.«
»Man kann nicht immer nach dem Äußeren gehen«, antwortet er, ohne nachzudenken, und wundert sich, woher der Satz kommt. Die Frau scheint ihn nicht zu hören. Lächelt nicht, zuckt nicht mit der Wimper. Sieht ihn nach wie vor fest an und sagt: »Dann merke dir: Ein Deutscher bettelt nicht.«
Abgang mit festem Schritt, flache Schuhe, hoch die Treppe, keine Eile, oben fährt der Zug ein, der vierte, fünfte, schnappende Türen, Stille.
Später kommt ein Junge aus einer anderen Klasse und gibt ihm die Mark. Allein im Abteil, denkt er drüber nach, warum ihm die Frau nicht geglaubt hat, dass er Deutscher ist. Sie hat etwas in ihm gesehen, was er selbst nicht sieht. Oder doch manchmal sieht, wenn er vor dem Spiegel steht. Die Ahnung, dass etwas mit ihm anders ist, als er dachte. Was ist eine Ahnung wert? Wenn sonst nichts mehr da ist, kein Wort, kein Anhaltspunkt, nichts?
(2000)
Zinsen aus Zürich
»Wie haben Sie geschlafen?«
»Oh, danke. Zuerst ganz gut. Bis zwei oder drei, dann bin ich aufgewacht. Die Schwester kam. Ich habe etwas getrunken … Gegen Morgen schlafe ich oft unruhig. Träume wirres Zeug. Manchmal auch schreckliches. Wie heute Nacht. Ich hatte einen schrecklichen Alptraum.«
»Was haben Sie denn geträumt?«, fragte er freundlich, ein wenig obenhin, an ihrem Bett stehend, mit etwas beschäftigt, was sie nicht sehen konnte. Aus ihrer liegenden Position sah sie ein Stück von seinem weißen Kittel und die Schläuche, die von oben, wo er hantierte, zu ihrem linken Arm führten.
»Von vergessenen Sachen auf einem Bahnhof. Ich träume immer von Bahnhöfen. Dass ich dort etwas verliere. Und dann ist es zu spät, der Zug fährt ab, ich kann nicht mehr suchen … Ich vermisse die Tasche mit allen Papieren, mit dem Geld, mit der Fahrkarte, irgendwo auf einem dieser schrecklichen Bahnhöfe, in Mannheim oder Fulda … Schrecklich.«
»Sie sollten es nicht weiter schwer nehmen«, sagte er. »Manche träumen viel schlimmere Dinge.«
Sie begann, sich zu ärgern. Das Bedrückendste an ihrer Lage war die Hilflosigkeit, die Hässlichkeit des Alters, ausgeliefert diesen viel Jüngeren, die sich insgeheim über sie lustig machten. Oder sich vor ihr ekelten. Seit dem Schlaganfall war sie gelähmt. »Leicht gelähmt«, wie sie es beharrlich nannte. Die linke Seite, Arm und Bein. Das Bein konnte sie inzwischen halbwegs bewegen, sie schleppte es nach. Sie konnte allein auf die Toilette gehen. Das würde sie tun, bis sie tot umfiel. Es kostete sie jedes Mal eine halbe Stunde, sie tastete sich an Bettkante, Stuhllehne, Wand, Türrahmen, Waschbecken langsam, Schritt für Schritt, in den Waschraum ihres Einzelzimmers. Wenigstens das: Sie lag in einer Privatklinik, allein, mit eigenem Zimmer, eigenem Bad.
Sie versuchte, sich gut zu halten. Jeden Tag ging es ein wenig besser. Sie war glücklich über den kleinsten Fortschritt. Von ihrer Tochter hatte sie sich Schminksachen bringen lassen, auch ein wenig Schmuck. Ein paar nicht allzu schwere Stücke. Perlen machten sich ganz gut zum Nachthemd. Sie hatte eine gewisse Schwäche für diesen jungen Arzt. Er war dunkelhaarig, hatte dunkle Augen mit starken Brauen. Ihr war, als ob er jemandem ähnelte, den sie einst gekannt hatte. Sie mochte Männer mit dunklen Haaren. Und mit Augen, die bei aller Munterkeit, allem Glanz, auf ihrem Grund etwas wie Trauer zeigten.
»Was wissen Sie denn?«, fragte sie. Es klang zurechtweisend. Ihre Stimme war noch intakt, hatte den alten, vollen Klang. »Was wissen Sie über die Träume anderer Menschen?«
»Sorry«, sagte er, »ich muss die Infusionsnadel einführen.«
»Ich habe diese schreckliche Geschichte geträumt …«, begann sie, entschlossen, jetzt unbedingt weiterzureden, wie immer, wenn sie Schmerz fürchtete. Gab es ein besseres Mittel gegen Schmerz als Reden? »Die Geschichte damals mit der Pelzjacke. Eine wahre Geschichte. Ich träume manchmal Sachen, die wirklich passiert sind.« Sie sprach rasch, ohne viel zu überlegen. Den Einstich in ihren Arm merkte sie kaum, doch die eindringende Flüssigkeit erzeugte ein drückendes Gefühl, eine schmerzhaftes Pressen, das ihr Angst machte.
»Ich kam von Basel«, fuhr sie fort, »ein Freund meines Mannes hatte mich im Auto hingefahren. Weil in Basel der Interzonenzug nach Berlin abging. Der Zug fuhr viele Stunden durch Deutschland, die Fahrt dauerte fast den ganzen Tag.«
»Warum sind Sie nicht geflogen?«, fragte der junge Arzt. Er ging wie immer auf sie ein. Sie war Patientin einer Privatklinik. Außerdem billigte er ihre Methode, sich auf diese Weise abzulenken.
»Damals flog man noch nicht so viel«, sagte sie, ihre Stimme klang kurzatmig, offenbar verursachte ihr die Infusion Beschwerden. »Es war nicht üblich«, fügte sie hinzu. »Fliegen war damals, in den Sechzigern, noch etwas Außergewöhnliches.« Sie musste eine kurze Pause einlegen. Dann, entschlossen: »Sie sind zu jung, um das zu wissen. Es war damals sehr viel teurer als mit der Bahn. Wir wollten Geld sparen, Motti und ich. Eine Marotte. Nachkriegszeit. In diesem Fall hat das Sparen viel Geld gekostet. Denn im Flugzeug wäre mir der Pelz nicht gestohlen worden … Der Dieb hätte nicht unterwegs aussteigen und verschwinden können.«
»Ein Pelz wurde Ihnen gestohlen?«, fragte der Arzt.
»Sagte ich das nicht?«
»Ich habe nicht gleich verstanden, ob es sich bei dem, was Sie erzählen, um Traum oder Wirklichkeit handelt.«
»Nein, mir ist wirklich ein Pelz gestohlen worden. Ein Nerz. Und das Schlimme war … Es war nicht nur der Pelz allein.«
»Nicht nur der Pelz allein?«, fragte er.
»Nein. Es war Geld drin. Ziemlich viel Geld.«
»Geld? In dem Pelz war Geld?« Die Frage kam rasch, wie aus der Pistole geschossen. Zum ersten Mal hörte sie etwas in seiner Stimme, ein Stutzen und Staunen, das wie echtes Interesse klang.
»Ja, ich hatte in der Pelzjacke Geld versteckt. Nun, nicht gerade versteckt, aber doch … sagen wir: untergebracht.«
»Erzählen Sie!«, sagte er und setzte sich auf den Stuhl an ihrem Bett. Der Stuhl war für Besucher da, es war nicht üblich, dass sich ein Arzt dort hinsetzte. Die Ärzte standen, sie waren meist in Eile. Nur selten nahm sich einer von ihnen Zeit zum Sitzen, wenn eine Therapie erklärt werden musste, wenn man ihre Unterschrift brauchte, ihre Kenntnisnahme der Nebenwirkungen oder Ähnliches.
»Sie werden die Strecke kennen. Basel–Berlin. Einmal der Länge nach durch Deutschland. Über Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Hanau, Fulda, Kassel, Göttingen, Wolfsburg, dann der Grenzübergang, wie hieß er noch? Ankunft in Berlin, Zoologischer Garten … Ich habe mir die Strecke gemerkt, weil ich hundertmal an diese Geschichte gedacht habe. So etwas vergisst man nicht. Ich gab mir selbst die Schuld – wem sonst? Ich war dumm. Unachtsam. Die Polizisten, die Schaffner, alle, die damals mit der Sache zu tun hatten, haben hinter meinem Rücken über mich den Kopf geschüttelt … Ich erinnere mich an Fulda. Und dann das letzte Stück von der Zonengrenze nach Berlin … Wie hieß noch der Grenzübergang?«
»In den Osten? Warten Sie … Der Zug Basel–Berlin fuhr damals, glaube ich, gleich hinter Fulda in den Osten rüber. Bei Bad Hersfeld. Nicht wie heute über Kassel und Wolfsburg. Der Übergang hieß Bebra.«
»Schön. Vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung. Hinter Fulda habe ich sowieso nichts mehr mitbekommen. Also kennen Sie die Strecke?«
»Ich bin sie oft gefahren. Ich habe in Freiburg studiert. Bis zur Approbation. Erst später in Berlin, die Facharztausbildung. Weil meine Frau Berlinerin ist. Wir haben in Berlin geheiratet. Ich bin aus Frankfurt. Wir haben am Rand von Frankfurt gelebt, meine Mutter und ich, zwischen Frankfurt und Hanau.«
»Öde Gegend«, sagte sie. »Das ödeste Stück Eisenbahnfahrt, an das ich mich erinnern kann. Verzeihen Sie, falls das taktlos klingt.«
»Ich verstehe, was Sie meinen.«
»Ab achtzig nimmt man sich einiges raus, was man früher nicht getan oder gesagt hätte«, erklärte sie. Sie wunderte sich über diesen Satz. Schüttelte kaum sichtbar den Kopf. Disziplin. Zum Gegenstand des Gesprächs zurückkehren, nicht wie manche alte Leute ins Schwatzen kommen. »Wir sprachen über die Gegend zwischen Frankfurt und Hanau. Flach wie ein Brett. Hässliche kleine Städte, Vororte, schüttere Bäume, dünnes Gehölz. Häuser dicht am Bahndamm, manche wie abgebrochen, damit die Bahn durchfahren kann. Wie angebissen. Dunkle Ziegeldächer. Hanau selbst todlangweilig. Öder Bahnhof. Mainhafen. Kastenförmige Gebäude auf sonniger Fläche. Es gibt Orte, wo sogar Sonnenschein bedrückend wirkt. Ordentlich geparkte Autos. Irgendwo ein großer Schornstein …«
»Sie treffen es ganz gut«, warf er ein. Er saß auf der Stuhlkante, die Hände auf den Knien. Leicht vornübergebeugt. Hatte sie den Faden verloren? Einen Augenblick war er unschlüssig, ob er aufstehen sollte und sich verabschieden.
»Zurück zu meiner Geschichte. Sie wollen sie hören? Die Geschichte, wie ich die Pelzjacke verlor?«
»Unbedingt.«
»Ich habe sie seit Jahren niemandem mehr erzählt. Hatte sie in mir begraben wie so viele Geschichten. Besonders solche, in denen man keine rühmliche Rolle spielt. Erst der Traum heute Nacht … Ich habe alles ganz deutlich gesehen. Die Landschaften, das Wetter, wie das Licht ins Abteil fiel, alles. Ich kam von Basel. Besser gesagt: von Zürich. Jemand hatte mich im Auto nach Basel gebracht, wo der Schnellzug nach Berlin abfuhr. Ein Geschäftsfreund von Motti. Ich hatte Zinsen geholt wie jedes Jahr. Damals gab es vier Prozent, bei einer Million machte das vierzigtausend im Jahr, und diese vierzigtausend hatte ich bei mir …«
»Vierzigtausend?«, fragte er halblaut. Es klang wie ein Raunen. Er saß auf der Stuhlkante wie erstarrt.
»Vierzigtausend, ja. Damals viel Geld. Ich habe es mir gemerkt –nichts bleibt einem so deutlich in Erinnerung wie Verluste. Ein Tag im Herbst. Angenehmes Wetter. Vormittags erreichten wir das Dreiländereck. Ich erinnere mich an die schöne Berglandschaft hinter Freiburg. Bewaldete Hügel, die sich aufwärts schoben zu einem Höhenzug. Er zog sich lange hin, auf der rechten Seite, bis er allmählich verflachte. Ach, das Verflachen … Saftiges, samtiges Grün. Auf den flachen Hängen, die nun folgten, auf ihrer Südseite die ordentlichen Reihen der Weinstöcke. Manchmal das Gemäuer einer alten Burg. Dort lebten die Alemannen, nicht wahr?«
»Ich denke, ja.«
»Auch Juden lebten dort. Der Höhenzug kam wieder, immer rechts. Links war es ganz flach. Todlangweilig. So bis Offenburg. Hinter Offenburg zogen sich die Berge allmählich zurück.«
»Der Schwarzwald.«
»Richtig. Das geht so bis Karlsruhe. Dann wird es immer flacher. Mannheim ist dann schon ganz trostlos.«
Als er ihren Blick spürte, nickte er zustimmend. Sagte nichts dazu, dass sie romantische Orte wie Heidelberg oder Neustadt an der Weinstraße unterschlagen hatte, die an dieser Strecke liegen, auch mehrere Höhenzüge – die Landschaft dort unten ist keineswegs flach. Es erschien einem nur so, wenn man im Zug durchfuhr und die Gegend nicht kannte. Doch das war gleichgültig. Er musste die Geschichte hören, sagte kein Wort.
»Ein D-Mark-Konto. Obwohl es bei einer Schweizer Bank war. Aus irgendeinem Grund hatte Motti in diesem Fall nicht die Währung gewechselt. Viele unserer Freunde hatten Konten in der Schweiz. Man redete nicht groß darüber, fuhr einmal im Jahr hin und holte die Zinsen. Manchmal fuhr Motti selbst, mit dem Wagen. Ich mochte das nicht, er ist immer so gerast. Sein Mercedes fuhr damals schon ziemlich schnell, hundertachtzig oder so. Eine Bahnfahrt war gemütlicher. In diesem Jahr fuhr ich Zinsen holen, Motti war verhindert. Ich nahm natürlich den Zug. Da konnte ich Zeitschriften lesen, mich unterhalten. Man lernt interessante Leute kennen auf solchen Reisen. Ich erinnere mich genau an die Rückfahrt. Erst saß ich allein in meinem Abteil, dann stiegen – in Offenburg, glaube ich – Leute ein, aus Frankfurt, mit denen ich, wie sich bald herausstellte, gemeinsame Bekannte in Berlin hatte. Ein Kunsthändler und seine Frau. Es gab damals nur wenige Gemeinden. Einige Hundert Leute in Berlin. Und in Frankfurt, Köln, München, Hamburg. Nicht wie heute in jeder Kleinstadt. Das begann erst, als die Russen kamen. Bis dahin waren wir so wenige, dass wir uns fast alle kannten. Manche hatten Entschädigungen bekommen und sie in Immobilien angelegt. Ein gutes Geschäft in den zerbombten Städten. Man kaufte Ruinen auf Abriss, baute sie aus, vermietete die Wohnungen. Auch Motti hat damit ein Vermögen gemacht. Mein verstorbener Mann. Er hieß eigentlich Mordechai, doch er nannte sich Maurice. Was bei seinem Namen nicht viel half …« Sie begann zu lachen.
Er stimmte höflich ein. Ihr Gelächter war ein gutes Zeichen. Noch immer galt ihr Zustand als kritisch. Der Schlaganfall vor drei Monaten hatte sie, wie es der Arzt bei sich nannte, »auf die Bretter geworfen«. Allmählich begann sie, sich zu erholen, dennoch war Vorsicht geboten. Übrigens gab es wirklich Grund zum Lachen: Sie hieß Citronenbaum, auch ihr verstorbener Mann – bedeutete das, er hatte sich Maurice Citronenbaum genannt? Die Namensänderung erfolgte meist, damit es »nicht so jüdisch« klang.
»Er änderte auch den Nachnamen«, fuhr sie fort. »Als Geschäftsmann nannte er sich Citroen, Maurice Citroen. So stand es auf seiner Karte. Das klang französisch, obwohl es eigentlich auch ein jüdischer Name ist. Die Leute wissen es bloß nicht. Das ist das Einzige, was zählt. So hat es mir Motti erklärt: ›Was die anderen nicht wissen, ist mein Kapital. Eine Wissenslücke, eine Marktlücke, eine Lücke zum Durchschlüpfen … Das ist es, worauf es ankommt.‹ Franzosen wurden damals von den meisten Deutschen für unseriös und flatterhaft gehalten, für Schürzenjäger und Bonvivants. Doch das war immer noch besser als Jude.«
»Es gibt auch genug Juden, die Schürzenjäger sind«, brachte er hervor, halblaut, zerstreut. Sein Denken kreiste um die Frage, ob er es ihr sagen sollte. Eine Überraschung, selbst eine angenehme, konnte in ihrem Zustand einen Schock auslösen. Eine Synkope, neue Durchblutungsstörungen, einen lebensgefährlichen Zwischenfall …
»Nicht Motti. In diesem Punkt hat er mir nie Probleme gemacht. Ich konnte ihn mit einer jungen Sekretärin arbeiten lassen. Da passierte nicht viel. Er nahm sich nicht die Zeit dafür. Ich erinnere mich, wie Ada Alabaster bei ihrem Mann aufpassen musste. Sie suchte ihm die Sekretärinnen persönlich aus, keine unter fünfzig.«
»Hat es was genützt?«
»Nein. Es muss ja nicht die Sekretärin sein. Er fing was mit einer Stewardess an. Galt damals als Traumberuf. Alle Mädchen wollten Stewardess werden … Das Paar, das in Offenburg einstieg, fuhr nur bis Frankfurt. Das hatte ich irgendwie vergessen. Wir unterhielten uns bis Mannheim ganz gut, doch hinter Mannheim wurde ich müde. Über Mannheim muss ich nichts sagen. Ein Alptraum von einem Bahnhof. Und ich war diesen Tag sehr früh aufgestanden. Den Abend davor war ich mit Freunden aus. Wir waren ziemlich jung damals, vergessen Sie das nicht. Ich bin nicht immer achtzig gewesen.«
Er zeigte ein Lächeln, das ermutigend wirken sollte. Ließ sie reden, dachte angestrengt darüber nach, wie er es ihr sagen könnte. So eine Geschichte passierte nicht zweimal. Auch Frankfurt stimmte. Jaschko hatte der Mutter erzählt, er hätte die Jacke beim Poker gewonnen. In Frankfurt, im Bahnhofsviertel. Der Dieb hatte sie offenbar gleich nach dem Diebstahl verzockt. Sich nicht mal die Zeit genommen, sie genauer zu untersuchen …
»Ich wurde so müde, dass ich unbedingt eine Tasse Kaffee haben musste. Jetzt sofort. Ich konnte nicht warten, bis der Kellner vorbeikam. Zwei oder drei Wagen weiter war der Speisewagen, da wollte ich rasch hingehen, einen Kaffee trinken. Es dauerte eine Weile, bis ich von den Leuten wegkam, die Frau war dabei, eine umständliche Geschichte zu erzählen, für Außenstehende todlangweilig, aber ihr schien es die interessanteste Geschichte der Welt zu sein. Sie redete ohne Punkt und Komma … So wie ich jetzt.« Sie lachte wieder. »Ich hoffe, ich langweile sie nicht?«
»Im Gegenteil«, sagte er. »Ich habe noch nie einer Geschichte mit so viel Spannung zugehört.«
»Sie sind wirklich ein gut erzogener junger Mann.«
»Danke. Meine Mutter würde sich freuen. Sie hat sich sonst nicht viel um mich gekümmert, aber sie wollte unbedingt, dass ich höflich bin.«
»Sie lebt nicht mehr?«
»Nein. Sie ist vor zwei Jahren gestorben. Und ihr zum Andenken versuche ich, höflich zu sein … Aber das ist nicht der Grund, warum ich Ihnen zuhöre. Ich habe einen persönlichen Grund.«
»Tatsächlich?«
»Ja. Ich habe das Gefühl«, begann er etwas ungefähr, »dass diese Geschichte auch mich etwas angehen könnte …« Er war froh über die Möglichkeit, sie schonend auf die Überraschung vorzubereiten. Wenn ihm das gelang, konnte er es aussprechen. Er fühlte sich beklommen, erschüttert, er wusste kein Wort dafür. Eine Art leichte Übelkeit. Eine Aufregung, die das Herz rasen ließ. Er versuchte, ruhig zu bleiben. Ein aufgeregter Arzt – unmöglich. Er hatte im Leben nicht damit gerechnet, je zu erfahren, woher das Geld in der Nerzjacke kam.
»Wie kann meine Geschichte mit Ihnen zu tun haben?«, fragte sie, etwas wie Starrsinn lag in ihrer Stimme.
Er war jetzt ziemlich sicher, dass es ein und dieselbe Jacke war. Die Jacke hatte Jaschko mitgebracht, ein Liebhaber seiner Mutter. Vielleicht war Jaschko sein Vater – auch das hatte er bis heute nicht herausgefunden. Jaschko war die Jacke, wie er sagte, einige Stunden zuvor im Poker »zugefallen«. So drückte er sich aus. Von einem Mann, den er flüchtig kannte, ein paarmal gesehen hatte. Beim Spiel. Jaschko spielte ständig, es war alles, was er tat, wenn man wollte: sein Beruf. Manchmal gewann er, dann warf er mit dem Geld um sich, manchmal verlor er alles, dann war er zu arm, ein Zimmer zu bezahlen, und kroch eine Weile bei ihnen unter. Zu anderen Zeiten, wenn er Schulden hatte, verschwand er für Monate. Manchmal waren Leute hinter ihm her. Unangenehme Leute. Mit einem Wort: Er kam nur dann und wann. Und wenn er kam, wusste man vorher nie, wie es um ihn stand. Aber an diesem Tag schien Jaschko groß gewonnen zu haben, er kam mit einem Auto und schleppte allerhand an, Wein, Likör, Blumen für die Mutter, Geld, eine Uhr, die Jacke, und da er seiner Mutter gegenüber ein schlechtes Gewissen hatte, schenkte er ihr die Jacke. Zusammen mit einem Blumenstrauß. Hier, sagte er, damit du diesen Winter nicht so frierst.
Die Mutter war nur mäßig erfreut über das Geschenk. Was sollte sie mit einer Nerzjacke? Sie arbeitete für eine Agentur, die Reinigungskräfte vermittelte, manchmal als Garderobenfrau oder Platzanweiserin im Kino Imperial – da konnte sie nicht im Nerz ankommen. Jeder, der sie darin sah, wäre davon ausgegangen, dass der Nerz gestohlen war. Das machte es auch schwierig, ihn zu verkaufen. Lange hing die Jacke im Schrank. Wenn die Mutter nicht da war, öffnete er den Schrank und streichelte den Pelz. Er hatte gern sein Gesicht in die weichen, warmen Felle geschmiegt, in die seidigen Grannen, die über dem Rauchgrau der kürzeren Haare standen und den Pelz aussehen ließen wie bereift, er hatte den Geruch geliebt, den kaum wahrnehmbaren Geruch nach Fell und Leder, den Hauch von teurem Parfum, der irgendwo darin verborgen war …
»Doch, ich denke, ich habe mit der Geschichte zu tun.« Er sagte es wie aus dem Schlaf heraus.
»Tatsächlich?«, fragte sie. »Aber damals waren sie noch gar nicht auf der Welt.«
»Ich war ein kleiner Junge.«
»Von mir aus. Vielleicht halte ich Sie für jünger, als Sie sind. Aber ich verstehe trotzdem nicht … Ich wollte erzählen, wie ich die Pelzjacke …«
»Halten Sie es für ausgeschlossen, dass der Pelz, also das Geld, das darin versteckt war … Dass dieses Geld, das Ihnen damals gestohlen wurde, sagen wir: in andere Hände gekommen ist? Ich meine, dass es jemand gefunden hat, der etwas Gutes damit anzufangen wusste?«
»Etwas Gutes? Was lässt sich mit Geld Gutes anfangen? Noch dazu mit gestohlenem Geld? Meist kommt es in die falschen Hände. Es war ein Dieb. Ein ganz gewöhnlicher Ganove. Er nutzte den kurzen Augenblick, als niemand im Abteil war. Ich ging Kaffee trinken, wie ich Ihnen sagte, und die Leute, die ich flüchtig kannte – aber doch gut genug, um zu wissen, wer sie waren, ihre Namen zu kennen, kurz gesagt: ihnen zu vertrauen –, diese Leute blieben im Abteil. Die Frau überlegte, ob sie mitkommen sollte, dann beschloss sie, bei ihrem Mann zu bleiben. ›Wir wollen in Frankfurt essen gehen‹, sagte sie, ›unsere Tochter holt uns vom Bahnhof ab.‹ Also ging ich allein in den Speisewagen. Trank meinen Kaffee, verlor mich irgendwie in Gedanken. Ich hatte immer eine Neigung dazu. Manchmal habe ich ganze Tage verträumt. Damals gab es in den Zügen noch keine Ansagen. Ich kam erst zu mir, als wir schon in Frankfurt waren. Durch irgendeinen Vorort fuhren … Ich wartete nicht, bis der Kellner kam, nein, ich stand sofort auf, lief nach vorn, dort war eine Art Buffet, ich sagte, ich müsste sofort zahlen, trotzdem dauerte es ein paar Minuten, er hatte noch irgendwas anderes zu tun, eine andere Rechnung, endlich waren wir fertig, ich hastete durch die Wagen … Mir war plötzlich eingefallen, dass die Leute in Frankfurt ausstiegen. Und sicher nicht auf mich warten würden, wenn die Tochter sie abholen kam. Obwohl der Zug in Frankfurt ein paar Minuten stand. Ziemlich lange sogar. Mir erschien es endlos …«
»Der Frankfurter Hauptbahnhof ist ein Kopfbahnhof«, sagte er leise, und es klang, als wollte er sich selbst beruhigen.
»Ach ja?«
»Der Zug fährt anders herum raus als er reingefahren ist. Das heißt, damals, als es noch keine Triebwagenzüge gab, musste am anderen Ende eine neue Lok angekoppelt werden. Das dauert seine Zeit.«
»Eine neue Lok? Ja, es dauerte eine Weile …«, erwiderte sie. Ihre Stimme verriet, was sie dachte: Wie Männer die Welt sehen, unter was für langweiligen Gesichtspunkten. Auch Motti hat immerzu über dergleichen gesprochen, Autos, Wertpapiere, Immobilien, dabei wusste er vor lauter Zahlen oft nicht, wie er die Sache angehen sollte. Und nicht selten hatte sie, die gar nichts davon verstand, ihm den entscheidenden Tipp gegeben. Einfach aus Intuition.
»Der Weg zurück in meinen Wagen war schrecklich. Überall standen die Leute in den Gängen, die Frankfurt aussteigen wollten, die Leute und ihr Gepäck, ich musste mich Meter um Meter vorwärts kämpfen, und als ich noch zwei Wagen von meinem Abteil entfernt war, fuhren wir auch schon in den Bahnhof ein, und das Aus- und Einsteigen begann. Es war ein Gewimmel und Gewusel, Kinder, Studenten, alte Damen mit Krückstöcken, Koffer wurden hereingereicht, ich vergesse das nie. Für die letzten paar Meter brauchte ich nochmals Minuten. Die ganze Zeit hatte ich dieses schlimme Vorgefühl … Und wirklich. Als ich endlich ins Abteil kam, sah ich sofort: Das Ehepaar war weg, und die Jacke war weg.«
»Wenn man Ihre Erzählung hört«, bemerkte er nach einer Pause, »bekommt man den Eindruck, das Paar hätte die Jacke mitgehen lassen.«
»Hätten sie es doch nur getan! Sie werden es nicht glauben, aber das war meine letzte Hoffnung. Ich rief noch am selben Abend bei ihnen an, nachdem ich – ich weiß nicht mehr wie – Bahnhof Zoo angekommen war. Unterwegs hatte ich den Vorfall dem Schaffner gemeldet, sogar die Polizei wurde benachrichtigt, irgendwo unterwegs … In Berlin holte mich Motti ab, mit dem Wagen. ›Schnell‹, sagte ich, ›fahr so schnell du kannst, ich muss diese Leute anrufen!‹ Sie müssen immer bedenken, dass es damals keine Handys gab. Heutzutage, wie viel einfacher wäre alles gewesen, ich hätte schon aus dem Speisewagen anrufen können: ›Nehmen Sie bitte die Jacke an sich, warten Sie die paar Minuten auf mich …‹ Damals trennten einen oft nur ein paar Meter, man verfehlte sich um Augenblicke. Lief aneinander vorbei wie blind. Ich frage mich manchmal: Wie haben wir es damals überhaupt geschafft, uns zu verabreden? Jemanden zu benachrichtigen, wenn man unterwegs war und etwas Unvorhergesehenes passierte … Kann sich das heute noch jemand vorstellen? Das Leben ist so viel einfacher geworden, aber die jungen Leute wissen es nicht, sie kennen die Welt nicht, wie sie damals war, unbequem, umständlich, viel schwieriger als heute … Endlich waren wir draußen in der Koenigsallee, in unserem Haus. Die gemeinsamen Bekannten, ein Ehepaar aus der Berliner Gemeinde, hatten die Nummer. Ich rief in Frankfurt an, meine stille Hoffnung war, sie hätten die Jacke mitgenommen.«
Pause. Beide sagten kein Wort. Er spähte zum Bett hinüber, um zu sehen, wie sie aussah, ob sie ruhig atmete. Sie sah aus wie immer. Wie immer in diesen Tagen. Die Geschichte schien sie nicht übermäßig zu erschüttern. Er zog den Stuhl näher heran, vorsichtshalber.
»Tausendmal habe ich an die Geschichte gedacht«, sagte sie. »Motti nahm es nicht so schwer, wie ich gefürchtet hatte. Er tröstete mich sogar. Machte Scherze. ›Eine Thermosflasche voll Kaffee mitzunehmen‹, sagte er, ›wäre billiger gewesen.‹ Trotzdem, ich träume manchmal davon. Es war ein Schock. Wir waren nicht immer reich. Im Gegenteil. Ich erinnerte mich an die Zeiten, als wir froh waren über ein Stückchen Brot. Im Ghetto standen die Kinder am Straßenrand, sie streckten ihre dünnen Händchen aus: A Stickele Brojt … Wir haben noch Hunger erlebt, richtigen Hunger, Wochenlang nicht satt essen, immer in Angst zu verhungern. Und nun hatte ich mit einem Schlag vierzigtausend Mark verloren … Wissen Sie, was vierzigtausend Deutsche Mark damals für eine Summe waren? Doppelt so viel wie heute. Mottis großer Wagen kostete weniger. Die Geschichte kommt mir immer noch vor wie ein böser Traum. Ich weiß nicht mehr, vor wie viel Jahren es passiert ist. Manchmal bin ich nicht sicher, ob es überhaupt passiert ist.«
»Es ist passiert«, sagte er leise wie zu sich selbst. »Ich kann Ihnen sogar sagen, wann.«
»Ja? Können Sie das?«
»Vor achtundzwanzig Jahren.«
»Kann sein … Vor achtundzwanzig Jahren war ich Mitte fünfzig, sechsundfünfzig … Ein dummes Alter. Ich habe die Fünfziger immer für ein dummes Alter gehalten. Unentschieden. Weder alt noch jung. Irgendwie dazwischen. Bis in die Vierziger habe ich mich jung gefühlt. Ab Mitte sechzig habe ich angefangen zu begreifen, dass ich eine alte Dame bin. Das war wieder ein eindeutiges Selbstgefühl. Man gewöhnt sich an alles, sogar an das Alter. Ich hatte ja nun inzwischen genügend Zeit, mich daran zu gewöhnen … Wie kommen Sie auf achtundzwanzig?«
»Weil ich damals zehn Jahre alt war. Und jetzt bin ich achtunddreißig. Einfache Mathematik.«
»Ich verstehe trotzdem nicht …«, sagte sie, und es klang ein wenig gereizt. »Was hat Ihr Alter damit zu tun?«
»Ich werde es Ihnen sagen. Darf ich noch eine Frage stellen? Was hatte der Nerz für eine Farbe?«
»Grau. Silbergrau. Sehr hell.«
»Und es war eine Jacke, ja? Eine Jacke, kein Mantel?«
»Eine Jacke. Was ist daran so wichtig?«
»Weil ich jetzt ganz sicher bin.«
»Wessen sind Sie ganz sicher?« Sie genoss den Genitiv.
»Ich bin sicher«, sagte er, »dass es dieselbe Jacke war. So was passiert nicht zweimal. Auch die Summe stimmt … Haben Sie noch etwas Zeit? Dann erzähle jetzt ich eine Geschichte. Eine kurze.«
»Gern«, sagte sie. Doch es klang müde. Sie hatte sich beim Erzählen verausgabt. Er horchte auf, schob seinen Stuhl ein Stück näher an ihr Bett. Ihre Müdigkeit machte ihn ein wenig nervös, erwollte jetzt sprechen, zum ersten Mal im Leben konnte er jemandem diese unglaubliche Geschichte erzählen. Er spürte seinen Herzschlag. Hart im Hals. Palpitation. Normal bei dieser Aufregung. Doch wenn es ihn schon so aufregte, wie würde sie reagieren? Es wäre klüger, sich zu verabschieden und sie in Ruhe zu lassen …
»Ich komme aus einer armen Familie«, begann er mit leiser Stimme. Ob bewusst oder unbewusst – er verließ sich auf ihren mütterlichen Instinkt: einen armen jungen Mann zu bemitleiden.
Und wirklich, ihre Stimme klang wieder munterer, als sie sagte: »Oh, das tut mir leid.«