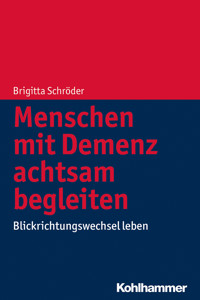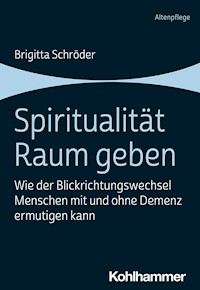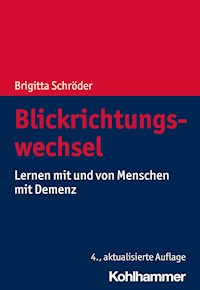9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wörterseh Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Das Buch "Martha, du nervst!" fasziniert auf verschiedensten Ebenen. Da ist zum einen die Biografie der Querdenkerin Brigitta Schröder, einer Diakonisse, die mit ihren Ansätzen im Umgang mit Demenz ebenso beeindruckt wie auch immer wieder aneckt. Da ist die Geschichte rund um ihre langjährige Freundin Martha, die nach einem Schlaganfall dement wurde und die sie über Jahre betreute – eine Aufgabe, die das Fundament für Brigitta Schröders Engagement für Menschen mit Demenz legte. Da ist der Blick zurück in eine Zeit, in der die Diagnose Demenz und Alzheimer noch nicht in aller Munde war. Und da sind verschiedene Menschen, die im Buch zu Wort kommen und die uns nicht nur das Thema Demenz näherbringen, sondern auch Ansichten, die Brigitta Schröders Überzeugung noch klarer machen: Menschen mit Demenz sind Pioniere für eine humanere Gesellschaft, denn sie werfen uns auf uns selbst zurück – an den einzigen Platz, wo Glück dauerhaft zu finden ist. "Mein innigster Wunsch ist, dass wir eines Tages den Blickrichtungswechsel vollziehen und nicht mehr von Demenzkranken oder Alzheimerpatienten reden, sondern von Menschen mit Demenz." Brigitta Schröder
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Ähnliche
Wörterseh wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016 bis 2020 unterstützt und dankt herzlich dafür.
Alle Rechte vorbehalten, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.
© 2018 Wörterseh, Gockhausen
Lektorat: Lydia Zeller, ZürichKorrektorat: Brigitte Matern, KonstanzProjektleitung: Andrea Leuthold, ZürichFoto Umschlag: Fiona Essex, SurreyUmschlaggestaltung: Thomas Jarzina, HolzkirchenLayout und Satz: Beate Simson, Pfaffenhofen a. d. Roth Druck und Bindung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
Print ISBN 978-3-03763-099-0E-Book ISBN 978-3-03763-753-1
www.woerterseh.ch
Für alle, die mutig miteinander da sind.
»Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für die Dinge, die du immer tun wolltest. Tu sie jetzt!«
Paulo Coelho
Inhalt
Über das Buch
Über die Autorinnen
Einige Gedanken zum Voraus
Lichtblicke
Herzensentscheidung
Gedanken zur Demenz
Blickrichtungswechsel
»Ich liebe dich so sehr!«Lotti Beitz
Im Hier und Jetzt leben
Weg von daheim?
»Reich beschenkt werden«Nicole Haas-Clerici
Junge Jahre
Freundschaft mit Martha
»Ich bin stolz auf ihn«Jeannine Zimmermann
Frosch im Eimer
Ich, Brigitta
»Wir müssen lauter werden!«Daniel Wagner
Leben als Diakonisse
»Zu viel System verdirbt den gesunden Menschenverstand«Michael Schmieder
Schwarzes Schaf
Wie auf einer Insel
»Das regenerative Potenzial des Gehirns ist größer als angenommen«Gerald Hüther
Ende und Neuanfang
»Ich möchte die Zukunft selbstbewusst angehen«Elisabeth Dolderer-Thalmann
Abschied von Martha
»Man sieht die Spitze des Eisbergs«Birte Weinheimer
Löwenzahn
Ein herzliches Dankeschön
Anhang
Hilfreiche Adressen
Hilfreiche Literatur
Über das Buch
Das Buch »Martha, du nervst!« fasziniert auf verschiedensten Ebenen. Da ist zum einen die Biografie der Querdenkerin Brigitta Schröder, einer Diakonisse, die mit ihren Ansätzen im Umgang mit Demenz ebenso beeindruckt wie auch immer wieder aneckt. Da ist die Geschichte rund um ihre langjährige Freundin Martha, die nach einem Schlaganfall dement wurde und die sie über Jahre betreute – eine Aufgabe, die das Fundament für Brigitta Schröders Engagement für Menschen mit Demenz legte. Da ist der Blick zurück in eine Zeit, in der die Diagnose Demenz und Alzheimer noch nicht in aller Munde war. Und da sind verschiedene Menschen, die im Buch zu Wort kommen und die uns nicht nur das Thema Demenz näherbringen, sondern auch Ansichten, die Brigitta Schröders Überzeugung noch klarer machen: Menschen mit Demenz sind Pioniere für eine humanere Gesellschaft, denn sie werfen uns auf uns selbst zurück – an den einzigen Platz, wo Glück dauerhaft zu finden ist.
»Mein innigster Wunsch ist, dass wir eines Tages den Blickrichtungswechsel vollziehen und nicht mehr von Demenzkranken oder Alzheimerpatienten reden, sondern von Menschen mit Demenz.«
Brigitta Schröder
Über die Autorinnen
© Fiona Essex
Brigitta Schröder, geb. 1935, wuchs im Dorf Langwiesen im Kanton Zürich auf. Bereits in ihrer Jugend verfolgte sie einen eigenwilligen Weg, denn Gerechtigkeit und Authentizität waren ihr schon früh wichtig. Nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester trat sie 23-jährig in die Diakonissen-Schwesternschaft Neumünster in Zollikerberg ein. Nach langen Berufsjahren in Deutschland setzte sie sich vertieft mit Menschen mit Demenz auseinander und schrieb drei Bücher zu diesem Thema – »Blickrichtungswechsel – Lernen mit und von Menschen mit Demenz«, »Menschen mit Demenz achtsam begleiten – Blickrichtungswechsel leben« und »Ja, geht denn das? – Zärtlichkeit, Zuwendung und Sexualität im Pflegealltag«. Noch heute leitet sie Workshops, arbeitet als Supervisorin (DGSv) und als Lebens- und Trauerbegleiterin. Ihr vielseitiges Engagement wurde im Jahr 2015 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.
www.demenz-entdecken.de
© Samuel Mizrachi
Franziska K. Müller ist selbständige Journalistin und Autorin. Für Wörterseh hat sie bereits zahlreiche Bestseller geschrieben, darunter »Heimatlos«, »Platzspitzbaby«, »Leben!«, »Mutanfall« und »für immer«. Als die Idee an sie herangetragen wurde, ein Buch über Brigitta Schröder und deren Blickrichtungswechsel im Umgang mit Demenz zu schreiben, sagte sie sofort zu, denn sie hatte bereits früher von Brigitta Schröder gehört und fand ihren Umgang mit dem Thema ebenso spannend wie tiefsinnig. Franziska K. Müller lebt und arbeitet in Wien und Zürich.
Einige Gedanken zum Voraus
Habe ich richtig gehört? Meine Vorstellungen von einem anderen Umgang mit Demenz sollen in Buchform veröffentlicht werden? Der Grund für die Anfrage des Wörterseh-Verlags ist ein Artikel im »Tages-Anzeiger«, der sich meinem Anliegen widmet, Menschen mit Demenz weder zu bewerten noch zu isolieren, sondern sie in ihrem Sosein anzunehmen und – mehr noch – von ihnen zu lernen. Der Artikel erschien am 15. August 2017, vier Tage vor dem ersten »Demenz Meet« in Zürich, einem Get-together für Angehörige, Betroffene und Fachleute, das Daniel Wagner, von dem Sie noch lesen werden, organisiert hatte.
Seit meinem ersten Buch, »Blickrichtungswechsel – Lernen mit und von Menschen mit Demenz«, sind Jahre vergangen, ich habe in der Zwischenzeit zwei weitere Sachbücher für Angehörige und Fachpersonal geschrieben. Und jetzt möchte die Autorin Franziska K. Müller meine Biografie mit meinen Anliegen verweben und ein Buch für die breite Öffentlichkeit schreiben.
Nach Rücksprache mit den Verantwortlichen des Diakoniewerks Neumünster bekam ich grünes Licht. Der Entscheid, alles neugierig geschehen zu lassen, fiel mir leicht, ich suchte meine Aufzeichnungen zusammen, ordnete Material und nahm mir Zeit für Gespräche. Die Arbeit am Buch hat mich dann aber an meine Grenzen gebracht. Warum? Waren es die unterschiedlichen Ebenen, die bei diesem Buchprojekt austariert werden mussten, oder hat mich schlicht und einfach meine Vergangenheit mit all ihren Höhen und Tiefen eingeholt? Ich weiß es auch rückblickend noch nicht.
Doch ich erkenne, welche Chancen ich durch die Arbeit an »Martha, du nervst!« erhalten habe, denn ich konnte gedanklich vieles ordnen und Stellung beziehen. Heute kann ich sagen, dass ich die letzten Monate nicht missen möchte, sie haben mich bereichert. Wie sehr, darüber kann ich nur dankbar staunen.
Franziska K. Müller hat für das Buch auch mit sechs Interviewpartnern Kontakt aufgenommen, die sich mit dem Thema Demenz auseinandersetzen oder die mit Demenz konfrontiert sind. So ist es ihr gelungen, die Vielfalt der Sichtweisen aufzuzeigen, was mir wichtig ist und mich auch entlastet.
Bevor Sie zu lesen beginnen, möchte ich vorausschicken, dass der Weg hin zu einem anderen Umgang mit Demenz für alle Beteiligten nicht einfach ist, im Gegenteil. Damit etwas Neues entstehen und gelingen kann, braucht es Zeit. Ein erster wichtiger Schritt ist, sich bewusst zu werden, dass nur wir selbst uns verändern können. Das Gegenüber – und diese Erkenntnis muss sich erst setzen – verändert sich nicht. Das trifft ganz besonders auf Menschen mit Demenz zu. Sie sind – unausweichlich – immer ganz sich selbst, sie haben ihre Masken und Fassaden abgelegt, wollen weder verletzen noch provozieren, sondern verhalten sich durch und durch absichtslos.
Um das zu erkennen, sollte ein Blickrichtungswechsel stattfinden. Bevor wir unser Gegenüber anschauen, wäre es gut, uns selbst in die Augen zu blicken. Das ist nicht leicht. Denn durch unsere Erziehung und unsere Sozialisation haben wir gelernt, die Verantwortung beim Nächsten zu suchen statt bei uns selber. Eigenverantwortung und Selbstreflexion wird in unserer Gesellschaft kaum eingeübt. Oder wer kennt sie nicht, die Aussage: »Eigenlob stinkt«? Wer einen Blickrichtungswechsel wagt, weiß: »Eigenlob stimmt«! Das bedeutet, sich selbst ganzheitlich anzunehmen mit allen Ängsten, Unsicherheiten, Grenzen, Unebenheiten, mit allen Inkompetenzen, aber auch Kompetenzen, mit allen Sonnen- und Schattenseiten, die unsere Persönlichkeit ausmachen. Denn erst, wer tolerant und authentisch sich selbst gegenüber ist, erst, wer sich selber loben kann, wird eine Haltung entwickeln, die es ihm möglich macht, anderen gegenüber aufrichtig tolerant zu sein und damit Menschen mit Demenz entspannter zu begleiten, was beide Seiten bereichert.
Die Bibel sagt: »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.« Dieser Satz wird oft falsch interpretiert: »Liebe deinen Nächsten bis zum Umfallen.« Dabei will er uns sagen: »Erst, wenn du dich selbst liebst, kannst du deinen Nächsten wirklich lieben, achten, respektieren.« Der im Buch interviewte deutsche Neurobiologe und Hirnforscher Professor Gerald Hüther hat dafür diese Worte gefunden: »seiner Würde bewusst werden«. Der Blickrichtungswechsel kommt dieser Sichtweise nahe.
Ich werde oft gefragt: »Warum, Brigitta, setzt du dich so sehr ein, dein Anliegen weiterzugeben?« Die Antwort darauf findet sich jetzt – oft auch zwischen den Zeilen – in diesem Buch. Ich habe es wieder einmal erfahren: »Wichtig ist, mutig miteinander da sein.«
Und jetzt: Viel Pläsier beim Lesen!
Brigitta Schröder, im Juli 2018
Lichtblicke
»Brigitta, bleibst du hier, gehst du fort? Gehst du fort, kommst du wieder?« Martha sitzt in ihrem großen Sessel im Wohnzimmer, fragt abermals: »Gehst du fort, kommst du wieder?« Ich sage ihr, was ich ihr an diesem Morgen schon zigmal gesagt habe: »Natürlich bleibe ich hier, Martha! Hör auf, mich ständig dasselbe zu fragen, ich kann es nicht mehr hören. Du weißt genau, wenn ich weggehe, organisiere ich jemanden, sodass du nicht allein sein musst.« Es ist ein Theater. Jeden Morgen. Immer dasselbe. Martha fragt – wieder und wieder: »Brigitta, bleibst du hier? Gehst du fort? Kommst du wieder?« Und ich, ich antworte wieder und wieder: »Wenn ich fortgehe, bist du nicht allein.« Spreche ich an eine Wand? Versteht Martha kein Deutsch oder nur mich nicht mehr? Oder will sie mich schlicht und einfach ärgern?
Nein, Martha hat Demenz. Nach einem Schlaganfall wurde es zur Gewissheit. Ohne darüber nachzudenken, welche Konsequenzen damit verbunden sein könnten, entschloss ich mich, sie auf ihrem Weg nicht allein zu lassen. Viel Einsatz war nötig, damit sie bei sich zu Hause bleiben und hier gepflegt werden konnte. Sie wollte, konnte und sollte nicht allein sein. »Bleibst du hier, gehst du fort? Gehst du fort, kommst du wieder?« Ich setze mich auf die Armlehne von Marthas großem Sessel, blicke sie an und beginne zu singen: »Ich bleib bei dir und geh nicht fort, an deinem Herzen ist der schönste Ort.« Dann lachen wir zusammen, und sie hält mir ihre seidenweiche Wange für ein Küsschen hin.
Dreimal pro Woche bade ich Martha, hebe sie mit einem speziellen Lift aus der Wanne, wickle sie in ein flauschiges Tuch. Der Pflegedienst cremt ihre Haut ein. Ihre Augen sind geschlossen, sie genießt es. An anderen Tagen hat sie Angst. Vor dem großen Wasser. Vor einem Dammbruch, der alles wegschwemmen wird, auch ihre eigene Existenz. Sie hat zwei Kriege erlebt, im Ersten Weltkrieg fiel ihr Vater. Mutter und Tochter wurden zweimal verschüttet. Martha zeigte mir, was sich auch in späteren Jahren bestätigte: dass die Biografie im Leben von Menschen mit Demenz ganz besonders wichtig ist, denn nur wenn diese berücksichtigt wird, kann eine einfühlsame Haltung eingeübt werden.
Eine Zeit lang rief sie in der Dunkelheit meinen Namen. »Brigitta! Brigitta!« Ich fragte nach, und trotzdem konnte ich nicht herausfinden, was sie brauchte. Bis mir eine Freundin sagte, Martha langweile sich möglicherweise. Diese Vermutung teilte ich ihr mit und forderte sie gleichzeitig auf, weiter nach mir zu rufen. Ich erklärte ihr, ich würde nun – in der Gewissheit, dass mein Name im Weltall erklinge – zu Bett gehen. Mit diesem Gedanken schlief ich ein, Martha ebenfalls. In anderen Nächten verband sie den vermuteten Wunsch nach Schutz und Nähe mit dem Satz: »Ich muss sterben; wenn du nicht sofort kommst, wirst du deines Lebens nicht mehr froh.« Meine Bitten und Ermahnungen, mich schlafen zu lassen, brachten nichts. Menschen mit Demenz leben einfach ihre Gefühle. Irgendwann sagte ich: »Martha, du nervst!«
Eines Nachts lauschte ich wieder einmal ihren Worten, setzte mich an den Tisch und begann mitzuschreiben – mit der Absicht, mich professionell beraten zu lassen. Ich wusste, dass Martha, wie so viele Menschen mit Demenz, über eine weiterentwickelte Sensibilität verfügte, über die Gabe, wahrzunehmen, wie es den Gesunden nicht möglich ist. Vielleicht vernahm sie auch nur das Kratzen des Stifts auf dem Papier, ein Geräusch in der Stille der Nacht, das im Rhythmus ihrer Sätze erklang; fühlte sich ernst genommen, empfand es als beruhigend, dass das Gesagte nicht mehr nur lästig zu sein schien, sondern aufgeschrieben wurde.
Ich konzentrierte mich nicht länger auf ihre Aussagen, und als meine Sätze zu Papier gebracht worden waren, stoppten auch ihre wiederkehrenden Drohungen. Das ist nur eines von vielen Beispielen, die mich im Leben mit Martha weiterbrachten, aber es ist ein Schlüsselerlebnis: Ich erkannte, dass Menschen mit Demenz sich nicht ändern können. Nur wenn ich mich verändere, verändert sich die Situation. Beim erwähnten Beispiel befreite ich mich aus der negativen Haltung Marthas Verhalten gegenüber. Diese Erfahrung bestätigte sich auch in späteren Jahren bei vielen Gelegenheiten: Auf dem Weg zu einem flexiblen und positiven Umgang mit Menschen mit Demenz sind Trampelpfade zu verlassen. Das ist nicht immer einfach: Routinen, Meinungen und Überzeugungen geben Halt. Sie zu hinterfragen, zu neuen Schlüssen zu gelangen, die innere Haltung zu verändern, erfordert Mut und Kraft. Schaffen wir es aber, in den vielen Veränderungen, die eine Demenz mit sich bringt, mehr als nur die Summe von Defiziten und schmerzvollen Verlusten zu erkennen, und zeigen Bereitschaft, einem solchen Prozess Raum zu geben, wird der Weg für alle Beteiligten leichter.
Menschen mit Demenz fordern ihr persönliches Umfeld heraus: Was bisher sinnvoll und richtig war, gilt oft nicht mehr. Demente Menschen sind frei von Normen, Systemen und Konventionen. Sie machen Grenzüberschreitungen und handeln absichtslos. Sie wollen niemanden verletzen, doch das Gegenüber fühlt sich oft verletzt. Auch Werte und Bedürfnisse verändern sich. Status, Prestige und alles Materielle verlieren an Bedeutung, dafür wird anderes wichtig.
Menschen mit Demenz erspüren Gedanken und machen – was auch immer die Umwelt davon denkt –, was sie wollen. Sie leben wie Kinder auf der Ebene des Herzens, die wir einst verlernen mussten, um in vorgegebene Strukturen zu passen und gesellschaftlichen Verhaltensregeln zu entsprechen. Doch sie sind keine Kinder, und sie haben eine Erziehung hinter sich. Sie sind geprägt und sozialisiert worden, benötigen keine Zurechtweisungen und keine Beurteilungen. Sie leben nicht mehr in unseren Systemen, wollen aber integriert und respektiert bleiben und zweifeln ihre Würde niemals an. Wir würden gut daran tun, dies nicht nur genauso zu sehen, sondern auch umzusetzen.
Von Menschen mit Demenz lernte ich im Verlauf von Jahrzehnten immer neu dazu. Sie unterstützen und ermutigen mich, Konventionen weniger wichtig zu nehmen und Prägungen verblassen zu lassen. Sie öffnen dem Immateriellen, aber auch neuen Erkenntnissen, der Fantasie und der geistigen Beweglichkeit einen Raum. Sie zeigen uns, wie anders leben möglich ist. Sie fordern jeden Einzelnen auf, über sich selbst nachzudenken und Eigenverantwortung einzuüben. In meiner Sicht sind Menschen mit Demenz Pioniere für eine humanere Gesellschaft. Diese oder ähnliche Worte fielen auch bei der Übergabe des Bundesverdienstkreuzes am Bande, das mir im Jahr 2015 von der deutschen Bundesregierung für mein Engagement in der Begleitung von Menschen mit Demenz verliehen wurde.
Dankbar denke ich an Martha zurück. Durch ihre Veränderung erhielt ich wertvolle Anregungen und kam mir dabei selbst auf die Schliche. Ich trat durch Türen, die sie mir geöffnet hatte, und entwickelte später den Blickrichtungswechsel: eine innere Haltung der Toleranz und Akzeptanz sich selbst und anderen gegenüber. Damit in belastenden Situationen Lichtblicke sichtbar werden.
Wie hat einst doch schon der Philosoph Jean Paul gesagt: »Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können.«
Herzensentscheidung
Manche Verhaltensweisen wiesen bei Martha bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf eine mögliche Demenz hin. Manche der Veränderungen geschahen sanft, ich bemerkte sie kaum. Sie rief mich täglich mehrmals an, hinterließ Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, erkundigte sich nach meinem Befinden und wollte wissen, welchen Beschäftigungen ich gerade nachgehe. Andere Auffälligkeiten, die damals für mich allerdings noch keine waren, betrafen klare Erinnerungslücken. Vieles führte ich anfänglich auf ihr Alter zurück. Ich erinnere mich aber auch an eine Episode beim Kleidereinkauf. Sie schien überfordert von der Warenvielfalt, und die Kleider aussuchen, anprobieren und dann an der Kasse bezahlen war eine zu große Herausforderung.
Menschen mit Demenz realisieren oft über einen längeren Zeitraum hinweg, was mit ihnen geschieht. Sie können Orientierungslosigkeit, Unruhe, Schlaflosigkeit, Wortfindungsstörungen und zunehmende Vergesslichkeit aber nicht oder nur unzureichend einordnen, sind verunsichert, was auch dem allgemeinen Gemütszustand abträglich ist. Gleichzeitig sind sie Meister im Schummeln und Überspielen.
Insbesondere im Bereich von Erinnerungslücken springt häufig das Umfeld ein, wann immer ein Wort nicht gefunden oder ein Gedanke nicht zu Ende gebracht werden kann. Obwohl die Hoffnungen schwinden, dass alles nicht so ist, wie man längst ahnt, versuchen wir an der Normalität festzuhalten. Menschen mit Demenz zeigen auch auf, wie sehr wir nach immer gleichen Vorstellungen und praktischen Routinen funktionieren: Eine Pfanne wurde dreißig Jahre lang so und nicht anders auf den Herd gestellt. Nach dem Spielfilm ging man gleich zu Bett. Im Bad war Ordnung. Die Rechnungen wurden pünktlich bezahlt. Am Samstag wusch man das Auto.
Menschen mit Demenz sehen in solchen und vielen anderen Tätigkeiten keinen Sinn. Manches haben sie vergessen, wollen es anders ausführen als bisher. Das kann eine große Herausforderung sein für die Angehörigen: Eine einst ordentliche Frau wird plötzlich zur Chaotin. Ein Mann, der stets das Oberhaupt der Familie war, nimmt die damit verbundenen Aufgaben nicht mehr wahr. Streitlust bei ehemals friedlichen Naturen, die Anhänglichkeit von Menschen, die bisher distanziert und kühl agierten, sorgen ebenfalls für Irritation und Ratlosigkeit.
Ich erinnere mich im Rahmen meines späteren Engagements an ein älter werdendes Ehepaar, das sich viel stritt. Die Kinder distanzierten sich, mischten sich nicht ein. Als die Ehefrau notfallmäßig in die Psychiatrie eingewiesen wurde und man nach der Ursache suchte, wurde beim Ehemann eine Demenz diagnostiziert. Sein verändertes Verhalten, jedoch auch das Unvermögen seiner Frau, aktiv zu werden, sich zu schützen, Hilfe zu beanspruchen und umzudenken, hatten zu ihrem Zusammenbruch geführt. Auch Urteile von außen und das belastende Mitleid haben Auswirkungen. Die Demenz wird in unserer vernunftgesteuerten Gesellschaft abgewertet, und viele von uns äußern sich wertend und negativ über Menschen mit Demenz, sind nicht fähig, sich in ihre Daseinsebene einzufühlen.
Die veränderte Situation ist auch für die Erkrankten sehr belastend. Der Statusverlust, die Tatsache, ihren Willen nicht länger durchsetzen zu können und auch nicht mehr in gewohnter Art und Weise am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, fällt vor allem leistungsorientierten, ehrgeizigen und erfolgreichen Menschen in der ersten Phase besonders schwer. Schamgefühle und ein negatives Selbstwertgefühl sagen aber auch etwas über die Gesellschaft aus, in der wir leben: dass man zum Außenseiter oder zu einem Nichts abgestempelt werden könnte, sobald die sogenannte Normalität ins Wanken gerät.
Die Angst vor dem Prestigeverlust und dem möglichen gesellschaftlichen Ausschluss kann dazu führen, dass über das Thema nicht gesprochen wird. Alles wird verdrängt, vertuscht, ignoriert. Ein Lichtblick war in diesem Zusammenhang die Begegnung mit einem sechzigjährigen Juristen, den ich kürzlich kennen lernte, einem gut aussehenden Herrn, mitten im Leben stehend, klug, distinguiert, gebildet. Öffentlich sagte er den einfachen Satz, der vielen so unendlich schwerfällt: »Ich bin dement.« Punkt. Diese Offenheit und dieses starke Selbstbewusstsein sind vorbildlich, beides trägt dazu bei, dass das Thema Demenz von Vorurteilen und einseitiger Betrachtung befreit werden kann. Eine solche Haltung zeigt auch, dass sich Wertvorstellungen verändern und das Annehmen dessen, was ist, die inneren Wogen glätten kann. Bereits gibt es Visitenkarten mit dem Aufdruck »Ich bin dement, haben Sie bitte Geduld mit mir«. Auf der Rückseite ist die Telefonnummer der jeweiligen Kontaktperson aufgedruckt.
Was, wenn in einer Partnerschaft der Verdacht aufkommt, dass die Partnerin oder der Partner an Demenz erkrankt sein könnte, zum Beispiel weil sich eine deutlich fortschreitende Vergesslichkeit zeigt oder es – nach einer jahrzehntelangen harmonischen Ehe – immer wieder zu Streitigkeiten kommt, die es früher in der Heftigkeit ganz einfach nicht gab? Soll dann das Risiko eingegangen werden und der Verdacht, dass die neu auftretenden Probleme eventuell auf eine beginnende Demenz hinweisen könnten, thematisiert werden? Oder soll der Partnerin, dem Partner unterstützend und ohne großes Aufheben beigestanden werden, bis die Situation ausweglos erscheint und es keinen anderen Ausweg mehr gibt, als endlich ärztliche Hilfe zu suchen?
In Memory-Kliniken werden Betroffene und Angehörige mit Ergebnissen der Untersuchungen konfrontiert, die das große Schweigen beenden. Wichtige organisatorische Fragen können erörtert werden, die Planung der nahen und vor allem der fernen Zukunft. Welche Verantwortungen und Aufgaben werden organisiert und delegiert, und welche können von der Familie erbracht werden? Auch Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten oder testamentarische Anliegen können geregelt werden oder Fragen, wie der Betroffene im späteren Stadium leben möchte, welche Hilfeleistungen er befürwortet, bis hin zu Abklärungen, ob man bis zuletzt zu Hause bleiben kann und wenn nicht, welche Institution zu wählen wäre. Die Klärung all dieser Fragen ist schmerzvoll, andererseits sind die Antworten – wenn sie denn einmal gefunden sind – oft auch eine Erleichterung.
Nach Marthas Schlaganfall und als erkannt worden war, dass sie Demenz hatte, bereitete ich ihre Wohnung auf ihre Rückkehr aus dem Krankenhaus vor. Martha in häusliche Pflege zu nehmen, war eine Herzensentscheidung. Über die Konsequenzen dachte ich nicht nach, und als mir dann bewusst wurde, was es für Martha bedeutete, machte ich einfach weiter. Von Anfang an war klar, dass ich die Grundpflege nicht übernehmen würde. Für diese Aufgaben organisierte ich professionelle Unterstützung, die mich entlastete. Selbständig wurde Martha nicht mehr. Nach einigen Nächten, in denen sie mich durch ihr Rufen nervte, konnte ich mich in sie hineinfühlen und mir zudem vorstellen, was manche Angehörige diesbezüglich durchzustehen haben. Erleichternd war bei uns, dass Martha nicht mobil war. Dass Menschen mit Demenz nächtelang in der Wohnung herumgeistern oder so lange an Nachthemden und Pyjamas ihrer Angehörigen zupfen, bis ihr Wunsch nach Aufmerksamkeit erfüllt wird, trägt wie viele andere Veränderungen zur Belastung jener bei, die ihnen beistehen, sie begleiten und unterstützen.
Damals, vor rund zwanzig Jahren, existierten bereits Möglichkeiten der externen Entlastung, doch sie waren wenig bekannt. Finanzielle Unterstützung durch die Pflegeversicherung erleichtert heute zumindest in Deutschland die Situation und bietet eine echte Chance auf Entlastung. Sich Grenzen einzugestehen, zum Beispiel dass die Herausforderungen nicht mehr zu bewältigen sind und vielleicht zum ersten Mal im Leben eine Situation entsteht, die nicht allein zu meistern ist, fällt Angehörigen schwer. Manche sind nicht bereit, die Situation anzunehmen: Mit dem Alter haben sie sich nicht auseinandergesetzt, Hilfe lehnen sie ab, und fremde Personen im Haushalt werden nicht geduldet. So rauben sie sich selbst, aber auch anderen die Kraft. Menschen mit Demenz hingegen akzeptieren die neuen Bezugspersonen oft ohne Probleme, ebenso wie die neuen Lebensumstände. Manchmal fehlt es jedoch an der Krankheitseinsicht. Das ist einerseits ideal, denn es zeigt, dass sie sich überhaupt nicht als defizitäre Wesen sehen. Und andererseits sorgt dieser Umstand gerade auch in pflegerischer Hinsicht immer wieder für neue Herausforderungen.
Auch Martha war in dieser Hinsicht gewöhnungsbedürftig. Am liebsten hätte sie mich, und nur mich, rund um die Uhr um sich gehabt. Doch auf diesen Wunsch ließ ich mich nicht ein. Als eine meiner regelmäßigen Reisen in die Schweiz bevorstand, appellierte ich an sie: »Wir sind ein gutes Team. Du hilfst mir, ich helfe dir, gemeinsam sind wir stark.« Sie blickte mich aus ihren schönen blauen Augen liebevoll an. Dann nickte sie und widmete sich wieder ihrer Beschäftigung. Sie saß im Ledersessel, auf den Knien das Kissentablett, und gestaltete mit bunten Würfeln Ornamente. Ich beobachtete sie: Vertieft in diese Betätigung, schien sie mich vergessen zu haben, in fließenden Bewegungen schuf sie einmalige und stets neue Kunstwerke. Fortan erklärte ich ihr jeweils meine Gefühle, meine Seelenlage, meine Bedürfnisse, und es bestätigte sich: Menschen mit Demenz begreifen viel. Ich möchte sogar sagen, sie begreifen und akzeptieren mehr als der Rest der Welt. Während manchmal der Eindruck entsteht, dass sie wenig oder gar nichts wahrnehmen, weil direkte Reaktionen ausbleiben, reagieren sie gefühlsmäßig wie Seismografen.
Martha hatte zudem ein Recht darauf, dass mit ihr angemessen gesprochen wurde. Sie verstand alles, was ich ihr sagte, und auch ich verstand sie mit der Zeit immer besser. Unsere Freundschaft erfuhr eine kaum beschreibbare, bereichernde Dimension. Natürlich macht die Liebe alles leichter, denn das Geben und Empfangen wird zum Schwerpunkt. Die Liebe ist stärker als alles, das Herz wird nicht dement. Das können alle bestätigen, die lieben und geliebt werden und so die positiven Aspekte der Demenz erleben. Genau wie jene Kinder, die erst einen Zugang zu ihren Eltern finden und eine negativ erlebte Vergangenheit verändern können, wenn diese dement werden. Oder Männer und Frauen, die sich wieder ineinander verlieben, weil die Frau akzeptiert, dass es den früheren Ehemann vielleicht nicht mehr gibt, es den Menschen mit seinen Emotionen aber immer geben wird. Freundschaften, die inniger werden, weil Konkurrenzdenken und Neid keine Rolle mehr spielen und die Beziehung eine andere Qualität entfalten kann. Wer wegrennt, sich sträubt, nichts wissen will, kommt nicht in diesen Genuss. Ob sich der Schmerz über die Veränderung nachhaltig verdrängen lässt, wage ich zu bezweifeln, manchmal kommt er bei einer ganz anderen Gelegenheit umso heftiger zurück. Vor allem aber wird jemand, der den Kopf in den Sand steckt, niemals erfahren, was er von einem Menschen mit Demenz lernen könnte: Ehrlichkeit, Authentizität, Entschleunigung. Die Fähigkeit, im Moment zu leben. Gefühle zu zeigen, Bedürfnisse zu stillen. Anerkennung zu geben und die Situation anzunehmen. Leistungsdenken verblassen zu lassen.
Als Martha erkrankte, steckte ich mit dieser Thematik noch in den Anfängen. Im Nachhinein würde ich einiges anders machen, doch diese Einsicht nehme ich gelassen zur Kenntnis; ich wusste es damals nicht besser. Anderes tat ich intuitiv, ließ das Herz entscheiden und handelte aufgrund meiner Überzeugung, dass jedes Leben lebenswert ist. Auf Ermahnungen, Anweisungen und Kritik an Martha versuchte ich von Anfang an zu verzichten, denn ich hatte schnell begriffen, dass Zurechtweisungen im Alltag die häufigste Quelle für Unstimmigkeiten sind. Nur wer ein schwaches Selbstwertgefühl hat oder von der Situation überfordert ist, gibt ständig Meinungen und Urteile ab, warum diese oder jene Aktion keinen Sinn ergibt. Dies versuchte ich zu unterlassen, obwohl es auch für mich ein stetes Einüben blieb. Die Spontanität, das Gefühl für kreative Ideen, die Beweglichkeit, die ich mir zuvor in vielen turbulenten Berufsjahren angeeignet hatte, das alles kam mir nun zugute. Gleichzeitig versuchte ich, Struktur und Rituale in unseren gemeinsamen Alltag zu bringen, und tat mit Martha, was wir auch bisher gern gemacht hatten: Musik hören, singen, lachen, malen, vorlesen.