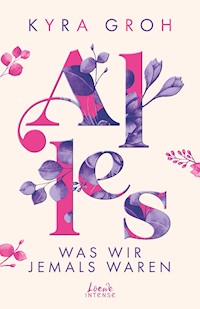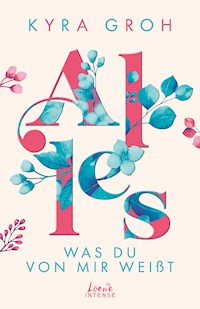4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Beim nächsten Traummann links abbiegen, bitte! 492 Kilometer. So weit ist es von Hamburg nach Frankfurt und eigentlich steht Romys exakt kalkulierter Fahrt wirklich nichts im Wege. Nur, dass sie sich ihren Opel Corsa ungeplant mit einem Möbel-Designer und einem Hund teilen muss, der so groß ist wie ein Kalb, und dass dieser fast einen Haufen auf die Rückbank gesetzt hätte. Der Hund, nicht der Designer. Leon. Dass dieser ziemlich attraktiv ist und wahnsinnig charmant kommt noch dazu. Doof, dass Romy eigentlich mit Flo zusammen ist. Und doof, dass Leon ihr eine Woche später im Meeting als neuer Kollege gegenüber sitzt. Manche nennen sowas Schicksal, Romy nennt es einen verdammt fiesen Zufall, der ihren wohldurchdachten Plan vom Leben ganz schön ins Wanken geraten lässt. Ein absolutes Wohlfühl-Buch, das von Lachern bis Herzschmerz alles zu bieten hat. Ich habe mitgefiebert, mich geärgert und Schmetterlinge im Bauch gehabt. -Bloggerin Magnificent Meiky
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Ähnliche
Die Autorin Kyra Groh wurde 1990 in Seligenstadt am Main geboren. Nach einem kleinen Umweg über die Uni Gießen, verschlug es sie 2012 nach Frankfurt, wo sie Trambahnen, Apfelwein und Supermärkte, die bis Mitternacht geöffnet haben, zu schätzen lernte. Sie behauptet gerne, neben dem Schreiben keine weiteren Talente zu haben – daher veröffentlicht sie nicht nur seit einigen Jahren humorvolle Liebesromane, sondern treibt auch hauptberuflich als Texterin ihr Unwesen. Sie hat eine Schwäche für gutes Essen, Instagram und Bilder von gutem Essen auf Instagram. Außerdem liebt sie Schachtelsätze, Erdnussbutter, Netflix und – aus Gründen, die ihr selbst manchmal schleierhaft sind – Sport.
Das Buch
Beim nächsten Traummann links abbiegen, bitte!
492 Kilometer. So weit ist es von Hamburg nach Frankfurt und eigentlich steht Romys exakt kalkulierter Fahrt wirklich nichts im Wege. Nur, dass sie sich ihren Opel Corsa ungeplant mit einem Möbel-Designer und einem Hund teilen muss, der so groß ist wie ein Kalb, und dass dieser fast einen Haufen auf die Rückbank gesetzt hätte. Der Hund, nicht der Designer. Leon. Dass dieser ziemlich attraktiv ist und wahnsinnig charmant kommt noch dazu. Doof, dass Romy eigentlich mit Flo zusammen ist. Und doof, dass Leon ihr eine Woche später im Meeting als neuer Kollege gegenüber sitzt. Manche nennen sowas Schicksal, Romy nennt es einen verdammt fiesen Zufall, der ihren wohldurchdachten Plan vom Leben ganz schön ins Wanken geraten lässt.
Kyra Groh
Mitfahrer gesucht - Traummann gefunden
Roman
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Originalausgabe bei Forever Forever ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin November 2017 (2) © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2017 Umschlaggestaltung: zero-media.net, München Titelabbildung: © FinePic® Autorenfoto: © privat ISBN 978-3-95818-214-1 Hinweis zu Urheberrechten Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
PROLOG 1
»Glaubst du an Schicksal?«, fragt mich Leon, der Mann auf meinem Beifahrersitz.
Eine ungewöhnliche Frage für eine Internetbekanntschaft. Die meisten anderen, mit denen ich bisher über ich-fahr-mit.de eine Fahrgemeinschaft von Hamburg nach Frankfurt vereinbart hab, fragten Dinge wie »Und … äh … was machst du so beruflich?«. Oft haben sie auch einfach so lange geschwiegen, bis die Stille mich fast erdrückt hat und ich aus Verlegenheit einen Radiosender mit leicht verdaulicher Popmusik angemacht habe.
»Nein«, antworte ich nüchtern.
»Sondern?«
»Na ja, eben eher an einen guten Plan. An Entwicklung. Ich denke zum Beispiel nicht, dass es Menschen gibt, die füreinander geschaffen sind. Schicksalhafte Begegnungen oder dergleichen … nein, das … damit geben wir einfach die Verantwortung ab.«
»Wie meinst du das?«
»Na ja. Die meisten Paare trennen sich statistisch gesehen ja. Und weil sie sich die Trennung leicht machen wollen, sagen sie dann so etwas wie Wir sind einfach nicht füreinander geschaffen. Und damit wollen sie sich freisprechen. Es ist eine Art Ablassbrief. Ein simpler Wink an das Schicksal, und man kann alles wegschmeißen, statt daran zu arbeiten. Es ist eine feige Methode, sich möglichst leicht aus der Affäre zu ziehen.«
»Nein!«
»Wie nein?«
»Na, einfach nein! Ich denke, du siehst das falsch.« Leon faltet seine Hände im Schoß, öffnet sie kurz wieder, macht eine rhetorische Geste und schließt sie erneut. »Schau: Wenn man füreinander geschaffen ist oder zumindest fest davon überzeugt ist, nur dann wird man an der Beziehung arbeiten. Es heißt nicht, dass man perfekt ist. Es heißt, dass man bereit ist, die Kraft aufzuwenden, die Beziehung gemeinsam weiterzuentwickeln.« Altklug legt er die Handflächen gegeneinander und fährt fort: »Wenn man aber nicht füreinander gemacht ist, kann man so viel arbeiten, wie man will. Es wird nie funktionieren. Daher verstehe ich nicht, wieso du einen Plan dem Schicksal vorziehst.«
Ich reagiere mit Schweigen. Ein Triumph, den Leon allerdings nicht auskostet. Wahrscheinlich sieht man mir an, wie sehr mich seine Worte aufwühlen und zum Nachdenken bringen.
»Manchmal ist es der beste Plan, keinen Plan zu haben«, sagt er abschließend.
PROLOG 2
»Ich liebe Flo«, ermahne ich meine Freundin Sarah, als sie mir unterstellt, einem anderen Mann hinterherzusabbern. Ich liebe meinen Freund Florian wirklich! Jemanden zu lieben, heißt ja nicht, beim bloßen Gedanken an ihn dahinzuschmelzen und jeden anderen Menschen mit Missachtung zu strafen. Jemanden zu lieben, bedeutet, ihn als Teil des eigenen Lebens zu akzeptieren. Ihn nicht missen zu wollen, oder vielmehr: ihn nicht missen zu können, weil die Vorstellung, ohne ihn zu sein, absurd wäre.
»Aber du bist nicht glücklich mit ihm.«
»Ich BIN glücklich. Ich bin vielleicht nicht über beide Ohren verliebt, und wir haben Probleme, aber es ist alles okay. Und okay ist doch okay, oder?«
»Ja, wenn okay für dich okay genug ist, dann ist es okay. Denke ich.«
Diese Aussage lasse ich mir durch den Kopf gehen, und ich merke, wie sie sich genau dort verankert. Wenn okay für mich okay genug ist, dann ist alles okay. Oder?
TEIL 1
Die Erschaffung des Allwetter-Haarsprays
4. Mai, in der Nähe von Hamburg
»Kannst du mir wenigstens den Namen und die Adresse dieses Mannes notieren?«
Meine Mutter gestikuliert heftig, während sie das brüllt, und eilt aus der Doppelhaushälfte, die einst mein Zuhause war. Sie rennt hinter mir her durch den Vorgarten und schwenkt dabei eine blaue Tupperdose. Ihre Frisur, die wie ein fein säuberlich angelegtes Vogelnest auf ihrem Kopf thront, wippt sanft umher und verströmt die gewohnte Note von Haarspray. Mama benutzt, seit ich denken kann, Drei-Wetter-Taft in der Intensitätsstufe vier, um ihre immer gleiche Hochsteckfrisur zu fixieren. So war es, und so wird es immer bleiben. Das ist so unumstößlich wie der Werbespot für Taft, in dem sich in den letzten Jahren lediglich das Modell geändert hat, das zur Behebung des Produkts bei Wind, Regen und Sonne aus einem schnittigen Fortbewegungsmittel aussteigt.
»Der Mann heißt Leon. Er wohnt … schätzungsweise in Hamburg oder in Frankfurt.«
»Schätzungsweise? Du bist lebensmüde. Le-bens-mü-de! Warum springst du nicht gleich aus einem fahrenden Zug?« Jetzt wird sie hysterisch und läuft hinter mir her auf die Straße. Würde in ihrem Frisuren-Nest ein Küken sitzen, wäre es spätestens bei ihrer schockierten Aussprache des Wortes »schätzungsweise« und der dazu passenden ruckartigen Kopfbewegung hinausgepurzelt.
»Mama! Es ist vollkommen normal, sich zu einer Mitfahrgelegenheit zu verabreden.«
»Es ist nicht vollkommen normal, dass eine junge Frau einen Wildfremden am Straßenrand aufsammelt – «
»Am Hauptbahnhof!«
Sie ignoriert meinen Korrekturversuch: »… und mal eben mit ihm fünfhundert Kilometer durch Deutschland fährt.«
Ich weiß überhaupt nicht, warum ich diese Diskussion erneut führe. In den letzten Jahren habe ich immer Mitfahrer mitgenommen, wenn ich meine Eltern in meiner Heimat in der Nähe von Hamburg besucht habe. Bis zu diesem Besuch war ich clever genug, meiner chronisch vorwurfsvollen Mutter nichts davon zu erzählen. Ausgerechnet heute Morgen beim Frühstück musste mir jedoch herausrutschen, dass ich einen Abstecher in die Hamburger Innenstadt mache, bevor ich mich auf den Rückweg in meine Wahlheimat Frankfurt begebe.
»In Zeiten des Carsharings und des Internets ist es nichts Ungewöhnliches.«
Meine Mutter hat natürlich keine Ahnung, was das Wort Carsharing bedeutet. Ihre Kenntnisse des Internets sind auf dem Stand von 2003. Sie glaubt noch heute, dass man einen Pakt mit dem Teufel eingeht, wenn man ein paar gebrauchte Schuhe auf eBay ersteigert, und E-Mails hält sie für einen vorübergehenden Trend.
»Du meinst also, nur anständige Menschen verabreden sich über das Internet? Darf ich dich an den Kannibalismus-Vorfall in Rothenburg erinnern? Zwei Männer, die sich über das Internet verabredet haben – und am Ende des Treffens hatte einer von beiden keinen Penis mehr! Weil seine Internetbekanntschaft ihn gegessen hat! GEGESSEN!«
Ich blinzle sie kritisch an. Unvorstellbar, dass ich dieses Gespräch wirklich führen muss.
Ich schließe für eine Sekunde genervt die Augen, greife mir an die Nasenwurzel und atme tief ein und aus. Mit einer Hand auf meinen Opel Corsa gestützt und mit der anderen meinen Rollkoffer umklammernd, sammle ich mich und sage ruhig: »In einer Sache kann ich dich beruhigen, Mutter: Die wildfremde Internetbekanntschaft wird nicht meinen Penis essen!«
Mama wirft erzürnt den Kopf in den Nacken und verschränkt die Arme. »Du willst mich nicht verstehen, Romy. Du willst es einfach nicht.«
Ich bemerke aus den Augenwinkeln, dass sie verstohlene Blicke die Straße rauf und runter wirft. Allein der Gedanke, einer der Nachbarn könnte beobachten, wie sie mit ihrer Tochter diskutiert, verursacht meiner Mutter Stress. Streit, Meinungsverschiedenheiten und Probleme lassen sich in ihren Augen am besten hinter verschlossenen Türen fixieren, wegbürsten und kaschieren. Wofür hat der liebe Gott denn sonst wetterfestes Haarspray geschaffen?
»Ich muss jetzt wirklich los«, betone ich und öffne die Autotür, um das zu unterstreichen.
»Du hörst also nicht auf deine Mutter.«
»Nein. Und das, obwohl ich doch erst siebenundzwanzig bin – muss man sich mal vorstellen!« Sie verdreht die Augen und lässt sich dann scheinbar die Zahl siebenundzwanzig auf der Zunge zergehen.
»Ja! Du bist siebenundzwanzig. In deinem Alter lag ich verheiratet in den Wehen. Nicht vergewaltigt auf der Autobahnraststätte.« Ihre panische Angst ist so absurd, dass ich unwillkürlich lachen muss.
»Ich rufe dich sofort an, wenn ich zu Hause bin. Und wenn wir an einer Raststätte halten sollten, achte ich sorgsam darauf, dass er mich nicht vergewaltigt.« Ich gehe um das Auto herum, öffne den Kofferraum und verstaue mein Gepäck.
Meine Mutter seufzt – ein verzweifeltes Geräusch der Resignation, das irgendwo zwischen Was habe ich nur falsch gemacht? und Das hat sie von ihrem Vater geerbt liegt. Dann drückt sie mir entnervt die Tupperdose in die Hand und grummelt mit erhobenem Zeigefinger: »Iss nicht alles alleine!«
»Siebenundzwanzig Jahre, Mama«, erinnere ich sie, »Wenn ich acht Stücke Kuchen alleine essen will, dann tue ich es.«
»Du weißt, was beim letzten Mal passiert ist, als du dachtest, du wärst alt genug, um deine Portionen eigenverantwortlich zu bestimmen?« Ich verziehe die Lippen zu einem schmalen, gekünstelten Lächeln. Nicht nur, dass meine Erzeugerin krampfhaft in der Vergangenheit lebt, sie muss auch noch jedem Menschen in ihrem Umfeld stets alle Fehler und Schwächen vorhalten. Wahrscheinlich steht deswegen auch kein aktuelles Foto von mir auf dem Kachelofen im Wohnzimmer, sondern eines aus meiner »speckigen Zeit«. Meine »speckige Zeit«, wie man sie in meiner Familie nennt, war etwa im ersten Jahr meines Studiums. Damals nahm ich in rekordverdächtigen zwei Semestern um die zwanzig Kilo zu. Meiner Einschätzung nach lag das daran. dass sich mein Körper in meiner neuen Frankfurter Studien-WG das holte, was meine Mutter ihm an dem Tisch, unter den ich zuvor neunzehn Jahre lang meine Füße streckte, untersagt hatte.
Kurz überlege ich, mich vor ihren Augen mit den acht Stück Streusel-Käsekuchen vollzustopfen. Doch dann sage ich mir lieber ein Mantra auf: Meine Mutter bestimmt nicht über mein Leben. Ich lasse ihre Probleme nicht an mich heran. Sie ist unzufrieden. Nicht ich.
Oder? Ach nee: Ommm, ich meinte Ommmmmmm.
Ich schnaufe tief durch, umarme sie und scherze: »Ich teile den Kuchen einfach mit meinem Vergewaltiger. Und jetzt muss ich los.«
»Wann kommst du das nächste Mal?«
Ich zucke die Schultern, rufe mir kurz den Kalender vor mein inneres Gedächtnis. Es ist Mitte Mai. Weihnachten kann ich ihr wohl kaum als akzeptablen nächsten Termin zur Stippvisite anbieten.
»Vielleicht zu Papas Geburtstag im Oktober.«
»Oktober!?«
»Ich muss los, Mama«, würge ich das aufkeimende Entsetzen in ihren Augen ab, umkreise den Wagen, öffne die Fahrertür und schlage sie zu, ohne noch einmal die Fenster herunterzufahren und dadurch ein weiteres Gespräch zuzulassen.
Die unzumutbaren Schachbrett-Schuhe
22. Mai, Frankfurt-Ostend
»Daniel hat sich gestern ein Paar Vans gekauft.«
Sarah wischt sich mit dem Ärmel ihrer Chiffonbluse über den Mundwinkel, aus dem ihr bei diesen Worten gerade eine gehörige Portion Barbecue-Soße gelaufen ist. Sie sieht mich mit einem düsteren Blick an, als hätte Daniel keine Schuhe gekauft, sondern das ganze Ersparte für eine Hüpfburg-Nachbildung des Schlosses Versailles auf den Kopf gehauen.
»Du meinst diese Skater-Treter, die wir alle mit vierzehn getragen haben?« Ich klaue eine Fritte von ihrem Teller, auf dem sich die Reste eines extragroßen Burger-Menüs befinden. Vor mir ruht eine komplett leer gekratzte Schüssel, die bis vor etwa einer Viertelstunde mit Salat und Ziegenkäse gefüllt war. Wenn ich Speisekarten aufschlage, in denen Burger, Fritten und Co. ganz oben aufgeführt werden, erklingt oft automatisch die Stimme meiner Mutter in meinem Kopf. Deswegen bin ich zu so einer schrecklichen Frau geworden, die in Restaurants immer Salat bestellt und versucht, den Brotkorb zu ignorieren. Es funktioniert aber meistens nur so lange, bis meine Essenbegleitung etwas Fettiges, gut Gewürztes auf ihrem eigenen Teller übrig lässt. Glücklicherweise ist Sarah nicht die Art Freundin, die mich darauf aufmerksam macht, dass es inkonsequent ist, Salat zu ordern und dann Pommes zu naschen.
»Doch genau die. Diese komischen Slipper mit Schachbrettmuster. Und ich fand die 2004 schon scheiße.« Sarah wedelt bedrohlich mit einer Pommes, um ihre Antipathie zu unterstreichen. »Es gibt wirklich keinen guten Grund für einen erwachsenen Mann von einunddreißig, im Jahr 2017 noch einmal mit so etwas anzufangen.«
»Meine Mutter hat mir die immer verboten. Sie meinte, die seien nicht gesellschaftstauglich.« Kurz fällt mir wieder ein, dass meine Mutter mir erst letzte Woche verbieten wollte, einen vermeintlich todbringenden Mitfahrer in mein Auto einsteigen zu lassen. Dieser Gedanke erfüllt mich mit einem Hauch kindlicher Aufregung.
»Damit hat sie ausnahmsweise mal recht. Und ich gebe ihr echt ungern recht, schließlich ist sie der Grund, warum du immer nur Grünzeug bestellst!« Sarah stopft sich die letzten Pommes in den Mund und schaut weiterhin finster. »Ich hasse es, meinen Freund zu bevormunden. Aber die Schuhe müssen weg, gib mir Argumente!«
Ob sie mich hierfür als qualifiziert erachtet, weil sie denkt, dass auch ich meinen Freund bevormunde? Na ja, da ist Leugnen wohl zwecklos. Ja, ich bevormunde meinen Freund hin und wieder. Vor allem, wenn es um seine Kleiderwahl geht.
»Ich? Argumente? Gegen die Turnschuhe eines Mannes? Du weißt schon, dass mein Freund so ’ne Art Berufsjugendlicher ist, der seit 1999 dasselbe Paar adidas Superstar trägt?«
Sarahs Blick sagt mir, dass die Schachbrett-Vans eindeutig schlimmer sind, da Superstars a) wenigstens Schnürsenkel und ein Fußbett haben, b) letzten Sommer in so ziemlich jedem Fashionblog vorstellig wurden und c) die Füße meines Freundes Flo und nicht die von Daniel darin stecken.
»Bei Flo passt das eben. Du weißt schon.«
Sarah spielt darauf an, dass mein Freund wirklich eine Art Berufsjugendlicher ist. Flo hat sich, nachdem er einige Jahre als Redakteur für ein Gaming-Magazin geschrieben hat, mit seiner eigenen Website selbstständig gemacht. Heute zählt sein Blog Flo zockt zu den erfolgreichsten deutschen Seiten in dieser Sparte. Zigtausend Menschen lesen wöchentlich seine Rezensionen und Berichte über Neuheiten aus der Welt der PC- und Konsolenspiele und verfolgen die Videos, in denen er in Echtzeit Spiele spielt und kommentiert. Doch Erfolg hin oder her: Flos Profession löst oft eher Kopfschütteln als Begeisterung aus; und festes Schuhwerk muss er während der Arbeit definitiv nicht tragen.
»Daniel ist promovierter Mathematiker und arbeitet in einer Bank. Die Latschen müssen weg.« Sie setzt einen Schmollmund auf. »Du hast doch auch sonst immer so überzeugende Argumente.« Anmerkung: Damit meint sie nicht meine Brüste. Sie spielt auf meinen Beruf als Account Managerin an. Als solche bin ich die meiste Zeit damit beschäftigt, den Kunden der Werbeagentur, in der ich arbeite, Dinge anzudrehen, die sie entweder nicht bezahlen wollen oder nicht zu brauchen glauben. Sarah ist es gewohnt, dass ich unseren Kunden in ellenlangen Streitgesprächen erkläre, warum es sich lohnt, Geld in provokative oder aufmerksamkeitsstarke Kampagnen zu investieren – Kampagnen, deren Urheberin Sarah ist. Denn sie ist nicht nur meine beste Freundin, sondern auch meine Kollegin. Sarah Ritter ist Art-Direktorin und denkt sich als solche kreative Konzepte, Designs und Layouts aus.
»Okay«, schließe ich und mache meine übliche, leicht Angela-Merkel-inspirierte Geste, die signalisiert, dass ich einen Plan gefasst habe. Ich imitiere Sarahs Stimme, die höher ist als meine eigene, und halte eine strenge Predigt: »Daniel, du hast einen Hochschulabschluss, eine Freundin, die sich bereits Namen für eure drei Kinder überlegt, du zahlst Einkommenssteuer und Rentenversicherung. Doch all das, sagt dieser Schuh nicht. Dieser Schuh sagt: Ich hasse meine Eltern, schwänze den Religionsunterricht und verbringe meine Freizeit damit, den Cranberry-Wodka von Lidl zu trinken und zu den Klängen von Green Day auf den Kapitalismus zu schimpfen.«
Sarah bricht in schallendes Gelächter aus und lacht noch, während wir unsere Taschen packen und uns aus der sonnigen Mittagspause zurück Richtung Agentur bewegen.
Als wir wieder in unserem Büro sind, wartet ein ganzer Haufen unbeantworteter E-Mails auf mich. Achtunddreißig, um genau zu sein, dabei waren wir nicht mal eine Stunde unterwegs. Ich mache mich sofort daran, eine nach der anderen abzuarbeiten. Als Account Managerin bin ich für unsere Kunden Berater, Babysitter und Fußabtreter in Personalunion. Die E-Mails spiegeln einen guten Querschnitt dieser Tätigkeitsfelder: zwei Dutzend Anfragen, Rückfragen, Nachfragen und dumme Fragen, ein paar Terminänderungen und Meetingerinnerungen, und der Rest ist – nennen wir es mal – unkonstruktive Kritik. Wie etwa die E-Mail meiner Lieblingskundin Frau Knallkopfski, die vor einer halben Stunde in meiner Abwesenheit eingetroffen ist.
Die Dame heißt natürlich nicht wirklich Knallkopfski. Ihr richtiger Name ist Regina Kanowski und sie ist die Marketingleiterin eines Unternehmens, das ziemlich erfolgreich Pappkartons herstellt. Und mit ziemlich erfolgreich meine ich: Gefühlt jeder zweite Karton auf Gottes schöner Erde stammt aus dem Hause papp.inc und wurde im nahe gelegenen Vordertaunus geboren. Die praktische Aufreiß-Methode der Amazon-Päckchen – eine Erfindung aus dem Hause papp.inc. Die ultraflache Kartonage des Billy-Regals ebenfalls. Genauso wie jede Versandbox, die man bei der Deutschen Post erwerben kann. Wahrscheinlich sind wir bei SCHMITT+MATUSCHEK daher auch so stolz darauf, dieses Unternehmen in unserem Kundenportfolio zu führen. So stolz, dass wir ihnen alles durchgehen lassen.
Regina Kanowski verfügt bei papp.inc über einen Marketingetat von knapp fünfzehn Millionen Euro im Jahr und finanziert damit einen Großteil unserer Gehälter. Das muss ich mir jedes Mal anhören, wenn ich es wage, mich bei meinem Chef über sie aufzuregen. Damit hat er natürlich auch recht. Aber es ist eben nicht immer leicht, mit Regina zu verhandeln. Sie erachtet sich in wirklich allem als überlegen – von Volkswirtschaft über Rechnungswesen bis hin zu Kreativer Konzeption und Produktion von Werbemitteln. Ja, einmal hat sie mir sogar zu erklären versucht, wie ich meine Haare kämmen müsse, damit sie besser glänzen.
Weil der Kunde König ist und ich eine doofe Heuchlerin, habe ich so getan, als hätte ich mir den Tipp zu Herzen genommen und am nächsten Morgen eine E-Mail an sie mit dem PS beendet: »Ich habe ihren Tipp beherzigt, und mein Haar ist wie verwandelt.« Was zwar nicht stimmte, mir aber ein positives Feedback und einen reibungslosen Arbeitstag mit ihr beschert hat.
Heute habe ich leider keine Schmeichelei auf Lager, mit der ich schlichten könnte, was offenbar in Reginas Köpfchen brütet. Ich gebe Sarah eine Kostprobe ihrer neuesten, wutentbrannten Nachricht: »Hey, hör mal zu. Bevor wir in die Mittagspause gefahren sind, habe ich Regina den Kostenvoranschlag für die Gestaltung des papp.inc-Messeauftritts geschickt.«
Im August hat papp.inc den größten Stand auf einer Messe der Verpackungsindustrie gebucht, und wir konnten uns in einer Ausschreibung einen großen Teil der angedachten Kommunikationsmaßnahmen sichern. Angefangen bei der Gestaltung des Standes bis hin zu Einladungskarten für besondere Gäste läuft alles über meinen Schreibtisch. Es ist der größte Job meiner bisherigen Karriere, und das erfüllt mich gleichermaßen mit Stolz wie mit grenzenloser Panik. Gemeinsam mit Sarah werde ich im August sogar nach London fliegen, wo die Messe stattfindet, um den Aufbau des Standes zu begutachten und abzunehmen. Jede wütende E-Mail meiner Kundin fühlt sich daher an, als hätte ich auf einer sehr steilen, großen Treppe eine Stufe verpasst und würde nun in Zeitlupe hinuntersegeln, während mir alle beim Scheitern zusehen.
»Lass mich raten: Frau Knallkopfski ist der Meinung, dass alles viel zu teuer ist und dass Gaudi persönlich ihr einen günstigeren Messestand bauen würde?«
Ich sehe Sarah verdutzt an und korrigiere: »Nicht direkt Gaudi, aber …« Ich verstelle meine Stimme zu einer Imitation unserer Kundin, die stets versucht, ihren starken südhessischen Akzent durch Überbetonung jeder einzelnen Silbe zu überdecken: »Liebe Frau Wagner. Darübär müssän wir aber schprechän.« Ich wechsle zurück in meine eigene Tonlage und paraphrasiere den Rest: »… was denken Sie eigentlich, wer Sie sind … denken Sie ernsthaft, wir geben die Hälfte unseres Messebudgets an Ihre Agentur? … ich habe Ihnen schon hundertmal erzählt, dass … Gott, bei diesem Gerede hätte ich genauso gut bei meiner Mutter wohnen bleiben können! Aber Achtung, jetzt kommt es: Ich habe mit einem Experten gesprochen und schlage vor, asap einen gemeinsamen Termin zu vereinbaren. Ich wünsche mir, dass er zentrale Elemente zur Gestaltung des papp.inc-Messestandes beiträgt.«
Sarah reißt entsetzt die Augen. Als leitende Art-Direktorin liegt die Gestaltung des Messestandes eigentlich bei ihr. Der Gewinn dieses Projekts war für sie ähnlich bedeutend wie für mich. Er hat uns beiden eine Beförderung eingebracht.
In ihren Augen ist deutlich zu lesen, was sie davon hält, sich die Gestaltung des Standes mit einem vermeintlichen Experten teilen zu müssen. Ihr Gesichtsausdruck sieht aus, als wäre ihr ein ziemlich übel riechender Hundefurz in die Nase gestiegen.
Für einen kleinen Augenblick bringt mich dieser Gedanke aus dem Konzept, und ich muss lachen. Ich erhebe die Hand, um mir damit auf die Schenkel zu klopfen und Sarah in einer »Weißt du noch, damals«-Manier, in mein Kopfkino einzuweihen. Aber dann fällt mir ein, dass Sarah ja noch gar nichts davon weiß, dass ich erst kürzlich ziemlich genaue Bekanntschaft mit einer mächtigen Stinkbombe von Hunde-Ausdünstung gemacht habe. Ich erinnere mich zum zigsten Mal an den großen braunen Hundekörper, der durch einen Zufall vor knapp einer Woche auf der Rückbank meines Autos lag und mit Verdauungsschwierigkeiten kämpfte. Ich denke an das Herrchen des Hundes, und das Herz rutscht mir in die Hose.
Bisher habe ich noch nicht entschieden, ob ich meine beste Freundin in diese Geschichte einweihen möchte. Doch Sarah lässt mir eh keine Gelegenheit, ihr von meinem Hundefurz-Insiderwitz zu erzählen. Sie springt von ihrem Stuhl auf, umkreist unsere Kopf an Kopf stehenden Schreibtische und wedelt bedrohlich mit dem Zeigefinger. »Wir müssen mit Matu reden! Romy, die Knallkopfski reißt mal wieder die gesamte Projektleitung an sich. Das können wir ihr nicht zugestehen. Wir müssen mit Patrick sprechen!«
Ich hebe beschwichtigend die Hände, verjage den Hund, der übrigens Dexter heißt, und sein Herrchen mehr schlecht als recht aus meinen Gedanken und lese den letzten Satz von Frau Kanowskis E-Mail laut vor: »Ich habe dies bereits mit Herrn Matuschek geklärt, schreibt sie.«
»WAS?!«, brüllt Sarah, »Dieser feige Mistsack! Er kann ihr doch nicht einfach … er kann doch nicht … ich will das nicht. Das ist mein Job!«
Jeder bei SCHMITT+MATUSCHEK weiß, dass Patrick Matuschek, seines Zeichens Kreativchef der Agentur, für einen Kunden alles machen würde. Eigentlich ist er ein netter Kerl, Sarah jedoch kann ihn auf den Tod nicht ausstehen. Patrick wurde erst vor fünf Jahren zum Teilhaber der Agentur, die in den Achtzigern von Reinhold Schmitt gegründet und Anfang der Zweitausender von seinem Sohn Matthias übernommen wurde. Schmitt Jr. ist als Geschäftsführer für den administrativen und wirtschaftlichen Bereich zuständig, außerdem für die Kundenakquise und Strategie. Er ist sozusagen die linke Hälfte des Firmengehirns und sieht genauso aus, wie man sich einen Zahlenmenschen mit logischem Denkvermögen vorstellt: Ende vierzig, Anzug, Krawatte, blank polierte Schuhe, gescheitelte Gelfrisur, nicht vorhandene Lippen und stolzer Besitzer eines Porsche Panamera. Auch Patrick Matuschek lebt als Kreativchef sämtliche Klischees aus, die sein Beruf so mit sich bringt. Er hat immer eine Motivationsfloskel auf Lager, feiert gerne mal eine exzessive Party und steht auf abgefahrene Dandy-Outfits: gelb gemusterte Hemden und rosafarbene Hosen mit gekrempelten Umschlägen, geringelte Socken, Einstecktücher mit Paisleydruck, Hüte und braune Hornbrillen.
Schon als ich die E-Mail lese, wird mir klar, dass ich wahrscheinlich den ganzen restlichen Tag in einem »Deeskalationsmeeting« zubringen werde. So nennt es Patrick, wenn man sich vier Stunden lang darüber auskotzt, dass Regina Kanowski nicht mehr alle Latten am Zaun hat, nur um am Ende zu beschließen, ihren hirnrissigen Wünschen stattzugeben. Es ist einer der Begriffe, die Patrick in den Management-Seminaren kennengelernt hat, die er besucht, um ein noch kompetenterer Chef zu werden.
»Beruhig dich, Sarah«, beschwichtige ich, schwinge mich dramatisch auf dem Schreibtischstuhl herum, sodass meine Finger auf der Tastatur ruhen bleiben und beginne bereits eine Antwort zu formulieren. »Sie ist nicht umsonst Frau Knallkopfski. Die Alte hat einfach einen Knall. Es bleibt ganz bestimmt dein Job«, beruhige ich meine beste Freundin.
Als ich vor vier Jahren als Juniorin im Account Management angefangen habe, wurde mir beigebracht, dass Kreative zarte Pflänzchen seien. Man muss sehr behutsam mit ihnen umgehen und ihnen a) ihre Freiheit und b) ihren Zorn lassen. Denn während ich mich vor den Beleidigungen und der Missgunst von Damen wie Miss papp.inc gut abschotten kann, geht es einer kreativen Seele wie Sarah oft an die Nieren. Wenn Frau von und zu papp.inc beschließt, einen externen »Spezialisten« anzuheuern, um einen Messestand zu gestalten, dann liest Sarah zwischen diesen Zeilen, dass ihre Arbeit unzureichend ist.
»Ich kann bei so einem Verhalten einfach nicht diplomatisch bleiben.« Sarah zieht mit beleidigter Miene ein Twix aus ihrer Zauber-Schublade, in der sie massenhaft Süßigkeiten aufbewahrt, und schiebt sich den ersten Riegel beinahe am Stück in den Mund.
Ich kann nicht anders, als ihre Kalorienzufuhr der letzten anderthalb Stunden im Kopf zu überschlagen. Diese Angewohnheit habe ich mir unfreiwillig von meiner Mutter abgeguckt. Während meiner »speckigen Zeit« sagte sie ständig Dinge wie »Ein Snickers entspricht fünf Kilometern Joggen« oder »Nimm lieber einen Salat statt Pommes« oder »Weißt du eigentlich, dass dieses Stück Kuchen ein Drittel deines Tagesbedarfs an Kalorien abdeckt?«.
Das Einzige, was ich durch diese Rechenbeispiele tatsächlich gelernt habe, ist, dass solche Ratschläge hundert Prozent meines täglichen Bedarfs an Bullshit decken.
Ich behalte die Nährwerte des Twix-Riegels daher für mich und gönne Sarah, dass ihr gestählter Körper scheinbar den Umsatz eines kleinen Kraftwerks besitzt. Erwähnte ich, dass Sarahs Arme dick wie Pythons und ihr Hintern stramm wie eine frisch gespannte Trommel ist? Vielleicht sollte ich mal mit ihr in ihr komisches Spezial-Fitnessstudio gehen, in dem sie Gewichte stemmt und in Rekordzeit Ausdauerübungen durchführt.
Seit ich das letzte Mal Sport getrieben habe, ist so einiges passiert in der Welt. Die Einführung des Euros zum Beispiel. Ich sollte Sarah mal zum Sport begleiten. Ein Paar muskelbepackter Arme ist bestimmt ein hilfreiches Argument, wenn ich Regina die Sache mit ihrem Spezialisten ausreden möchte.
Die Serien-Fantasie
22. Mai, Frankfurt-Ostend
Als ich gegen Viertel vor sieben etwas verspätet Feierabend mache, habe ich den Vorsatz, bald mit Sarah zum Sport zu gehen, bereits wieder vergessen. Er wurde von einem Haufen neuer Informationen und Vorhaben verdrängt, die in den letzten Stunden eingetrudelt sind. Patrick Matuschek hat das dringende Meeting in Sachen papp.inc auf den morgigen Vormittag verschoben, was die Angelegenheit für Sarah nur verschlimmert hat. Sie zeterte den ganzen restlichen Arbeitstag über nichts anderes mehr und aß vor lauter Aufregung noch ein zweites Twix (und damit meine ich ein komplettes zweites, nicht einfach nur den zweiten Riegel aus der ersten Packung). Mir hingegen kam der Aufschub ganz recht. So wurde »Krisenmeeting mit Matu« auf meiner Liste für den heutigen Tag erst mal gestrichen. Damit verbleiben in meinem Moleskine-Taschenkalender nur noch folgende Tagesordnungspunkte:
Flo fragen, ob er seinen Teil der Kaution an mich zurücküberwiesen hat
Kühlschrank-Temperatur prüfen
Gemischtes Gemüse mit Hähnchen zum Abendessen
Ja, ich schreibe mir tatsächlich auf, was es abends zum Essen geben soll. Ich laufe sonst Gefahr, mir zum Abendessen eine ganze Packung Käse reinzupfeifen, die ich Scheibe für Scheibe direkt aus dem Kühlschrank esse.
Ich mache gerne Pläne, und Teil des Plans ist, selbigen aufzuschreiben und zur vorgesehenen Zeit auszuführen. Nach diesem Konzept habe ich mein Studium strukturiert, meine ersten Praktika absolviert und auch mein Privatleben vorausgeplant.
Beim Gedanken an mein Privatleben, das mich zu Hause wahrscheinlich wieder einmal in Lotterklamotten und ungeduscht erwartet, notiere ich einen weiteren Punkt:
Netflix-Serie
Stranger Things
ansehen
Ich grinse, während ich den Kugelschreiber wieder zudrehe und in die Handtasche zurückstecke. Mein Blick wandert durch die Straßenbahn, in der ich nach Hause fahre, und scannt die vorbeirauschende Umgebung. Als würde ich Ausschau halten nach etwas, nach jemandem, nach ihm, weil er gesagt hat, ich solle mir diese neue Netflix-Show unbedingt ansehen, sie würde mir gefallen.
Serien sind meine absolute Schwäche. Wenn mich eines aus der Spur bringen kann, dann eine wirklich gute Show, von der man zehn Folgen nahtlos am Stück schauen kann. Selten schalte ich so ab, wie wenn ich eine ganze Serienstaffel an nur einem Wochenende sehen kann. Wenn ich in die Welt der Protagonisten eintauche und meine eigene für zehn wunderbare Stunden links liegen lassen kann. Es gibt vermutlich keine populäre Show der letzten zwanzig Jahre, die ich nicht zumindest angefangen habe. Nicht jede entspricht meinem Geschmack, aber wenn mich etwas fesselt, dann werde ich zum bedingungslosen Fan.
Wenn ich miterlebe, wie sich Ross und Rachel aus Friends verlieben, kann ich dabei Popcorn essen, ohne dass mich die Stimme meiner Mutter an die speckige Zeit erinnert. Wenn ich einen Ausflug nach Stars Hollow mache und dort die Gilmore Girls besuche, dann ist die ganze Welt aus Zuckerwatte, und ich vergesse, was ich alles zu erledigen habe. Wenn ich eine Folge Lost schaue, überlege ich, was mir im Leben noch wichtig wäre, wenn ich auf einer einsamen Insel stranden würde. Ob ich an Flo denken müsste, wenn mein Flugzeug abstürzt. Ob Frau Knallkopfski mich dann mal kreuzweise könnte. Ob ich zum Helden mutieren oder komplett durchdrehen würde – und wie mein Körper wohl aussehen würde, wenn ich wochenlang hauptsächlich von Mangos leben müsste?
Und wenn ich eine Folge von Dexter, einer meiner Lieblinge, schaue, werde ich fortan wahrscheinlich nur noch an den riesigen rotbraunen Hund denken, der mir letzten Sonntag fast auf die Rückbank meines Opel Corsas gekackt hätte.
Der Anfang vom Anfang
14. Mai, Kilometer 0
Ein Wochenende in meinem Elternhaus ist wie eine Zeitreise. Nur dass ich dabei nicht nur durch Raum und Zeit reise, sondern zu einem vergangenen Selbst von mir werde. Einem, das mit Vorwürfen und kritischen Fragen überschüttet wird und dem nicht das geringste Fünkchen Eigenverantwortung zugestanden wird.
Scheinbar mache ich den Eindruck, nichts alleine entscheiden zu können, ohne dabei fett oder sogar misshandelt zu werden. Warum sonst sollte meine Mutter Bedenken haben, mich mit acht Stück Kuchen und einem bisher anonymen Mitfahrer alleine zu lassen?
Vorsichtshalber schalte ich bereits jetzt mein Handy auf »lautlos«. Ich habe wirklich keine Lust, während der Fahrt mit einem »Wildfremden« im Auto mit meiner psychotischen Mutter zu telefonieren.
Ich sortiere mich an der Ampel ein, die mich auf den Zubringer zur Autobahn führt, und atme merklich auf. Mit jedem Meter, mit dem ich die menschenleere Kleinstadt weiter hinter mir lasse, werde ich entspannter. Ganz so, als würde ich meinem vergangenen Selbst davonfahren und Stück für Stück wieder die Romy werden, die ich jetzt bin.
Wenn ich es mir recht überlege, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich meine Eltern wirklich erst wieder im Oktober zu Gesicht bekomme. An den vergangenen vier Tagen dieses verlängerten Christi-Himmelfahrt-Wochenendes hat Mama mich nicht nur mehrfach daran erinnert, dass ich mal übergewichtig war. Sie hat mir auch unablässig Fragen über die neue Wohnung gestellt, in die ich vor einem Monat umgezogen bin. Hat mir unterstellt, dass diese sicher noch sehr chaotisch und nicht fertig eingerichtet wäre, dass sich darin das Geschirr türme, weil ich keine Spülmaschine besitze, und dass ich mir eine Wohnung mit Balkon in Frankfurt-Bornheim doch ganz sicher nicht leisten könne.
Dabei kann Mama das gar nicht beurteilen, weil sie weder eine Ahnung davon hat, wie viel ich in meinem Job als Account Managerin verdiene, noch, wie viel eine Wohnung mit Balkon in Bornheim eigentlich kostet. Sie wohnt schon ihr Leben lang in einem Kaff im Norden und kennt Frankfurt nur aus den Börsennachrichten im Fernsehen.
Auch ihre wiederholten Sticheleien rund um die Themen Heirat und Kinder sind mir nicht entgangen. Dabei dachte ich bisher, es wäre eine Erfindung von Funk und Fernsehen, dass Eltern mit voranschreitendem Alter ihres Nachwuchses von der Panik ergriffen werden, ihr Stammbaum könnte nicht fortgesetzt werden.
Meine Mutter hat wirklich keinen Grund, sich darum zu sorgen, dass ich ihr keine Enkelchen schenke. Ich liebe Kinder. Das weiß sie auch. Oder sie wüsste es zumindest, wenn sie mir in den letzten sechsundneunzig Stunden zumindest einmal zugehört hätte, als ich auf ihre Seitenhiebe mit »Mama, ich liebe Kinder« reagiert habe.
Ich sollte mir über all das keine Gedanken machen, denn
a) ich bin eine siebenundzwanzigjährige Frau mit eigenem, nicht gerade schlechtem Einkommen, einem Dach über dem Kopf und einem gut funktionierenden Gehirn,
b) ich habe noch alle Zeit der Welt zum Kinderkriegen, denn bis ich als spätgebärend eingestuft werde, müssen locker noch zehn Jahre ins Land gehen,
c) die neue Wohnung kann ich mir durchaus leisten, dass sie noch etwas chaotisch ist, muss meine Mutter nicht wissen, und die Anschaffung der Spülmaschine ist bereits im Finanzplan der nächsten sechs Monate einkalkuliert, und außerdem
d) hat meine Mutter keine Ahnung. Weder davon, wie es ist, mit siebenundzwanzig über ein eigenes Einkommen zu verfügen, noch, wie man mit Vollzeitjob einen Haushalt und einen Haufen Spülgeschirr meistert. Ganz zu schweigen davon, dass sie einen Internetservice zum privaten Carsharing nicht von einem Portal für mordlustige Perverse unterscheiden kann.
Mit einem ihrer Themen, mit dem sie mich partout nicht in Ruhe lassen wollte, hat sie jedoch nicht unrecht. Meine Mutter hatte immer Bedenken, was Flo angeht. Auch ich kann spätestens seit unserem Zusammenziehen nicht mehr leugnen, dass es reifere und vernünftigere Männer als ihn gibt. Aber ich habe mich nun mal für ihn entschieden. Oder? Und ich bin kein Mensch, der Pläne einfach über Bord wirft.
Den Weg in die Hamburger Innenstadt zum Hauptbahnhof fahre ich wie mit Autopilot. Dort angekommen parke ich meinen weißen Kleinwagen auf dem Parkplatz nahe der U-Bahn-Haltestelle und steige aus, um nach meiner Internetbekanntschaft Ausschau zu halten. Über die App von ich-fahr-mit.de haben wir schriftlich diesen Ort als Treffpunkt um vierzehn Uhr vereinbart. Ich gehe davon aus, dass diese Uhrzeit gerade noch rechtzeitig sein wird, um einem Stau möglichst aus dem Weg zu gehen. Sicherlich fahren viele Menschen am Ende dieses langen Wochenendes nach Hause. Wenn wir, wie ich es mir zurechtgelegt habe, auf der Höhe von Hannover tanken und bei Göttingen oder Kassel eventuell halten, um mal aufs Klo zu gehen oder einen Snack zu kaufen, könnten wir es binnen fünf Stunden nach Frankfurt schaffen.
Ich schaue auf die Uhr. Sieben nach zwei. Ich will nicht sagen, dass ich pingelig bin, aber Unpünktlichkeit setzt mich ein bisschen unter Druck. Ich habe nun mal angepeilt, um sieben am Frankfurter Hauptbahnhof und eine Viertelstunde später auf meinem Sofa zu sein. Mit mindestens einem Stück des Käsekuchens und einer Folge Game of Thrones.
Natürlich wäre es auch kein Drama, erst um halb acht oder acht damit zu beginnen, mich mit Kuchen vollzustopfen, während ich Jon Snow und Co. dabei zugucke, wie sie Schwerter schwingen und Köpfe abhacken. Aber jeder hat eben seine Macken, und meine besteht darin, meine Vorhaben einzuhalten.
Schon zwölf nach zwei übrigens.
Ich entferne mich ein paar Schritte von meinem Corsa und schaue auf dem belebten Bahnhofsparkplatz umher. Etwa vier Dutzend Taxen sind hier geparkt, ebenso viele Privatfahrzeuge. Menschen wuseln umher, rennen zur U-Bahn-Haltestelle und in den Hauptbahnhof hinein. Ich zähle zwei Obdachlose und vier Bettler und fünf Menschen, bei denen ich mir unsicher bin, ob sie zur einen oder zur anderen Kategorie gehören oder ob sie ein anderes schlimmes Schicksal ereilt hat, das dazu führt, dass man an einem Sonntagnachmittag auf dem Parkplatzboden vor dem Hamburger Hauptbahnhof kauert und Flaschen mit alkoholhaltigen Getränken an den zahnlosen Mund führt. Mich überkommt gleichermaßen Ekel wie Mitleid, und ich drehe mich weg. Vierzehn Uhr vierzehn.
Ein Paar ganz in meiner Nähe auf dem Bürgersteig sieht ebenfalls aus, als würde es auf eine Mitfahrgelegenheit warten. Sie hat einen Trekkingrucksack geschultert und bunte Fäden und Perlchen in ihre hüftlangen Dreadlocks geflochten. Der Mann an ihrer Seite ist attraktiv, um die dreißig, führt einen großen braunen, schlanken Hund an einer Leine mit sich und streicht sich nervös über den Bart, während er immer wieder auf die Anzeige seines Smartphones schaut. Ich beobachte das ungleiche Paar. Das Einzige, das sie gemeinsam zu haben scheinen, sind die ähnlichen Wander-Rücksäcke.
Erst als das Mädchen auf einen kleinen, abgewrackten Renault zugeht, die aussteigende Fahrerin (Anfang zwanzig, Rastazöpfchen und Haremshose) mit einer herzlichen Umarmung begrüßt und mit ihr davonfährt, fällt mir auf, dass die beiden gar nicht zusammengehören. Der Mann ist auf dem Bordstein zurückgeblieben, streichelt nun mit einer Hand den Kopf des Hundes und hält sich mit der anderen das Telefon ans Ohr.
Plötzlich treffen sich unsere Blicke. Er steckt das Handy weg, kneift die Augen zusammen, als würde er in mir eine alte, verschollen geglaubte Freundin wiedererkennen, und kommt auf mich zu.
»Fährst du nach Frankfurt?«, fragt er und streckt mir eine große Hand entgegen. Mein lieber Scholli! Das ist wirklich eine große Hand. Als ich ihm irritiert die meine reiche, verschwinden meine Finger fast vollkommen unter seinen. Dabei sind meine Hände für meine Körpergröße von einem Meter fünfundsechzig recht normal proportioniert. Seine Hände jedoch sind wie die eines Basketballers, noch dazu spröde und trocken.
Etwas verwirrt, warum mich dieser Fremde mit Handschlag begrüßt, stammle ich: »Ja … ähm …« Mein Blick wandert von seinem bärtigen Gesicht zu dem angeleinten Hund, dessen rotbraunes Fell fast unnatürlich schön glänzt.
»Romy, richtig?«, fragt er mich, »Ich bin Leon, von ich-fahr-mit.de!«
Nun bin ich es, die die Augen zusammenkneift, um ihn genauer zu betrachten. Das Foto von ihm, das in seinem Profil in der App hinterlegt war, sieht ihm nicht im Geringsten ähnlich. Darauf war ein blasser, glattgesichtiger Typ mit kurz geschorenem Haar zu erkennen, dessen Alter ich auf grade-fertig-mit-dem-Abi geschätzt habe.
Doch der Mann vor mir hat einen wettergegerbten, gesunden Teint, einen Haarschnitt wie Patrick Dempsey in Grey’s Anatomy und einen dunkelblonden Vollbart, der sicher zwei Wochen gezüchtet worden ist. Und sein Schulabschluss liegt bestimmt schon zehn Jahre zurück. Sein Paar eisblauer Augen, das mich soeben in einen geradezu hypnotischen Bann zieht, war ebenfalls auf dem Profilbild nicht zu erkennen – von seinem tierischen Begleiter einmal ganz zu schweigen.
»Oh! Leon!« Ob es meine Mutter beruhigt, dass mein potenzieller Mörder einen soliden Händedruck hat und offenbar einer handwerklichen Tätigkeit nachgeht – zumindest nach der Rauheit seiner Hände zu schließen? Oder dass er es geschafft hat, ein Hemd zuzuknöpfen, ohne einen Knopf zu verfehlen? Oder dass seine Augen eher zu »Schwiegermamas Liebling« als zu »Geistesgestörter Killer« passen?
»Du … dein … auf deinem Foto sahst du ganz anders aus, entschuldige! Ich hab dich nicht erkannt.«
»Ja, sorry. Das müsste ich aktualisieren. Ich glaube, das ist … aus dem ersten Semester an der Uni oder so.«
»Es wurde auf jeden Fall aufgenommen, bevor Bärte hip wurden«, scherze ich und bereue es sofort. Ich habe gelesen, dass der Mann von heute sehr viel Zeit und Pflege in seine Gesichtsbehaarung investiert. Ich möchte es mir nur ungern mit einem Menschen verscherzen, mit dem ich die kommenden fünf Stunden auf engstem Raum gemeinsam verbringen werde, nur weil ich sein haariges Hobby verspottet habe.
Aber Leon lacht und präsentiert mir neben einem Sinn für Humor zwei Reihen weißer Zähne. Der Hund wird auf die Gesprächspartnerin seines Herrchens aufmerksam und beginnt zunächst an meinen Schuhen, dann an meinen Beinen zu schnuppern. Ehe ich michs versehe, schiebt er seine feuchte, lange Schnauze direkt zwischen meine Beine und schubst mir damit genau in den Schritt. Ich kenne Hunde, und ich mag Hunde. Ich weiß, dass sie gerne mal ihre Nase in intime Angelegenheiten stecken, und bin – normalerweise – erwachsen genug, um mich dadurch nicht peinlich berührt zu fühlen. Doch heute erschreckt mich das feuchte Riechorgan in meiner Mädchenregion so sehr, dass ich zurückschrecke und gegen den Seitenspiegel meines Autos remple.
»Oh Gott, Entschuldigung! Dexter! Dexter, zurück!« Leon zieht an der Leine, und der Hund schaut traurig von ihm zu mir, als wüsste er nicht, was er denn falsch gemacht habe. Sein Hundeblick sagt deutlich: »Was denn? Ich will doch nur mal wissen, ob die Dame freundlich ist, und dafür muss ich nun mal an ihren Genitalien riechen!« In der Hundewelt ist das wahrscheinlich so etwas Ähnliches wie das Angebot, sich fortan beim Vornamen zu nennen.
»Ist schon okay«, besänftige ich und streichle Dexter, um mein Einverständnis zu untermalen. Ich bin gespannt, ob Leon bald mal ein Wort darüber verliert, wieso ein Hund an seiner Seite ist.
»Ich hab versucht, dich anzurufen. Außerdem habe ich dir in der letzten halben Stunde ein gutes Dutzend Nachrichten geschrieben. Wegen ihm.« Er nickt zu dem Hund, der nun, wo wir Duzfreunde sind, mit freudigem Schwanzwedeln auf meine Berührung reagiert. Leon klingt kein bisschen vorwurfsvoll, weil ich seine Anrufe versäumt habe. Im Gegenteil. Sein Tonfall ist unterwürfig, und seine Stimme wird flehend, als er fortfährt: »Es tut mir so leid! Ich wäre nicht mit einer Mitfahrgelegenheit gefahren, wenn ich gewusst hätte, dass er dabei ist. Ich wollte mir einen Mietwagen nehmen, aber ich konnte so kurzfristig keinen mehr kriegen. Ich schwöre dir, ich wusste nicht, dass ich den Hund bei mir habe, als wir die Fahrt vereinbart haben. Ich hätte dich auf jeden Fall erst gefragt, ob du ihn mitnimmst.« Er kramt in der hinteren Tasche seiner Jeans nach einem braunen Lederportemonnaie, schaut hinein, zählt ein paar Banknoten durch und sagt: »Ich gebe dir natürlich zusätzlich Geld für ihn. Vielleicht zwanzig Euro? Oder dreißig? Wie du magst! Ich gebe dir …« Er lächelt gleichermaßen verzweifelt wie charmant. »… mein letztes Hemd … und unterwegs lade ich dich auf ein Fünf-Gänge-Menü ein oder so.« Leon wiederholt noch einmal: »Ich wusste nicht, dass ich Dexter bei mir habe. Das habe ich erst vor einer Stunde erfahren, und ich muss ihn wirklich mit nach Frankfurt nehmen. Mir ist klar, dass das sehr merkwürdig wirkt und mich nicht gerade wie den vertrauenswürdigsten Mitfahrer aussehen lässt. Aber … einfach nur: Bitte!«
»Dein Hund heißt Dexter?«, frage ich, grinse freudig und gehe in die Knie, um dem kräftigen Tier richtig in die Augen sehen zu können. »Du darfst natürlich mitfahren, Dexter!«
Das Cinnimini-Fiasko
22. Mai, Frankfurt-Bornheim
Bevor ich zu Hause den Schlüssel in die Wohnungstür einstecke, schaue ich auf die Uhr. Es ist Viertel nach sieben. Ich fühle mich muffig und schlapp von der Arbeit, vielleicht sollte ich noch ein Bad nehmen.
Ich schließe die Wohnungstür auf und trete ein. Der Flur ist dunkel, aber die Tür am Ende des Ganges steht einen Spaltbreit auf, und Licht fällt in einem schmalen Streifen auf das Laminat der Altbauwohnung. Diese unfassbar schöne Altbauwohnung, für die ich eine Niere auf dem Schwarzmarkt verkauft hätte, um sie zu bekommen.
Ich lege mein Gepäck neben den Umzugskisten ab, die sich noch immer im Flur türmen. Ein kleiner Teil von mir hat ja wirklich gehofft, sie hätten sich während meiner Abwesenheit am letzten Wochenende irgendwie von selbst ausgeräumt und in den Keller getragen. Aber als ich vorigen Sonntag voll bepackt mit Gepäck und einer halb leer gegessenen Kuchendose die Wohnung betrat, traf mich die Erkenntnis, dass die Umzugskartons wohl so lange in unserem Flur stehen werden, bis ich mich erweiche und sie selbst wegräume.
Ich folge dem Lichtstrahl zum Ende des Flurs und stoße die Tür auf. Ähnlich wie im Gang herrscht auch hier das blanke Chaos. Im Zimmer ist es viel zu warm, es riecht süßlich-chemisch nach Energydrinks, und der Geruch von ungewaschener Kleidung liegt in der Luft. Das bekannte Brummen und Summen der Computerbelüftung erfüllt den Raum, und auf dem Boden liegt eine nach links gekrempelte Jeans, die aussieht, als wäre sie gedankenlos heruntergetreten und ausgestrampelt worden. So als hätten sich hier zwei Liebhaber blind vor Leidenschaft die Kleider vom Leib gerissen.
»Hey, ich bin da«, sage ich.
Keine Reaktion.
Auf dem Computerbildschirm ragt der Lauf eines Maschinengewehrs in eine öde, exotische Landschaft.
»Flo?«
Immer noch nichts.
Ich trete seufzend einen Schritt in den Raum hinein, fasse den mir zugewandten Rücken an den Schultern an und sage laut: »Florian!«
Flo zuckt zusammen und zieht sich die Kopfhörer von den Ohren. Er dreht sich auf dem Schreibtischstuhl herum und strahlt mich überrascht an.
»Du bist ja schon da!«
»Flo, es ist fast halb acht.«
Er rappelt sich auf. »Ja, aber manchmal … du weißt schon: Seitdem du diesen Riesenjob von der Pappkarton-Tante übernommen hast, kommst du auch oft erst nach acht heim.«
Flo klopft sein T-Shirt glatt, und dabei fallen seine Kopfhörer, gefolgt von einer Milliarde undefinierbarer Krümel, auf den Teppich. »Ich hab gar nicht bemerkt, wie spät es geworden ist. Ich hatte … ich wollte … Eigentlich wollte ich noch was zu essen machen.« Flo trägt nur blau karierte Boxershorts (das erklärt die zerknitterte Jeans-Leiche auf dem Teppichboden) und ein T-Shirt, auf dem in dicken Lettern Wacken 2007 zu lesen ist.
Beinahe an jedem Tag, an dem ich erst nach achtzehn Uhr aus dem Büro herauskomme, verspricht Flo, etwas zu essen vorzubereiten. Er vergisst es eigentlich immer. Das stört mich nicht besonders, denn Flos Talent am Herd pendelt sich irgendwo zwischen Rührei, Miracoli und Salamitoast ein.
»Sieht aus, als hättest du schon gegessen.« Ich deute auf seinen Schreibtisch, auf dem neben der Tastatur eine riesige Salatschüssel steht, in der noch ein kleiner See von Milch und einige von Flos liebsten Cornflakes, Cinniminis, vor sich hin dümpeln.
»Ach das …« Er winkt ab. »War mein Mittagessen.«
»Wieder eine ganze Packung?«
»Nein. Nur etwa drei Viertel.« Flo zeigt mir sein typisches spitzbübisches Grinsen, tritt auf mich zu und drückt mir einen Kuss auf den Mund.
Er folgt mir in die Küche und sieht mir dabei zu, wie ich zwei Hähnchenbrüste zu zerteilen beginne. »Wie war’s eigentlich bei deinen Eltern?«
»Flo, ich bin bereits seit einer Woche wieder hier.« Ich sage das in einem Ton, als würde ich mit einem Mann reden, der nach einem langen Koma an Gedächtnisschwund leidet.
»Ja, aber wir haben noch gar nicht richtig darüber geredet.«
»Wahrscheinlich, weil du seit Wochen zu sehr in Battlefield oder Call of Duty oder was es auch immer war, vertiefst bist.«
»Tut mir leid«, spult er hastig herunter und lässt sein Standardargument folgen. Wann immer Flo mich wegen eines Computerspiels sitzen lässt, rechtfertigt er es mit »Aber Romy: Es. Ist. So. Geil!«.
Als ich vor einer Woche vom verlängerten Wochenende bei meinen Eltern heimkam, hatte ich Flo in ähnlichem Zustand vorgefunden wie gerade eben. Er hat mich nur kurz begrüßt und dann den restlichen Abend am Computer verbracht. Ich saß mit einem Kopf voller verwirrender Gedanken auf der Couch und sah mir zum wiederholten Mal die Pilotfolge der Crime-Serie Dexter an, ehe ich bereits um halb zehn ins Bett ging. Flo kam gegen ein Uhr nachts nach, kuschelte sich an mich, rieb sein Becken gegen meine Rückseite und flüsterte mir ins Ohr, er habe mich vermisst. Ich habe so getan, als würde ich tief schlafen. Ich konnte seine Nähe an diesem Abend nicht mehr ertragen.
Jetzt berühre ich beiläufig seinen Unterarm, wie um zu sagen: »Ist schon okay«, fahre fort, das Hähnchen in Streifen zu schneiden, und beantworte seine Frage: »Es war eigentlich wie immer. Aber einen Tag länger hätte ich meine Mutter nicht ertragen«, stöhne ich.
Flo kichert und sieht zu, wie ich das Gemüse und das Fleisch in den Wok schmeiße. Auf seinem Gesicht breitet sich eine Mischung aus Faszination und hungriger Vorfreude aus.
Ich ergreife diese Gelegenheit, um ein Thema anzusprechen, das mir unter den Nägeln juckt, seit ich ihn eben in voller Pracht in seinem Arbeitszimmer gesehen habe.
»Sag mal, war das T-Shirt nicht schon mit einem Bein in der Altkleidertonne?« Ich erinnere mich nur zu gut daran, dass ich dieses Exemplar bei unserem Umzug in einen blickdichten schwarzen Sack für Altkleidersachen gepackt habe, weil es unter dem Kragen voller Löcher und an den Säumen ausgefranst ist.
Flo hat mir beim Einrichten unserer gemeinsamen Wohnung bis auf Kleinigkeiten die Oberhand überlassen. Es war ihm egal, welche Farbe die Wände oder welche Form die Sessel haben. Wichtig war ihm nur, dass sein Arbeitszimmer so ist, wie er es will. Und da mir klar war, dass ich diesen Raum nur ab und an betreten werde, um zu lüften und um nach längerer Abwesenheit nachzusehen, ob Flo überhaupt noch lebt, durfte er dort walten, wie es ihm beliebte.
Offenbar hatte er aber bemerkt, dass ich heimlich einige Relikte aus seinem Kleiderschrank entsorgt habe. Flo hat eine beachtliche Sammlung an Band- und Motto-Shirts. Neben Wacken 2007 hat er auch Andenken aus den Jahren 2008 bis 2016 von diesem Festival mitgebracht. Er besucht das bekannte Metal-Event jedes Jahr mit alten Freunden aus der Schulzeit. Dabei mag Flo die Musikrichtung nicht einmal besonders. Die Jungs fahren nach Wacken, um drei Tage lang zu zelten, Bier zu trinken und Gras zu rauchen. Und um ein T-Shirt zu kaufen, natürlich.
»Ja, aber daran hängen wertvolle Erinnerungen. Das kannst du nicht einfach wegschmeißen!«
Wahrscheinlich hat er recht damit. Nur weil wir jetzt zusammenleben, habe ich noch lange nicht das Recht dazu, seine Garderobe zu bestimmen. Aber das labbrige, verbeulte Ding ist zehn Jahre alt!
»Und wie war die Heimfahrt?«, fragt Flo.
Für einen Moment bin ich wirklich versucht, ihm zu erzählen, dass ich mir den Corsa ungeplant mit einem Möbeldesigner und seinem Hund geteilt habe, der so groß war wie ein Kalb, und dass dieser mir fast einen Haufen auf die Rückbank gesetzt hätte. Der Hund, nicht der Designer. Dass sein Herrchen frischgebackener Single ist und dieselben Serien mag wie ich. Dass wir uns die ganze Fahrt über blendend unterhalten haben. Dass er die drei Stück von Mamas Kuchen gegessen hat. Dass er wirklich ziemlich gut in seiner Lederjacke ausgesehen hat. Dass ich es noch nie so genossen habe, fünf Stunden mit einem Fremden zuzubringen. Dass ich zum ersten Mal bei einer Fahrt so abgelenkt war, dass ich bis zum letzten Tropfen Sprit gefahren bin. Dass das Leons Schuld war. Dass ich mich frage, wo Leon wohl unterkommt, ob er sich wieder einlebt, ob er eine Wohnung findet, ob er seinen Betrieb hier gut starten kann, ob er bleibt, ob er sich eines Tages wieder mit seiner Exfreundin vertragen wird und zurück nach Hamburg geht, ob wir uns irgendwann mal über den Weg laufen. Und wie wir uns dann begrüßen. Ob wir in entgegengesetzte Richtungen blicken, obwohl wir uns ganz genau gesehen haben, aber beide entscheiden, dass wegschauen einfacher ist.
Aber stattdessen sage ich nur: »War okay. Hab nur ein bisschen länger gebraucht.«
Flo reagiert, wie ich es erwartet habe: »Cool.«
Die Kofferraumproblematik
14. Mai, Kilometer 0
Nachdem ich Leon oder vielmehr dem Hund mit einem tiefen Blick in dessen treue bernsteinfarbene Augen versprochen habe, ihn auf die knapp fünfhundert Kilometer lange Reise mitzunehmen, setzt das Zögern ein.
Ich werfe einen Blick auf meinen Opel Corsa.
In der Werbebroschüre des Pkw steht sicherlich nirgendwo beschrieben, dass er sich bestens eignet für lange Fahrten mit Hunden, die ein Stockmaß von knapp siebzig Zentimetern haben. Was ist das überhaupt für eine Rasse? Handelt es sich bei dem Knaben mit dem glänzenden rotbraunen Fall vielleicht um einen Kampfhund, der mir während der Fahrt die Kopfstützen der Rücksitze abkaut? Ist er stubenrein oder vielmehr: kleinwagenrein? Übersteht das Tier fünf Stunden auf so engem Raum? Überstehe ich das? Ist es Leons Hund, oder hat er ihn nur zur Pflege? Und wenn es sein Hund ist, wieso kam es für ihn dann so überraschend, dass er ihn mitnehmen muss? Gehen Flecken von Hunde-Pipi eigentlich wieder raus?
Ich merke, wie die Anwesenheit des Tieres mich langsam, aber sicher aus dem Konzept zu bringen droht. Ich will weder Geld noch kulinarische Gegenleistungen dafür, dass der Hund mitfahren darf. Stattdessen würde ich gerne eine Garantie ausgestellt bekommen, dass das Tier meinen Plan nicht ruiniert. Und auch nicht die Inneneinrichtung meines Autos.
»Ist er …? Ich meine: Muss er nicht zwischendurch mal aufs Klo? Also aufs Hundeklo?«
»Er kackt dir bestimmt nicht in den Kofferraum, falls du das fragen willst.«
»Ja, ich denke, das wollte ich fragen.«
Ich öffne die Klappe des Kofferraums. Sein Ladevolumen hat sich bisher für Taschen, Wocheneinkäufe und kleinere IKEA-Besuche immer als vollkommen ausreichend erwiesen. Aber jetzt mustere ich Dexter, der schon wieder sehr interessiert an meinem Intimbereich schnuppert, und bin mir ziemlich sicher, dass das nicht funktionieren wird. Auch nachdem ich den Kofferraumdeckel entfernt und meinen Trolley herausgehoben habe, wird meine Einschätzung nicht besser. Dexter passt da nicht hinein. Niemals. Und falls ich ihn doch dort hineinzwänge, handle ich mir sicherlich Probleme mit Peta ein.
»Ich vermute, er kackt, wenn überhaupt, auf die Rückbank«, resümiere ich.
»Da hast du wahrscheinlich recht. Ich meine …! Nein!« Leon greift sich besorgt an die Nasenwurzel und sagt zu sich selbst: »Großartige Reaktion, Kumpel!« Dann lächelt er mir gewinnend zu und erklärt: »Ich garantiere dir, er kackt nirgends hin. Er kennt es, auf der Rückbank zu sitzen. Er fährt total gerne mit dem Auto. Er legt sich hin und schlummert sofort ein. Wir könnten auf der Hälfte der Strecke eine kleine Pause für ein Sicherheits-Gassigehen einlegen, wenn das okay ist.«
»Ähm, na klar. Sicherheits-Gassigehen klingt gut.« Ich lächle zögerlich.
Etwas an Leons freundlichem Gesicht überzeugt mich. Es könnten seine strahlend blauen Augen sein, die es beinahe unmöglich machen, ihm einen Wunsch abzuschlagen. Aber schlussendlich siegt auch meine Menschlichkeit. Ich kann ihn ja schlecht mit dem Hund hier am Hauptbahnhof stehen lassen – vor allem nicht, nachdem ich bereits versprochen habe, die beiden mitzunehmen.
»Dann wollen wir mal«, schlage ich vor und werfe einen letzten kritischen Blick auf die Uhr. Zweiundzwanzig nach zwei. Das Sicherheits-Gassigehen mit einkalkuliert, wird sich unsere Ankunft in Frankfurt mindestens um eine halbe Stunde verzögern.
»Super! Danke! Das wirst du definitiv nicht bereuen.« Leon schwingt den Wanderrucksack von der Schulter und verstaut ihn. »Dexter ist der liebste Hund der Welt. Und wenn wir halten, geht dein Kaffee auf jeden Fall schon mal auf mich.«
»Das ist lieb«, sage ich, während ich die Fahrerseite besteige, und denke gar nicht daran, das Angebot aus Höflichkeit auszuschlagen. Ein Kaffee ist doch eine nette Aufmerksamkeit dafür, dass ich bereit bin, mein Auto den Exkrementen seines Hundes auszusetzen – und wesentlich bescheidener als das eben noch versprochene Fünf-Gänge-Menü ist es auch.
Die Matuschek’sche Mediationsmethode
22. Mai, Frankfurt-Ostend
Ich genieße es, immer ein paar Minuten früher im Büro zu sein. Zum einen ist die Straßenbahn noch nicht so voll, wenn ich bereits um kurz vor acht losfahre, zum anderen kann ich meine Gedanken ein wenig sortieren, bevor das große Chaos losbricht.
SCHMITT+MATUSCHEK sitzt im sechsten und siebten Stock eines großen Bürogebäudes im Frankfurter Ostend. Im Erdgeschoss befindet sich ein Autohaus, das neue und gebrauchte Kia- und Hyundai-Wagen verkauft, die anderen Etagen nimmt eine Firma ein, die sich mit Datenverarbeitung beschäftigt. Es ist eines dieser alten Industriegebäude mit vier Meter hohen Decken und Wänden aus blankem Beton und Stein, die man aus stylischen Gründen unverputzt belassen hat. Die Büroräume von SCHMITT+MATUSCHEK sind so eingerichtet wie viele Werbeagenturen, die etwas auf sich und auf Designermöbel halten: Eames-Stühle in den Konferenzräumen, USM-Sideboards in den Chefbüros und großblättrige exotische Zimmerpflanzen im Empfangsbereich.
Mein Büro liegt im unteren der beiden Stockwerke. Ich teile mir den eher kleinen Raum mit Sarah, die vis-à-vis von mir sitzt, und einem weiteren Kollegen, dessen Schreibtisch ein wenig von unserem Doppel entfernt steht. Pierre-Holger Schwarzbrod ist nicht grade stark darin, sich zu unterhalten, Augenkontakt herzustellen oder sonst etwas zu tun, was für Zwischenmenschlichkeit wichtig ist. Seine Sozialschwäche ist wohl der Grund, warum Pierre-Holger es vorzieht, mit dem Rücken zu uns zu sitzen und vor sich nichts als zwei Computerbildschirme und die weiße Wand zu haben. Nicht ein Blatt Papier bedeckt seinen perfekt aufgeräumten Schreibtisch. Lediglich eine schnurlose Tastatur, eine kabellose Maus und ein Kugelschreiber in einem Becher mit Turtles-Aufdruck befinden sich darauf. Alle Utensilien sind so ausgerichtet, dass sie in rechten Winkeln und Parallelen zueinanderliegen. Nachdem Pierre-Holger die Ordnung morgens nach seinem Eintreffen zwei- oder dreimal zerstört vorgefunden (der Stift lag nur noch im Siebenundachtzig-Grad-Winkel zur Maus) und daraufhin einen kleinen Zusammenbruch erlitten hatte, setzte sich unser Chef dafür ein, dass das Reinigungspersonal seinen Platz nicht mehr berühren darf. Was eh überflüssig ist, da Pierre-Holger seinen Schreibtisch mehrmals am Tag selbst reinigt.
Man munkelt, dass die Chefetage den spleenigen, aber eigentlich herzensguten jungen Mann nur deshalb mit zwei Tratschtanten wie uns in ein Büro gesetzt hat, damit er irgendwann von selbst kündigt. Dass Sarah und ich jeden Tag ein paar Minuten damit zubringen, über unsere Männer zu schimpfen, mit schrecklichen Worten über Frau Knallkopfski herzuziehen oder uns über Schuhe, Filmstars und andere lebenserhaltende Wichtigkeiten zu unterhalten, hat Pierre-Holger aber bisher ziemlich kaltgelassen. Im Gegenteil: Wir haben ihn mittlerweile sogar so weit, dass er ab und an mit uns spricht. Als zum Beispiel die Scheidung von Brad Pitt und Angelina Jolie publik wurde, da trug er zu unserer Diskussion bei: »Ich habe nie verstanden, wieso diese Menschen so viele Kinder haben. Die waren doch sicher nicht oft daheim, um Zeit mit ihnen zu verbringen.« Sarah klopfte mit der Faust auf den Tisch und brüllte: »Vollkommen meine Rede, Pierre! Du hast es raus!« Eigentlich, denke ich, wäre Pierre-Holger ein guter Charakter in unserer eigenen Ausgabe von The Office.
Wie jeden Morgen sortiere ich vier Stapel auf meinem Schreibtisch: Einen »Erledigt«-Stapel, mit beendeten Aufgaben, die ich nur zur Sicherheit und aus Aberglaube nicht direkt ad acta lege, einen »Von mir aus erledigt, aber nicht fertig«-Stapel mit Jobs, die von meinem Schreibtisch auf einen anderen gewandert sind, von mir aber geprüft und nachgefasst werden müssen, einen »To-do«-Stapel mit Aufgaben für den bevorstehenden Tag und einen längerfristigen »To-do«-Haufen.
Ich fahre meinen Computer hoch und starte das E-Mail-Programm und den Kalender. Sofort verkünden mir mehrere laute Ping-Töne, dass einige Termine für den heutigen Tag anstehen. Patrick Matuschek muss bereits heute Morgen um sieben ein Meeting für zehn Uhr eingestellt haben – das zumindest sagt Outlook. Der Creative Director legt viel Wert darauf, dass alle mitkriegen, dass er sich zu unkonventionellen Uhrzeiten um die Arbeit Sorgen macht. Gerne antwortet er nachts um halb zwei auf E-Mails, die man ihm am Vormittag geschickt hat, besonders gerne, wenn sich dabei ein Geschäftsführer oder ein Kunde auf CC befindet. Auch vom Frühstückstisch oder vom Frühsport versendet er hin und wieder Nachrichten und versieht sie mit Grußzeilen, die eindeutige Hinweise auf seine derzeitige Verfassung geben. »Schweißnasse Grüße aus dem Gym, PM« oder »Mein Green Smoothie ist schon grün vor Neid – bis später, PM«. Heute früh um sieben schrieb er Folgendes:
»Ladys, zehn Uhr zum Mediations-Meeting in meinem Büro. Operation Kanowski. Wir werden die Pappschachtel schon handeln. Ich widme mich nun wieder meinem Morning-Yoga. Namaste, Girls! PM.«
Ich hoffe stillschweigend, dass PM bei seinen Yoga-Verrenkungen nicht der Clown wieder hochkommt, den er offenbar zum Frühstück verspeist hat.
Als ich das nächste Mal hochsehe, erschrecke ich mich vor Pierre, der ohne den leisesten Ton hereingekommen sein und sich an seinem Platz niedergelassen haben muss.
»Oh! Guten Morgen, Pierre! Alles gut?«
Er nickt, ohne mir den Kopf zuzuwenden oder meinen Gruß zu erwidern. Aber für Pierre ist ein Nicken eigentlich schon ein Zeichen der Zuneigung.