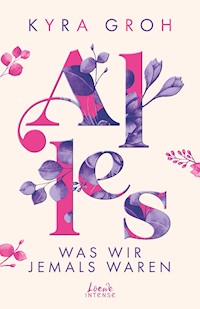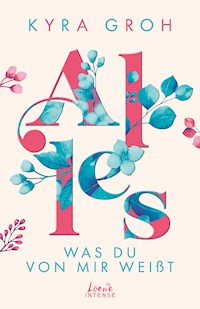4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Liebe geht über die Treppe: Auf gute Nachbarschaft und ein Happy End! Felicitas, genannt Feli, ist ein bisschen kompliziert, zugleich Chaosqueen und Gewohnheitstier. Trotz Anglistik-Studium (nicht auf Lehramt) besitzt sie mit ihren 20 Jahren nicht mal ein Bücherregal. Und sie schämt sich auch nicht dafür, dass sie süchtig nach dem Sat1 "Family Movie" am Dienstag ist, den sie keine Woche verpasst. Denn wenn es im echten Liebesleben schon nicht läuft, dann kann sie sich wenigstens auf das Fernseh-Happyend verlassen. Bis sie eines Tages ihrem neuen Nachbar Janosch vor die Füße fällt, der zwar rein äußerlich Traummann-Potential hat, aber unhöflich und sarkastisch ist. Und so fängt sicher keine große Liebesgeschichte an, oder?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Ähnliche
Pinguine lieben nur einmal
Die Autorin
Kyra Groh wurde 1990 in Seligenstadt am Main geboren. Nach einem kleinen Umweg über die Uni Gießen, verschlug es sie 2012 nach Frankfurt, wo sie Trambahnen, Apfelwein und Supermärkte, die bis Mitternacht geöffnet haben, zu schätzen lernte. Sie behauptet gerne, neben dem Schreiben keine weiteren Talente zu haben – daher veröffentlicht sie nicht nur seit einigen Jahren humorvolle Liebesromane, sondern treibt auch hauptberuflich als Texterin ihr Unwesen. Sie hat eine Schwäche für gutes Essen, Instagram und Bilder von gutem Essen auf Instagram. Außerdem liebt sie Schachtelsätze, Erdnussbutter, Netflix und – aus Gründen, die ihr selbst manchmal schleierhaft sind – Sport.
Das Buch
Felicitas, genannt Feli, ist ein bisschen kompliziert, zugleich Chaosqueen und Gewohnheitstier. Trotz Anglistik-Studium (nicht auf Lehramt) besitzt sie mit ihren 20 Jahren nicht mal ein Bücherregal. Und sie schämt sich auch nicht dafür, dass sie süchtig nach dem Sat1 „Family Movie” am Dienstag ist, den sie keine Woche verpasst. Denn wenn es im echten Liebesleben schon nicht läuft, dann kann sie sich wenigstens auf das Fernseh-Happyend verlassen. Bis sie eines Tages ihrem neuen Nachbar Janosch vor die Füße fällt, der zwar rein äußerlich Traummann-Potential hat, aber unhöflich und sarkastisch ist. Und so fängt sicher keine große Liebesgeschichte an, oder?
Von Kyra Groh sind bei Forever erschienen:Mitfahrer gesucht - Traummann gefundenGar kein Plan ist auch eine LösungHalb drei bei den ElefantenTage zum SternepflückenPinguine lieben nur einmal
Kyra Groh
Pinguine lieben nur einmal
Roman
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Neuausgabe bei ForeverForever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinApril 2020 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2020Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®Autorenfoto: © privatE-Book powered by pepyrus.com
ISBN 978-3-95818-558-6
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
1. Akt:
Exposition
Cem findet Ramadan doof
Ich bin kompliziert
Beste Freundin
Holterdipolter
Mir ist wenig peinlich
Entschuldigung sagen
Mama
Entschuldigung sagen, Klappe, die Zweite
Mein Gehirn nervt
Du machst eine Party, wie nett von dir
Ich kann wirklich nicht flirten
Wir tanzen auf den Tischen, die Stimmung ist beschissen
Gelesen von Rufus Beck
Ich hätte gerne Tee
2. Akt:
Steigen der Handlung
Nicht mal verliebt lassen sie einen sein
Gefühlssachen
Kaffee und Mandarine
Schlecht gelaunt
Na ja, vielleicht ist die Welt doch gar nicht so blöd
Fast hätte ich vergessen, dass ich hungrig bin
Ich habe echt viele Vorurteile
Ausschauhalten
Zeit kann so lange dauern … aber auch so kurz
Depressive Playlist
Ambulanz
Tonight we can truly say
Wo keine Krise, da keine Krisensitzung
Fühlen ist das A und O
Acht ist so … was ist acht eigentlich?
Der Vorleser im wahrsten Sinne
3. Akt:
Höhepunkt
Okay, Feli … was willst du?
Besetzung
Erklärungsnot
Ernst und sarkastisch vs. nett und lustig
Ich hatte schon vergessen, wie schön das ist
Unternehmen, irgendwas, ich entscheide
Sieeeeben
Jetzt sag schon
Mal wieder Simon
Komplimente
Kopflosigkeit
Home sweet home
Hallo … Feli … citas … Nein, nicht auf Lehramt … Er wohnt unter mir
Karo Sieben und Herzdame
4. Akt:
Peripetie mit retardierendem Moment
Ein Geschenk für Janosch?
Papa
Was tun? Simon anrufen!
Sogar mit Plätzchen
Oder eben doch
Die beste Strategie: Einfach mal die Klappe halten
Chaos bleibt Chaos bleibt Chaos
Ich tanze gleich nackig aufm Tisch
Zwei Schweden, drei Stunden und vier Zigaretten später
Showdown, oder: Ich kann es eben nicht für mich behalten
5. Akt:
Katastrophe
Vielleicht sollten wir es lieber lassen
Vielleichtsolltenwireslieberlassen.
Leiden fühlt sich im Moment sehr viel besser an
21. Dezember – 3 Tage bis Weihnachten, 10 Tage bis Silvester (= Janoschs Geburtstag): Wo sind die Taschentücher?
22. Dezember – 2 Tage, 9 Tage: Ein Gespräch mit Mama
23. Dezember – 1 Tag, 8 Tage: Ich will ein Pinguin sein
Ich wünsche mir vom Christkind, ein Pinguin zu sein.
24. Dezember – 0 Tage, 7 Tage: Männer sind auch Menschen, Männer sind etwas sonderbar
Für einen Moment war alles so einfach
27. Dezember – 4 Tage: Ein Ziel muss her
Routine durchbrechen
Ähm??? Cemobulus?
31. Dezember: Hupsi
Jetzt
Baden gegangen
Epilog
Anhang
Leseprobe: Gar kein Plan ist auch eine Lösung
Empfehlungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Prolog
Natürlich weiß ich, dass Beziehungen nie so sind wie im Fernsehen. Das nur mal vorweg.
Ich muss gestehen, dass ich sehr gerne fernsehe. Und ich schaue viel zu oft ziemlich großen Mist. Eines habe ich dabei aber gelernt: Produzenten und Drehbuchautoren jubeln uns immer wieder solche Beziehungen unter, von denen wir hoffen, dass wir sie eines Tages erleben werden.
Besonders der Anfang dieser Beziehungen läuft in romantischen Komödien stets nach Schema F ab. Die Erforschung besagten Schemas beschäftigt mich mehr oder weniger bewusst seit etlichen Jahren. Na ja. So etlich, wie Jahre eben sein können, wenn man zwanzig ist.
Besonders gerne gucke ich Sendungen und Filme, die ich mit grausamem Humor Bildungsfernsehen zu nennen pflege und die dem menschlichen Hirn alles zufügen, nur keine Bildung. Die Privatsender zeigen sie am liebsten zur Prime Time, damit möglichst viele kitschverwöhnte Frauenherzen zusehen, mit den falschen Idealen gefüttert werden und sich Hoffnungen darauf machen, dass auch ihnen eines Tages eine formvollendete Liebesgeschichte widerfährt. Sat.1 ist ein wahrer Spezialist in Sachen Kitschfrauenverwöhnung. Jeden Dienstag läuft ein sogenannter Family Movie, der an Klischees und Schnulz und – ja, ich gebe es zu – an neidischen Seufzern meinerseits kaum zu überbieten ist.
Darin halsüberkopfen sich Zimmermädchen und Millionäre, oder alleinerziehende Mütter von Samenbankzwillingen vergucken sich mit einer zeitlichen Verspätung von sechzehn Jahren in die Erzeuger ihrer Kinder. Die Filme haben dann poetische Namen wie Noch ein Wort und ich heirate dich! und jagen mir grausige und wohlige Schauer zugleich über den Rücken.
So gerne ich diese Formate auch schaue, sie regen mich dermaßen auf, dass ich regelmäßig vor dem Fernseher sitze und Selbstgespräche führe. Aber Unterhaltungen mit mir selbst sind oft unausweichlich, weil mein Mitteilungsbedürfnis nun mal sehr groß und nicht immer ein Gesprächspartner in Reichweite ist.
Natürlich sorgen die Filme dafür, dass meine Anforderungen an Männer, Beziehungen und romantische Taten ins Unermessliche wachsen. Allein deshalb sollte ich sie lieber nicht gucken. Aber ich mag sie. Sie sind so schön … berechenbar. Trivial und berechenbar – aber mir gefällt es nun mal, wenn alles so läuft, wie ich es haben will.
Schon um 20.13 Uhr weiß ich, wie mein Dienstagabendfilm verlaufen und ausgehen wird. Das erspart mir böse Überraschungen. Mal ehrlich: Würde das blöde Kindermädchen den seitengescheitelten Millionär nicht bekommen, dann würde ich es in Betracht ziehen, den Sat.1-Pro7-Konzern wegen seelischer Grausamkeit zu verklagen oder den Programmdirektor mit einer Axt zu bedrohen.
Ich brauche die Gewissheit, dass trotz vorhersehbarer Schwierigkeiten, unlogischer Handlungsstränge und trivialer Streitigkeiten am Ende alles gut wird.
Ich weiß, wie diese Filme funktionieren, das lässt in mir eine innere Ruhe entstehen, die verhindert, dass ich beim Fernsehgucken in Tränen ausbreche. Denn das passiert mir oft. Ich muss weinen, wenn ein deutscher Gewichtheber seiner verstorbenen Frau eine olympische Goldmedaille widmet, wenn Kai Pflaume indische Mütter und amerikanische Väter aus der Versenkung holt oder wenn Thomas J. in My girl – Meine erste Liebe stirbt, obwohl er doch Artist werden wollte.
Alles nur, weil ich nicht schon vorher wusste, wie es endet. Ich konnte ja nicht ahnen, dass dieser Sportler Gold holt. Ich konnte nicht sicher wissen, dass das verschollene Familienmitglied vom Nur-die-Liebe-zählt-Caravan gefunden wird, und ich verlange von einem Jugendfilm, dass alles mit einer großen Party und Kerzen und Torten und Einhörnern endet – und nicht mit einem toten Macaulay Culkin.
Beim Sat.1-Family-Movie bin ich vor solchen televisionären Überraschungen sicher.
Der Grund ist folgender: Alle Filme laufen nach demselben Schema ab. Dabei sind die Macher nicht wirklich innovativ, denn das Sat.1-Prinzip hat sich ein alter Grieche namens Aristoteles ausgedacht, und seit jeher sind Dramatiker von der Wirkung dieses Prinzips überzeugt.
Der Aufbau des klassischen Dramas lässt sich fast ohne Umschweife auf Liebesschnulzen übertragen.
Es fängt an mit dem ersten Akt. Der EXPOSITION. Meister Aristoteles, Schiller und Konsorten wollen, dass darin alle Figuren, Konflikte und Beziehungsstrukturen vorgestellt werden. Fein. Wird auch beim Fernsehfilm so gemacht. Von Viertel nach acht bis circa zwanzig vor neun werden wir in die Handlung eingeführt, lernen die Hauptpersonen kennen und erfahren, wie sie zueinander stehen. Wir lernen den Protagonisten kennen, von dem wir wissen, dass er am Ende des Films mit der zweiten Hauptperson zusammen sein wird, und wir werden seinem oder ihrem Widersacher vorgestellt, von dem wir zwischenzeitlich denken werden, dass er eventuell doch das Rennen um das Herz des Protagonisten machen wird.
Im zweiten Akt, der circa bis halb zehn geht, steigt die HANDLUNG. Wir erfahren, wie die Personen so miteinander umgehen, wir bekommen mal lustige, mal dramatische Konfrontationen zwischen den baldigen Lebensgefährten mit, wir amüsieren uns zwischenzeitig, können aber auch erahnen, was früher oder später zu Streit führen wird: Wir sehen dabei zu, wie der Millionär dem Zimmermädchen seinen Reichtum verschweigt, oder bemerken, dass der Zwillingserzeuger krumme Dinger am Laufen hat.
Im unausweichlichen dritten Akt kommt nach dem klassischen Ideal der HÖHEPUNKT. Im Film ist das jetzt ganz körperlich zu nehmen. Gegen halb zehn kommt es nämlich zu ersten körperlichen Annäherungen, und je nach Wagemut des Regisseurs erwartet uns eine mehr oder weniger große Portion Sex.
Akt vier beginnt zwischen zwanzig und zehn vor zehn. Alle Seifenblasen zerplatzen, Ungesagtes fliegt auf, sämtliche Karten kommen auf den Tisch. Aus gegebenem Anlass wird gestritten. Ein bisschen Eifersucht, ein bisschen Fremdgehen – die Palette an Gestaltungsmöglichkeiten für den vierten Akt, für die PERIPETIE inklusive RETARDIERENDEM MOMENT (der Verzögerung der Handlung), ist unendlich groß.
Zu Beginn des fünften Aktes macht es dann kräftig Knallbumm. Die Liebenden wollen sich nie wiedersehen und leiden darunter, denn eigentlich wollen sie es doch. Die klassische KATASTROPHE sieht normalerweise den absoluten Showdown vor, das Grande Finale, den Tod einer Hauptperson, aber zugleich die seelische und moralische Überlegenheit des Protagonisten. Beim Family Movie gestaltet sich die KATASTROPHE ein wenig optimistischer, es gibt ein bisschen mehr Kuchen, dazu lustige Hüte, rosa Blümchen und vielleicht sogar Ponys. Die Verliebten vertragen sich am Ende nämlich immer, verzichten für den Partner auf geile Jobs, große Geldsummen oder etwas ähnlich Lukratives.
Am Ende, um Viertel nach zehn, haben sich dann alle lieb. Als Zuschauer redet man sich ein, dass sie augenblicklich, noch während man selbst die paar Minuten bis zur ersten Werbepause der anschließenden Sendung Akte guckt, Kinder machen, Golden Retriever züchten, Ferienhäuser kaufen, Bäume pflanzen und sich ewig lieben werden.
Ich mag meine Sat.1-Idylle, weil ich immer vorhersagen kann, was geschehen wird. Denn leider kommt es nicht oft vor, dass die Dinge so passieren, wie ich das gerne hätte. Ich mag diese Harmonie, ich mag Märchenwelten.
Eigentlich dachte ich, dieser Startschuss in ein Und-wenn-sie-nicht-gestorben-sind-dann-leben-sie-noch-heute-Leben, in eine Prinzessinnen-und-Prinz-auf-weißem-Ross-Beziehung existiere nur im Fernsehen.
Bevor ich Janosch kennengelernt habe, war ich vollkommen zufrieden damit, einmal die Woche zwei Stunden lang die Zeit vor dem Zubettgehen mit ein wenig stumpfsinniger Zauberstaubidylle zu überbrücken. Denn ich wusste, dass die schönen, nicht unbedingt bildenden Hundertzwanzigminüter in meiner Flimmerkiste eingesperrt sind und auch drinbleiben. Ich wusste, dass Beziehungsanfänge nicht in diesen fünfaktigen aristotelischen Rahmen zu pressen sind. Ich wünschte es mir, wie jede Zuschauerin, aber ich glaubte nicht wirklich daran.
Doch dann stolperte ich in Janoschs Leben – und zwar buchstäblich, ich bin nämlich furchtbar trottelig – und stellte fest, dass auch das echte Leben aristotelisch sein kann. Mit der Ausnahme, dass sich das echte Leben nicht in einen Rahmen pressen lässt.
1. Akt:
Exposition
Wer auftritt … in order of appearance, damit keiner traurig ist.
Ich erdreiste mich jedoch, mich selbst zuerst zu nennen.
FELICITAS GRÜN Das bin ich. Eine zwanghafte Chaotin.
CEM DEMIREL Mein Mitbewohner. Ein hungriger Saftdieb.
SOPHIE Meine beste Freundin. Eine alleswissende Schuhfetischistin.
SIMON Simon eben. Ein Zahnpastamodel mit Helfersyndrom.
JANOSCH WINTER Mehr als bloß ein Gegenüber. Ein genervter Nasenbrecher.
MAMA Ähm … ja. Man glaubt es kaum: meine Mutter.
KIRSTEN Meine andere beste Freundin. Eine Stimme der Vernunft, aber nicht immer.
STEFFI Die von nebenan. Eine paarungswillige Gastgeberin.
AUSSERDEM:
HMB – ein verkleidetes Skelett; ein italienischer Eisverkäufer mit akzentfreiem Deutsch; Zylindermännchen und Wahrheitsmännchen; Mirko – der neue Mitbewohner; ein kahl geschorener Gangsterrapper; mein Papa, mein Bruder und meine Oma.
SPECIAL GUESTS:
Rufus Beck – das beste Schlafmittel der Welt; Harry Potter, Ron Weasley, Neville Longbottom und Mad-Eye Moody, außerdem eine Spinne; Brad Pitt und die eine oder andere Angelina; Charles Darwin; Tine Wittler; Ray Charles; Janis Joplin; Deichkind – und sie machen gewaltig Remmidemmi; Hape Kerkeling; Benjamin Lebert mit Tom Schilling und Robert Stadlober im Schlepptau; der Tigerenten-Janosch; Arnold Schwarzenegger; sublustige Menschen; Winnie Puh; Katja Epstein, Freddie Prinze Junior; Daredevil.
Cem findet Ramadan doof
»Ich hasse dich«, lässt mich Cem zum wiederholten Male wissen.
»Ich weiß«, sage ich ihm. Ich habe es im vergangenen Jahr ertragen, dass mich Cem eine Mondsichel lang gehasst hat, also werde ich es auch dieses Jahr verkraften.
»Ich meine, ernsthaft, Feli, ich hasse dich. Heute besonders doll!«
»Ja, ich weiß. Ich komm damit klar.« Auch gestern hat er mich besonders doll gehasst. Ich beiße herzhaft in meinen Chickenburger.
»Ist es schon dunkel?«
»Cem, es ist erst sechs.«
»Um sechs ist es dunkel.«
»Ja, im November vielleicht, aber nicht Ende August.«
»Ich sterbe.«
»Du bist theatralisch.«
»Nein, wirklich. Ich. Sterbe.«
Cem stirbt seit letzter Woche jeden Tag. Oft auch mehrfach täglich. Und wenn er nicht gerade stirbt, dann schaut er auf die Uhr oder aus dem Fenster. Cems Definition von Dunkelheit hat sich seitdem drastisch verändert.
»Ich finde, es ist ziemlich dunkel.« Er zieht die Küchenvorhänge ganz auf, um den zartblauen Himmel zu kontrollieren. »Wirklich. Ziemlich dunkel. Es ist echt erst sechs? Du musst dich irren.«
Ich schüttele den Kopf und wickele den halb aufgegessenen Burger wieder in das Papier. »Ich lass dir das übrig, okay?«, frage ich ihn.
Er kniet vor mir nieder, küsst meine Hände und preist: »Oh, oh Feli, ich liebe dich.«
Auch das weiß ich. Cem hat es sehr gerne, wenn ich ihm etwas zu essen übrig lasse, weil das nicht oft vorkommt. Ich esse nämlich gerne (auch gerne mal zu viel) und fürchte deswegen immer, man könnte mir etwas wegfuttern.
Ich steige über Cem hinweg, der auf dem Boden kauernd die eingepackte Kalorienbombe fixiert und auf die Dämmerung wartet, und durchforste den Kühlschrank. Irgendwie habe ich ein gespaltenes Verhältnis zu Kühlschränken. Ich mag sie, weil sie meine Leidenschaft fürs Essen unterstützen, gleichzeitig hasse ich sie aus ebendiesem Grund. Außerdem hasse ich, dass man darin nie etwas findet, das zu einem gewissen Zeitpunkt eine gewisse Lust befriedigt. Noch mehr hasse ich sie, wenn sie leer sind.
»Haaalloo«, rufe ich in den Kühlschrank und erwarte ein Echo. »Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn mein Saft?« Ich krieche fast in den Kühlschrank. Hinter mir höre ich Cem »Ich war’s nicht« murmeln.
Wütend drehe ich mich zu ihm um und explodiere. »Du hast meinen Saft getrunken! Dabei weißt du genau, dass ich das nicht ausstehen kann. Das bringt alles durcheinander. Ich kaufe immer so viel Saft, dass es für eine Woche reicht. Jetzt geht das Konzept nicht auf. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich etwa schon am Donnerstag einkaufen gehen?«
Cem sieht mich schuldbewusst an und grummelt: »Ich hab mir extra heute den Wecker auf fünf gestellt, weißt du, und dann hatte ich solche Lust auf deinen Saft. Ich kauf dir neuen, ehrlich.«
»Nein«, bocke ich und lasse mich mit einer doofen Flasche Wasser auf meinen Stuhl plumpsen.
Cem betrachtet abwechselnd den Burger und die Farbe des Himmels.
»Iss ihn halt, verdammt noch mal!«
»Nein.«
»Warum nicht?«
Ich werde mit dem Weil-Ramadan-ist-Blick beäugelt, den ich dieser Tage sehr häufig auf mir spüre.
Zu Beginn wollte ich Cem unterstützen und habe ihm versprochen, mit ihm zusammen zu ramadanen. Aber es war einfach zu schwierig für mich, da ich sehr gerne Nahrung zu mir nehme, ohne mir den Wecker stellen zu müssen, und weil ich tagtäglich den kompletten Sündenkalender abklappere: Ich lüge, ich fluche, ich trinke viel Koffein und hin und wieder Alkohol.
Kurzum: Ich habe keine fünf Stunden durchgehalten. An meinem ersten Ramadan-Tag war ich mittags um zwei so unausstehlich, dass mich Cem zum Essen eingeladen hat. Das heißt, ich habe gegessen und getrunken, als gäbe es kein Morgen. Er hat mir dabei zugesehen und sich fremdgeschämt.
»Okay, Cem, warum machst du überhaupt beim Ramadan mit? Kann doch eh keiner kontrollieren. Du gehst ja nicht mal in die Moschee, warum quälst du dich dann so?«
»Es ist eine religiöse Pflicht für alle Muslime. Und ich bin Moslem, Feli.«
»Na und? Ich bin katholisch und mache auch keinen Katholikenquatsch mit.«
»Du feierst doch Ostern, oder?«
»JA«, sage ich mit Nachdruck, »Ostern ist auch total super.«
»Ist aber eine christliche Tradition, und du machst sie mit, obwohl du das letzte Mal in der Kirche warst, als du behauptet hast, dass du dich traust, einen Becher voll Weihwasser zu stehlen.«
»Das hab ich auch gemacht!«, betone ich meinen Heldenmut. Allerdings hat mich eine sehr gläubig aussehende Omi kritisch dabei beobachtet, weshalb ich mich damit gerechtfertigt habe, dass ich gerne einen kleinen Vorrat daheim habe. Schließlich wisse man nie, wann man mal eine Nottaufe durchführen müsse. »Außerdem ist das was ganz anderes. An Ostern gibt es hasenweise Schokolade.« Ein triftiger Grund, dieses Fest gebührend zu feiern!
Cem verzieht die südländerbraune Stirn. »Ja, weil ihr Christen eure Feste immer sehr frei interpretiert.«
»Dann interpretiere deinen Ramadan auch frei und iss den Burger. Ist doch sowieso egal. Allah hat dich längst auf dem Kieker.«
»Allah? Mich auf dem Kieker? Warum?«
»Ich weiß auch nicht so recht, aber ich glaube, mit Sex vor der Ehe hat der Gute es eher nicht, oder?«
»Das gilt nur für Frauen.«
Ich hebe die Augenbrauen und spare mir einen Kommentar zum Thema Emanzipation.
»Aber Homosexualität ist voll sein Ding, oder wie?«
»Ich … äh … nein. Sei still. Meine Sexualität und meine Religion sind zwei verschiedene Dinge. Ich ziehe den Ramadan durch, ob dir das passt oder nicht.«
»Es passt mir super. Nur wage es, dich noch einmal an meinem Saft zu vergreifen. Dann gnade dir Gott. Ich meine Allah.«
Ich lasse ihn mit dem verführerisch duftenden Chickenburger in der Küche alleine und gehe in mein Zimmer. »Ich finde es ja auch doof«, höre ich Cem noch sagen, ehe ich die Tür hinter mir zuziehe.
Ich bin kompliziert
Das bin ich wirklich.
Ich bin bestimmt der einzige Mensch, bei dem zwanghaftes Verhalten mit einem unglaublichen Hang zum Chaos kollidiert.
Es ist ein kleines Waterloo, wenn Cem meinen Saft leer trinkt, bevor ich neuen besorgen kann, weil es meine Routine unterbricht. Ich bin ein Gewohnheitstier, deshalb gehe ich jeden Samstag in den Supermarkt und kaufe immer nur den Saft, von dem ich weiß, dass er mir schmeckt. Ich möchte kein Geld für ein anderes Produkt ausgeben, bei dem die Gefahr besteht, dass es meinem Geschmack nur halb oder gar überhaupt nicht entspricht.
Nicht, dass ich Finanzpläne oder so hätte, nein. Ich plane nicht mit meinem Geld. Am Ende meines BAföGs ist meistens noch erschreckend viel Monat übrig, und das beunruhigt mich dann doch hin und wieder.
Anfang Juli – es war schrecklich – war plötzlich überhaupt kein Geld mehr da. Mein Konto war bis auf dreizehn Euro und vierundzwanzig Cent leer gefegt. Ich habe mich nicht getraut, meine Eltern anzupumpen, weil das zu einer Grundsatzdiskussion geführt hätte, der ich nur ein Ende hätte setzen können, wenn ich mir mein Versagen eingestanden hätte. Der Grund für die Ebbe war, dass ich vergessen hatte, beim BAföG-Amt eine Verlängerung zu beantragen. Dessen war ich mir allerdings gar nicht bewusst, also rief ich dort an und regte mich auf. Am Apparat hatte ich den unsympathischsten Menschen dieses Sonnensystems. Der hielt es in keiner Weise für nötig, mich freundlich über mein Säumnis aufzuklären, sondern hackte so lange auf mir herum, bis ich in Tränen ausbrach. Mein Heulanfall brachte ihn derart aus dem Konzept, dass er ganz vergaß, unfreundlich zu sein, und mich prompt zu einem persönlichen Gespräch einlud, bei dem er den Verlängerungsantrag mit mir gemeinsam auszufüllen versprach.
Ich bin extrem unordentlich. Nicht auf die Art unordentlich wie andere Mädchen, die behaupten, es zu sein, sondern wirklich extrem. Ich bin einfach ziemlich faul und bequem, was Sauberkeit betrifft. Ich räume bloß auf, wenn hoher Besuch kommt.
Ich habe sehr viele Bücher, aber nur sehr wenige stehen in Regalen. Sie türmen sich, nach persönlicher Präferenz und Themen sortiert, in meinem ganzen Zimmer, die vielen Favoriten schlafen mit in meinem Bett, um bei Gelegenheit aufgeschlagen und angelesen zu werden.
Außerdem sammele ich CDs und DVDs. Im Gegensatz zu den Büchern sind die Hüllen der Film- und Musiksammlung fein säuberlich nebeneinander in Schuhkartons alphabetisch sortiert. Nichts hasse ich mehr, als wenn das System durcheinander- oder gar eine CD in die falsche Hülle gerät. Das ist ein guter Grund für mich, einen Wutanfall zu bekommen, in dem ich Mütter und Ideologien beleidige.
Außerdem schreibe ich oft und viel. Tagebuch und andere Textchen – alles, was mir so einfällt, möchte ich immer und überall aufschreiben, was dazu führt, dass mein Zimmer mit Post-its beklebt und mit Papierfetzen gepflastert ist. Ich räume diese Wörtersammlungen nicht gerne weg, weil ich Angst habe, sie dann nicht wiederzufinden.
Ordnung macht mir Angst. Meine gut sortierte Bücher- und CD-Sammlung ist dabei die regelbestätigende Ausnahme. Deren Ordnung ist ungemein wichtig für meine Lebensqualität!
Wenn ich etwas mag, will ich davon so viel haben, dass es mir fast zum Hals raushängt.
Seien es Kissen oder Pflanzen oder Bilderrahmen. Ich kaufe, kaufe, kaufe, und wenn etwas kaputtgeht, dann kaufe ich neu, ohne mir darüber Gedanken zu machen. Ich neige dazu, meine Wohnaccessoireskaufsucht und meine Pflanzenmordlust wegzuignorieren.
Ich habe keinen Freund. Nicht mehr. Ich wurde schon zweimal verlassen, aber verlassen habe ich bisher nie. Mein erster Freund wartete bei der Trennung mit dem schlagkräftigen Argument auf, dass ich ihm zu kompliziert sei. Auch dem zweiten wurde ich nach drei Jahren zu anstrengend. Um sich von mir zu erholen, flüchtete er nach dem Abitur nach Kanada, um Französisch zu lernen und Holz zu hacken.
Letztlich brauche ich einen Partner, der die Kompromissbereitschaft besitzt, meine Kompromissunfähigkeit kompromisslos zu akzeptieren, und mir alles durchgehen lässt. Ich weiß, dass das egoistisch ist und natürlich nicht geht. Deshalb bin ich ja auch mein eigenes Ganzes und nicht Teil eines Doppels.
Dass Cem es mit mir aushält, ist bestimmt sein beeindruckendster Charakterzug.
Cem habe ich kennengelernt, als ich letztes Jahr kurz nach der Einschreibung zu meinem ersten Semester ein WG-Zimmer besichtigte. Damals sah ich mir ein Zehn-Quadratmeter-Pupsi-Zimmer an, war frisch getrennt von meinem flüchtigen Kanada-Exfreund, und Cem war einer der drei weiteren Interessenten. Die Anbieter nahmen uns in eine Art Kreuzverhör, das Cem und mir das Genick brach. Seitdem hegen wir Verschwörungstheorien, warum wir für die rein männliche Sportstudenten-WG nicht gut genug waren.
Meine Theorie: Ich bin nicht schön genug.
Cems Theorie: Er ist ein schwuler Türke.
Cem meckerte vor der Haustür fürchterlich über Rassismus und sexuelle Diskriminierung, ich stimmte ein und schimpfte wie der sprichwörtliche Rohrspatz. So fanden wir uns und kurz darauf eine Zweizimmerwohnung in einem von Studenten bevölkerten Mehrparteienhaus, in dem sich alle sehr lieb haben.
Mein Mitbewohner ist dreiundzwanzig und studiert Medizin, was ich abgefahren finde. Mediziner sind tolle Menschen, die machen alles heil. Noch macht Cem nicht so viel heil, weil er erst ins fünfte Semester kommt. Er möchte sich auf Gynäkologie spezialisieren. Ja. Ich habe das anfangs auch für einen dummen Mediziner-Insider gehalten, aber es ist ihm todernst. Man verzeiht es ihm, weil er es ja nicht tut, um ein bisschen zu gucken und zu grabschen, sondern weil er (Zitat) Leben nicht nur retten, sondern auch schenken möchte. Das finde ich wunderbar und wunderschön, und es macht ihn noch liebenswerter.
Cem Demirel ist ein sehr gut aussehender schwuler Türke. Mein Typ ist er nicht, ich stehe nicht so auf Südländer, doch er könnte locker der männliche Hauptdarsteller in einer Verwechslungskomödie sein, in der sich eine süße Modedesignstudentin in ihn verliebt, um dann rauszufinden, dass er sie nicht will, weil sie eine Frau ist. Er ist ungefähr so groß wie ich, also knapp einen Meter siebzig, mit einer schlanken Normalo-Figur und einem an Spießigkeit grenzenden schicken Klamotten- und Frisurenstil (einer Mischung aus korrekter Seitenscheitel-Gel-Frisur und gezügeltem Durcheinander). Seine Lippen sind voll, die Augen von einem leckeren Schokobraun, Wimpern und Augenbrauen dicht und die Gesichtskonturen zart, wie bei einem Sechzehnjährigen. Deshalb sieht es auch komisch aus, wenn er sich mal nicht rasiert. Die Bartstoppeln wollen so gar nicht dazu passen.
Ich für meinen Teil studiere Anglistik, und – nur um eventuelle Fragen vorwegzunehmen – was ich damit machen will, weiß ich noch nicht.
Im Übrigen heiße ich Felicitas Grün, aber nur meine Mutter nennt mich Felicitas. Mein Vater nennt mich Fee, und meine Freunde nennen mich Feli. Ich selbst nenne mich auch Feli, weil ich zumindest die meiste Zeit ein Freund von mir bin.
Jetzt muss ich mich allerdings um Cem kümmern, weil er nach eigener Aussage im Augenblick lautstark an Ramadan stirbt.
Beste Freundin
Ich höre, wie es an der Tür klingelt. Meine Freundin Sophie ist da.
Sie besucht mich und Cem sehr oft, und ich bin mir sicher, dass Cem verliebt in sie wäre, wenn er Brüste aus mehr als nur anatomischen Gründen interessant finden würde. Besonders seit er an Ramadan leidet, hat er ein Faible für Sophie, weil sie in den Semesterferien beim Cateringservice ihrer Eltern arbeitet und sehr oft nach Anbruch der Dunkelheit leckere Sachen vorbeibringt.
Sie balanciert eine weiße Pappschachtel in die Küche und präsentiert gefüllte Leckerchen und eingelegte Schmeckerchen.
»Oh! OH! Essen. Es ist dunkel, oder, Feli? Ist es dunkel?«
»Stockdunkel«, versichere ich ihm und sehe, dass es sowieso schon zu spät ist. Das Burgerpapier lugt schon aus dem überfüllten Papierkorb heraus.
Sophie deckt den Tisch für uns, zaubert von irgendwo eine Flasche Wein herbei, entkorkt sie und schenkt mir und sich ein. Cem trinkt keinen Wein, denn er will seinen Magen nicht mit so etwas Unsinnigem wie Flüssigkeit füllen. Außerdem sei ja Ramadan, betont er. Als wüsste ich das nicht so langsam.
»Oh, ist das gut«, stöhnt Cem und schiebt sich etwas gefülltes Pilzähnliches zwischen die Zähne.
Sophie ist aus vielen Gründen eine meiner besten Freundinnen. Ein wichtiger Grund ist, dass ich ihre bin. Weil wir uns voll und ganz akzeptieren, wie wir sind, und noch nie versucht haben, uns zu ändern. Sie ist ziemlich klug. Zwischen den Leckereien erzählt sie zum Beispiel eine halbe Stunde von Charles Darwin und von irgendwelchen Finken, die nach ihm benannt sind. Wenn ich mir so etwas merken müsste, würde mein Kopf platzen. Außerdem ist sie sehr lustig und in der Lage, ihre Intelligenz und ihren Humor zu kombinieren. Sie kann aber nicht nur intellektuelle Witze reißen, sie hat auch einen ausgezeichneten Sinn für Fäkalhumor, und das schätze ich sehr.
Unsere Freundschaft zeigt sich in kleinen, unbedeutenden Situationen. Wir können uns zum Beispiel sagen, dass wir mal ein Deo benutzen sollten, oder ohne nachzufragen vom Teller der anderen naschen, wenn wir essen sind. Wir können miteinander viele Flaschen Sekt trinken, um dann aus dem Sexnähkästchen zu plaudern, wir können uns ins Gesicht sagen, dass wir heute schlecht angezogen sind, genauso wie wir uns Komplimente machen können.
Sophie ist einundzwanzig und studiert Lehramt. Sie weiß, dass ich deswegen von ihr denke, sie hätte sie nicht mehr alle, weil ich die Vorstellung, mein ganzes Berufsleben mit verpickelten Bushido-Fans zu verbringen, furchtbar frustrierend finde. Wenn ich Lehrerin wäre, wäre es eine beiderseitige Zumutung.
»Ich hab gesehen, ihr bekommt neue Nachbarn«, bemerkt sie, während sie über den Rand ihres Weinglases reibt und dadurch einen Ton erzeugt.
»Tatsächlich?«, fragt Cem. »Welche Wohnung ist denn frei?«
»Die im Erdgeschoss, direkt neben der Eingangstür links.«
»Warum weißt du das?«, frage ich und scheitere bei dem Versuch, ihren Weinglastrick nachzumachen.
»Ein Kerl trägt Kisten in die Wohnung. Es sah aus wie ein Einzug.«
»Ein Kerl? Also ein Mann?«, will Cem wissen.
Sophie nickt. »Mitte zwanzig. Blond. Ganz schnuckelig.«
Cem wirkt interessiert.
»He, es ist Ramadan. Kein Geschlechtsverkehr.«
»Woher weißt du das alles?«, fragt er mich zischend mit verengten Augen.
»Hat mir Tante Google erzählt. Wenn ich drauf achten soll, dass du keine Regeln brichst, muss ich die Regeln kennen. Kein Essen und Trinken bei Tageslicht, kein Fluchen, kein Sex.« Ja, ich habe mich informiert, schließlich wollte ich das Ganze zusammen mit ihm durchziehen. Fünf Stunden lang.
»Ich halte morgen mal die Augen offen. Neue Nachbarn müssen wir willkommen heißen«, verkündet er.
Fein.
Cem plant bereits, die neuen Nachbarn mit Brot und Salz in die Hausgemeinschaft aufzunehmen.
Holterdipolter
Während der Semesterferien ist mir ein bisschen langweilig. Aber mir ist nicht so langweilig, dass ich mir einen Job suchen würde. Ich habe noch genügend Beschäftigungsmöglichkeiten. Lesen zum Beispiel. Ich versuche mich immer damit rauszureden, dass Lesen zu meinem Studium dazugehört, aber eigentlich dient es doch eher meiner persönlichen Unterhaltung.
Cem hingegen ist ein großes Stück eifriger als ich. Er lernt den ganzen Tag. Es lenkt ihn davon ab, hungrig und durstig zu sein. Beispielsweise lernt er zum wiederholten Mal die Namen sämtlicher Knochen und unterhält sich mit dem lebensgroßen Skelett, das mangels Platz in seinem Zimmer die Küche bewohnt. Anfangs wollte ich mich mit dem Ding nicht anfreunden, weil es mich bei jedem Griff in den Kühlschrank daran erinnerte, dass irgendwo Menschen hungern und ich nicht. Zugleich bin ich aber auch neidisch auf das Skelett, weil es aus gegebenem Anlass sehr schlank ist.
Cem hat es dann verkleidet und ihm einen Namen gegeben, damit ich es als drittes WG-Mitglied akzeptieren kann. Seitdem heißt es Horst-Muhammed Beckham. Horst, weil das sehr deutsch klingt, Muhammed, weil das sehr türkisch klingt, und Beckham, weil es dünn wie Spielergattin Victoria ist. Es trägt eine blinkende Weihnachtsmannmütze, eine Blumenkette und eine herzförmige Sonnenbrille, die wir mit Tesa festkleben mussten, weil Horst-Muhammed Beckham weder Nase noch Ohren hat. Außerdem ist eine Lichterkette um ihn herum drapiert, weshalb er gleichzeitig als indirekte Beleuchtung fungiert. Die RTL-Einrichtungsspezialistin Tine Wittler wäre sicher stolz auf unsere innenarchitektonische Kreativität.
Cem hat Horst-Muhammed Beckham oder kurz HMB (sprich: Äitsch-Äm-Bi – das Aufsagen des kompletten Namens hat sich nach kurzer Zeit als zu zeitaufwendig erwiesen) in die Küchenmitte verfrachtet, wo er an ihm herumdoktert und klug klingende lateinische Wortbrocken murmelt.
Es ist Samstag, also Einkaufstag.
Ich unterbreche Cem beim Klugklingen und bestehe auf unsere allwöchentliche Aldi-Lidl-Edeka-Tour. In genau dieser Reihenfolge und nicht anders. Wir können nicht alles in einem Supermarkt besorgen, weil das nicht geht. Aldi ist am günstigsten, also wird bei Aldi der Großteil des Einkaufs erledigt. Meinen Saft gibt es aber bei Lidl, also muss ich zu Lidl. Tütensuppen von Maggi gibt es bei Edeka, also muss ich zu Edeka. Für Tütensuppen von Maggi würde ich zwar nicht alles, aber auf jeden Fall sehr viel geben.
Unsere Einkaufstouren nehmen manchmal mehrere Stunden in Anspruch, weil wir oft darüber streiten, was wir brauchen und was nicht. Wenn es Schnäppchen gibt (dickminige Buntstifte, Dampfgarer oder gar Donutmaschinen – wie super ist das denn, eine Donutmaschine!!!), möchte ich die nämlich gerne alle haben. Obwohl ich weiß, dass es weitaus vernünftiger wäre, darauf zu verzichten, bedarf es Woche um Woche des diplomatischen Geschicks meines Sparfuchsmitbewohners, um mich davon abzuhalten.
Nach anstrengenden zwei Stunden Shoppingkampf kommen wir gegen drei Uhr nachmittags zurück nach Hause, und ich bin immer noch etwas miesepetrig, weil mir Cem verboten hat, uns von meinem Geld eine automatische Zitrusfruchtpresse zu kaufen. Er dagegen quengelt, weil ich ihn davon abgehalten habe, mitten im Aldi eine Fressorgie mit noch unbezahlten Schokokeksen zu starten. Wir fauchen uns an, bis wir die Eingangstür passieren.
Dann wird Cem plötzlich aufgeregt. »Duhuuu«, sagt er lang gezogen, »ist jetzt schon ein paar Tage her, dass Sophie von dem Einzug hier gesprochen hat.« Er deutet auf die Wohnung links neben der Haustür.
Ich nicke. Cem war sehr enttäuscht, dass bisher niemand bei uns geklingelt hat, um sich persönlich vorzustellen.
Er lässt die properen Einkaufstüten mit einer Vielzahl verschiedener Supermarktlogos auf den Boden plumpsen, rollt die Pulloverärmel bis zu den Ellenbogen hoch und drückt ein Ohr gegen die geschlossene Wohnungstür.
»CEM«, ermahne ich ihn, »das ist ja wohl total unhöflich, komm weg da!« Ich zerre an seinem Pulli, aber er rührt sich nicht vom Fleck.
Wie ein kleines Kind lauscht er an der Wohnungstür und fängt an zu kichern. Mist. Ich linse das Treppenhaus hoch und luge in alle Winkel. Keiner da. Alles völlig ausgestorben.
»Was hörst du?«, flüstere ich.
Dieses Haus ist nämlich furchtbar hellhörig und hat sich deshalb schon mehrfach als studentenuntauglich erwiesen. Steffi zum Beispiel, die neben uns wohnt, hat ein reges Sexualleben, und Kai, der über uns wohnt, ist leidenschaftlicher Rammstein-Fan. Viel Gestöhne und viel Musik sind äußerst störend und frustrierend, wenn es weder das eigene Stöhnen noch die eigene Musik ist.
»Sei nicht so albern!«
»Pssst, das ist total spannend.«
»Was hörst du denn, verdammt?«, zische ich und verfehle den geplanten Flüstertonfall um mehrere Dezibel. »Das ist nicht fair!«
Ich ziehe weiter an Cems Pullover und erkämpfe schließlich einen Platz für mein Ohr an der Tür. Was wir hier machen, ist absolut nicht in Ordnung, dessen bin ich mir bewusst, aber Neugierde und moralische Korrektheit haben wirklich nur eine kleine Schnittmenge.
»Ich hör gar nix«, beschwere ich mich. Da ist nichts. Hinter dieser Tür findet kein Leben statt. Zumindest nicht so eines, wie Cem und ich oder Steffi oder Kai es führen. Kein lateinisches Gemurmel, kein Kulikratzen, keine Lust, keine Musik, nicht mal Stimmen.
Cem fängt doll an zu lachen. Er hat mich reingelegt, der gemeine Saftdieb! Trotzdem drücke ich noch mal das Ohr an die Tür, presse es fest dagegen. Vielleicht ist ja doch Leben in der Bude? Die schweren Einkaufstaschen schneiden mir in die Handfläche, als ich mich nach vorne lehne, um ja kein Geräusch zu verpassen.
»Komm weiter, Feli, ich hab dich bloß verarscht. Da tut sich kein Mucks.«
»Doch, warte!«
Wir sind unkollegial und lauschen an fremden Türen. Wir sind böse!
Ich höre Füße.
»Da ist doch jemand!« Ich kralle mich an den Einkäufen fest.
Erst ein Ruck, dann ein Knarren, ein entsetzlicher Schlag und eine schmerzhafte Bruchlandung mit dem Gesicht vorweg. Überall umherkullernde Äpfel, Nudelverpackungen und auch ein paar kaputte Eier.
Ich rappele mich auf die Knie auf, rücke meine Brille gerade und mache mich daran, ohgottohmeingottmurmelnd und tutmirleidsosehrleidentschuldigend meine Tüten wieder zu bepacken. Ich zaubere sogar Tempos aus der Tasche und wische über die Eiermatschepatsche, was natürlich rein gar nichts bringt. Ich möchte nicht aufschauen, weil ich dann den Mieter dieser Wohnung ansehen muss, der vor mir steht und mich bestimmt nicht nur für sehr unfreundlich und unverschämt, sondern auch noch für den verdammten Obertrottel hält.
Fettnapf, ich komme! Ja, Fettnapf. Die Verniedlichungsform ist an dieser Stelle nämlich so was von unangebracht! An mir gibt es im Allgemeinen wenig zu verniedlichen. Aber dieses Verhalten … Ich möchte sterben. Von mir aus auch grausam. Hauptsache, mir bleibt die Peinlichkeit erspart, das Gesicht, das zu diesen Adidas-Schuhen gehört, ansehen zu müssen.
»Feli«, zischt Cem plötzlich mit ernster Stimme, »jetzt steh schon auf!«
Mühsam rappele ich mich hoch und gucke beschämt an mir herunter. Ich habe in einem explodierten Joghurtbecher gekniet. Oh mein Gott. Eier, Joghurt und etwas Undefinierbares geben sich auf dem Parkettboden ein matschiges Stelldichein.
»Das tut mir sooo leid! Wirklich!« Nie im Leben war mir etwas so peinlich. Endlich traue ich mich, mein Gegenüber anzusehen. Er starrt ungläubig vor sich hin und sieht ziemlich gut dabei aus. Der große, dunkelhaarige Besitzer der Adidas-Schuhe sieht blöderweise alles in allem ziemlich gut aus. Ist schon klar, dass man sich immer nur vor den hübschen Männern blamiert.
»Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Wir haben hier geredet, und ich hab mich gegen die Tür gelehnt und da …«, blablabla, lüglüglüg. »Ich helfe dir natürlich, alles sauber zu machen.«
»Danke. Ist nicht nötig.«
Die Stimme irritiert mich. Ein Bariton. Sehr weich. Und sehr genervt. Fast aggressiv.
»Doch, doch. Ich kann ja sehen, was ich angerichtet habe.«
»Ich weiß. Nur weil ich es nicht sehe, heißt das nicht, dass ich es nicht alleine sauber machen kann.«
Die Tür knallt vor meiner Nase zu.
Ich gucke Cem an. Cem guckt zurück.
»Oh nein«, sage ich flüsternd.
»Oh doch«, murmelt Cem, legt mir einen Arm um die Schultern und geht mit mir die Treppe hoch.
Mir ist wenig peinlich
Das ist einfach so. Manchmal glaube ich, mein Organismus funktioniert nach folgender Grundeinstellung: Warum wertvolle Lebensenergie mit dem Ausschütten von Peinlichkeitsenzymen verschwenden? Mein Stoffwechsel bevorzugt es sowieso, Energie einzulagern, statt sie in etwas Nützliches umzusetzen.
Es wäre viel zu mühselig, sämtliche peinlichen Dinge aufzuzählen, die mir im Laufe meines Lebens so passiert sind. Ich kann recht gut über mich selbst lachen, deshalb habe ich all diese Aktionen auch ganz gut überstanden, ohne mir so etwas wie Schamgefühl oder eine niedrige Peinlichkeitsschwelle anzueignen. Ich habe kein Problem damit, verlottert, ungeschminkt und ungeduscht Brötchen holen zu gehen, und ich erzähle auch immer, ohne rot anzulaufen, dass ich keine einzige Folge der Zeichentricksendung Avatar – Herr der Elemente verpasst habe.
Wahrscheinlich hat mich diese Nachlässigkeit in Sachen Beschämtfühlen zu einem fahrlässig tollpatschigen Menschen gemacht.
Ich sitze am Küchentisch und schäme mich so sehr, dass ich heulen muss. Zunächst war ich schockiert über mein Benehmen, dann stinksauer auf mich, und jetzt bin ich einfach nur traurig, dass ich so blöd bin.
Cem krault mir den Kopf. Das ist zwar schön, macht die Sache aber im Moment nur unwesentlich besser.
»Das konntest du nun wirklich nicht wissen. Ich hab’s zuerst auch nicht bemerkt.«
»Aber ich … ich hab das gar nicht so gem-m-m-meint, als ich ge-ge-gesagt hab, dass ich sehen kann, was ich a-aa-angerichtet habe«, schniefe ich und fühle mich noch sehr viel schlechter.
»Ich weiß, Feli«, versucht Cem mich zu beruhigen, aber leider gibt es momentan keine einzige Möglichkeit, mich zu beruhigen. Ich bin schrecklich böse auf mich selbst.
Es ist nicht in allererster Linie Peinlichkeit, sondern wirkliche Scham. Ich schäme mich, so taktlos zu sein. Warum habe ich den starren Blick nicht sofort richtig interpretiert? Ich war voll und ganz damit beschäftigt, mein attraktives Gegenüber anzustarren, weshalb ich gar nicht gemerkt habe, dass er mich wohl niemals ansehen würde.
Ich weiß nicht recht, wie ich mir einen Blinden vorgestellt habe. Wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nie einen blinden Menschen getroffen und habe das Stereotyp Ray Charles vor Augen. Außerdem einen weißen Gehstock, obwohl ich bezweifle, dass Gehstock das korrekte Wort dafür ist, und einen Blindenhund.
Ich habe immer nur an die Accessoires eines Blinden gedacht. Niemals daran, wie ein Blinder an sich ist, wie er sich kleidet, wie er lebt.
Meine Gedanken würden wahrscheinlich jeden blinden Menschen dazu bringen, mich abstoßend zu finden: Wie kann ein Blinder alleine wohnen? Wie kann ein Blinder ohne Hilfe putzen? Was geht einem Blinden durch den Kopf, wenn er einen anderen Menschen zum ersten Mal trifft?
Ich habe gar keinen Kontakt zu Menschen mit Behinderung, und wie die meisten Menschen habe ich keine Ahnung, wie ich mit etwas, das ich nicht kenne, umgehen soll.
Ich weiß, dass ich mich entschuldigen muss – aber wie? Ich habe große Angst, etwas falsch zu machen. Was soll ich denn sagen? Dass ich mich schäme, weil ich wie eine neugierige Rotzgöre an seiner Tür gelauscht und dann auch noch eine riesige Sauerei in seiner Wohnung angerichtet habe? Dass ich das nicht so gemeint habe, wie er es verstanden hat? Dass es nicht meine Absicht war, ihn zu verärgern? Dass ich wirklich nicht bemerkt habe, dass er blind ist?
Dann kommt mir ein saublöder Gedanke: Ich könnte ja einfach klingeln und so tun, als wäre ich gar nicht die, die in seine Wohnung gefallen ist und eine Riesensauerei veranstaltet hat.
Ich rufe Sophie an, aber die weiß zunächst auch keinen Rat.
»Du musst auf jeden Fall Entschuldigung sagen.«
»Ich weiß«, sage ich kleinlaut.
»Nimm Cem einfach mit. Der ist immerhin nicht ganz unschuldig.«
»Ja. Gute Idee.«
»Macht das doch mit Brot und Salz, das finde ich süß. Hast du noch das Maisbrotrezept, das ich dir mal gegeben habe? Back ihm das Brot selbst, dann freut er sich bestimmt.«
»Na, ich weiß ja nicht.« Im Gegensatz zu Sophie bin ich kein Backspezialist. Außerdem hab ich keine Ahnung, wo das Rezept abgeblieben ist. Irgendwo in irgendeinem meiner Notizbücher.
»Es war eine total bedrückende Situation«, gestehe ich dann, was mir seither auf der Seele liegt.
»Feli, du bist in seine Wohnung gepoltert und hast Rührei hinterlassen. Natürlich war das keine besonders glückliche Situation.«
»Ich meine, er hat irgendwie bedrückt ausgesehen.«
»Vielleicht bildest du dir das ein, weil du ein schlechtes Gewissen hast.«
Diese Aussage befriedigt mich nicht.
»Bring das erst mal ins Reine. Ich kenn dich. Wenn du die Sache nicht klärst, geht sie dir wochenlang nicht aus dem Kopf.«
Natürlich hat Sophie damit recht. Ihr fällt es deutlich leichter als mir, Pannensituationen objektiv zu betrachten. Ich versinke häufig in einem Berg an Selbstvorwürfen, was dazu führt, dass ich nicht mehr nach links und rechts blicken kann, geschweige denn einen Ausweg aus dieser Situation erkenne.
Entschuldigung sagen
Ich traue mich nicht. Ich mache gleich unter mich. Das doofe Brotrezept habe ich zwar gefunden, aber ich hätte dafür Maismehl kaufen gehen müssen, und heute ist Montag. An Montagen gehe ich nun mal nicht einkaufen. Also habe ich einen Kuchen gebacken, der leider nicht verhindern kann, dass ich mich lächerlich und überfordert fühle, als ich gemeinsam mit Cem vor der verschlossenen Wohnungstür im Erdgeschoss stehe. Cem wollte eigentlich, dass wir erst später vorbeischauen, weil es rein theoretisch sein könnte, dass wir spontan zum Mitessen reingebeten würden. Diese Einladung könnte er natürlich nur nach Einbruch der Dunkelheit annehmen.
Ich dagegen glaube, dass wir ganz bestimmt nicht spontan auf ein Stückchen eingeladen werden, deshalb ist es auch nicht nötig, den Schokokuchen zu einer ramadanfreundlichen Uhrzeit vorbeizubringen.
Cem ist also mies gelaunt, als wir mit meinem gut duftenden Backwerk vor der unteren Wohnung stehen.
Ich habe Cem mit Gesten geboten, absolut still zu sein, weil ich verhindern will, dass der Bewohner sich wie am Samstag von uns belästigt fühlt und die Tür öffnet, obwohl ich noch nicht dazu bereit bin. Einen Moment fürchte ich sogar, er könnte meinen nervösen, schnellen Atem hören.
Entschuldigung zu sagen ist etwas, das mir schon immer extrem schwergefallen ist. Aber noch nienienie war es so schlimm, denn noch nie war die Ausgangssituation so unglücklich.
Als ich allen Ernstes darüber nachdenke, heimlich in unsere WG zurückzuschleichen und den Kuchen bei Mondschein mit Cem alleine zu verdrücken, kommt jemand zur Haustür herein und macht diese Option zunichte. Gut für meine Figur, schlecht für meine nervöse Blase.
»Hallo«, grüßt der Neuankömmling, zückt einen Schlüssel und steckt ihn in die Tür, vor der wir seit drei Minuten darauf warten, dass ich den Mut aufbringe, die Klingel zu drücken.
»Hallo«, erwidern Cem und ich mechanisch.
»Kann ich euch helfen?«
Ja, wir müssen sehr hilfsbedürftig aussehen, wie wir hier schweigend mit einem Schokokuchen vor einer verschlossenen Wohnung stehen.
»Wir haben gesehen, dass hier neue Nachbarn eingezogen sind«, kokettiert Cem. Wenn er jetzt zu flirten beginnt, gehe ich an die Decke! »Da dachten wir, wir heißen sie willkommen!«
Wir? Mir kam es so vor, als hätte ich heute eine Stunde lang Kuchen gebacken und mit Schokolade bepinselt.
»Wahnsinn«, findet der Fremde. Sein Grinsen ist sehr zahnweiß und jungenhaft. »Simon. Hi!«
Morgens Aronal, abends Elmex.
»Cem«, sagt Cem.
»Feli«, sagt Feli, also ich.
»Find ich echt cool, dass sich hier mal jemand von den Nachbarn blicken lässt.«
»Ja, gehört doch dazu, oder?«, schmachtet Cem.
Stirb, Cem, stirb!
»Wohnt ihr hier zu zweit?«, traue ich mich zu fragen.
»Nein«, zahncremt Simon, »ich bin nur zu Besuch. Ich bin … ein guter Freund.«
Ich nicke. Sein Zögern nach »ich bin« entgeht mir nicht.
Simon dreht den Schlüssel im Schloss herum und stößt die Tür auf.
»Hey, Mann, Besuch für dich«, ruft er mit einer merkwürdigen Selbstverständlichkeit durch die Wohnung.
»Besuch?«, antwortet eine sanfte Baritonstimme, die ich bereits kenne.
Als sich Schritte nähern, gucke ich an Simon vorbei in die Wohnung. Sie ist sehr leer. Fast steril. Anders als bei uns gibt es hier keinen Flur, der in Küche, Bad und zwei Zimmer mündet, sondern man befindet sich gleich in einer großen Wohnküche. Darin gibt es eine kleine Küchenzeile, auf der alles an seinem rechtmäßigen Platz zu stehen scheint, eine fluffig aussehende weiße Couch, einen Fernseher, einen CD-Spieler und einen Tisch mit zwei Stühlen. Mehr nicht. Keine Farbe, keine Deko, kein Schnickschnack. Keine verkleideten Skelette. Keine indirekte Tine-Wittler-Beleuchtung. Aber auch kein bisschen Unordnung.
Dann sind die Schritte angekommen, und das Herz rutscht mir vor Scham in meine Socken.
»Ähm, hallo«, mäuschenpiepse ich. Es ist an der Zeit, mich zu erkennen zu geben. »Wir haben uns am Samstag schon mal ge … getroffen.« Oh Gott, fast hätte ich gesehen gesagt. »Ich bin … also, ich bin in deine Wohnung gefallen.« Ich gebe ein hohles Hühnerkichern von mir und hoffe auf eine Reaktion.
Es kommt aber keine Reaktion. Die Augen starren über mich hinweg auf einen Punkt an der Wand, den sie nicht erkennen können, das Gesicht bleibt ausdruckslos. Schon am Samstag, als ich zu seinen Füßen in den Überresten meines Einkaufes lag, war mir aufgefallen, dass er ganz gut aussieht. Jetzt, da er direkt vor mir steht, ist seine Attraktivität nicht mehr von der Hand zu weisen. Groß, muskulös, braune Haare. Männlich, schießt es mir durch den Kopf. Er sieht männlich aus!
Es ist Simon, der eine Reaktion zeigt. »Ach, herrje!«, sagt er sehr treffend mit strahlendem, offenem Gesichtsausdruck.
Ich beginne Simon zu mögen.
»Ach, herrje!«, wiederholt er noch mal. »Janosch hat mir schon davon erzählt. Das ist eine echt lustige Story.«
Cem, der Schleimer, stimmt in Simons Kichern ein.
»Ich wollte nur kurz sagen …« Ja, was eigentlich? Dass ich ein gigantischer Volltrottel bin? »… dass, ähm, mir das alles ziemlich peinlich ist und leidtut. Deshalb wollte ich den Kuchen hier vorbeibringen, als quasi, ähm, Entschädigung. Ich weiß nicht, ob er schmeckt, also, ja, ähm, esst ihn oder auch nicht. Und wir, wir gehen dann mal wieder hoch, nicht wahr, Cem? Wir wohnen nämlich oben in der Vier.«
Ich neige dazu, wirren Unfug zu stammeln, wenn ich nervös bin. Dass in diesem Fall ein attraktiver Mann der Auslöser ist, macht die Sache nur noch schlimmer. Eigentlich würde ich jetzt lieber geistreich und witzig rüberkommen. Stattdessen manifestiere ich den ersten Eindruck von mir als fahrigem Tollpatsch.
Schnellen Schrittes gehe ich zu der Küchenzeile, stelle den Kuchenteller darauf ab und husche mit gesenktem Kopf zurück zur Tür.
»’tschuldigung noch mal, wir wollten nicht stören. Tut mir leid. Wirklich. Ist mir echt unangenehm.« Ich habe es ziemlich eilig, zurück in meine Wohnung zu kommen, weil ich dieses Nichtssagen und das Nichtreagieren nicht ertrage.
Cem, der wohl immer noch darauf wartet, zum Kaffeekränzchen eingeladen zu werden, macht keinerlei Anstalten, mich zu begleiten, also nehme ich ihn bei der Hand und ziehe ihn hinter mir her.
»Das mit dem Kuchen ist eine Wahnsinnssache, wollt ihr nicht ein Stück mitessen?«, fragt Simon und sieht mich mit funkelnden Augen an.
Cem wirft mir einen sehnsüchtigen, flehenden Blick zu, aber ich schmettere das Angebot mit einem unanfechtbaren Argument nieder. »Nein, danke, geht nicht. Es ist Ramadan.«
Mama
Nach dem Anruf meiner Mama kann man für gewöhnlich die Uhr stellen. Zweimal die Woche. Dienstags und freitags, immer gegen vier.
Meine Eltern leben getrennt, seit ich dreizehn bin. Und das ist okay so. Ich war nie der Meinung, die beiden nach ihrer Trennung wieder zwangsvereinen zu müssen, was mich wohl zu einer Rarität macht. Mir sind getrennte Eltern tausendmal lieber als streitende, weil ich ein Freund von Harmonie bin.
Wahrscheinlich bin ich meiner Mutter ähnlicher, als ich gerne zugebe. Oft werfe ich ihr vor, kompliziert, streitsüchtig und nervtötend zu sein, außerdem, dass sie zu oft an mir rummeckert und zu viel schwatzt.
Meine Mutter ist eine von der jung gebliebenen Sorte. Das heißt jetzt nicht, dass sie eine Frau ist, die von sich selbst behauptet, jung geblieben zu sein. Denn solche sind meistens Überbleibsel der Achtundsechziger, tragen Walla-Walla-Kleider und konsumieren von Zeit zu Zeit gerne Janis Joplin und/oder Marihuana.
Meine Mutter ist es einfach. Jung geblieben. Sie gibt viel Geld für Kleidung, Schuhe und Abendgestaltung aus, sie hat gerne Dates. In diesem Punkt unterscheiden wir uns wahrscheinlich maßgeblich.
»Felicitas«, flötet sie in den Hörer.
»Mama«, flöte ich zurück.
»Erzähl mir von deinem Wochenende«, fordert sie. »Cem hat sich das doch ausgedacht, oder?«
Oh, stimmt. Mama und Cem sind Busenfreundinnen. Er besteht geradezu darauf dranzugehen, wenn meine Mutter anruft, damit er vor mir ein bisschen mit ihr tratschen kann. Cem ist für meine Mutter der schwule beste Freund, den sie nie hatte. Und sie ist für ihn die verständnisvolle Erzähl-mir-aus-deinem-Leben-Mutter, die er nie hatte.
Manchmal lästern sie sogar über mich. Soeben hat Cem sie also über meine Panne mit dem neuen Hausbewohner aufgeklärt.
»Felicitas, bist du denn wahnsinnig geworden? An fremden Türen lauschen!«
Der feine Cemiblödi hat ihr also nicht erzählt, wessen Glanzidee das war. Als ich die Sachlage klarstellen will, unterbricht sie mich jedoch: »Man kann nicht immer alles auf die anderen schieben.«
Jaja. Schon immer so gewesen. Ich habe nie recht, alle anderen dafür aber aus Prinzip. Ich denke, das ist eine weitverbreitete Eltern-Kind-Problematik.
»Du warst noch nie besonders geschickt.« Auch das hat sie mir schon diverse Male erzählt. »Wenigstens hast du dich entschuldigt. Dass dieser Junge keine Manieren hat, ist nicht deine Schuld. Cem hat recht, er hätte euch auf ein Stück Kuchen einladen sollen.«
»Hat Cem dir nicht erzählt, dass er gerade Fastenzeit hat?«
»Ah! Apropos. Fastenzeit würde dir auch mal ganz gut stehen. Wolltest du ihn nicht dabei unterstützen?«
Als ich noch zu Hause gewohnt habe, sagte sie immer Sachen wie »Wolltest du nicht was zu trinken holen?« oder »Könntest du mal den Staubsauger mitbringen?«. Sie vergaß dabei immer, dass mir die Modalverben wollen und können die Entscheidung offen ließen, mit Ja oder Nein zu antworten. Aber wehe, ich habe Nein gesagt. Mama benutzt das Verb wollen als Synonym für »ich befehle dir«.
Als ich mich widerwillig mit »Ja, vielleicht« der Frage entwinde, widmet sie sich anderem Tratsch. Ich schalte auf Durchzug und kommentiere nur hier und da mit »Mhm« oder »Mhm, richtig« oder »Mhm, stimmt schon« oder »Mhm, ja«.
Entschuldigung sagen, Klappe, die Zweite
Dass ich seinen Namen nicht mehr weiß, macht das Grübeln über meinen neuen Nachbarn nicht besser. Ich versuche jedoch, ihn unter keinen Umstanden mit irgendeiner Substantivierung des Wortes blind zu betiteln, weil ich das abwertend finde und nicht will, dass mich jemand als behindertenhassende oder diskriminierende Person beschimpft. Weil ich das nun mal nicht bin. Nichts davon und auch sonst nichts Faschistisches. Also bitte. Mein Mitbewohner ist ein schwuler Türke, der Frauenarzt werden will! Das zeugt doch von einer sehr liberalen Lebenseinstellung, oder?
Am Samstag komme ich mit Sophie und unserer gemeinsamen Freundin Kirsten von meinem Wocheneinkauf zurück. Die beiden haben mich begleitet, weil wir heute Abend zusammen kochen wollen. Ich habe ihnen soeben eine Geschichte aus meiner Schulvergangenheit erzählt und versucht in Worte zu fassen, wie sie mit meinen jüngsten Erfahrungen mit unserem neuen Nachbarn verzahnt ist.
»Es ist schon ein bisschen klischeemäßig, dass er dich angemeckert hat, weil du das Wort sehen verwendet hast, oder?«, fragt Kirsten und nimmt mir die Tragetasche ab, während ich in meiner Handtasche nach dem Hausschlüssel krame. Kirsten ist ein ziemlich intelligenter Mensch, sie kombiniert gut und stellt an den richtigen Stellen die richtigen Fragen. »Er muss doch wissen, dass er damit den Menschen in seiner Umgebung Unbehagen bereitet!«
»Ja, vielleicht. Aber … es ist doch auch irgendwie scheiße.«
»Schon, trotzdem muss er das nicht an dir auslassen«, wirft Sophie ein.
»Die Menschen sind nun mal empfindlich. Entweder weil man sie mit Samthandschuhen anfasst oder weil man sie eben normal behandelt. Manche meinen auch, es mache sie zu einer erhabeneren Person, wenn sie jedem schlechte Absichten unterstellen.«
Ich finde eine beruhigende Wahrheit in Kirstens Worten. Das ist eine ihrer Gaben. Egal wie scheiße man sich fühlt – ein Gespräch mit ihr, und sie schafft es, die Sachlage aus einer ganz anderen, klareren und positiveren Perspektive zu beleuchten.
»Warum grübelst du eigentlich immer noch darüber?«, fragt Sophie berechtigterweise.
Ich entziehe mich einer Antwort, indem ich den mittlerweile gefundenen Schlüssel ins Schloss stecke, aufschließe und die Tür mit dem Hintern aufdrücke.
»Grüß dich, Feli«, höre ich hinter mir eine bekannte Stimme.
Simon hält mir die Tür auf und winkt uns ins Haus.
»Ähm, hallo.« Seine Freundlichkeit erschlägt mich fast ein bisschen. Wie schafft er es nur immer, so ungezwungen rüberzukommen?
Er trägt ein T-Shirt, verwaschene Jeans und eine Jacke über dem Arm, er sieht sportlich und gut aus. Wirklich ein bisschen wie ein Werbemodel für Zahncreme oder andere Pflegeprodukte. Simon ist groß, schlank, dunkelblond und hat einen von diesen Beatles-nur-cooler-Haarschnitten, die bei Frauen meist Fantasien von Händehineinkrallen auslösen. Auch bei mir, das möchte ich nicht bestreiten. Kurz: Simon ist einer von diesen smarten Typen, die alle Mädchen gerne heiraten möchten, die von mir aber rein gar nichts wollen.
Vielleicht sollte ich weniger Gedanken an unsere Haar-Hände-Kompatibilität verschwenden und besser versuchen, mit seiner Hilfe mehr über den noch Namenlosen herauszufinden. Aber ich traue mich nicht.
»Hallo, Simon«, sage ich noch mal, damit er merkt, dass ich mich noch an ihn erinnere. »Ähm, das hier ist Sophie, und das ist Kirsten.«
»Oh, ihr habt wohl eine Shoppingtour gemacht?«
Wir nicken. Wir wechseln einen Blick.
Huihui, süßer Typ, sagen Sophies Augen. Ehrlich? Ist mir gar nicht aufgefallen, lügt mein Blick. Regt euch ab, weist uns Kirsten zurecht.
»Das steht heute bei mir auch noch an.« Er klopft sich über die Jeanstaschen. »Vergesst ihr auch so oft eure Schlüssel?« Er lacht.
»Ähm.« Ich sage oft Ähm. Es ist ein tolles Wort, ein Ausdruck universeller Ahnungslosigkeit und Wortungewandtheit. Besser als Ähm ist nur Häh. Während ich mich noch frage, warum Simon einen Schlüssel zu einer Wohnung besitzt, in der er gar nicht lebt, schlage ich vor: »Warum klingelst du nicht einfach?« Ja, das ist doch wirklich mal ein Geistesblitz.
Aronal-Lächeln, dann: »Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Aber es ist niemand da.«
»Wirklich nicht? Warum?«, platzt es aus mir heraus, was mir einen Wimpernschlag später auch schon peinlich ist.
Simon lächelt weiter (und er lächelt und er lächelt und wenn er nicht gestorben ist …) und antwortet dann, als gäbe es an meinem Ausbruch nichts zu beschämen: »Ja, Janosch ist im Sport. Schwimmen.«
Janosch.
Sport.
Schwimmen.
Mit dieser Menge an Informationen bin ich überfordert. Dabei waren es nur sechs Wörter. Mein Gehirn hat allerdings derzeit Semesterferien. Die letzte Hausarbeit habe ich vor einer Woche beendet, daher ist es auf Energiesparmodus eingestellt.
»Echt?«, ist meine nächste echt saublöde Frage.
»Natürlich«, ist Simons natürliche Antwort.
Ich setze ein Lachen auf und versuche mich dabei an der Unbefangenheit, die Simon stets ausstrahlt. Es gelingt mir nicht. Bei mir wirkt es in etwa so, als habe mir gerade eine Taube auf den Kopf gemacht und ich würde versuchen, der Situation etwas Humoristisches abzugewinnen.
Da nimmt Sophie die Situation in die Hand, und dafür liebe ich sie. »Das ist ja interessant. Macht er das auf Leistungssportebene?«
Auf Leistungssportebene? Auf diese Frage wäre ich in tausend Jahren nicht gekommen. Aber ich habe ja auch keine Ahnung, was Darwin-Finken sind.
»Oh, also, er ist richtig gut, soweit ich weiß. Ich bin ja nicht dabei. Janosch ist da … speziell.«
Wieder entgeht mir sein Zögern nicht. Daher frage ich nach: »Wie meinst du das?«
Ich kann Simon ansehen, dass er mir nicht zu viele Informationen geben will, während er antwortet. »Er braucht viel Zeit für sich. Er will niemanden dabeihaben. Nur seine Schwester.«
»Verstehe«, behaupte ich, obwohl ich rein gar nichts verstehe.