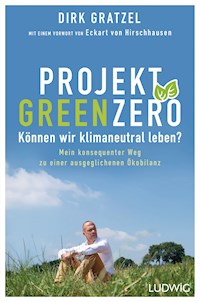
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ludwig Buchverlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Ist es möglich, den eigenen ökologischen Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren und sogar die bisher angehäuften Klimaschulden wieder auszugleichen?
Dirk Gratzel tritt den Beweis an: Er hat fest vor, künftigen Generationen keine ökologischen Schulden zu hinterlassen.
Umweltwissenschaftler der TU Berlin haben für Gratzel die Ökobilanz seines bisherigen Lebens errechnet. Das Ergebnis: Er muss seine gesamte Lebensweise auf den Kopf stellen, um seinen Ressourcenverbrauch und die Belastung der Ökosysteme zu reduzieren: Duschen? Nur noch 45 Sekunden. Neue Kleidung? Fehlanzeige. Fliegen? Nie wieder.
Doch dabei bleibt es nicht: Gratzel möchte alle bisher verursachten Schäden wiedergutmachen und die »Grüne Null« erreichen. Dafür ergreift er erstaunliche Maßnahmen … Ein leidenschaftlicher, inspirierender Selbstversuch!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Ähnliche
Zum Buch
Ist es möglich, den eigenen ökologischen Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren und sogar die bisher angehäuften Klimaschulden wieder auszugleichen? Dirk Gratzel tritt den Beweis an: Er hat fest vor, künftigen Generationen keine ökologischen Schulden zu hinterlassen.
Umweltwissenschaftler der TU Berlin haben für Gratzel die Ökobilanz seines bisherigen Lebens errechnet. Das Ergebnis: Er muss seine gesamte Lebensweise auf den Kopf stellen, um seinen Ressourcenverbrauch und die Belastung der Ökosysteme zu reduzieren: Duschen? Nur noch 45 Sekunden. Neue Kleidung? Fehlanzeige. Fliegen? Nie wieder. Doch dabei bleibt es nicht: Gratzel möchte alle bisher verursachten Schäden wiedergutmachen und die »Grüne Null« erreichen. Dafür ergreift er erstaunliche Maßnahmen … Ein leidenschaftlicher, inspirierender Selbstversuch!
Über den Autor
Dirk Gratzel, geboren 1968, ist promovierter Jurist, ehemaliger Topmanager und Gründer eines viel beachteten KI-Unternehmens. Er hält regelmäßig Vorträge auf nationalen und internationalen Konferenzen zu den Themen Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit. Gratzel ist der erste Mensch, der die Ökobilanz seines Lebens kennt – und sie bis zu seinem Tod ausgleichen möchte. Der Vater von fünf mittlerweile erwachsenen Kindern lebt bei Aachen und ist passionierter Jäger und Sportler.
DIRK C. GRATZEL
PROJEKT
GREENZERO
Können wir klimaneutral leben?
Mein konsequenter Weg
zu einer ausgeglichenen Ökobilanz
Mit einem Vorwort von
Eckart von Hirschhausen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 08/2020
Copyright © 2020 by Ludwig Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Regina Carstensen
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München,
unter Verwendung eines Fotos von © Maurice Weiss/OSTKREUZ
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN: 978-3-641-25831-3V002
www.Ludwig-Verlag.de
Für Miriam, Felix, Johanna, Nils und Philipp
Vorwort
Dirk Gratzel brennt für eine Idee – weniger zu verbrennen! Ich kenne niemanden, der so hartnäckig daran arbeitet, seinen eigenen Beitrag zur Erderwärmung zu reduzieren. Er ist im positiven Sinne »verrückt« – weil er für jeden, mit dem er spricht, die Maßstäbe »verrückt«, nach denen wir uns selber gerne als die Guten definieren: Ich habe doch schon dreimal auf eine Plastiktüte verzichtet, dann habe ich mir den Wochenendtrip nach New York doch auch verdient. Dirk Gratzel will weder sich noch anderen weiter in die Tasche lügen und fällt auf – einigen sicher auch auf die Nerven. Wie viel gilt der Prophet im eigenen Land? Einige der ersten größeren Presseartikel zu seinem Projekt erschienen in englischen Zeitungen.
Dirk und ich haben uns vor einiger Zeit zufällig in einem Restaurant kennengelernt und merkten schnell, an wie vielen Punkten wir uns schon hätten begegnen können. Wir brennen beide für das Thema Nachhaltigkeit, wobei dieses Wort so wenig beschreibt, worum es geht: Wir müssen nicht »das Klima retten«, sondern uns! Als Arzt weiß ich, dass die Grundlage von Gesundheit weder in einer Tablette, einer Operation oder sonst einer medizinischen Intervention liegt. Die ganze Hochleistungsmedizin nützt uns nichts, wenn die biologischen Basics für unser Leben nicht mehr gegeben sind: Wasser, Essen, Luft und erträgliche Temperaturen. Deshalb habe ich von Anfang an die Demonstrationen von Fridays for Future unterstützt, die Scientists for Future mitgegründet und inzwischen eine eigene gemeinnützige Stiftung: Gesunde Erde – Gesunde Menschen.
Zusammen mit der Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG) und dem Aktionsbündnis Health for Future versuche ich die verschiedenen Ideen und Kräfte zu bündeln, um schnell eine Veränderung im Denken und in der Politik zu ermöglichen. Die ist bitter nötig, denn die Klimakrise ist die größte Gesundheitsgefahr, vor der wir stehen. Und das Ausmaß, in dem jetzt und erst recht in den nächsten Jahren unser Wohlergehen und unser Wohlstand für immer kippen kann, ist den wenigsten bewusst. Psychologisch versiert, weiß Dirk Gratzel auch, dass wir Menschen uns nur ungern mit unangenehmen Wahrheiten länger beschäftigen, vor allem wenn sie abstrakt, weit weg und wenig emotional dargestellt werden. Deshalb hat er begonnen, eine andere Geschichte zu erzählen: die Geschichte seines Lebens.
Da keiner die so gut erzählt wie er, möchte ich nicht zu viel verraten, außer: Es ist eine klassische Heldenreise. Dirk hat den Ruf gehört, dass sich etwas ändern muss. Er hat vor dem Problem gestanden, dass es noch keine wirklich brauchbaren Ideen gibt, sodass unser Fußabdruck nicht nur runtergeht, sondern wir in Deutschland wirklich nachhaltig und klimaneutral leben können. Und er hat gegen alle Widerstände Wege gesucht und gefunden, sich und die Welt zu verändern.
Ein Waldspaziergang mit Dirk öffnet einem die Augen für das Wunder der Natur und unseren menschlichen Einfluss, im zerstörerischen wie im positiven Sinn. Die Veränderungen, die anstehen, tun uns gut. Es geht nicht um Verzicht, sondern um Gewinn an Lebensqualität und Gesundheit. In der Corona-Krise war die Klimadiskussion scheinbar ganz weit weg – dabei fielen markante Sätze wie: »Wirtschaftliche Interessen dürften den Schutz von Menschenleben nicht überlagern.« Warum gibt es dann eine Million Neuzulassungen für SUVs, die nie ein Gelände sehen, kein Tempolimit und in Deutschland als letztem Land der Europäischen Union noch Tabakwerbung? Wenn Politiker neuerdings auf Virologen hören können, warum dann nicht auch auf Klimaforscher und Umweltmediziner?
Versuche ich gerade, die Corona-Krise zu instrumentalisieren? Nein. Als Arzt sucht man nach den Ursachen für eine Erkrankung. Und im besten Fall vermeidet man Risiken schon vorher. Globale Epidemien werden häufiger, so gesehen war es für die Fachleute keine Frage von ob, sondern eher eine von wann, dass nach Ebola, SARS, MERS und HIV neue Viren von Tieren auf Menschen überspringen. Der Ursprung des neuartigen Coronavirus ist dem Umstand geschuldet, dass wir Wildtiere und ihre natürlichen Lebensräume zu anderen Zwecken missbrauchen. Wie der Chef des Berliner Naturkundemuseums, Johannes Vogel, es noch deutlicher formuliert: »Dieses Virus ist auch der Preis unserer Ausbeutung der Natur. Erreger überspringen Artgrenzen, wenn wir natürliche Ressourcen respektlos ausbeuten. Machen wir so weiter, scheitern wir.« Auf einer Tagung des Auswärtigen Amts zu »One Health« erlebte ich vor Corona-Zeiten, wie sich globale Gesundheitsgefahren nicht an unsere Denkmuster halten und nicht an Zuständigkeiten einzelner Ressorts und Disziplinen. Endlich kamen Virologen und Artenschützer, Human- und Tiermediziner, Kommunikationsexperten und Klimaforscher zusammen, um ihre jeweiligen Puzzleteile der Erkenntnis aus ihrem Gebiet zusammenzutragen. Aus heutiger Sicht schon fast zum Schmunzeln: Der Charité-Virologe Christian Drosten konnte auf dem Kongress praktisch unerkannt und ohne zehn Kameras und Mikros vor der Nase reden.
Nach meinem Vortrag über die Frage, wie man bei bedrohlichen Erkenntnissen psychologisch aus der Lähmung ins Handeln kommt, lernte ich Kim Gruetzmacher kennen. Sie ist Program Manager für die globalen Gesundheitsthemen für die Wildlife Conservation Society, eine der großen weltweiten Naturschutzorganisationen. Sie veranschaulichte mir, wie wir Menschen diesen Planeten plattmachen. »Stell dir vor, wir würden alle Wirbeltiere auf der Erde auf eine Waage stellen. Was glaubst du, wie viel Anteile hätten Wild- und Nutztiere im Verhältnis zu uns?« Ich hatte keinen Schimmer und staunte nicht schlecht, als ich erfuhr: Vor 10 000 Jahren hatten die paar Menschen einen Gewichtsanteil von etwa ein Prozent und Wildtiere 99 Prozent. Dann wurden wir sesshaft, begannen unsere extrem erfolgreiche Vermehrung, Ackerbau und Viehzucht. Damit haben wir die Verhältnisse komplett auf den Kopf gestellt. Die Wildtiere haben gerade mal noch ein Prozent der Biomasse für sich. Dafür machen Menschen 32 Prozent aus und 67 Prozent ihre Nutztiere. Und die – jetzt mal deutlich gesprochen – trampeln, fressen, kacken und pupsen alles aus dem Gleichgewicht. Gruetzmacher weiter: »Die Wildtiere werden gejagt, wie Drogen gehandelt, auf Märkten blutig übereinandergelegt und gegessen. Es gibt noch 600 000 Viren, die auf den Menschen übertragbar sind. Deshalb müssen wir endlich diesen perversen Wildtierhandel weltweit stoppen.«
Ein gesundes Wildtier hat ja gar kein Interesse, Menschen kennenzulernen. Es läuft weg, flieht oder fliegt davon, wenn es eine Fledermaus ist. Nur in Horrorfilmen kommen die vampirig gierig auf uns zu. Wir sind aber die Gier, wir sind für die Tiere der Horrorfilm. Sie werden so eingeschränkt in ihren natürlichen Lebensräumen, dass sie buchstäblich mit dem Rücken zur Wand stehen, gestresst und anfällig werden und sich »rächen« an uns, indem sie uns auf ihren letzten Metern noch ihre Viren dalassen, bevor sie für immer verschwinden. Oder wir irgendwann.
Dieses Buch von Dirk Gratzel wird Sie nicht »neutral« lassen. Entweder Sie werden erfasst von den sprudelnden Gedanken, das eigene Leben zu neutralisieren. Oder Sie werden denken: Das, was der kann, kann ich niemals. Das dachte ich auch, als ich ihn das erste Mal traf. Aber Vorsicht: Sein Enthusiasmus ist ansteckend. Inzwischen haben wir gemeinsam ein kleines Stück Wald gekauft, um die Ideen eines ökologischen Umbaus in der Praxis zu belegen, oder wie er es in einer E-Mail beschreibt: »Ziel ist eine Parzelle klimastabilen Waldes, an dem sich möglichst unsere Enkel in fünfzig Jahren noch erfreuen können.«
Dirk denkt über den Tellerrand – und über den Waldrand hinaus. Das schätze ich außerordentlich an ihm. Und genau das braucht es heute, damit wir die historische Chance nutzen, die letzte Generation zu sein, die an dem Ausmaß der Klimaveränderungen etwas ändern kann, bevor Kipppunkte erreicht und überschritten sind.
Wir können nur schützen, was wir schätzen.
In diesem Buch nimmt er auch Sie, liebe Leser, mit auf seine Entdeckungsreise.
Dabei wünsche ich Ihnen angesichts dieser Horizonterweiterung viel Freude, viele persönliche Einsichten und Ideen, um selbst nicht länger Teil des Problems zu sein – sondern Teil der Lösung zu werden!
Herzlich,
Ihr
Prolog
Im Bauzaun ist ein Loch. Jugendliche haben, wie ich aus Internetforen weiß, hier ein Loch in die Maschen geschnitten, um die verfallenen Gebäude zu durchstöbern, Feuer zu machen, Partys zu feiern, Abenteuer zu erleben. Doch heute ist alles still. Sonntäglicher Novemberregen taucht das große Industrieareal in ein lautloses Grau. Für eine Party die falsche Zeit, der falsche Tag und das falsche Wetter.
Miriam und Nils gehen voran, dann kommt meine Frau Heike. Ich mache die Nachhut. Emil ist schon längst voraus. Er hat nicht auf die Lücke im Maschendraht gewartet, sondern ist ein Stückchen früher durch ein Loch unter dem Zaun hindurchgeschlüpft. Er wuselt jetzt über den alten Fahrradparkplatz Richtung Brombeeren, zwischen kaputten, uralten Computern, Plastikstühlen, einer zertrümmerten Toilettenschüssel und Unmengen von Müll hindurch. Ich sehe die vielen Scherben, mache mir Sorgen um seine Pfoten und rufe ihn zu mir. Er kommt ungern. Wahrscheinlich haben Fuchs, Dachs und Wildschwein frische Fährten hinterlassen, den Unrat ignorierend, und die sind für Emil allemal spannender als unsere heimliche Besichtigungstour.
Miriam macht Fotos. Sie biegt nach links ab, wo zwischen den alten Bürocontainern und den Trafohäuschen irgendwo der Uhu gehaust haben muss. Er ist längst ausgezogen, hoffentlich mitsamt gesundem Nachwuchs. Nils zieht es nach rechts, Richtung Bunker. Heike und ich folgen ihm. Der große Bau liegt ganz am Nordrand der Fläche und ist komplett übererdet, schmale Birken und Buchen wachsen auf seinem Dach. Die kaputten Transformatorenhäuschen am Weg dorthin, der Müll, herausgerissene Leitungen, Gitter und Fensterrahmen und die Brennnesseln mischen sich mit dem Novemberregen zu dystopischen Bildern, die Miriam, denke ich, gewiss einfängt.
Vom Bunker hätte ich auch gern Fotos, vor allem von innen. Die verschweißte Tür ist aufgebrochen – ein Paradies für Ratten und für Füchse. Doch Miriam ist verschwunden, jetzt schon eine Viertelstunde. Ich fange an, mir Sorgen zu machen. Heike ruft sie. Es bleibt still.
Zu dritt umrunden wir den Bunker und stehen auf einer alten Rangierfläche. Sie ist übersät von den Scherben eingeschmissener Scheiben, alten Büromöbeln, kaputten Reifen, zwei umgestürzten Loren und einer Kaffeemaschine, die bestenfalls in den Siebzigerjahren das letzte Mal geblubbert hat. Nils stupst sie mit dem Fuß an. Dann schüttelt er den Kopf über all das Chaos.
Er kommt zu mir herüber. Ein wenig fröstelnd stellt er sich neben mich. Dann legt er mir freundschaftlich den Arm um die Schulter.
»Was wolltest du hier noch mal machen?«, fragt er schmunzelnd.
»Ökologie«, antworte ich.
I.
Im Herbst 2016, ich war achtundvierzig Jahre alt, traf ich eine mir banal erscheinende, unverändert gültige Entscheidung:
Ich werde, wenn mir meine statistisch vorbestimmte Restlebenszeit von rund dreißig Jahren bleibt, die ökologische Bilanz meines Lebens bis zu meinem Tod ausgleichen. Keine ökologischen Schulden hinterlassen. Oder, mit anderen Worten: Ich will sterben in der Gewissheit, mit meinem Dasein Schaden und Nutzen für das Lebenssystem Erde zumindest in der Balance gehalten zu haben.
Bis dato ist diese Bilanz natürlich tiefrot.
Die Entscheidung für dieses Vorhaben war eine private. Sie war zuvorderst egoistisch motiviert. Ich wollte mein Lebensgefühl verbessern und mein schlechtes Gewissen im Hinblick auf die Frage, was ich meinen Kindern mit meinem Leben hinterlasse, beruhigen. Ich hatte nicht die Erwartung oder gar die Absicht, dass aus diesem Entschluss mehr werden würde als ein, so dachte ich, nicht ganz einfaches, am Ende vielleicht ein wenig eigenwilliges Projekt, das mich Zeit, Energie und Geld kosten würde.
Gut zwei Jahre später, im Dezember 2018, erschien anlässlich der Weltklimakonferenz im polnischen Katowice ein von der US-amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press (AP) verbreiteter, recht langer und bebilderter Artikel über den Zwischenstand meines Vorhabens, der in über dreißig Ländern der Welt in großen Tageszeitungen veröffentlicht wurde. Am Erscheinungstag schrieben mir Freunde, Bekannte und Geschäftspartner, aber auch wildfremde Menschen aus Indien, Singapur, aus China, den USA und Australien, und schickten mir die Zeitungsmeldungen samt Fotos von meinem Hund Emil und mir. Ich las ihre E-Mails und Kommentare und betrachtete die Fotos, die mich staunen ließen. Das fühlte sich surreal an. Als Kind hatte ich davon geträumt, berühmt zu werden, als Fußballer oder als Tennisspieler. Wir alle träumen wohl dann und wann davon. Als Unternehmer und Gründer von PRECIRE Technologies hatte ich im digitalisierungsskeptischen Deutschland dann tatsächlich einiges an medialer Aufmerksamkeit erfahren – meist ungefragt und nicht immer zu meinem Vorteil. Aber dass mich nun ein – aus meiner Warte – banales Vorhaben, nämlich im Tod ökologisch ein halbwegs aufgeräumtes Leben zu hinterlassen, für einen kurzen Moment weltweit präsent werden ließ: Das verstörte mich schon ordentlich. Ich erinnere mich, dass ich abends im Bett noch einige E-Mails und Nachrichten las und dann, nach dem Einschlafen, recht sonderbare Dinge träumte, die mich, unterwegs auf einer Art In 80 Tagen um die Welt-Reise, mehrfach aufwachen ließen, nur um den seltsamen Traum nach dem nächsten Einschlafen fortzusetzen.
Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, dass mein Vorhaben Neugier weckt. Ich finde die Idee dahinter weiterhin unspektakulär. Das lässt mich immer wieder zweifeln, ob mein »Green Zero«, meine grüne Null, tatsächlich so viel Aufmerksamkeit verdient. Aber die Geschichte der Idee und ihrer Umsetzung ist in der Tat ganz unterhaltsam.
Und diese Geschichte beginnt genau genommen so:
II.
Mist.
Es ist ein ganz sanftes Ziehen in der Magengegend, irgendwo hinten-unten zwischen Beckenboden und Zwölffingerdarm, gefolgt von einem leichten Kräuseln meiner Jahr für Jahr wachsenden Stirn, das mir zweifelsfrei signalisiert:
Den Start hatte ich mir wohl deutlich leichter vorgestellt.
Ernüchterung kehrt ein.
Mist.
Unschlüssig halte ich ein Paar brauner Socken in den Händen. Sie haben ihre beste Zeit eindeutig hinter sich. Der Linke scheint mir in Ehren gealtert, mit lichten Flecken dort, wo Hacke und Zehen seit einem ganzen Sockenleben mahlend und scheuernd an meinen Schuhen reiben, eine Art textiler Untergrundkämpfer zahlloser Meetings und Besprechungen, die er geduldig in meinen Schuhen, mal rechts, mal links, verbracht hat, freundlicher Schutz gegen die drohende Fußkälte in Herbst und Winter. Es steht nicht gut um ihn. Ich fühle mit ihm.
Und der Rechte? Oha, denke ich, während ich ihn gegen die Sonne halte, der Rechte ist in seinem Sockenleben noch einen Schritt weiter. Selbst für einen Veteranen der Haute Couture ist er ein trauriger Fall, dreifach gelöchert, mit Knubbeln und Rissen übersät und von schlapper Taille da, wo er sich einst entschlossen an mein Schienbein klammerte, überreif für die Altkleidersammlung oder den Restmüll. Ein bisschen schäme ich mich. War es mangelnde Pflege oder übermäßiger Gebrauch, das falsche Waschmittel oder ein Mangel an Weichspüler, die ihn derart zugerichtet haben? Zur Scham gesellt sich etwas Unwohlsein, und das am frühen Samstagmorgen.
Verflixt.
Das braune Paar ist, bei meinem ersten Griff, eine Zufallsbeute aus dem schubgeladenen Panoptikum meiner Fußkleider, einem wilden Haufen brauner, schwarzer, grüner und – hier muss mich ein modischer Teufel geritten haben – orangener Socken, die bis vor einer Minute einen friedlichen Samstagmorgen in der oberen Schublade meiner Schlafzimmerkommode verbracht haben. Sie reihen sich in der linken Hälfte zu knödeligen Formen irgendwie ineinander gewurstet auf, gefolgt von einer eindrucksvollen Rotte ehemals weißer – jetzt grauer – Sportsocken. Ich zähle acht Paar. Daneben liegen zwei Varianten mehrfarbiger, mehrschichtiger Socken zum Wandern in Braun und Grau, wahrscheinlich, so erkläre ich mir die farblichen Unterschiede, eins für das Flachland und eins fürs Gebirge. Dann drei Paar Socken für die Jagd, dunkelgrün und erschreckend groß, die wie erschlaffte Gummistiefel aussehen, eskortiert von zwei merkwürdigen kleinen Nylondingern, die sich wahrscheinlich aus dem Kleidungsfundus meiner beiden Töchter hierhin verirrt haben. Und während ich noch staune über den Irrsinn dieses eigentlich alltäglichen Anblicks, drängt sich schon vehement der rechte Teil der Schublade ins Blickfeld, in dem die Unterhosen ein großzügiges Terrain besetzen; ich will sie jedoch erst angehen, wenn ich mit den Socken durch bin.
Die Socken ihrerseits geraten nun, so scheint mir, in Unruhe. Ich kann ihre Verwirrung mit meiner eigenen wachsen spüren, denn – ihre penible Zählung steht bevor: die mit neutestamentarischer Konsequenz geführte Eintragung all meiner Socken und Unterhosen in lange Listen, aber auch all meiner Unterhemden, T-Shirts und Pullover, Hosen, Jacken, Mäntel und Westen, einschließlich des Regiments meiner Schuhe und Stiefel und noch all der Schals, Mützen und Hüte, der Handschuhe und Einstecktücher, der Fliegen und Krawatten, der Ersatzschnürsenkel, Anstecker und Abzeichen, der Börsen, Brieftaschen und Etuis, der Schlüsselbunde, Schweißbänder und Schirme. Nun ja, um genau zu sein: schlicht all der Dinge, die ich besitze und die ich, mit der nimmermüden Akribie eines fünfzigjährigen Konsumenten, angeschafft, genutzt, verwahrt, behütet, mehr oder weniger gepflegt, gefaltet, sortiert, gestapelt, verräumt, verlegt und – oft überraschend – vor-, auf- und wiedergefunden habe.
Die Socken sind für mein Vorhaben, für das ich diesen Samstag im Januar schon vor Wochen eingeplant habe, ein ganz mieser Start. Denn schon nach wenigen Momenten meiner Beobachtermission muss ich feststellen, dass dieses Zählen bei Weitem nicht so einfach ist, wie es mir aufgegeben wurde: Einzutragen in lange Excel-Listen sind nämlich »Art des Kleidungsstücks« (»Socke«), »Anzahl« (»2«), »Alter« (ich rate: »24 Monate«) und, und spätestens da sperren sich die braunen Probanden hartnäckig, »Materialzusammensetzung« (»Baumwolle« – und was noch?), »Herkunftsland/-region« (ich habe keine Ahnung), »Herstellungsprozess konventionell« oder »Herstellungsprozess biologisch« (wer weiß denn so was?) und »Nutzungsdauer« (in Monaten; ich gebe beiden noch eine Gnadenfrist von einem Monat und trage »25« ein, weil ich den Tag nicht mit einem Verlust beginnen möchte).
Verzweiflung macht sich breit. Es ist ein Gefühl, wie ein Tennisspiel mit drei Doppelfehlern zu beginnen.
Ich überlege kurz, meine Frau um Hilfe zu rufen – doch sie hat meine Seelenpein quer durch alle Bruchsteinwände unseres alten Hauses längst erahnt. Sie kommt auf knarzenden Stufen die Wendeltreppe zum Schlafraum hinauf, ein die Antwort schon vorwegnehmendes »Und, klappt’s?« auf den Lippen. Sie kennt meine Mission, und sie goutiert sie mit freundlicher Langmut.
Ich schlucke und ringe mit der Formulierung, dann murmele ich in die Schublade:
»Weißt du, woher die Socken sind?«
»Geschenk von deiner Mutter, vorletztes Weihnachten.«
Meine Frau erstaunt mich immer wieder.
III.
Ab und zu werde ich gefragt, wie ich denn auf die Idee gekommen sei, ein ökologisch ausgeglichenes Leben herstellen zu wollen. Das klingt, als erwartete der Fragende eine mehr oder weniger spektakuläre Antwort – vielleicht die Schilderung eines einschneidenden Erlebnisses, einer Art spiritueller Erweckung, die mir, in einem Moment großer innerer Erleuchtung, die Zusammenhänge nachhaltiger Lebensführung und ökologischer Sensibilität vor Augen geführt hätte. Doch das ist nicht passiert. Wahr ist: Mein Entschluss und die mit ihm kommende Veränderung in meinem Leben haben keinen fest zu benennenden Anfang und wohl auch kein Ende, mein eigenes ausgenommen. Ich bin nicht klüger geworden, und die Entscheidungen, die ich zu meinem Lebensstil und zu meinen Wiedergutmachungsaktivitäten getroffen habe, waren nicht die Summe eines, sondern vieler Momente, vieler Gedanken und Gespräche. Sie scheinen mir mehr die Folge des Kollapses meiner Verdrängungskräfte denn bewusster Entschluss, die Welt, das Leben oder die Umwelt und Natur plötzlich mit ganz anderen Augen zu betrachten. Ich sehe oder denke heute nicht viel anders als vor zehn Jahren. Ich schaffe es nur nicht mehr so gut, so fühlt es sich zumindest an, mich in ein paar grundlegenden Lebensfragen selbst zu beschummeln.
Das für Sie nachvollziehbar zu machen, dazu hilft vielleicht ein kurzer Blick dahin, wo ich eigentlich herkomme, geografisch wie sozial. In der raum-, klassen- und zeitfreien Sprache meiner Heimat heißt das: wo einer wegkommt.
Ich bin 1968 im Essener Norden geboren, im Stadtteil Borbeck. Borbeck, noch in den Siebzigerjahren über 100 000 Einwohner stark, müsste seiner gelebten lokalen Phonetik nach eigentlich »Boahhbeck« geschrieben werden, wobei ein Doppel- oder Dreifach-O auch denkbar wären. Das r bleibt, außer am Anfang eines Wortes, im Ruhrgebietsslang meist stumm. Von wenigen, eher förmlichen Situationen abgesehen, hat der kleine Konsonant in seiner gesprochenen Form die Industrialisierung im Revier nicht überlebt.
Borbeck vereinte in meiner Kindheit (und tut dies mancherorts bis heute) alle Klischees, die zum Pott so gern kultiviert werden. Wie alle Klischees haben sie ein paar wahre Kerne. Also bin ich in manchen dieser Bilder groß geworden. Sozialisierung ist in solchen Ballungsräumen – das Ruhrgebiet ist der fünftgrößte Europas und der einzige, der aus mehreren zusammengewachsenen Städten besteht – womöglich besonders intensiv: Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich das Steigerlied höre (»… deeeeeerrr Steiger kommt …«), obwohl ich nie unter Tage gearbeitet habe. Ich sympathisiere in einer leicht melancholischen Grundstimmung mit meinem Heimatclub Rot-Weiss Essen (seit Jahren viertklassig, die Fans ausgenommen – jede Menge Anders-Depressiver, so wie ich), und ich träume an schwierig-grauen Tagen oft von einem kalten Pils und einer ordentlichen Portion Pommes, am liebsten an einer dieser lärmenden, straßenbahnbefahrenen Hauptstraßen in Frintrop oder Bergeborbeck – Borbecker Untergliederungen, deren Charme sich ausnahmslos nur dem erschließt, der dort einmal gelebt hat.
Wenn ich als Kind aus dem Kinderzimmer- oder Küchenfenster unserer Dreizimmerwohnung sah (was in den trüben und regnerischen Jahreszeiten eine Art YouTube-Vorläufer war, dem ich mich stundenlang widmete), konnte ich in den Gärten hinter unserem und hinter den Nachbarhäusern Ältere bei der Gartenarbeit beobachten, zwischen Kartoffeln, Lauch, Salat, Radieschen, Rot- und Blumenkohl. Sie waren die grauen Eminenzen spannender Latifundien. Selbst gebaute Volieren waren in fast allen Gärten Standard, gefüllt mal ganz pragmatisch mit Huhn, mal, eher sportlich, mit Tauben oder Finken. Nymphensittiche waren noch unbekannte Exoten und hätten wohl eher als Ausdruck von Prunksucht und Realitätsverlust denn als Auszeichnung gegolten.
Die Zeiten ändern sich.
Auf den Garagenhöfen spielten wir Kinder – außer samstags, wenn sie für den Höhepunkt der Woche, jedenfalls den der Männer, in riesige Autowaschsalons verwandelt wurden, in denen in infernalischer Lautstärke WDR 2 »Sport und Musik« lärmte, mit den Livereportagen aus der Fußball-Bundesliga. Der Verbrauch an Autoshampoo war immens – der von örtlichen Brauereiprodukten ebenfalls.
Schräg hinter unserem Haus, in der Germaniastraße, zog sich ein kleiner Pfad durch eine große Brache mit üppigem Buschwerk, einem riesigen ockerfarbenen Luftschutzbunker, zunehmend verlassenen Industrieanlagen und standhaften alten Bäumen bis hin zum Tor der Zeche Wolfsbank, etwa drei-, vierhundert Meter Luftlinie entfernt. Dort stand, direkt neben dem Zecheneingang, ein unscheinbares Vierfamilienhaus. In ihm lebten meine Großeltern mütterlicherseits. Es war flankiert von Kohle- und Abraumhalden, die mir als Kind wie gemischtfarbige Gebirgsriesen daherkamen, obwohl sie gerade einmal ein paar Meter hoch waren.
Das Haus meiner Großeltern war ebenfalls graubraun, von schmutziger Luft verfärbt, sein Garten riesig. In ihm sprießte, was immer zum Gartenanbau geeignet war: Blumenkohl, Kartoffel, Salat und Gurke, Lauch, Karotte, Erbse, Bohne, Kohlrabi, Zwiebel, Rote Bete und Rhabarber, und natürlich bis in die Siebzigerjahre auch Tabak, der an der Lunge meines Opas mutmaßlich ähnliche Schäden anrichtete wie der Steinstaub aus seinen Untertagejahren. Das Klo lag zwischen zwei Etagen und war ein zugiger, ungeheizter Bretterverschlag, die Badestätte eine Zinkwanne im Waschkeller, der, ziemlich düster und modrig, eher ein Ort des Unbehagens denn der Säuberung für mich war.
Bis 2018, dem Jahr, in dem im Ruhrgebiet die letzte Zeche geschlossen wurde, sind dort nach Zahlen des Vereins »Statistik der Kohlenwirtschaft« 9 924 003 285 Tonnen Steinkohle gefördert worden. Das entspricht etwa 25 Mal dem Gesamtgewicht aller Menschen oder mehr als 60 000 Mal dem Gewicht des Kölner Doms.
Der Deutsche Bundestag hat bereits 2007 die CO2-Bilanzen verschiedener Energieträger von seinem eigenen wissenschaftlichen Dienst dokumentieren lassen. Demnach sind Stein- und Braunkohle, gerechnet auf eine bestimmte Strommenge, bis zu 100 Mal klima- und umweltschädlicher als Wasser- und Windenergie. Photovoltaik, die in der Herstellung einen durchaus erheblichen Fußabdruck produziert, ist um den Faktor 10 bis 15 umweltfreundlicher. Kernenergie schlägt trotz des Förder- und Transportaufwands für Uran fossile Brennstoffe ebenfalls um ein Vielfaches: Gas im Grundsatz um den Faktor 30, Kohle um den Faktor 50.
Der mütterliche Zweig meiner Familie lebte seit dem Kriegsende auf dieser Straße, die den Zecheneingang flankierte – mal ein paar Jahre fünfzig Meter weiter rechts, dann für ein paar Jahre wieder hundert Meter links herunter. Die Männer verdienten das Geld erst unter Tage, später in dem, was der Strukturwandel im Ruhrgebiet – nach knapp zehn Milliarden geförderten Tonnen Kohle – für Nichtakademiker bereithielt: irgendeine ungewohnte, meist weniger schmutzige und doch nur widerwillig erlernte Arbeit, eingeklemmt in der gigantischen Melange des Reviers – einer wirklich erstaunlichen Mischung aus allen Völkern, Industrien, Vorlieben und Lastern, frei von Chic und Chichi. Ich mag sie bis heute sehr. Walter Kempowski schrieb einmal: »Heimat ist der Ort der frühen Schmerzen und der späten Sehnsucht.« Nichts trifft mein Empfinden zum Ort meiner Geburt und meiner frühen Kindheit so genau.
Natur war in meiner Kindheit die Welt jenseits der Haustür. »Draußen« also. Draußen sein war der Höhepunkt meiner Tagesplanung und hieß: nass geregnet werden. Unter Büsche kriechen. Staub aufwirbeln. Dreckig (ich meine: so richtig dreckig) werden. Kettcar oder, später dann, Bonanzarad fahren. Freunde treffen, Feinde ärgern, zur Mutprobe Würmer am Stück verschlucken (sind nicht bissfest) und beim Fußballspielen auf irgendeiner Brache auch mal mit Schwung auf einem ordentlichen Hundehaufen ausrutschen (was nicht selten auf das Zweikampfverhalten der Gegenspieler erstaunlich dämpfend wirkte).
Draußen sein empfand ich als mehr oder minder selbstverständliche Begegnung mit der Welt in ihrer ursprünglichen, eben: ihrer für mich natürlichen Form. Mehr Natur und Wildnis als die Montanflächen und -brachen vor unserer Haustür waren undenkbar. Das zwischen mir und dem Wohnhaus meiner Großeltern nicht ein Quadratmeter von Menschen unbearbeitet geblieben, nicht ein Jota nicht industriell bewirtschaftet war, fiel mir damals – wie auch? – nicht auf. Und als wir nach ein paar Jahren, meinen Vater verschlug es beruflich dorthin, in ein kleines Dorf in Niedersachsen – »aufs Land« – zogen, da war ich einen Moment lang wirklich orientierungslos, weil die Fülle an Böden, Feldfrüchten und Tieren und der eklatante Mangel an Straßen- und Industrielärm erst einmal verarbeitet werden wollten.
Nach einiger Zeit begriff ich, dass auf dem Land mehr über als unter der Erde gearbeitet wurde. Das war neu und spannend, denn da konnte ich – anders als am Pütt – mitmachen. Ich hackte Rüben, mähte Gras, arbeitete ab und an bei einem Freund im Stall und lernte Getreide-, Gemüse- und Obstsorten, Himmelsrichtungen und Heumachen, Feldvögel und Greife. Ich grub, kletterte, rannte und baute, und ich spielte Fußball auf einem Rasenplatz, was im Ruhrgebiet allenfalls in den sehr privilegierten Wohngegenden denkbar (und damit zutiefst verpönt) gewesen wäre. Ich war ständig draußen, und überall war etwas Lebendiges. Und überall war immer wieder Stille. Und Wetter: Schneereiche, eiskalte Winter und heiße, trockene Sommer, wo mir das Wetter im Ruhrgebiet eigentlich noch nie so recht aufgefallen war.
Ich genoss diese andere Kindheit sehr. Ich mochte die Felder, die Bauernhöfe, diese geerdete Welt. Nur: Die Ruhe war kurz. Nach ein paar Jahren ging es zurück nach Essen, nach Borbeck, und wenn ich nicht meine Leidenschaft für das Laufen entdeckt hätte, das in der noch laufbandfreien Epoche allein im Freien sinnvoll zu leisten war – der Wandel der Jahreszeiten wäre mir bestenfalls früh- bis spätpubertär an der Menge der Kleidung meiner Mitschülerinnen aufgefallen. So weit war ich mit meinem Leben wieder von all dem entfernt, was im Ruhrgebiet wohlwollend unter »Natur« zu verstehen war.
Zum Studium verschlug es mich nach Tübingen, nach seinem Abschluss (ich studierte Jura, dazu ein bisschen Betriebs- und Volkswirtschaft) und der Promotion nach Aachen, einer Region, der ich bis heute mit einigen Unterbrechungen treu geblieben bin. Ich arbeitete mehr oder minder ununterbrochen, heiratete, wurde Vater und brachte es mit viel Fortune und dank wohlwollenden Mentoren alsbald auf ein für westliche Verhältnisse vielleicht nicht bahnbrechendes, aber fraglos sehr privilegiertes Lebensniveau. Aus Wohnungen wurden nach und nach Häuser. Die Häuser und die Autos wurden größer, die Autos schneller und stärker. Unsere Reiseziele wurden exotisch, und die Urlaube durchaus auch einmal opulent.
Wohlstand und Lebensqualität assoziierte ich mit materieller Sicherheit, wohl nicht ganz untypisch für meine Herkunft und meine Generation. Für diese Sicherheit war ich bereit, viel zu tun. Für mich und natürlich auch für meine Frau und unsere fünf Kinder. Es sollte uns »gut gehen«. Und gut ging es uns meinem Verständnis nach, wenn die wesentlichen Elemente unseres Lebens – das Wohnen, das Essen, die Reisen, die Ausbildung und Freizeitmöglichkeiten der Kinder – von stets ausreichender Quantität und guter oder bester Qualität waren.
Der Verbrauch von (natürlich auch inneren) Ressourcen für dieses Leben war beachtlich. Und doch: Die Frage, welche Wirkung mein, welche Wirkung unser familiärer Lebensstil auf das Ökosystem, in dem wir uns bewegten, haben würde, stellte sich mir nicht. Ökologie war nicht relevant. Nicht in unserer Familie, nicht in mir. Nicht weil ich nicht hätte erkennen können, dass drei Mal volltanken an einem Tag (von dem es viele gab) ein Unding an unserer Zukunft war, sondern weil sich die Frage nach der umweltbezogenen Angemessenheit meines Tuns nur sehr selten in mein Bewusstsein schob. Ökonomie und Soziales waren wesentlich wichtiger. Ein Stück weit hatte ich es früh »geschafft«, war beruflich wie sozial in der Wahrnehmung vieler Menschen durchaus erfolgreich – ein jedenfalls nicht unordentliches Mitglied der Gesellschaft, Vorstand und Geschäftsführer, Ehemann und Vater von fünf Kindern, Steuerzahler, dann Unternehmer, hie und da in Vereinen, Verbänden oder gemeinnützigen Organisationen und durchaus auch einmal für mehr als nur den Eigennutz engagiert. Kein schlechtes Leben – und allemal keines, das mir Freunde und Familie als kurzsichtig, ökologisch untragbar oder schlichte Sauerei vorgehalten hätten.
Die Vereinten Nationen streben in ihren 2015 vereinbarten Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) für das Jahr 2030 nach einer inklusiven, chancengerechten und hochwertigen Schulbildung, die zu relevanten und effizienten Lernergebnissen führt. Dies berührt zwei wesentliche Achsen der Pädagogik, nämlich den Zugang zur Bildung einerseits und den Inhalt und die Bildungsziele andererseits.
Nach dem Stand von heute zeigt sich ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen sozio-ökonomischer Entwicklung einer Gesellschaft und ihrem ökologischen Fußabdruck. Länder mit leistungsfähigen und vergleichsweise chancengleichen Bildungssystemen sind wirtschaftlich deutlich entwickelter (reicher) als Länder mit schwachen Bildungssystemen, weisen aber diesen gegenüber auch einen um ein Vielfaches höheren Fußabdruck ihrer Bevölkerung auf. Demnach wäre Bildung für die Ökologie kontraproduktiv. Infolgedessen nehmen die SDGs in der Ausgestaltung des Bildungsziels insbesondere auch die Lerninhalte in den Blick. Sie fordern eine Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, eine Weltbürgerschaftsausbildung und explizit eine weltweite Wertschätzung kultureller Vielfalt.
In kurzen Momenten des – oft erzwungenen – Innehaltens vom hektischen Alltag regte sich zumindest dann und wann ein wenig mein Gewissen: Jeden Freitag schleppte ich säckeweise unseren vermeintlichen Recyclingmüll vor die Tür, in der Regel ordentlich getrennt und doch in dem Wissen, dass die städtischen Entsorgungsunternehmen ihn überwiegend in Verbrennungsanlagen »thermisch verwerten«, also von uns genutzte Ressourcen final vernichten würden. Weihnachten stiegen die Aktienkurse der Verpackungshersteller allein schon wegen der Lkw-Ladungen voll Styropor und Plastik, in denen unsere Geschenke – nicht selten Dinge von kurzer Lebensdauer – gekauft oder geliefert worden waren. Die Mengen unserer Papier- und Restmüllproduktion waren atemberaubend, die Fleischberge auf den Tellern – ich bemaß mit einbrechender Pubertät der Jungs die Mengen nur noch in Kilogramm – ebenfalls. Beim Fahrtenbuchführen für mein Dienstauto endete die Jahresbilanz selten unter, oft weit über 60 000 Kilometern, und das Dröhnen der Flugzeugmotoren neben bunten Tanklastzügen auf dem Flughafenvorfeld ließ selbst in mir gelegentlich die Frage aufkommen, was eigentlich all das Kerosin mit unserer – gerade beim Fliegen gut erkennbar – dünnen Atmosphäre anrichtet.
Der weltweite Flugverkehr verbraucht pro Sekunde etwa 11 500 Liter Kerosin. Auf der Internetplattform globometer.com kann man solche Daten live verfolgen. Täglich sind dies mehr als eine Milliarde Liter, eine unvorstellbar große Menge. Binnen zweier Wochen könnten wir mit diesem Kerosin den Vierwaldstättersee und in etwa elf Monaten den Tegernsee füllen.
2018 gab es rund 38 Millionen Starts mit mehr als 4,4 Milliarden Passagieren. Bei einem Anstieg von knapp sieben Prozent wuchs die Menge der Flugkilometer auf 8,2 Billionen. Bis zum Jahr 2037 erwartet der Internationale Luftverkehrsverband eine knappe Verdoppelung der Fluggastzahlen auf 7,2 Milliarden jährlich.
Hinzu kam alle paar Jahre ein beruflich veranlasster Umzug, den ich als Student noch mit einem alten Golf, als Familienvater nunmehr schon mit einer Logistikflotte, die einem NATO-Herbstmanöver angestanden hätte, bewerkstelligte. Und obwohl ich mir stets zugutehielt, abzugeben, was ich nicht länger brauchte, auszusortieren, was überflüssig oder verbraucht war, und materiell insgesamt eher zurückhaltend unterwegs zu sein (lachen Sie nicht: Manch einer unserer Freunde fand unsere Wohnungen oder Häuser gar »kahl« oder »leer«), war die Menge an Dingen, die wir unser Eigen nannten, ein stetig wachsender Haufen an irgendwie Unerlässlichem. Das von der Werbung unterschwellig propagierte »Must have« als Mantra wirkte tadellos, und aus heutiger Perspektive bin ich manchmal sprachlos erstaunt, wie selbstverständlich sich mein Inneres für den Besitz jedes noch so groben Unfugs schnell eine tragfähige und widerspruchsfreie Begründung zurechtgebastelt hatte. Konsum braucht systematischen Selbstbetrug.
Ab Mitte vierzig jedoch kombinierten sich drei Dinge allmählich zu einer Mischung, die wie ein vorsichtiger Wachmacher in mir wirkten. Zum einen wurde die Erkenntnislage und die Berichterstattung zu Themen wie dem Artensterben, dem Klimawandel und der Umweltverschmutzung so erdrückend, dass selbst ich unter Aufbietung all meiner mir eigenen Ignoranz nicht verhindern konnte, das ein oder andere an Information dazu nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit der Seele aufzunehmen. Bilder von wuchernden Metropolen, brennenden Urwäldern, Meeren voller Müll und gewilderten Tieren mögen zwar mittlerweile alltäglich sein. Doch während ich sie lange und bequem um- und ausschalten, weglegen oder ausblenden konnte, erreichte mich als einzige Konstante zwischen all den sonstigen medialen Katastrophen der Themenstrom zu Umweltfragen zunehmend nicht nur beharrlich, sondern auch mit einer selbst für mich leicht auszumalenden Zukunftsperspektive. Und diese Perspektive war, so viel Grundrechnen und 1+1-Zusammenzählen schaffte ich dann doch noch, eher düster.
In den letzten fünfzig Jahren hat die Menschheit etwa 8,5 Milliarden Tonnen Plastik produziert, und der Ausstoß an Plastik wächst unverändert und rasant: Lag die jährliche Produktionsmenge von Kunststoff 1989 bei 100 Millionen Tonnen, erreichte sie schon 2002 200 Millionen. 2013 waren es 300 Millionen, seit Ende 2017 sind es mehr als 350 Millionen Tonnen. Ein Sechstel dessen (2017: 64,4 Millionen Tonnen) entfällt auf Europa.
Der überwiegende Teil des Plastiks befindet sich als Müll in der Umwelt. Bis zum Jahr 2050 wird der Plastikmüll weltweit voraussichtlich auf etwa zwölf Milliarden Tonnen ansteigen.
Würden wir den heute in der Umwelt, also den verstreut herumliegenden, in Gewässern treibenden oder vergrabenen Plastikmüll schreddern und so verdichten, dass wir ihn gut in Güterwaggons transportieren könnten, bestünde dieser Zug aus knapp einer Milliarde Transportwaggons von jeweils 30 Metern Länge. Er wäre etwa 25 Millionen Kilometer lang und würde mehr als dreißig Mal zum Mond und zurück reichen, oder gut 550 Mal um die Erde. Die Schienen für unseren Zug am Äquator entlang gelegt, stünden wir also auf einer Breite von rund zwei Kilometern vor schnaubenden Lokomotiven, die jeweils einen Äquator langen Güterzug mit Plastikmüll hinter sich herzögen – und das Ende der 550 Züge wäre direkt in unserem Rücken …
Diese Düsternis allein allerdings hätte mich angesichts meiner fortschreitenden Alterung (irgendwann würde ich sterben, also sei’s drum) womöglich wenig beeindruckt, wäre nicht ein zweiter, wohl entscheidender Umstand hinzugekommen: meine Kinder. Sie verlängern mein Leben über meine eigene Existenz hinaus. Ihnen gilt all meine Liebe und meine Sorge. Und: Von ihnen lerne ich.
Schon früh (und bis heute) pflegen meine Kinder eine Art selbstverständlicher Verachtung für viele materiell geprägte Dinge, die mir in vergleichbaren Lebensphasen unerlässlicher Lebensinhalt, ja nicht selten Mittelpunkt meines kurzfristigen Denkens geworden waren. Ein Beispiel: das Auto. Autos habe ich beim Kauf mit einer Akribie sondiert, getestet und beobachtet, ausgesucht, konzipiert, konfiguriert, kalkuliert und dann herbeigesehnt – hätte meine Frau sich mit der Partnerwahl so sorgfältig beschäftigt wie ich mich mit der Entscheidung für den nächsten Dienst-Pkw, ich wäre wohl heute noch unverheiratet.
Keines meiner Kinder hingegen besitzt ein Auto. Meine Kinder fahren mit dem Zug und den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn alle Stricke reißen auch einmal mit BlaBlaCar – das war’s. Sie haben kleine Wohnungen oder Zimmer, kaufen Secondhand (etwas, zu dem ich mich bis heute nicht durchringen kann), arbeiten überwiegend lieber sozial als kommerziell (oder gar nicht) und kommen auch gut fleischlos durch die Woche, wo ich über Dekaden – trotz großer Leidenschaft für das Kochen – nicht im Ansatz gewusst hätte, wie man ohne Fleisch ein brauchbares Menü gestalten könnte.
Der Fleischverbrauch





























