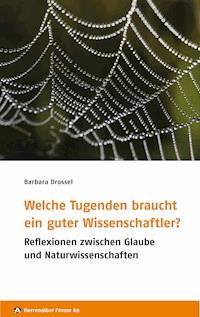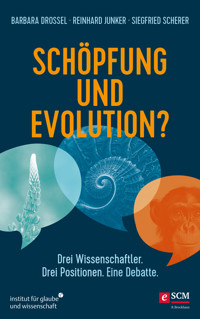
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SCM R. Brockhaus
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
»Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.« – Aber danach beginnt schon die Diskussion: Schuf er allein durch das Wort oder doch durch Evolution? Dauerten die sechs Tage wirklich 24 Stunden, obwohl die Sonne erst am 4. Tag erschaffen wurde und die Erde laut Wissenschaft in Milliarden Jahren entstanden ist? Und: Lassen sich wissenschaftliche Erkenntnisse heute überhaupt noch mit der Bibel vereinen? Drei Wissenschaftler diskutieren über das Verhältnis von Schöpfung und Evolution? – respektvoll und mit Interesse an der Meinung der anderen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 458
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BARBARA DROSSEL (Jg. 1963) ist Professorin für Theoretische Physik an der TU Darmstadt. Sie forscht an der mathematischen Modellierung biologischer Systeme und an Grundlagenfragen der Physik. Schon viele Jahre befasst sie sich mit dem Thema Glaube und Wissenschaft.
REINHARD JUNKER (Jg. 1956) studierte Mathematik, Biologie und Theologie und promovierte zur theistischen Evolution. Er arbeitete von 1985 bis 2021 bei der SG »Wort und Wissen« und befasst sich nach wie vor u.a. mit dem Design-Argument in der Biologie und mit paläontologischen Themen.
SIEGFRIED SCHERER (Jg. 1955) ist Professor an der TU München und leitete dort bis 2021 einen mikrobiologischen Lehrstuhl. Zurzeit arbeitet er an der kritischen Analyse von evolutionsbiologischen Modellen zur Entstehung von biomolekularen Maschinen.
»AM ANFANG SCHUF GOTT HIMMEL UND ERDE.«
Aber danach beginnt schon die Diskussion: Schuf er allein durch das Wort oder doch durch Evolution? Wie lange dauerten die Schöpfungstage wirklich? Was sagt die Naturwissenschaft zum Alter der Erde? Und: Lassen sich wissenschaftliche Erkenntnisse heute überhaupt noch mit der Bibel vereinen? Drei christliche Wissenschaftler diskutieren über das Verhältnis von Schöpfung und Evolution – respektvoll und immer mit Interesse an der Meinung der anderen.
Ein Debattenband, der dabei hilft, eine eigene Position zu finden und zu stärken.
BARBARA DROSSEL · REINHARD JUNKER · SIEGFRIED SCHERER
SCHÖPFUNGUNDEVOLUTION?
Drei Wissenschaftler.Drei Positionen. Eine Debatte.
Dieses Buch erscheint in der Reihe Glaube und Wissenschaft des INSTITUTS FÜR GLAUBE UND WISSENSCHAFT. Herausgeber der Reihe ist Dr. Alexander Fink.
SCM R.Brockhaus ist ein Imprint der SCM Verlagsgruppe, die zur Stiftung Christliche Medien gehört, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.
ISBN 978-3-417-27108-9 (E-Book)
ISBN 978-3-417-24183-9 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book: CPI Clausen & Bosse GmbH, Leck
© der deutschen Ausgabe 2024
SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH
Max-Eyth-Straße 41 · 71088 Holzgerlingen
Internet: www.scm-brockhaus.de | E-Mail: [email protected]
Soweit nicht anders angegeben, sind die Bibelverse in den Texten von Barbara Drossel und Siegfried Scherer folgender Ausgabe entnommen: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart (LUT)
Soweit nicht anders angegeben, sind die Bibelverse in den Texten von Reinhard Junker folgender Ausgabe entnommen:
Die Heilige Schrift übersetzt von Hermann Menge. (MENG)
Weiter wurden verwendet:
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, vollständig durchgesehene und überarbeitete
Ausgabe © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart (EÜ)
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen (ELB)
Bibeltext der Neuen Genfer Übersetzung. Copyright © 2009 Genfer Bibelgesellschaft, CH-1204 Genf. Wiedergegeben mit der freundlichen Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten.
(NGÜ)
Idee und wissenschaftliche Beratung: Dr. Alexander Fink, IGUW
Lektorat: Christiane Kathmann
Umschlaggestaltung: Sybille Koschera, Stuttgart
Titelbild: freepik
Satz: Burkhard Lieverkus, Wuppertal
Inhalt
Einleitung
Teil 1: Darstellungder eigenenPosition
Barbara Drossel
Gott erschafft durch Prozesse
Einleitung
1 Die Bibel und die Naturwissenschaften
2 Von Erdalter und Evolution
3 Schöpfung, Sünde und Tod in der Bibel
4 Evolution und fortschreitende Forschung
Reinhard Junker
Gott erschafft durch das Wort und nicht durch Evolution
Einleitung
1 Biblische Aspekte
2 Wissenschaftstheoretische Aspekte
3 Naturwissenschaftliche Aspekte
Schluss
Siegfried Scherer
Erschafft Gott durch Evolution und Design?
Einführung
1 Evolutionsbiologie
2 Das Phänomen Leben
3 Evolution, Weltanschauung und Bibel
Schluss – Naturbetrachtung und Gotteserkenntnis
Dank
Teil 2: Konstruktiv-kritischeStellungnahme zu den anderen beiden Positionen
Barbara Drossel
Was uns eint
Ist es wirklich denkbar, dass die Erde jung ist?
Wie ist die Bibel zum Thema »Schöpfung« auszulegen?
Ist die Grundtypentheorie haltbar?
»Experimentelle« versus »historische« Forschung
Was ist mit den »missing links«?
Sind Konvergenzen ein Problem für die Evolutionstheorie?
Ist Makroevolution de facto widerlegt?
Reduktionismus und Naturalismus
Wie entsteht Neues?
Ist Intelligent Design die Lösung?
Reinhard Junker
Eine Grundsatzentscheidung
Embryonalentwicklung und Evolution
Abstammung des Menschen
Evolution und Sündenfall
Gottes Wirken in der Evolution
Zum biblischen Schöpfungsbericht
Naturwissenschaftliche Aspekte
Daten und Deutungen
Überwältigende Belege für die Abstammung des Menschen?
Zum Design-Ansatz (»Intelligent Design«)
Zum Schluss
Siegfried Scherer
A. Kommentar zu Barbara Drossel
Das Alter der Welt
»Wie sich die Idee der biologischen Evolution durchsetzte«
»Von Menschen und Schimpansen«
Die biblischen Schöpfungstexte
Der Sündenfall und die Lehre von Paulus über den Tod
»Warum lässt Gott Tod und Leid zu?«
»Die drei Bedeutungen von ›Evolution‹«
»Wie Wissenschaft funktioniert«
»Warum das Thema wichtig ist«
B. Kommentar zu Reinhard Junker
Biblische Aspekte
Wissenschaftstheoretische Aspekte
Naturwissenschaftliche Kritik an Evolutionstheorien
»Schlagende Beweise« für Makroevolution?
Intelligent Design und Schöpfung
Kritische Anmerkungen zur kurzzeitkreationistischen Schöpfungslehre
Schlussbemerkung
Teil 3: Replik auf die Stellungnahmen
Barbara Drossel
Wie ist die Bibel zu lesen?
Wie viel Zweifel ist angebracht?
Embryonalentwicklung versus Evolution
Wie funktioniert Evolution?
Schlussgedanken
Reinhard Junker
Kosmologie und Geowissenschaften
Zu Fragen der Bibelauslegung
Zur Theodizee-Frage: Das Übel in der Schöpfung angesichts von Gottes Allmacht und Güte
Zur Grundtypenbiologie
Mensch und Schimpanse
Zu den »missing links«
»Schlagende Beweise«?
Konvergenzen
Wissenschaftstheoretisches
Intelligent Design
Warum innovative Evolution nicht funktioniert
Siegfried Scherer
1 Naturwissenschaftliche Aspekte
Die Interpretation von Grundtypen
Missing links
Evolutionäre Innovationen (Wie entsteht Neues?)
Wie geschieht Evolution?
Anomalien im Evolutionsparadigma
2 Wissenschaftstheoretische Aspekte
Evolution und Design (Schöpfung) als gleichartige, konkurrierende Erklärungsansätze?
Experimentelle versus empirisch-historische Forschung
Reduktionismus und Naturalismus
3 Biblische Aspekte
Wörtliches Verständnis der Schöpfungstexte
Kurzzeitkreationismus und Evangelium
4 Was ist am wichtigsten?
Literatur
Barbara Drossel
Reinhard Junker
Siegfried Scherer
Einleitung
Am Anfang …
… schuf Gott Himmel und Erde. Diesem allerersten Vers der Bibel stimmen wohl alle Christen1 (und nicht nur sie!) zu. Aber schon im zweiten Vers beginnen die Meinungsunterschiede: War oder wurde die Erde wüst und leer? Wie lange dauerten die sechs Schöpfungstage? Und wie sind diese zu verstehen? Waren es 24-Stunden-Tage, obwohl die Sonne erst am vierten Tag erschaffen wurde und die Naturwissenschaft uns Milliarden von Jahren als Alter für Universum und Erde nahelegt? Worin besteht eigentlich die Intention der Texte in Genesis 1 und 2? Haben sie eine Relevanz für heutige Modelle zur Geschichte des Kosmos, der Erde und des Lebens? Was kann uns Naturwissenschaft über die Schöpfung und die Geschichte des Universums sagen? Und mit welcher Gewissheit? Welche Rolle spielen dabei weltanschauliche Vorentscheidungen? Sowohl beim naturwissenschaftlichen Forschen als auch beim Auslegen der Bibel? Hat Evolution einen Schöpfer widerlegt oder lassen sich Evolution und biblisches Schöpfungszeugnis miteinander vereinbaren?
Nicht selten habe ich hitzige Gespräche zu diesen Fragen miterlebt und war manchmal sogar mittendrin. Leider laufen solche Gespräche oft nicht mit dem angebrachten Respekt ab. Ein Diskussionsteilnehmer wirft dem anderen vor, »kein echter Christ« zu sein, weil er die Unfehlbarkeit der Bibel »kompromittiere« – aber woran macht man fest, ob jemand ein »echter« Christ ist und welcher Mensch die Bibel unfehlbar richtig auslegt? Einem anderen wird vorgeworfen, kein »ernst zu nehmender« Wissenschaftler zu sein, weil er »seit Langem allgemein akzeptierte Tatsachen« hinterfrage – aber wo ist es in der Wissenschaftstheorie eigentlich verboten, Thesen zu hinterfragen und zu testen? Macht sich Wissenschaftlichkeit an einer Methodik oder einem Glauben fest? Um die eigene Meinung als richtig zu erweisen, schreckt man nicht davor zurück, Argumente aufzubauschen, gegnerische Ansichten falsch darzustellen, das eigene Wissen zu übertreiben usw. Am Ende solcher Diskussionen steht dann häufig nicht nur eine Meinungsverschiedenheit, sondern auch soziale Trennung. Man meidet den anderen als Person oder schließt ihn sogar aus bestimmten Gruppen aus. Es kommt zum Bruch.
In dieser Hinsicht ist die Debatte über Schöpfung und Evolution natürlich kein Einzelfall. Beispielsweise haben sich über der Frage nach der Realität und dem Gefahrenpotenzial des Corona-Virus und nach angemessenen Reaktionen darauf ganze Gemeinden gespalten. Die Gesellschaft polarisiert sich im Social-Media-Zeitalter immer schneller und das macht auch vor Christen nicht Halt.
Dabei müssen Spaltungen oder Trennungen natürlich nicht per se schlecht sein (in der Reformation zeigte sich exemplarisch, dass ein biblisches Verständnis von Glaube, Gnade und Errettung sich einfach nicht mehr mit der gängigen Lehrpraxis der damaligen Kirche vereinbaren ließ), vorausgesetzt, solche Spaltungen geschehen über den richtigen Streitfragen, nämlich primären Glaubensinhalten. Aber wir alle würden es wohl seltsam finden, wenn wir von einer Gemeindespaltung in den ersten Jahrhunderten lesen würden, die sich an der Interpretation biblischer Geschlechtsregister entzündet hätte, was wohl der Apostel Paulus in 1. Timotheus 1,3-4 im Blick gehabt haben dürfte. Warum sollte eine Gemeinde dafür ihre von Gott geschenkte Einheit aufgeben?
Das bedeutet natürlich ebenso wenig, dass Christen nicht auch unterschiedliche Meinungen zu wichtigen sekundären Themen haben und hier nach der Wahrheit fragen dürfen. Wie Gott die Welt erschaffen hat, ist ja eine weitreichende Frage, die auch Implikationen für unser Gottes- und Menschenbild hat.
Wer wäre nicht gern dabei gewesen, als Gott das Weltall ins Dasein rief und es im weiteren Verlauf zum ersten Auftreten des Menschen kam, oder würde gern den Dokumentarfilm im Kino sehen, am besten mindestens mit 3D-Brille und Dolby-Surround. Doch das ist nicht möglich, und wenn wir konstruktiv über Streitfragen ins Gespräch kommen wollen, benötigen wir die richtige Gesprächskultur. Dabei sollte klar sein, dass wir uns gegenseitig als im Ebenbild Gottes geschaffene, von Gott geliebte Personen annehmen – und darüber hinaus als Glaubensgeschwister, in dem Bewusstsein, dass wir auch die Ewigkeit miteinander verbringen werden.
Wir müssen Lernbereitschaft mitbringen und anderen auch mal zuhören, wenn sie längere Zeit in eine Richtung argumentieren, die wir nicht nachvollziehen können. Könnten wir nicht vielleicht auch dabei etwas lernen? Einem konstruktiven Dialog dient es, wenn wir offenlegen, von welchen Denkvoraussetzungen wir selbst ausgehen, wo wir selbst herkommen in unserem Verstehen und Denken, und wenn wir ehrlich die Grenzen unseres Nichtwissens zugeben. Darüber hinaus lohnt es sich, die Bedeutung von Begrifflichkeiten zu hinterfragen und zu klären (z.B. »Was genau meinst du mit ›Evolution‹ oder mit dem ›Handeln Gottes‹?«).
Darüber hinaus ist es wichtig, mit einer gewissen Ergebnisoffenheit an das Gespräch heranzugehen und nicht von vornherein zu erwarten, dass der andere die eigene Meinung übernimmt. Kurzum: Hilfreich sind Gespräche in Liebe, die sich in echtem Interesse, Respekt und Demut äußert.
Genau das wollen wir in diesem Buch versuchen. Ich habe drei Naturwissenschaftler, die sich öffentlich zum christlichen Glauben bekennen, gebeten, ihr (durchaus unterschiedliches) Verständnis biblischer Schöpfungstexte zu erklären und anschließend darüber ins Gespräch zu kommen.
Im ersten Teil stellen die drei Autoren ihre persönliche Auffassung dar. Dabei werden zunächst methodische Fragen geklärt, wie man mit biblischen Texten umgeht und wie man naturwissenschaftliche Daten interpretiert. Anschließend stellen die Autoren jeweils ihre Sichtweise auf Evolutionsbiologie sowie ihre Auslegung biblischer Schöpfungstexte dar und geben theologische, philosophische, naturwissenschaftliche und teils auch biografische Gründe für ihre Sicht an. Alle drei Darstellungen wurden gleichzeitig und unabhängig voneinander verfasst, ohne dass die Autoren schon aufeinander eingehen konnten.
Im zweiten Teil reagieren die drei Autoren auf die ihnen vorgelegten Ausführungen von Teil 1. In einem neuen Artikel gehen sie dabei auf die Thesen und Argumente der beiden anderen Autoren ein. Sie unterstreichen, wo sie sich einig sind, stellen manche Aussagen oder Definitionen infrage und erklären, warum sie anders denken. Es wird deutlich, dass die Bewertung von Argumenten auch stark mit unterschiedlichen Vorentscheidungen zu tun hat.
Im dritten Teil hat dann jeder Autor noch einmal die Gelegenheit, auf die in Teil 2 erfolgte Kritik durch die anderen beiden Mitautoren zu reagieren und seine eigene Position zu verteidigen.
Um es vorwegzunehmen: Die drei Autoren scheinen mir weitgehend bei ihrer ursprünglichen Auffassung geblieben zu sein, aber sie haben diese intensive, respektvolle Auseinandersetzung als bereichernd erlebt. Die Texte dieses Buchs fokussieren sich, wie der Titel schon sagt, vorwiegend auf die Unterschiede in den drei Positionen zum Verhältnis von Schöpfung und Evolution. Daher möchte ich im Sinne aller Autoren gleich zu Beginn klarstellen, dass die Gemeinsamkeiten in vielen anderen Fragen des christlichen Glaubens trotzdem überwiegen, auch wenn darauf in diesem Buch nicht die Betonung liegt. Der Glaube an den dreieinigen Gott, die Liebe und Faszination für seine Schöpfung, die Dankbarkeit für unsere Erlösung durch den Tod von Jesus am Kreuz und seine Auferstehung von den Toten verbindet alle drei stärker, als sie die Unterschiede in der Frage trennen, wie Gott den Kosmos geschaffen hat. Das Evangelium kann uns in die Lage versetzen, Unterschiede in Liebe auszuhalten und gemeinsam einen Weg zu gehen, so wie auch Jesus uns liebevoll in unserer Eigenart annimmt, obwohl er sicher nicht immer einer Meinung mit uns ist.
Doch wer sind die drei Autoren, die uns einen Einblick in ihre Position geben und miteinander ihre unterschiedliche Position diskutieren? Wir stellen sie in alphabetischer Reihenfolge vor, ebenso wie wir auch ihre Texte jeweils in dieser Reihenfolge sortiert haben. Schon die Biografien lassen uns eine interessante Debatte erwarten!
Barbara Drossel (geb. 1963) ist seit 2002 Professorin für Theoretische Physik an der TU Darmstadt. Nach ihrem Studium in München und Straßburg und ihrer Doktorarbeit an der TU München forschte sie sieben Jahre lang in den USA, in England und Israel, bevor sie die Stelle in Darmstadt antrat. In ihrer Forschung befasst sie sich mit der Modellierung biologischer Systeme, darunter Ökosysteme, Regulationsnetzwerke in der Zelle und Evolutionsprozesse. Hinzu kommen wissenschaftsphilosophische Themen wie die Interpretation der Quantenmechanik und Emergenz. Seit bald dreißig Jahren befasst sie sich mit dem Thema Glaube und Wissenschaft, ist dazu national und international vernetzt und hat viele Artikel und mehrere Bücher geschrieben. Manchmal fühlt sie sich dabei wie eine Kämpferin an drei Fronten: Die eine Front bilden atheistische Wissenschaftler, die aus der Wissenschaft materialistische Weltanschauungen ableiten; die zweite Front bilden Kreationisten, die das wissenschaftlich etablierte Alter der Erde nicht akzeptieren; die dritte Front bilden liberale Theologen, die nicht glauben, dass Jesus leibhaftig aus dem Grab auferstanden ist. Zum Glauben kam Barbara Drossel im Alter von 16 Jahren, als sie auf der Suche nach dem Sinn des Lebens war. Sie ist in einer Freien evangelischen Gemeinde aktiv und seit 34 Jahren glücklich mit ihrem Mann Michael verheiratet. Als sie noch nicht Long Covid hatte, waren ihre Hobbys Wandern, Radfahren, Klavierspielen, Lesen und Blog schreiben. Wenn Darmstadt 98 spielt, verfolgt sie normalerweise den Live Ticker.
Reinhard Junker (geb. 1956) studierte Biologie, Mathematik und Theologie, promovierte in Interdisziplinärer Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Leuven über »theistische Evolution« und arbeitete 36 Jahre lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Studiengemeinschaft Wort und Wissen, bei der er weiterhin ehrenamtlich aktiv ist. Seine Arbeitsschwerpunkte sind: fossile Überlieferung diverser Tier- und Pflanzengruppen, Design-Argumente und ihre Kritiker, Vergleichende Biologie und Wissenschaftstheorie. Während des Studiums kam er zum Glauben an Jesus Christus. Durch das Lesen der Bibel wurden ihm fundamentale Widersprüche zwischen der biblischen Heilsgeschichte und einer evolutionären Deutung der Geschichte des Lebens bewusst, was ihn dazu veranlasste, sich intensiv mit dem Thema »Schöpfung, Heilsgeschichte und Evolution« sowohl theologisch als auch naturwissenschaftlich zu beschäftigen. Daraus entstanden eine Reihe von Büchern und zahlreiche Artikel. Er wandert viel mit seiner Frau Christiane, am liebsten in den Alpen, und auch ihre fünf Kinder konnten sie dafür begeistern. Reinhard Junker führt sehr gerne botanische Exkursionen durch und freut sich, dass die Teilnehmer dadurch die Schöpfung mit ganz anderen Augen sehen und die Spuren des Schöpfers erkennen. Außerdem spielt er gerne Klavier und fotografiert Details in der Natur. Gemeindlich war er bis vor Kurzem in der Jugendarbeit tätig und ist in Hauskreisen aktiv.
Siegfried Scherer (geb. 1955) ist Professor an der TU München und leitete dort bis 2021 einen biologischen Lehrstuhl. Nach Studium und Promotion in Konstanz sowie Forschungsaufenthalten in China und den USA wurde er 1991 an das Wissenschaftszentrum Weihenstephan der TUM berufen. Dort arbeitete er in den Bereichen Lebensmittelmikrobiologie, Taxonomie und Evolution und wurde 2005 und 2016 mit dem Otto von Guericke-Forschungspreis ausgezeichnet. Seit seiner Emeritierung befasst er sich mit kritisch-konstruktiven Analysen der Evolutionsbiologie, unter anderem als Gastwissenschaftler am Weizmann-Institut in Rehovot (Israel). Schon als Student interessierte er sich für die Beziehung zwischen Glaube und Naturwissenschaft, insbesondere Evolution und Schöpfung. Darüber hat er auf populärer und fachlicher Ebene publiziert, dazu kommt eine umfangreiche apologetische Vortragstätigkeit. Schon als Doktorand war er bei der SG Wort und Wissen aktiv, hat sich jedoch später aus wissenschaftlichen und theologischen Gründen von dem dort vertretenen Junge-Erde-Kreationismus distanziert. Er ist Mitglied in der interkonfessionellen AGAPE-Gemeinschaft München und wirkt dort unter anderem im Predigtdienst mit. Seine Hobbys sind Wissenschaft und Gemeindearbeit. Bei schönem Wetter radelt er und mit seiner Frau Sigrid, die er im ersten Studiensemester kennenlernte, mit E-Bike und Pflanzenbestimmungsbuch durch die herrliche Naturlandschaft des bayerischen Voralpenlandes.
Ich bin Barbara Drossel, Reinhard Junker und Siegfried Scherer von ganzem Herzen dankbar, dass sie sich auf dieses Abenteuer eingelassen haben und diese schriftliche Diskussion trotz der vielen Verpflichtungen, Herausforderungen und sonstigen Tätigkeiten mit so viel Ehrlichkeit und Offenheit, Leidenschaft und Engagement und Respekt füreinander über ein Jahr lang geführt haben! Was wäre gewonnen, wenn wir eine solche Diskussionskultur auch generell wieder vermehrt in unserer Gesellschaft erleben würden?
Es ist mein Wunsch, dass dieses Buch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, hilft, die verschiedenen Positionen zu verstehen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Das darf sogar bedeuten, offene Fragen als solche zu benennen und stehen zu lassen. Und vielleicht kann diese Art des Diskurses auch Sie für zukünftige Streitgespräche inspirieren.
Eine gewinnbringende Lektüre wünscht
Dr. Alexander Fink
Leiter des Instituts für Glaube und Wissenschaft (IGUW)
Teil 1:Darstellung der eigenen Position
Barbara Drossel
Gott erschafft durch Prozesse
Einleitung
»Gott hat mich geschaffen«, davon sind die meisten Christen überzeugt. Die Verfasser der Bibel bekannten dies auch: »Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe«, schreibt David in Psalm 139,13. An dieser Überzeugung halten wir auch dann fest, wenn man uns sagt, dass die Entstehung eines Babys im Mutterleib wissenschaftlich erforscht wurde und inzwischen gut verstanden wird. Wir sehen hierin keinen Widerspruch dazu, dass Gott uns geschaffen hat. Den Prozess, den die Embryologen erforschen, interpretieren wir als das lebensschaffende Handeln Gottes, und wir sind fasziniert davon, wie großartig er sich die Entwicklung des Babys im Mutterleib ausgedacht hat.
Die Verfasser der Bibel beschrieben den Entstehungsprozess des Babys ganz anders, als wir das tun würden. David schreibt in Psalm 139,15, dass er »unten in der Erde« gebildet wurde und in Hiob 10,9 heißt es: »Bedenke doch, dass du mich aus Lehm gemacht hast.« Wie sollen wir angesichts der Wissenschaft diese Formulierungen verstehen? Wir lesen sie wahrscheinlich als bildhafte Beschreibung dafür, dass wir alle aus irdischem Material gemacht sind.
Auch der Verweis auf die Rolle des Zufalls bei der Entstehung eines Babys bringt uns nicht von dem Glauben ab, dass Gott uns geschaffen hat. Wir erkennen zwar an, dass der Zufall darüber entscheidet, welche Gene der Eltern in jede Ei- bzw. Samenzelle kommen und welche Samenzelle das Ei befruchtet, aber wir glauben, dass Gott der Herr über den Zufall ist und in all dem seine Ziele verfolgt.
Am meisten fordert uns wahrscheinlich der Hinweis heraus, dass bei der Entstehung eines Babys vieles schiefgehen kann: Ungefähr ein Drittel der befruchteten Eier sterben, ohne sich in die Gebärmutter einzunisten, oder sie nisten sich zwar ein, aber die Frauen erleiden eine Fehlgeburt. Es gibt Chromosomenaberrationen wie Trisomie 21 (Down-Syndrom) und Fehlentwicklungen wie siamesische Zwillinge. Dies stößt uns auf die Frage nach der Herkunft des Leids und erinnert uns daran, dass die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist und sich nach Erlösung sehnt, wie Paulus in Römer 8,21-23 schreibt.
Mit diesem Beispiel der Embryonalentwicklung sind im Kleinen die wichtigen Themen und Fragen angesprochen, um die es auch im Großen bei der Entwicklung des Universums, der Erde und des Lebens auf der Erde geht: In welchem Verhältnis stehen Gottes schaffendes Handeln und die naturgesetzlichen Abläufe zueinander? Wie passen wissenschaftliche Erkenntnisse über die Entstehung des Universums sowie des Lebens und Bibeltexte über die Schöpfung zusammen? Wie lässt sich Gottes Allmacht und Güte mit der Allgegenwart von Leid und Tod vereinbaren?
In meinem Buchbeitrag werde ich auf diese Fragen eingehen und zeigen, dass die etablierten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die lange Geschichte des Universums und der Erde mit der Botschaft der Bibel nicht in Konflikt stehen. Letztlich kommen ja beide, die von der Wissenschaft erforschte Welt und die Bibel, von Gott. Diese Überzeugung steht auch am Beginn der modernen Wissenschaft.
1 Die Bibel und die Naturwissenschaften
Es gibt eine lange Tradition, die Natur mit einem Buch zu vergleichen. Frühe Naturwissenschaftler der Neuzeit wie Francis Bacon (1561–1626), Galileo Galilei (1564–1642) und Michael Faraday (1791–1867), die gläubige Christen waren, sprachen daher davon, dass Gott uns zwei Bücher gegeben hat: das Buch der Natur und das Buch der Bibel. Die Natur zeigt uns die Werke Gottes, die Bibel bringt uns das Wort Gottes. Weil beide Bücher denselben Autor haben, können sie einander nicht widersprechen, wenn wir sie richtig lesen und auslegen. Die Natur »lesen« wir, indem wir sie erforschen.
Die beiden Bücher
Es ist für mich als Naturwissenschaftlerin ein großes Privileg, dass ich Gottes Schöpfung erforschen und etwas über die Gesetze und Prinzipien lernen darf, nach denen er die Natur eingerichtet hat. Ich zitiere hierzu gerne Psalm 111,2: »Groß sind die Werke des HERRN; wer sie erforscht, der hat Freude daran.« Johannes Kepler (1571–1630) begründete unsere Fähigkeit, die Natur zu erforschen, damit, dass wir Gottes Ebenbild sind. Im Jahr 1599 schrieb er in einem Brief: »Jene Gesetze liegen innerhalb des Fassungsvermögens des menschlichen Geistes; Gott wollte sie uns erkennen lassen, als er uns nach seinem Ebenbild erschuf, damit wir Anteil bekämen an seinem eigenen Gedanken.«2 Warum unser begrenztes Gehirn die Naturgesetze entdecken und verstehen kann, ist für jemanden, der nicht an Gott glaubt, schwer zu begründen. Einstein sagte einmal: »Das Unverständlichste am Universum ist im Grunde, dass wir es verstehen.«
Weil unser Verstand und unsere Fähigkeit, zu forschen, von Gott kommen, dürfen wir den Ergebnissen unserer Forschung vertrauen, wenn sie sich gründlich genug bewährt haben. Gott führt uns nicht in die Irre und täuscht uns nicht, wenn wir beim Blick in die Tiefen des Universums und in die geologischen Schichten unserer Erde die Spuren einer viele Millionen, ja Milliarden Jahre langen Geschichte sehen. Von der Entdeckung dieser Geschichte, bei der christliche Geologen und Kosmologen eine führende Rolle spielten, werde ich weiter unten berichten.
Anders als das Buch der Natur teilt uns die Heilige Schrift diejenigen Dinge mit, die unser Verstand nicht aus eigener Kraft erkennen kann, ja die ihm sogar töricht erscheinen (1. Korinther 1,18). Sie erzählt von unserer Verlorenheit und Gottes Erlösungsplan, der mit der Geschichte vom Sündenfall am Anfang der Bibel beginnt und mit Gottes neuer Schöpfung im letzten Buch der Bibel endet. Im Zentrum steht die Offenbarung Gottes in Jesus mit seiner Lehre und seinem Wirken, seinem Leiden, Sterben und Auferstehen.
Die Bibel sagt uns, dass die Welt, die wir wissenschaftlich erforschen, Gottes Schöpfung ist. Sie beschreibt Gottes Schaffen im ersten und zweiten Kapitel, aber auch an anderen Stellen. Eine Reihe von Christen sehen einen Konflikt zwischen dem, was die Bibel über die Erschaffung der Welt sagt, und dem, was die etablierte Wissenschaft herausgefunden hat. Dieser Eindruck eines Konflikts wird verstärkt, wenn in populärwissenschaftlichen Sendungen oder Büchern behauptet wird, die Wissenschaft habe gezeigt, dass wir Menschen ein Produkt des Zufalls sind und dass es hinter der Geschichte des Universums und des Lebens keinen Plan, kein Ziel und keinen Sinn gibt.
Wir werden diese Behauptungen weiter unten hinterfragen. Sind sie wirklich das Ergebnis wissenschaftlicher Forschung oder sind sie Grenzüberschreitungen? Ebenso müssen wir aber auch manche Bibelinterpretationen hinterfragen. Wie sind die Bibeltexte über die Schöpfung, über Adam und Eva, den Sündenfall und den Tod zu verstehen? Wie haben die damaligen Leser sie verstanden? Was ist die Botschaft dieser Texte? Ein historisches Beispiel, aus dem wir viel lernen können, ist die Auseinandersetzung um die Lehre des Kopernikus, dass die Erde um die Sonne kreist.
Die Bibel und die Planetenbahnen3
Galileo Galilei wurde im Jahr 1633 von der katholischen Kirche gezwungen, die Lehre, dass die Erde um die Sonne kreise, zu widerrufen, und danach bis an sein Lebensende unter Hausarrest gestellt. Das alte, geozentrische Weltbild war seit 2000 Jahren eine unumstößlich scheinende, unmittelbar durch die Anschauung belegte Tatsache. Es war nicht nur in der Kirche, sondern auch an den Universitäten, im philosophischen Denken und im Naturverständnis fest verankert. Dass die Erde sich bewegt, schien gegen jede Vernunft. In der Natur konnte man Folgendes beobachten: Ein Gegenstand, der von einem Turm fällt, kommt direkt unterhalb des Anfangspunkts seines Falls auf. Nun argumentierte man: Wenn die Erde sich bewegen würde, müsste er seitlich davon entfernt aufkommen, weil die Erde sich ja während des Falls unter ihm weiterbewegt hätte. Inzwischen wissen wir natürlich, dass diese Argumentation nicht stimmt, doch damals kannte man das Trägheitsgesetz (das erste Newtonsche Gesetz) noch nicht. Außerdem glaubte man, jeder Fixstern müsse am Himmel eine kleine scheinbare Kreisbahn beschreiben, während die Erde einmal um die Sonne wandert. Man sah aber keine solchen Kreisbahnen. Der Gedanke war an sich korrekt, aber dass die Fixsterne so weit von der Erde entfernt sind, dass das Auge die Kreisbahnen nicht erkennen kann, konnte man sich damals nicht vorstellen.
Neben diesen naturwissenschaftlichen Argumenten gab es philosophische Argumente: Seit Aristoteles war man davon überzeugt, dass der Kosmos zwei verschiedene Bereiche hat: den ewigen, unveränderlichen und vollkommenen Bereich jenseits der Sphäre des Mondes, und den vergänglichen, veränderlichen, verdorbenen Bereich innerhalb dieser Sphäre und insbesondere auf der Erde. Die Hölle wurde im Inneren der Erde angesiedelt, der Himmel jenseits der Fixsternsphäre. Es schien offensichtlich, dass fallende Gegenstände sich deshalb zur Erde hinbewegen, weil sie aus irdischem Material gemacht sind und die Erde daher ihr natürlicher Aufenthaltsort ist.
Die Bibel scheint dieses Weltbild in einigen Versen zu unterstützen:
• Psalm 19,7: Die Sonne »geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende«. (Also: Die Sonne kreist um die Erde.)
• Psalm 93,1: »Fest steht der Erdkreis, dass er nicht wankt.« (Also: Die Erde bewegt sich nicht.)
• Josua 10,12-13: Josua sprach: »Sonne, steh still zu Gibeon … Da stand die Sonne still«. (Also: Die Sonne bewegt sich entlang des Firmaments.)
• Epheser 4,9-10: Jesus ist »hinabgefahren in die Tiefen der Erde … aufgefahren über alle Himmel«. (Also: Das Totenreich ist im Inneren der Erde, der Himmel oberhalb der Sterne.)
Wir sehen also, wie das alte, geozentrische Weltbild felsenfest stand, gestützt durch Anschauung, physikalische Vorstellung, philosophische Konzepte, jahrhundertealte Tradition und Bibelinterpretation. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass es 150 Jahre dauerte, bis sich das neue Weltbild etablierte.
Anfangs gab es vor allem mathematische, ästhetische Argumente für das neue Weltbild: Die Bahnen der Planeten werden einfacher, wenn man davon ausgeht, dass sich alle Planeten, auch die Erde, um die Sonne bewegen. Erst nach Erfindung des Fernrohrs zu Beginn des 17. Jahrhunderts kamen immer mehr empirische Belege dazu: Galilei entdeckte, dass der Jupiter von mindestens vier Monden umkreist wird und dass die Venus genau wie unser Mond zu- und abnehmende Phasen hat. Beides weckte Zweifel an der Vorstellung, dass alle Himmelskörper ausschließlich um die Erde kreisen. Das Fernrohr machte auch Flecken auf der Sonne und Krater auf dem Mond sichtbar und zeigte, dass die Welt außerhalb der Erde nicht rein und perfekt ist. Als schließlich Isaac Newton das Gravitationsgesetz entdeckte und zeigte, dass mit ihm alle Planetenbahnen berechnet werden können, wurden die letzten Zweifel ausgeräumt.
Die Christenheit musste sich an den Gedanken gewöhnen, dass die Erde nun zu einem himmlischen Gestirn, gleichberechtigt mit den anderen Planeten, avancierte. Man musste lernen, die wichtigen Inhalte des Glaubens von den konkreten, zeitgebundenen Vorstellungen zu trennen, die man sich dazu gemacht hatte. Das war freilich nichts völlig Neues. Die Kirchenväter hatten schon immer die verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten der Bibel betont. Augustinus hatte bereits um das Jahr 400 davor gewarnt, im Namen der Bibel Aussagen über die Gestirne zu machen, von denen gelehrte Menschen wissen, dass sie falsch sind. Dadurch würden diese Menschen vom Glauben abgehalten. Die Reformatoren des 16. Jahrhunderts dachten ähnlich: Sie betrachteten die Bibel als letztgültige Autorität in Fragen des Glaubens und der Lebensführung, aber nicht in Bezug auf alle Fragen. Der Reformator Calvin betonte, dass man sich nicht an die Bibel wenden sollte, wenn man Astronomie lernen wolle. Galileo sagte in der Diskussion mit der katholischen Kirche, dass die Bibel uns nicht lehre, wie die Himmel gehen, sondern wie wir zum Himmel gehen. Er meinte, die Formulierungen in der Bibel seien dem Verständnis und den Vorstellungen ihrer Zeit angepasst.
Doch zu Galileos Zeit waren diese Aussagen der Kirchenväter und Reformatoren zum Teil in Vergessenheit geraten, und es gab sowohl in der evangelischen als auch in der katholischen Kirche ein Festhalten am wortwörtlichen Verständnis der Bibelverse über Sonne und Erde. In protestantischen Kreisen lag das daran, dass man das Prinzip »sola scriptura« (allein die Heilige Schrift) der Reformatoren auch auf nicht die Heilsbotschaft betreffende Aussagen anwandte. In katholischen Kreisen hielt man im Kampf gegen die Reformation an der Tradition und damit am bisherigen Bibelverständnis fest.
Heutzutage gibt es wohl nur wenige Christen, die einen Widerspruch zwischen der Bibel und der Erkenntnis sehen, dass die Erde um die Sonne kreist. Uns allen ist klar, dass die Sprache, in welche die biblische Botschaft gefasst ist, nicht gleichzusetzen ist mit der Botschaft selbst. Bei dem obigen Vers aus Psalm 19 soll die Herrlichkeit der Schöpfung und die Pracht der Sonne gepriesen werden, es soll nicht die Lehre vermittelt werden, dass die Sonne um die Erde läuft, auch wenn der Schreiber sich dies bestimmt so vorgestellt hat. Bei dem Vers aus Psalm 93 geht es darum, dass Gottes Schöpfung stabil und beständig ist. Der Schreiber drückt dies in der Vorstellung seiner Zeit aus, dass die Erde auf einem soliden Fundament ruht.
2 Von Erdalter und Evolution
Die Entdeckung, dass die Erde um die Sonne kreist, war der Anfang einer Serie von wissenschaftlichen Entdeckungen, die dazu herausforderten, das bisherige Bild vom Kosmos und eine beliebte Lesart bestimmter Bibelstellen zu hinterfragen. Die Geschichte dieser Entdeckungen werde ich in den nächsten fünf Teilkapiteln darlegen.
Wie man entdeckte, dass die Erde alt ist4
Bis ins 18. Jahrhundert hinein überwog in Europa die Vorstellung, dass die Erde und die Menschheit ungefähr gleich alt seien. Man dachte, die Erde und ihre Flora und Fauna seien von Anfang an so gewesen, wie sie heute sind. Dies ist nur menschlich und natürlich: Wir alle tendieren dazu, zu denken, dass etwas immer schon so war, wie wir es gewohnt sind. Das Alter der Erde schätzte man auf einige tausend Jahre. Doch es gab auch andere Vorstellungen. Der Philosoph Aristoteles meinte zum Beispiel, die Erde sei ewig. Wissenschaftliche Erkenntnisse zum Alter der Erde gab es bis in die Neuzeit nicht.
Die geologische Erforschung der Erde begann in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Der Däne Nicolaus Steno formulierte als Erster das stratigrafische Prinzip, dass Gesteinsschichten eine zeitliche Abfolge widerspiegeln, wobei die jüngeren Schichten über den älteren abgelagert wurden. Man rätselte damals über die Natur von Fossilien und kam schließlich im frühen 18. Jahrhundert zu dem Konsens, dass sie Überreste früherer Lebewesen sein müssen. Dabei fragte man sich, wie Meeresfossilien hoch in den Bergen entstehen konnten. Viele Naturforscher erklärten das durch die Sintflut. Doch es gab auch den Vorschlag, dass diese Fossilien auf normaler Meereshöhe entstanden waren und der Meeresboden später durch Erdbeben zu Bergen angehoben wurde, während sich anderswo die Erde absenkte. Manche Forscher stellten damals die These auf, dass nicht nur Meeresfossilien hoch in den Bergen, sondern alle geologischen Schichten und Fossilien durch die Sintflut abgelegt worden seien. Aber man erkannte recht bald, dass dies nicht möglich ist, da weder die Menge des Materials noch die Anordnung der Fossilien sich durch eine einzige Flut erklären lässt – es sei denn, man würde eine Kette von Wundern annehmen. Um das Jahr 1750 herum war daher die »Flutgeologie« zu einer Minderheitenmeinung geworden.
Um das Jahr 1800 war man in der Geologie zur Erkenntnis gelangt, dass die Erde sehr viel älter sein muss, als man bis dahin gedacht hatte, nämlich viele Millionen oder gar Milliarden Jahre. Die verschiedenen Gesteinsschichten erzählen davon, dass die Erde eine lange und wechselvolle Geschichte hat und dass viele Gebiete der Erde sowohl mehrfach Landoberfläche als auch mehrfach vom Meer bedeckt waren. Über die Natur der Prozesse, welche die Schichten geformt haben, war man sich jedoch noch nicht einig: Die einen vertraten die These, dass praktisch alle geologischen Schichten durch Wasser abgelagert wurden, die anderen meinten, dass viele Gesteine aus geschmolzener Lava gebildet wurden. In den folgenden Jahrzehnten erkannte man, dass sowohl Sedimentation im Wasser als auch Lavaflüsse Gesteinsschichten erzeugt haben.
Im frühen 19. Jahrhundert machte William Smith, ein Kanalingenieur, in Südengland die Entdeckung, dass in den einzelnen Schichten jeweils unterschiedliche Sorten von Fossilien dominieren, und dass dieselbe Schicht an verschiedenen geografischen Orten die gleichen Fossilien enthält. Etwa zur selben Zeit machten auch einige andere Geologen diese Entdeckung. In der Folge zeigte sich, dass anderswo in Europa und in anderen Kontinenten die Abfolge der Fossilien mit den geologischen Schichten dieselbe ist: Trilobiten treten in tieferen Schichten auf als Meeresreptilien, Dinosaurier immer über den ersten Landpflanzen, Insekten und Amphibien. Die ersten Farne findet man in tieferen Schichten als die ersten Blütenpflanzen usw.
Solch ein durchgängiger Befund wirft die Frage nach der Ursache der Veränderungen in Flora und Fauna von einer Schicht zur nächsten auf. Die Mehrzahl der Geologen vertraten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Auffassung, dass Katastrophen alte Spezies vernichtet hätten. Zunächst dachte man an Fluten, doch dann wurden auch Gletscher, Erdbeben und Vulkanausbrüche für katastrophale Veränderungen verantwortlich gemacht. Man meinte, dass neue Arten danach von anderswo einwanderten oder dass Gott neue Arten schuf, die an die jeweilige veränderte Umgebung angepasst waren. Es gab zwar vor Darwins Buch auch schon evolutionäre Ideen (z.B. von Lamarck), doch diese schienen vielen damaligen Geologen nicht zum empirischen Befund zu passen. Während in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die »Katastrophisten« dominierten, gewannen in der zweiten Hälfte die »Uniformisten« die Oberhand. Diese meinten, die geologischen Schichten seien durch sehr langsame, gleichförmige Prozesse gebildet worden. Im Laufe des 20. Jahrhunderts schließlich setzte sich die Erkenntnis durch, dass es beide Arten von Prozessen gegeben hat. Inzwischen kann man auch ganz gut unterscheiden, welche Schicht durch welchen Prozess entstanden ist.
Die meisten prominenten Geologen des 19. Jahrhunderts waren überzeugte Christen (z.B. Georges Cuvier, William Buckland, Adam Sedgwick und John Fleming) und ihre Erkenntnisse wurden von ihren jeweiligen Kirchen akzeptiert. Selbst die führenden evangelikalen Theologen nahmen deshalb die Schöpfungstage der Bibel nicht mehr wortwörtlich. Es hatte im Judentum und im Christentum schon immer eine Vielfalt von Interpretationen der Schöpfungstage gegeben. Allerdings war in den Jahrzehnten vor den geologischen Entdeckungen ein wortwörtliches Verständnis weit verbreitet. Dieses Verständnis geriet nun ins Wanken. Es gab im Wesentlichen drei verschiedene Ansätze, das hohe Alter der Erde mit dem ersten Kapitel der Bibel zusammenzudenken.
Die Lückentheorie (»Gap Theory«)
In der Lückentheorie wird zwischen dem ersten und zweiten Vers der Bibel eine zeitliche Lücke angenommen. Der zweite Vers wird dann übersetzt mit »Und die Erde wurde wüst und leer« (statt »sie war wüst und leer« – rein linguistisch ist beides möglich). Man geht dabei davon aus, dass nach der ursprünglichen, in Vers 1 erwähnten Schöpfung (»Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde«) eine Katastrophe passierte, und dass die ab Vers 3 berichteten sechs Schöpfungstage eine Neuschöpfung beschreiben. Die Lückentheorie erfuhr viel Aufmerksamkeit, als sie im Jahr 1917 in die einflussreiche Scofield-Bibel aufgenommen wurde.
Auch wenn diese Theorie mit einem hohen Erdalter verträglich ist, passt sie nicht so richtig zum geologischen Befund, da sich die Katastrophe vor der angenommenen Neuschöpfung in den fossilen Schichten zeigen müsste. Außerdem ist die Lesart »wurde« statt »war« nicht die naheliegende Lesart des hebräischen Originaltextes.
Die Tag-Zeitalter-Theorie (»Day-Age Theory«)
In der Tag-Zeitalter-Theorie werden die Schöpfungstage als längere Zeiträume aufgefasst. Eine beliebte Aussage aus der Bibel hierzu ist: »Vor Gott sind tausend Jahre wie ein Tag« (Psalm 90,4). Außerdem weist man darauf hin, dass im Alten Testament das hebräische Wort für »Tag« nicht immer im Sinne eines 24-Stunden-Tages verwendet wird, sondern weiter gefasst ist.
Diese Interpretation hat einiges für sich. Doch wenn man die sechs Schöpfungstage als sechs aufeinanderfolgende Zeiträume interpretiert, entspricht dies nicht durchgängig dem geologischen Befund: Zum Beispiel werden im Bibeltext die Vögel vor den Reptilien geschaffen, doch in den geologischen Schichten ist die Reihenfolge umgekehrt. Wir sehen also auch bei dieser Interpretation, dass der Versuch, die modernen wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Bibel wiederzufinden, nicht wirklich gelingt.
Die schematische Sicht (»Framework View«)
Schon der Kirchenvater Augustinus war der Auffassung, dass die sechs Schöpfungstage als ein Gliederungsschema und nicht als aufeinanderfolgende Zeitabschnitte zu verstehen sind. Heutige Theologen weisen zur Unterstützung der schematischen Sicht auf die Gliederung der sechs Tage in zwei Dreiergruppen hin: An den ersten drei Tagen werden Trennungen vollzogen und dadurch Räume geschaffen. An den zweiten drei Tagen werden diese geschaffenen Räume in derselben Reihenfolge bevölkert, in der sie geschaffen wurden (siehe Abschnitt 3. für mehr Details). Dies stützt die Sicht, dass die vorgenommene Einteilung in sechs Schöpfungstage ein Stilmittel ist, um Gottes Handeln bei der Schöpfung zu bezeugen, und dass es nicht in erster Linie darum geht, den chronologischen Ablauf der Naturgeschichte zu erzählen.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vertraten die meisten gläubigen Geologen entweder die Lückentheorie oder die Tag-Zeitalter-Theorie. Darwins Buch »On the Origin of Species« war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschrieben, es wurde erst 1859 veröffentlicht, und evolutionäre Ideen waren noch eine Minderheitenmeinung. Das sollte sich bald ändern, doch das Thema »Evolution« werde ich später behandeln und hier stattdessen noch erzählen, wie es gelang, das Alter der Erde genauer zu bestimmen.
Lord Kelvin, der wesentlich an der Entwicklung der Thermodynamik beteiligt war, benutzte die Beobachtung, dass die Erde immer heißer wird, je tiefer man unter die Oberfläche geht. Er vermutete deshalb, dass die Erde anfangs aus flüssigem Gestein bestanden hat, und berechnete, wie die Temperatur an und unter der Erdoberfläche sich mit der Zeit ändert, wenn ein am Anfang einheitlich heißer Planet abkühlt. Durch den Vergleich mit dem heutigen Temperaturprofil folgerte er, dass die Erde einige zehn Millionen Jahre alt ist. Damit waren die Geologen seiner Zeit jedoch nicht glücklich, da sie an ein deutlich höheres Alter glaubten.
Heute wissen wir, dass Kelvins Rechnung auf falschen Annahmen beruht. Er dachte nicht daran, dass das Gestein im Erdmantel in Bewegung ist und dadurch Wärme aus dem Erdinneren in die Nähe der Oberfläche transportiert. Wenn man diese Konvektionsströme berücksichtigt, bleibt die Erdoberfläche viel länger warm. Kelvins Assistent John Perry berechnete schon im Jahr 1895, dass die Erde folglich mehrere Milliarden Jahre alt sein kann.
Eine genaue Bestimmung des Alters der Erde und der verschiedenen geologischen Schichten wurde erst durch die Entdeckung der Radioaktivität und die Entwicklung der radiometrischen Datierung möglich. Inzwischen wissen wir, dass die Erde rund 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Dieses Alter wurde mithilfe verschiedener radiometrischer Methoden bestimmt, die alle zum gleichen Ergebnis kommen. Es passt auch sehr gut zu dem, was wir durch Überlegungen über das Alter der Sonne folgern können: Wenn man ausrechnet, wie lange ein Stern von der Größe der Sonne durch das Verbrennen von Wasserstoff zu Helium leuchten kann, kommt man auf ungefähr zehn Milliarden Jahre. Da unsere Sonne irgendwo in der Mitte ihres Lebens ist, ergibt dies also ein ähnliches Alter wie das der Erde, aber auf ganz anderem Wege. Dies bringt uns zu der Frage, wie man das Alter des Universums bestimmen kann.
Wie selbst Atheisten vom Urknall überzeugt wurden5
Nachdem man entdeckt hatte, dass die Erde Milliarden von Jahren alt ist, war klar, dass das Universum mindestens genauso alt sein muss. Bis in die 1960er-Jahre waren viele Wissenschaftler der Überzeugung, dass das Universum schon immer existiert hat, also keinen Anfang hatte. Einen plötzlichen Anfang empfand man als unästhetisch, denn die Naturgesetze schienen zeitlos gültig zu sein. Insbesondere wer glaubte, dass außer dem Universum nichts weiter existiert, musste eigentlich folgern, dass es ewig ist, denn es kann ja dann nicht durch etwas (oder jemand) anderes verursacht worden sein.
Die Kosmologie als Wissenschaft begann mit Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie, die 1915 veröffentlicht wurde. Diese Theorie formuliert den Zusammenhang zwischen Raum, Zeit, Materie, Energie und Gravitation, und sie hat sich in vielfältigen experimentellen Messungen bewährt. Die früheste und vielleicht bekannteste dieser Messungen ist der Nachweis der Ablenkung von Lichtstrahlen von Sternen im Gravitationsfeld der Sonne während der totalen Sonnenfinsternis 1919, die von Einstein vorhergesagt worden war. Weitere berühmte Bestätigungen von Vorhersagen der Allgemeinen Relativitätstheorie sind der Nachweis von schwarzen Löchern und die Detektion von Gravitationswellen.
Schon bald nach Veröffentlichung seiner Theorie begann Einstein damit, sie auf das Universum als Ganzes anzuwenden. Er nahm dafür an, dass das Universum überall gleich aussieht, wenn man es auf einer genügend vergröberten Skala betrachtet. Dabei zeigten seine Rechnungen, dass das Universum nicht stabil sein kann: Es müsste kollabieren, weil die Gravitationskraft alle Sterne und Galaxien zueinander hinzieht. Um das zu verhindern, führte Einstein seine »kosmologische Konstante« ein, eine Art Anti-Gravitation, die das Universum auseinandertreibt. Wenn diese genau den umgekehrten Wert wie die Anziehungskraft hätte, bliebe das Universum statisch und unverändert.
Alexander Friedmann war der erste Physiker, der in einem Fachartikel diskutierte, was passieren würde, wenn man die kosmologische Konstante weglässt. Er zeigte, dass das Universum nicht unbedingt kollabieren muss: Wenn es am Anfang eine genügend große Ausdehnungsgeschwindigkeit hat, reicht die Gravitationskraft nicht aus, diese Ausdehnung auf null zu verlangsamen und dann umzukehren. Das ist so, wie wenn man einer Rakete so viel Anfangsgeschwindigkeit gibt, dass sie dem Gravitationsfeld der Erde entkommt und nicht wieder zur Erde zurückkehrt. Ein solches sich ausdehnendes Universum wird mit der Zeit immer größer und alle Punkte in ihm entfernen sich voneinander.
Unabhängig von Friedmann fand der Priester und Physiker George Lemaître ebenfalls in den 1920er-Jahren dieselben Lösungen der Einstein-Gleichungen. Doch im Gegensatz zu Friedmann, der mehr an den mathematischen Eigenschaften der Gleichungen interessiert war, dachte Lemaître darüber nach, was es für den Anfang des Universums bedeutet, wenn es sich heute ausdehnt. Wenn man die Ausdehnung zurück in die Vergangenheit verfolgt, müsste das Universum einmal ganz klein und dicht gewesen sein. Lemaître nannte den Anfangszustand des Universums »Ur-Atom«. Dieses »Ur-Atom« habe alle Materie des Universums enthalten und seine Explosion sei der Beginn des Universums gewesen. Aufgrund dieser Explosion hatte die Materie seiner Meinung nach genügend Anfangsgeschwindigkeit dafür erhalten, dass das Universum sich bis heute ausdehnen kann, trotz der anziehenden Wirkung der Gravitation. Mit dieser Idee gilt er als der Vater des Urknalls – auch wenn die Bezeichnung »Urknall« erst später aufkam.
Einstein war mit Friedmanns und Lemaîtres Überlegungen überhaupt nicht einverstanden, und aufgrund seiner Autorität siegte zunächst weiterhin die Auffassung von einem statischen Universum. Doch dann wurde das statische Universum durch die Weltraumbeobachtung mit den neu entwickelten leistungsstarken Teleskopen infrage gestellt. Schon seit 1912 gab es Messungen, die zeigten, dass die meisten anderen Galaxien sich von uns entfernen. Dies erkannte man daran, dass die Wellenlängen des von ihnen ausgesandten Lichts gestreckt sind. Man nennt diesen Effekt die »Rotverschiebung«. Edwin Hubble konnte diesen Befund deutlich präziser machen, indem er einen Zusammenhang zwischen der Entfernung einer Galaxie und ihrer Geschwindigkeit entdeckte. Im Jahr 1926 veröffentlichte er das später nach ihm benannte Gesetz, dass die Geschwindigkeit, mit der sich Galaxien von unserer Galaxie entfernen, proportional zu ihrem Abstand von uns ist. Eine doppelt so weit von uns entfernte Galaxie entfernt sich also doppelt so schnell von uns. Wenn aber alle Galaxien sich voneinander entfernen, bedeutet dies, dass das Universum sich ausdehnt.
Einstein wurde durch diese Entdeckungen vom Urknall überzeugt und schaffte seine kosmologische Konstante wieder ab. (In den 1990er-Jahren wurde sie wieder eingeführt. Wir nennen sie heute »Dunkle Energie«.) Doch die Mehrheit der damaligen Kosmologen und Astronomen waren noch nicht überzeugt. Auch wenn das völlig statische Universum wegen der Rotverschiebung der Galaxien nicht mehr möglich war, gab es ein Konkurrenz-Modell zum Urknall-Modell: das sogenannte »Steady-State«-Modell, dessen bekanntester Vertreter der Astrophysiker Fred Hoyle war. Nach dem Steady-State-Modell sieht das Universum überall und zu jeder Zeit gleich aus. Es expandiert zwar, doch die neuen Zwischenräume werden beständig mit neuen Atomen gefüllt, aus denen sich neue Sterne und Galaxien bilden. Damit dieses Universum bei der Rückschau in die Vergangenheit nicht zu einem Punkt schrumpft, muss es unendlich groß sein. Hoyle ist übrigens der Namensgeber des Urknalls: Er nannte in einer Radiosendung 1949 das von ihm abgelehnte Modell spöttisch »Big Bang« – und diese Bezeichnung wurde im Laufe der Zeit von allen adoptiert.
Wie ist es möglich, zu beurteilen, welches Modell das zutreffende ist? Zum einen lässt sich prüfen, ob das Modell das erklärt, was man schon über das Universum weiß. Außerdem kann man aus dem Modell Vorhersagen über das ableiten, was man im Universum beobachten müsste. Gemäß dem Steady-State-Modell müsste man z.B. in jeder Entfernung von uns sowohl alte als auch junge Galaxien finden. Die Gestalt der Galaxien müsste also unabhängig von ihrer Entfernung von uns sein. Das Urknall-Modell besagt dagegen, dass alle Galaxien ungefähr dasselbe Alter haben. Deshalb müsste man in großen Entfernungen jüngere Galaxien sehen, denn ihr Licht war Milliarden von Jahren zu uns unterwegs. Doch was davon zutrifft, konnte man erst seit den 1990er-Jahren überprüfen, da Teleskope nun in der Lage sind, weiter als acht Milliarden Lichtjahre zu blicken. Dort sieht man Galaxien, die kleiner und unregelmäßiger aussehen als die modernen Galaxien in unserer Nähe. (Dass ein solches Aussehen ein junges Alter anzeigt, überprüft man mit Computersimulationen zur Galaxienentwicklung.)
Das Urknallmodell kann außerdem erklären, warum ca. drei Viertel der Materie im Universum Wasserstoff sind und der Rest überwiegend Helium. Dass dies so ist, erkennt man daran, welche Lichtwellenlängen im Universum wie stark absorbiert werden. Laut dem Urknallmodell war das Universum in seiner Anfangszeit extrem heiß und dicht. Das bedeutet, dass am Anfang die Materie in ihre kleinsten Bausteine zerlegt war, die miteinander reagierten, während das Universum sich ausdehnte und abkühlte. In den 1940er-Jahren konnten Alpher und Gamov auf Basis der neusten Erkenntnisse über Kernreaktionen ausrechnen, was sich gemäß dem Urknallmodell in den ersten Minuten des Universums abgespielt hat, bis es für weitere Kernreaktionen zu kalt wurde. Sie berechneten, dass in diesen wenigen Minuten ca. ein Viertel des Wasserstoffs zu Helium verschmolzen wurde, passend zu dem beobachteten Mengenverhältnis. Das Steady-State-Modell kann dagegen keine Aussagen über die Häufigkeiten der Elemente machen.
Ein frühes Problem des Urknall-Modells war das Alter des Universums, das anhand der Fliehgeschwindigkeiten der Galaxien berechnet wurde. Es war mit knapp zwei Milliarden Jahren geringer als das der Erde, was natürlich nicht sein kann. Man war sich allerdings bewusst, dass die diesem Ergebnis zugrunde liegenden angenommenen Entfernungen der Galaxien noch recht ungenau waren. Das berechnete Alter des Universums wurde deutlich größer, als die hubble’schen Messungen mit größerer Messgenauigkeit wiederholt und mit neueren Erkenntnissen zur Entfernungsbestimmung von Galaxien verbunden wurden. Doch selbst in den 1990er-Jahren waren die Unsicherheiten über das Alter des Universums noch groß, und die Angaben bewegten sich im Bereich von zehn bis fünfzehn Milliarden Jahren. Erst in diesem Jahrtausend konnte mithilfe der modernen Weltraumteleskope das Alter des Universums auf ca. 13,7 Milliarden Jahre festgelegt werden.
Die bekannteste Vorhersage des Urknallmodells ist die kosmische Hintergrundstrahlung. Aus dem Urknall-Modell kann man errechnen, dass das Universum nach ca. 380 000 Jahren so kalt war, dass sich die Elektronen und Protonen zu stabilen Atomen vereinigten. Ab diesem Zeitpunkt konnte sich Licht frei ausbreiten. Diese bei einer Temperatur von 3000 Grad Kelvin freigesetzte Wärmestrahlung entstand an allen Stellen des Universums gleichzeitig und in fast gleicher Stärke und muss deshalb, von der Erde aus betrachtet, gleichmäßig aus allen Richtungen kommen. Wenn das Urknallmodell stimmt, muss man diese Strahlung nachweisen können. Da das Universum sich seitdem mehr als tausendfach ausgedehnt hat, ist die Wellenlänge des damals orangefarbenen Lichts inzwischen mehr als tausendfach gestreckt und ist (im Bereich maximaler Intensität) knapp zwei Millimeter groß, also im Mikrowellenbereich. Die Entdeckung dieser Hintergrundstrahlung genau im erwarteten Wellenlängenbereich durch Penzias und Wilson im Jahr 1964 verhalf der Urknalltheorie zum Durchbruch. Spätere, genauere Messungen untersuchten im Detail das Spektrum dieser Strahlung und bestätigten, dass es das Spektrum von Wärmestrahlung ist.
In der Zeit, als das Urknall-Modell noch nicht allgemein anerkannt war, nahmen die Diskussionen oft weltanschauliche Formen an. Viele lehnten den Urknall deshalb ab, weil er einem Schöpfungsakt zu ähnlich war. Fred Hoyle äußerte explizit, dass der Urknall seiner Meinung nach auf christlich-jüdischem Fundament stehe. Der Nobelpreisträger George Thomson meinte einmal frustriert: »Wahrscheinlich würde jeder Physiker an die Erschaffung des Universums glauben, wenn die Bibel nicht unglücklicherweise schon vor langer Zeit etwas darüber gesagt hätte, sodass das veraltet erscheint.« In der Sowjetunion wurden Wissenschaftler, die den Urknall vertraten, ins Arbeitslager geschickt. Der damalige Papst Pius XII ergriff Partei für den Urknall und sagte, dass die Entstehung des Universums aus dem Nichts einen Schöpfer erfordere, und dass die Wissenschaft somit Gott bewiesen hätte.
Diese Rede des Papstes im Jahr 1951 machte in der ganzen Welt Schlagzeilen. Ein Freund Hubbles schrieb ihm scherzend: »Ich hätte nicht zu träumen gewagt, dass der Papst sich auf dich stützen muss, um die Existenz Gottes zu beweisen. Dies sollte dich für die Heiligsprechung qualifizieren.« Der Urheber der Theorie des Urknalls, George Lemaître, war allerdings überhaupt nicht glücklich mit der Äußerung des Papstes, obwohl er ja nicht nur Physiker, sondern auch Priester war. Er war strikt dagegen, Theologie und Kosmologie zu vermischen.
Die Natur kann zwar ein Hinweis auf den Schöpfer sein, aber sie beweist ihn nicht. So kommt es, dass viele Kosmologen, die den Urknall akzeptiert haben, trotzdem am Atheismus festhalten. Um das zu tun, müssen sie die materielle Welt für ewig halten. Sie postulieren zum Beispiel, dass das Universum pulsiert, sich also immer abwechselnd ausdehnt und wieder zusammenfällt, oder dass unser Universum Teil eines Multiversums ist, in dem immer wieder neue Universen entstehen und andere vergehen. Wissenschaftlich prüfen lässt sich dies freilich nicht. Christen haben keinen Grund, ein Multiversum zu postulieren, weil Gott ein Universum auch aus dem Nichts schaffen kann (vgl. Hebräer 11,3).
Die Feinabstimmung der Naturkonstanten
Für das Leben auf der Erde ist Kohlenstoff das wichtigste chemische Element. Kohlenstoffatome können sich sowohl untereinander als auch mit einer Reihe von weiteren Atomen verbinden und auf diese Weise lange Kettenmoleküle bilden. Nur dadurch wird die komplexe Biochemie möglich, mit der Lebewesen ihre Zellen aufbauen und aus Nahrung Energie gewinnen. Kohlenstoff bildet ca. 50 Prozent der Trockenmasse von Lebewesen. Im Universum ist Kohlenstoff, gemessen nach Masse, das vierthäufigste Element.
Doch es war lange Zeit ein Rätsel, wie diese große Menge an Kohlenstoff entstehen konnte. Wie bereits erwähnt, wurde nach Alpher und Gamov in den ersten Minuten nach dem Urknall ein Viertel des anfänglichen Wasserstoffs zu Helium verschmolzen. Später berechnete man, dass sich damals außerdem eine kleine Menge Lithium bildete. Elemente jenseits von Lithium konnten während der kurzen genügend heißen Phase des frühen Universums nach den Rechnungen der Kernphysiker jedoch nicht entstehen.
Schon seit den 1920er-Jahren verfolgten einige Physiker die Idee, dass im viele Millionen Grad heißen Inneren der Sterne Kernreaktionen stattfinden, die nicht nur aus Wasserstoff Helium produzieren (doch längst nicht so viel, wie in den ersten Minuten des Universums entstand), sondern durch weitere Reaktionen auch schwerere Elemente herstellen. Fred Hoyle entwickelte als Erster in der Mitte der 1940er-Jahre genauere Vorstellungen dazu, wie in Sternen Elemente bis hin zum Eisen entstehen können. Er berechnete, wie Druck und Temperatur im Inneren eines Sterns sich in den verschiedenen Lebensphasen ändern und welche Reaktionen folglich jeweils stattfinden können. Man hatte damals auch schon die Idee, dass Elemente jenseits von Eisen entstehen können, wenn eine Supernova explodiert. Die Schockwelle, die während einer solchen Explosion durch den Stern geht, liefert die nötige Energie dafür.
Doch es gab zunächst ein unüberwindbares Problem: Die kernphysikalischen Rechnungen erklärten nicht, wie Kohlenstoff entsteht. Wenn Kohlenstoff erst einmal vorhanden ist, kann man das Entstehen der weiteren Elemente berechnen. Aber als man diejenigen Kernreaktionen durchrechnete, die im Prinzip Kohlenstoff erzeugen können, kamen viel zu kleine Reaktionsraten heraus. Es ist unmöglich, dass auf diese Weise die Menge Kohlenstoff entstanden ist, die wir im Universum finden.
Die Lösung dieses Rätsels fand Fred Hoyle durch eine kühne Überlegung, die in dieser Form in der Geschichte der Physik einmalig ist: Er betrachtete zunächst diejenige Reaktionskette, die für die Erzeugung von Kohlenstoff infrage kommt. Die häufigste Variante von Kohlenstoff ist ¹²C, das aus sechs Protonen und sechs Neutronen besteht. Ein solcher Atomkern kann rechnerisch entstehen, wenn drei Helium-4-Atomkerne (⁴He) zusammenkommen, denn sie haben je zwei Protonen und zwei Neutronen. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass drei Atomkerne genau gleichzeitig am selben Ort sind, ist extrem gering. Also müssen zunächst zwei ⁴He-Kerne zusammenkommen und Beryllium-8 (⁸Be) produzieren. Aber dieser Atomkern ist sehr instabil und zerfällt in 10–¹⁶ Sekunden (das ist weniger als ein Millionstel von einer Milliardstel Sekunde) wieder in zwei ⁴He-Kerne. Dass während dieser kurzen Zeit ein dritter ⁴He-Kern dazukommt und auch noch so lange bleibt, bis dieses instabile Objekt durch Energieabgabe stabil wird, passiert viel zu selten, um die nötige Menge Kohlenstoff zu produzieren.
Fred Hoyle sah nur eine einzige Möglichkeit, wie der Kohlenstoff trotzdem erzeugt werden kann: Wenn es eine energiereichere Version des ¹²C-Atomkerns gibt (eine sogenannte Anregung oder Resonanz), deren Masse genau die Summe der Massen von ⁴He und ⁸Be beträgt, dann kann ¹²C in genügender Menge produziert werden. Die Raten von Kernreaktionen werden nämlich deutlich erhöht, wenn es solche Resonanzen gibt. Hoyle war sich so sicher, dass es so sein muss, dass er in das Büro des berühmten Kernphysikers William Fowler marschierte und ihm sagte, dass ¹²C einen angeregten Zustand mit einer Energie nahe bei 7,65 MeV (Megaelektronenvolt, eine sehr kleine Energieeinheit, passend für Atomkerne) haben muss. Diese Energie entspricht der Differenz zwischen der gemeinsamen Masse von ⁴He und ⁸Be und der Masse des stabilen Zustands von ¹²C. (Anhand der einsteinschen Formel E=mc² lässt sich die Masse m in Energie E umrechnen, c ist hierbei die Lichtgeschwindigkeit.) Hoyle drängte Fowler, er möge dies durch Messungen überprüfen.
Fowler nahm Hoyle zunächst nicht ernst, denn es war damals noch gänzlich unmöglich, mit solcher Genauigkeit einen angeregten Zustand eines Atomkerns zu berechnen. Doch Hoyle hatte nicht gerechnet, sondern eine logische Überlegung angestellt:
1) Weil es Kohlenstoff gibt, muss es möglich sein, dass er in einer Kernreaktion entsteht.
2) Damit diese Kernreaktion möglich ist, muss eine Resonanz vorhanden sein.
3) Folglich gibt es diese Resonanz.
Hoyle ließ deshalb nicht locker und überzeugte Fowler schließlich mit dem Argument, dass er nur ein paar Tage verlieren würde, wenn die Vorhersage nicht stimmte, aber wenn sie stimmte, hätte er Anteil an einer der wichtigsten Entdeckungen der Kernphysik. Fowler ließ die Experimente von einem jungen Mitarbeiter durchführen – und die Resonanz wurde gefunden.
Wer noch bezweifelt hatte, dass alle chemischen Elemente ausgehend von Wasserstoff durch Kernreaktionen erzeugt wurden, wurde durch diese Entdeckung überzeugt. Fred Hoyle selbst wurde in seinem Atheismus erschüttert. Er meinte, ein superintelligentes Wesen müsse die Resonanz mit Absicht so gewählt haben, dass Kohlenstoff entstehen kann, der wiederum die Grundlage für das Leben ist.6 Aber zum Glauben an Gott brachte ihn dies nicht …
Heute sprechen wir von der Feinabstimmung der Naturkonstanten. Die Energie, bei der die »Resonanz« des Kohlenstoffatoms liegt, wird durch die Stärke der Kernkräfte bestimmt. Wäre ihre Stärke ein wenig anders, würde die Erzeugung von größeren Mengen Kohlenstoff nicht mehr funktionieren. Doch nicht nur die Stärke der Kernkräfte muss so sein, wie sie ist, damit Leben existieren kann. Kosmologen haben auch berechnet, wie sich das Universum entwickeln würde, wenn die Stärke der Gravitationskraft oder der elektromagnetischen Wechselwirkung, die Massen der Elementarteilchen oder andere Eigenschaften des anfänglichen Universums anders wären. Sie kommen zum Ergebnis, dass das Universum dann nicht mehr die Voraussetzungen für Leben bieten würde: Entweder würde das Universum nach dem Urknall so schnell auseinanderfliegen, dass sich gar keine Sterne bilden könnten, oder es würden sich zwar Sterne bilden, diese wären aber sehr kurzlebig, oder es würden nur ganz wenige chemische Elemente entstehen. Es könnte auch passieren, dass Atome gar nicht stabil wären oder dass die Menge möglicher chemischer Reaktionen und möglicher Moleküle zu klein wäre, um Leben zu ermöglichen. Man nennt diese Eigenschaft des Universums, dass es für menschliches Leben »gemacht ist«, das anthropische Prinzip.