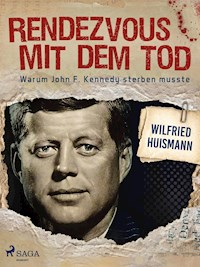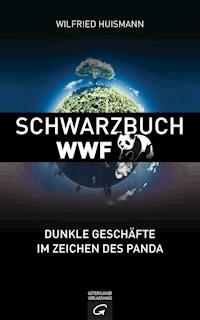
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
3. Auflage, 2012
Copyright © 2012 by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Coverabbildungen: © Mike Kiev (Weltkugel) / © sindjelicmilos (Panda) – Fotolia.com
ISBN 978-3-641-07392-3V002
www.gtvh.de
Inhalt
1. DIE BRAUT TRÄGT PANDA
2. IN DER HÖHLE DES LÖWEN
3. AUF TIGERSAFARI
Jäger und Gejagte
Die Tigerfrau
Ullash Kumar
Beim Stamm der Honigsammler
Landraub
Auf Leonardo DiCaprios Spur
4. FISCHIGE FREUNDE
Der König der Lachse
Schwimmende Apotheken
Wenn der Panda mit dem Lachs
Tod im Käfig
Petters glückliche Lachse
Unter Haifischen
Pandas beißen nicht
5. ES BEGANN IN AFRIKA
Grzimeks Mission
Prinz Philip geht an Bord
Nashorn Gerti
Öl im Blut
Alte Kameraden
Leichen im Keller
Operation Lock
Deckmantel Naturschutz
Die Rückkehr der weißen Jäger
6. SCHÖNER STERBEN MIT DEM WWF
Borneo brennt
Im Märchenwald
Grüne Wäsche
Geschäftsmodell WWF
Eine Nacht in Sembuluh
Palmöl-Krieg
7. GRÜNER ABLASSHANDEL
Die philanthropische Bank
Aufstand auf Sumatra
Holzdiebe mit Lizenz
Das Wunder zu Köln
Champion-Kultur
Das gebrochene Herz Borneos
We feed the World
8. TANGO MIT MONSANTO
Mitglied Nummer 572
Die Soja-Diktatur
Dialog eines Patriarchen
Auf dem Soja-Highway
Soja-Linke
In Monsantos Arm
Pizarro
9. DIE NEUAUFTEILUNG DER ERDE
Der Pakt
Jason Clay
Blackwater
Die Freunde Europas
Eis essen für den Regenwald
Weltmacht WWF
Die Eroberung Papuas
Kasimirus’ Ende
DANKSAGUNG
Register
»Es ist leichter, in die Geheimnisse der CIA einzudringen,
als in die des WWF.«
Raymond Bonner, Reporter der New York Times, 1993
»Im Falle meiner Reinkarnation würde ich gerne als tödliches Virus zurückkehren, um etwas zur Lösung des Problems der Überbevölkerung beizutragen.«
Prinz Philip im Interview mit dpa, August 1988
1. DIE BRAUT TRÄGT PANDA
Auf dem Bremer Ökomarkt treffe ich Abiud. Er war gerade in seiner Heimat Mexiko, um dort zu heiraten; und zwar nicht irgendwo, sondern in Chiapas, dem Zentrum des zapatistischen Aufstandes. Auch jetzt noch, Tage nach dem großen Ereignis, wirkt Abiud verwirrt. Denn die Stadt San Cristóbal machte keinerlei revolutionären Eindruck, sie ist fest in der Hand des Getränkekonzerns Coca-Cola. Als er die barocke Kathedrale betrat, empfing ihn der ohrenbetäubende Lärm vom Gemurmel hunderter Gläubiger. Sie hockten auf dem nackten Steinfußboden und huldigten ihren alten indianischen Göttern. Viele verfielen in ekstatische Tänze; wahrscheinlich, so dachte sich Abiud, weil sie den heiligen Schnaps namens Pox getrunken hatten. Vom Pox muss man rülpsen – ein bewährtes Mittel, um die bösen Geister zu vertreiben. Als Abiud selbst kostete, musste er sich fast übergeben: Im Gefäß war Coca-Cola pur.
Die Company hat mit der Gemeinde einen Partnerschaftsvertrag geschlossen. Sie spendet Geld, im Gegenzug wird im Tempel Gottes nur noch Coca-Cola getrunken. Auch in den Supermärkten der Stadt gibt es nur noch Coca-Cola zu kaufen. Die Ladenbesitzer erhalten von der Firma eine Prämie, wenn sie andere Getränke aus den Regalen nehmen. Die Stadt ist gepflastert mit leeren Coca-Cola-Dosen und die Kinder lachen die Besucher aus zahnlosen Mündern an. Nirgendwo auf der Erde wird so viel Coca-Cola getrunken wie in Chiapas. In den Bergen über der Stadt hat Coca-Cola die Wasserquellen gekauft, und es würde einen nicht wundern, hätte der Konzern sogar mit der Guerrilla in Chiapas einen für beide Seiten ertragreichen Deal abgeschlossen. Sogar die Comandantes trinken jetzt Coca-Cola.
Chiapas ist das Gleichnis einer perfekten Warenwelt, in der ein global agierender Konzern seine sanfte Herrschaft ausübt. Vor zehn Jahren hätte mir diese Geschichte niemand geglaubt. Coca-Cola genoss als einer der größten Wasserverbraucher der Erde einen schlechten Ruf, sodass sich das Marketing entschloss, die Firma »anzugrünen«. Heute wird Coca-Cola »nachhaltig« hergestellt und so, dass die »natürlichen Ressourcen der Erde geschont werden.« Glaubt der Kunde diese frohe, grüne Botschaft der Werbeabteilung? Wohl kaum.
Also muss der Konzern sich eine Braut ins Bett holen, die der Marke neuen Glanz verleiht. 2007 schließen Coca-Cola und der WWF einen Partnerschaftsvertrag – »um gemeinsam das Trinkwasser der Erde zu schützen«. Dafür dürfen sich die Coca-Cola-Produkte von nun an mit dem Panda schmücken, ein Vertrauen stiftendes Wappentierchen, das besonders bei Kindern sehr beliebt ist. So erobert man die Kunden der Zukunft. Den Konzern kostet das Sponsoring 20 Millionen Dollar. Ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass der WWF-Panda laut Marktforschung eine der glaubwürdigsten Marken der Welt ist.
Neben Geld bekommt der WWF auch die Zuneigung und Anerkennung des Big Business. Auf seiner Webseite entdecke ich einen Videoclip: Muktar Kent, der Boss von Coca-Cola, und Carter Roberts, Präsident des WWF USA, auf einer gemeinsamen Tour durch die Arktis. Man sieht die untergehende Sonne, Eisbären und jede Menge Schnee. Der WWF-Chef bekennt: »Die Partnerschaft bringt zwei der größten Marken der Welt zusammen. Die Besten und Klügsten wollen nicht nur Märkte erobern, sie wollen auch Führer sein, um die größten Probleme der Welt zu lösen. Coca-Cola war eine logische Wahl.« Der gerührte Coca-Cola-Chef im Polarpelz antwortet: »Wir arbeiten zusammen, damit auch die Generationen nach uns die wundervollen Eisbären genießen können – und den ganzen Planeten.«
Die WWF-Nomenklatura sieht sich auf Augenhöhe mit dem Jetset der globalen Unternehmen. Manager von Coca-Cola und des Gentechnikriesen Monsanto werden an der Schweizer Akademie des WWF zu »Führern des Planeten« ausgebildet, und Neville Isdell, der ehemalige Generaldirektor der Coca-Cola-Company, ist Chef der WWF-Personalkommission geworden. Er sucht das zukünftige Führungspersonal des WWF auf dem Markt und schlägt es zur Ernennung vor. Denn so etwas Altmodisches wie Wahlen gibt es beim WWF nicht.
WWF-Direktor Jason Clay verkündet der Welt, er werde mit den 100 größten Konzernen im Energie- und Ernährungssektor Verträge abschließen. Denn diese Konzerne kontrollierten die wichtigsten Rohstoffe der Erde. »Wenn die sich bessern, bessern sich alle in der Branche.« Und dass sie sich bessern, kann laut Jason Clay als sicher gelten, denn der WWF werde sie »umarmen«. So einfach ist das also. Komisch, dass vorher noch niemand darauf gekommen ist.
Auffallend viele Industrieunternehmen, mit denen der WWF in Verbindung steht, haben sich bei der Verschmutzung der Umwelt und beim Raubbau an den Schätzen der Erde hervorgetan: British Petroleum, Exxon Mobile, Marine Harvest, Shell, McDonalds, Monsanto, Weyerhäuser, Alcoa und der größte Palmölkonzern der Erde, Wilmar. Ihnen steht der Panda gut. Aber warum geht der WWF diese Liaisons ein – kann er damit wirklich die Welt verbessern, oder verkauft er womöglich seine Seele für bares Geld? Eine Spurensuche im grünen Empire. Sie führt uns um die ganze Welt. Am Ende sehen wir den Panda mit anderen Augen.
2. IN DER HÖHLE DES LÖWEN
In Gland am Genfer See liegt das internationale Hauptquartier des WWF, des World Wide Fund for Nature. Der graue Betonklotz ist ein Geschenk des deutschen Kaufhauskönigs Peter Horten. Er wirkt wie eine ästhetische Kriegserklärung an die Schweizer Kleinstadtidylle.
In den Gängen und Konferenzräumen herrscht emsiges Treiben. Junge Menschen aus aller Welt in Jeans und Turnschuhen beherrschen das Bild. Alle lächeln freundlich, wirken cool, kreativ und weltoffen. »Wir sind ein großes Team«, verkündet der Öffentlichkeitschef Phil Dickie, als er uns freudestrahlend am Empfang abholt. Mein Kameramann Ulli Köhler und ich sind gekommen, um uns vorzustellen, denn wir wollen für den WDR einen Film zum 50. Geburtstag des WWF drehen.
Phil Dickie ist Australier. Zuvor arbeitete er bei einer »geheimen Ermittlungseinheit« der australischen Regierung, wie er uns auf dem langen Weg zu seinem Büro mit verschwörerischer Miene wissen lässt. Ich habe den Eindruck, dass er nicht so recht weiß, wie er uns einschätzen soll. Er ruft Rob Soutter hinzu, einen alten Haudegen des WWF. Der weiße und hochgewachsene Südafrikaner ist seit Jahren für die globalen Artenschutzkampagnen des WWF zuständig und organisiert gerade das Gipfeltreffen der Tigerstaaten in St. Petersburg – mit Wladimir Putin als Gastgeber. Rob Soutter wischt meine kritischen Fragen zu den Industriepartnerschaften des WWF mit einer Handbewegung vom Tisch: »Coca-Cola ist eine unserer strategischen Partnerschaften. Man kann die Welt nicht mit Nein-Sagen verändern. Die Macht haben die Konzerne. Nur mit ihnen gemeinsam kann man etwas erreichen.« Coca-Cola habe sich verpflichtet, den Verbrauch von Frischwasser in seinen Abfüllanlagen um 20 Prozent zu senken, auch die CO2-Bilanz soll besser werden; und wenn man gemeinsam den Eisbären rettet, ist das doch auch nicht schlecht, oder? Klingt vernünftig.
Der 1961 gegründete WWF ist nicht aus einer Protestbewegung von unten entstanden. Er war von Anfang an eine Organisation von Menschen, die sich als Teil der gesellschaftlichen »Elite«begriffen.
Der gewiefte Pressemann Phil erfasst intuitiv, dass Rob Soutter die richtige Wahl für uns ist und bietet ihn als Interviewpartner an: Der WWF habe nichts zu verbergen; alles sei transparent und offen – raus mit den Fragen! Also gut: Wie hält es der WWF mit der Gentechnik? Am Runden Tisch für verantwortungsvolles Soja sitzt er mit dem Gentechnikriesen Monsanto zusammen, sehr zum Missfallen der anderen großen Naturschutzgruppen, für die Monsanto der Teufel auf Erden ist. Phils Gesicht verfinstert sich und durch die geschlossenen Lippen hindurch presst er einen Fluch: »Diese verdammte Gentechnik.« Volltreffer.
Er weist mich darauf hin, dass die meisten europäischen WWF-Organisationen die Gentechnik ablehnen. Auch Rob Soutter guckt gequält. Damit er keine schlechte Laune bekommt, wechsle ich das Thema und frage nach der Artenschutzpolitik des WWF – ein ihm vertrautes Terrain. Seine Sommersprossen leuchten auf, als er mir vorschwärmt, wie schön eine Safari-Tour auf dem Rücken eines Pferdes durch das Kaokoveld-Reservat in Namibia bei Sonnenuntergang sei. »Auge in Auge mit einer Löwenfamilie – ein unglaubliches Glücksgefühl.« Der Traum von der unberührten Wildnis. Soutter ist ein WWF-Romantiker der alten Schule. Was nicht heißt, dass er die Fehler der Gründergeneration rechtfertigen möchte.
Die Wildparks Afrikas waren bis in die 1980er-Jahre fest in weißer Hand. Soutter räumt offen ein: »Das führte dazu, dass viele Schwarzafrikaner dachten, der WWF sei eine Art Fortsetzung des Kolonialismus. Wir haben dazugelernt und arbeiten heute eng mit der lokalen Bevölkerung zusammen. Wir geben ihnen Jobs; sie begreifen, dass der Schutz der Tiere in ihrem ureigenen Interesse liegt. So funktioniert das.«
Etwas klingt in meinen Ohren schräg an dieser gönnerhaften Sicht auf die Eingeborenen. Täusche ich mich oder schwingt da nicht ein Unterton aus der alten Kolonialepoche mit? Nach dem Motto: Wir aufgeklärten Weißen wissen, wo es langgeht, und müssen unsere verstockten schwarzen Brüder an die Hand nehmen, damit sie mit der Natur pfleglich umgehen. Die insgeheim spürbare Arroganz des Rotschopfs macht mich wütend. Wie kann man vergessen, dass diese Menschen seit Jahrhunderten in und von den Wäldern und Savannen Afrikas gelebt haben, ohne sie zu zerstören? Erst als die weißen Kolonialherren auftauchten, ging es den Löwen, Nashörnern, Elefanten und Büffeln an den Kragen. Die Großwildjäger aus der zivilisierten Welt veranstalteten in Afrika ein wahres Massaker. Um den Wildbestand nachhaltig zu sichern, begannen die Kolonialverwaltungen damit, überall in den südlichen Ländern Afrikas Reservate und Schutzparks anzulegen, in denen nur Weiße jagen durften.
Mir kommt mein erstes Sammelalbum der Spar- und Raiffeisenkasse in den Sinn. Die wilden Tiere Afrikas hieß es, und ich habe es, getrieben von einer unerklärlichen Sehnsucht nach der Wildnis, so oft durchgeblättert, bis die Seiten schwarz waren. Damals hatte ich keine Ahnung von dem Preis, den die Schwarzafrikaner dafür zahlen mussten, dass sich der weiße Mann auf ihrem Land ein Paradies schuf. Die Reservate wurden immer auf dem Terrain der Schwarzen angelegt, nie dort, wo sich weiße Siedler niedergelassen hatten. Während Rob Soutter unbeirrt über die herrlichen Schutzprojekte des WWF und die »Integration« der Schwarzen referiert, sehe ich in Gedanken lange Flüchtlingskolonnen vor mir. Allein in Afrika sind 14 Millionen Menschen gegen ihren Willen umgesiedelt worden, um Platz für wilde Tiere zu schaffen.
Irgendwie habe ich keine Lust mehr auf den Small Talk im Hauptquartier des WWF am glitzernden Genfer See mit seinen schaukelnden Jachten und grünen Auen; also unterbreche ich Robs Redefluss mit einer provokanten Frage: »Dürfen wir beim nächsten Panda-Ball Filmaufnahmen machen?« Soutters gerade noch selbstzufriedenes Lächeln verrutscht zu einem schiefen Grinsen: »Ich glaube kaum. Die Teilnehmer legen Wert auf Diskretion.«
Der Panda-Ball findet einmal jährlich statt, oft im Buckingham-Palast in London oder in anderen Palästen. Zutritt haben nur die Auserwählten, die Mitglied im Club der 1001 sind – eine Art geheimer Eliteorganisation des WWF. Nachdem Rob seine Contenance wiedergefunden hat, tut er das Thema mit einem Schulterzucken ab: »Der Club spielt keine Rolle mehr – wir haben ihn nur aus Respekt vor dem seligen Prinz Bernhard der Niederlande am Leben erhalten. Er bringt auch nicht so viel Geld ein, wie man vielleicht denkt.« Kaum gesagt, glaube ich ein ärgerliches Blitzen seiner Augen zu erkennen – womöglich bereut er diese Aussage schon.
Der Club der 1001 wurde 1971 von Prinz Bernhard der Niederlande gegründet, als er Präsident von WWF International war. Einige seiner alten Kameraden aus der gemeinsamen Zeit bei der IG Farben und der Reiter-SS folgten ihm in den Club der 1001, der genau 1001 Mitglieder aus aller Welt zählt. Wer aufgenommen wird, bleibt zumeist lebenslang Mitglied. Wenn jemand stirbt, rückt ein Bewerber nach.
Nummer Eins war bis zu seinem Tod Prinz Bernhard selbst, die Namen der anderen 1000 Mitglieder sind geheim – bis heute. Nur einzelne Namen sind durchgesickert: Henry Ford, Baron von Thyssen, der pakistanische Milliardär Prinz Aga Khan, Prof. Bernhard Grzimek, Robert McNamara, Fiat-Chef Agnelli und Mitglieder aus den europäischen Königshäusern. Eine Allianz aus Geld- und Blutadel.
Der Club der 1001 bezahlt die Gehälter des zentralen Sekretariats in Gland am Genfer See – damit die WWF-Spitze unabhängig von den inzwischen über 90 nationalen Gruppen des WWF operieren kann. Auf dem Panda-Ball und bei anderen diskreten Treffen wird bestimmt auch über die strategische Ausrichtung der größten Naturschutzorganisation der Welt gesprochen. Der Club der 1001 ist sicherlich keine geheime Kommandozentrale des WWF, aber ein elitäres Old Boys-Netzwerk mit viel Einfluss in der Welt der multinationalen Konzerne und der globalen politischen Entscheidungsstrukturen.
Rob Soutter will wissen, ob ich eine Mitgliederliste des Clubs habe und wirkt irgendwie beruhigt, als ich verneinen muss. Spätestens nach diesem Gespräch ist mir klar, dass ich diese Liste unbedingt finden muss. Sie könnte der Schlüssel zum inneren Reich des WWF sein. Auch die fünf Millionen Mitglieder der Naturschutzorganisation haben keine Ahnung, wer im WWF die Macht hat und warum. Sie glauben unbeirrt an das Gute im Panda.
Pandas mit Geldschlitz
© Wilfried Huismann
3. AUF TIGERSAFARI
In den Wochen nach unserem Antrittsbesuch in Gland erhalte ich dann und wann eine beruhigende E-Mail von Rob Soutter: Alles in Ordnung, wir sehen uns bald in Namibia auf dem Rücken der Pferde. Im Moment sei er allerdings zu beschäftigt, denn das Jahr des Tigers nähert sich inzwischen seinem Höhepunkt. Leonardo DiCaprio wird zum Botschafter des WWF für den Tiger ernannt und nimmt in St. Petersburg am Tigergipfel teil. Alle Staatschefs der sieben Tigerländer sind gekommen, um die Ausrottung der 4000 noch lebenden Tiger zu verhindern. Der Tiger ist auch das Lieblingstier des Gastgebers Wladimir Putin. Im Hollywood-Star erkennt er einen Gleichrangigen, einen »echten Muschik«. Immerhin, so Putin bei der Begrüßung, wäre Leonardo DiCaprio bei seiner langen Reise nach Russland fast ums Leben gekommen. Zunächst musste seine Maschine wegen eines Flugzeugschadens notlanden und dann noch einmal bei einem schweren Unwetter.
Der WWF zeigt im Jahr des Tigers, was er kann: Staatschefs mobilisieren und die ganze Welt mit einer Werbekampagne für die Rettung des Tigers überrollen, deren Credo Leonardo DiCaprio verkündet: »Wenn wir den Tiger retten können, können wir auch die Erde retten.« Es geht um alles oder nichts. Wer möchte da abseits stehen?
Nach zwei Monaten vergeblichen Wartens auf ein konkretes Angebot von Rob Soutter beschleicht mich das Gefühl, dass aus unserem gemeinsamen Ausritt zu den Löwen nichts wird. Also entschließen wir uns, schon einmal auf eigene Faust mit den Recherchen über den WWF anzufangen – und zwar im Tigerland Indien.
Von Raipur aus geht es nach Norden, in eines der ältesten Tigerreservate Indiens. Wir fahren durch eine grüne Kornkammer mit idyllischen Dörfern. Welch eine Wohltat, denn Raipur ist mir wie die Hölle auf Erden vorgekommen. Der penetrante Gestank aus der Kanalisation, die offen neben den Straßen verläuft, die Müllberge auf dem Bürgersteig, durch die sich knochige Rinder wühlen, der ohrenbetäubende Lärm der Motorräder, die sich gegenseitig und die Fußgänger mit großer Aggressivität von der Straße drängen.
Ein höchstens 13-jähriges Mädchen schläft mit einem Säugling im Arm auf dem Bordstein – nur Zentimeter neben der Autospur – und ist kaum zu sehen unter den schwarzen Schwaden, die von den maroden Dieselfahrzeugen ausgestoßen werden. Der Überlebenskampf macht die Menschen apathisch und gnadenlos. Indiens Städte ersticken in Dreck und Müll. Im Jahr 2050 wird es mehr Inder als Chinesen geben, Land wird ein knappes Gut – und die Gier der Industrie macht selbst vor den indischen Nationalparks nicht halt.
Nach sechs Stunden Fahrt auf staubigen Straßen grüßen am Wegesrand die ersten grünen Schilder mit dem Logo des WWF-Panda: »Rettet den Tiger«. Wir sind in der Pufferzone des Kanha-Nationalparks. Viele der Menschen, die hier in den Dörfern leben, wohnten früher im Wald. Sie wurden von der Regierung hierhin umgesiedelt. Tiger und Menschen könnten angeblich nicht »koexistieren«. So wie hier sind als Folge der WWF-Planungen für die neuen Tigerreservate überall in Indien Adivasi-Stämme umgesiedelt worden – zum Teil mit militärischer Gewalt.
Wenige Kilometer nachdem wir den Haupteingang des Nationalparks passiert haben, öffnet sich ein eisernes Tor und wir fahren durch einen paradiesischen Garten in das Reich der Singinawa Jungle Lodge. Lemuren hüpfen von Baum zu Baum und dann auf das Dach des Bungalows, um unserer Begrüßung durch drei »boys« in postkolonialen khakibraunen Fantasieuniformen zuzuschauen, die uns ein luxuriöses britisches Frühstück servieren. Außer uns sind nur acht weitere Touristen hier, wohlhabende Rentner aus den USA und Großbritannien. Sie haben bei Natural Habitat gebucht, einem Reisebüro, bei dem der WWF Premier Partner ist. Wir freunden uns schnell mit ihnen an. Sie fahren zwei Wochen lang mit dem auf der WWF-Internetseite gebuchten Programm Wild India durch die Gegend und müssen dafür knapp 10.000 Dollar zahlen. Ganz schön happig. Aber dafür verspricht Nanda SJB Rana, der freundliche Besitzer der Lodge, dass jeder Teilnehmer mindestens einen Tiger in freier Wildbahn zu sehen bekommt.
WWF-Tigerkampagne: »Zum Sterben geboren«
Fotografiert von Wilfried Huismann
Am nächsten Morgen um fünf Uhr geht es bei drei Grad Celsius über null los, und als unsere Kolonne etwa eine Stunde später vor dem Haupttor des Nationalparks eintrifft, haben die ersten schon blaue Finger. Wir reihen uns in eine lange Warteschlange ein. 155 Jeeps sind hier jeden Tag für Safaris zugelassen – und zwar nicht in der Randzone, sondern im Kern des Parks, wo die meisten Tiger leben. Das Jagdfieber steigt, und als sich der Schlagbaum hebt, donnert das Jeep-Geschwader los. Zu meiner Überraschung gibt es im Nationalpark ein gut ausgebautes Wegenetz. Am Rand stehen Männer und fegen den »Tiger-Highway«. Es sind Adivasi, Waldmenschen. Früher waren sie die stolzen Herrscher des Dschungels – jetzt sind sie Servicekräfte des Ökotourismus.
Nach offiziellen Zahlen gibt es hier noch etwa 100 Tiger, aber unser Ranger hält diese Zahl für Propaganda. Nach seiner Kenntnis sind es höchstens noch 50 – unsere erste Lektion in indischer Tigermathematik.
Auf der Safari sehen wir Affen, wunderschöne Vögel und ein paar Gaur, die größten lebenden Rinder der Erde, tonnenschwere, graue Monster. Immer wenn er ein Tier sieht, tritt der Ranger auf die Bremse. Ein paar Sekunden Stopp für die Fotos und dann geht die Jagd weiter. Die zahlenden Gäste wollen keine Büffel und Affen, sondern Tiger sehen. An einem Baum zeigt uns der Ranger, wie der Tiger sein Revier markiert. Er hat tiefe Rillen in das harte Holz des Baumes gegraben, in drei Metern Höhe. Man ahnt die Kraft, die in der Raubkatze steckt. Jedes Tigermännchen beansprucht für sich ein Revier von 40 Quadratkilometern. An der nächsten Weggabelung stoßen wir auf einen Tigerspähtrupp: Ranger auf Elefanten, ausgestattet mit Funkgeräten, sind seit Stunden unterwegs, doch vom Tiger keine Spur. Wäre ich ein Tiger, hätte ich mich bei diesem Höllenlärm auch längst ins Unterholz verkrochen.
Nachdem wir drei Stunden herumgekurvt sind, von denen wir etwa 30 Minuten in Staus auf dem schmalen Tiger-Highway verbracht haben, treffen sich alle auf dem Frühstücksplatz wieder. Die Ranger packen Fresskörbe aus und verteilen ihren Inhalt auf den mit weißen Tischdeckchen geschmückten Kühlerhauben der Jeeps: Toast, Schinken und gekochte Eier, Tee und Kaffee. Die Jeep-Besatzungen tauschen miteinander Jägerlatein aus, eine Frau will den Schwanz eines flüchtenden Tigers gesehen haben.
Hier auf dem Grasland lebten früher einmal die Adivasi. Ihr Dorf und ihre Kultur sind verschwunden. Die Touristen haben weiter keine Fragen dazu, denn die Umsiedlung durch die Regierung erscheint ihnen womöglich gerechtfertigt. Der WWF hat, ohne sich allerdings explizit für Zwangsumsiedlungen auszusprechen, viele Jahre lang verkündet: Wir Menschen haben den wilden Tieren seit vielen hundert Jahren ihren Lebensraum weggenommen, jetzt muss man sich um sie kümmern.
Plötzlich brüllt ein Ranger: »Nicht weit von hier wurde ein Tiger gesichtet.« Alle rennen zu ihren Jeeps. Die Motoren heulen auf und weiter geht es. Dort, wo der Tiger angeblich gesehen wurde, stoppen wir. Ein Affe stößt den Tigerwarnruf aus. Hirsche rennen durchs Gebüsch. Wir beobachten, dass sie verfolgt werden – von einem Wildschwein. Mist, wieder kein Tiger. Pause zum Lunchfassen im Dschungelhotel. Danach noch einmal in den Tigerwald. Nur keine Zeit verlieren, denn um 18 Uhr schließt der Park. Wir haben schon am zweiten Tag keine Lust mehr auf die Tigerjagd und bleiben am Swimmingpool des Hotels. Die anderen Touristen sind fassungslos über uns Weicheier, aber die Dame des Hauses, Latika Nath Rana, quittiert die Entscheidung mit einem dankbaren Blick.
Jäger und Gejagte
Dr. Latika Nath Rana ist Tigerforscherin mit Oxford-Diplom. Als einzige Frau hat sie sich unter den indischen Tigerforschern einen prominenten Platz erobert. Beim Frühstück eröffnet sie mir, dass sie für die ganze Zunft wenig übrig hat: »Wir wissen eigentlich alles über den Tiger, man sollte ihn einfach in Ruhe lassen.« Auch auf die Tigerkampagne des WWF ist sie nicht gut zu sprechen: »Damit kommen immer mehr Tigerexperten ins Land und belagern die Raubkatzen.« Sie bauen überall Fotofallen auf, schießen mit Betäubungsgewehren auf die Tiere und hängen ihnen Funksender um den Hals. Der WWF will dadurch Vorkommen, Bewegungsmuster und Anzahl schätzen, um weitere Tigerschutzgebiete auszuweisen. Dr. Rana hält davon wenig: »Alles überflüssig, für die Forschung bringt das nichts. Es hat nur einen Sinn: Das Geld muss ausgegeben werden.« Ich spreche sie auf die WWF-Schilder an, die die Straßen zum Nationalpark schmücken. Sie lacht: »In Public Relations sind die gut. Aber ich habe hier noch kein wirklich nützliches WWF-Projekt gesehen.«
Dr. Latika Nath Rana hat den Haushalt des WWF Indien unter die Lupe genommen und ist der Meinung, dass ein großer Teil der WWF-Spendengelder, die aus dem Ausland kommen, nicht für konkrete Schutzprojekte vor Ort ausgegeben wird: »Das meiste Geld, das der WWF offiziellen Regierungsstellen gibt, verschwindet letztlich doch in den Taschen der Funktionäre.« Als sie meinen verblüfften Gesichtsausdruck bemerkt, fügt sie hinzu: »Das ist nichts Besonderes für Indien. Wenn die Spendengelder in den Tigerreservaten ankommen würden, dann könnten wir für jeden Tiger vier Wärter einstellen, eine Schutzmauer um alle 39 Tigerreservate Indiens ziehen und dazu noch für alle Tiger eine Lebensversicherung abschließen.« Sie selbst hat sich von dem Tigerrummel abgewandt und konzentriert sich auf die Arbeit mit den Dorfbewohnern in der Pufferzone. »Wenn wir die gewinnen, können wir auch dem Tiger helfen.«
Immer wieder, so Dr. Latika Nath Rana, findet die indische Tigermafia in den Dörfern rund um die Reservate willfährige Handlanger, die einen Tiger töten. Die Tigerkiller bekommen dafür lediglich ein paar Rupien, sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie hoch die Weltmarktpreise für Tigerprodukte sind. Tee aus Tigerknochenmehl kostet in Chinatown in New York inzwischen mehr als Heroin. Das Getränk soll die sexuelle Leistungsfähigkeit des Mannes erheblich steigern.
Beim Dinner am langen Tisch am selben Abend erzählt ihr Mann Nanda, woher der in Asien weit verbreitete Glaube an die Potenzwirkung von Tigerextrakten kommt: »Wenn Tiger sich paaren, geht es hoch her; sie treiben es tagelang miteinander. Der Rekord liegt bei einem Tigerpaar, das 113 Mal an einem einzigen Tag Sex hatte.« Jack aus Arizona, der häufig geschäftlich in Shanghai zu tun hat, wendet ein, dass es in China doch längst riesige Tigerfarmen mit eigener Aufzucht gebe. Der Hausherr schüttelt den Kopf: »Das hilft uns nicht viel. Die Chinesen glauben, dass die Essenzen vom wilden Tiger eine bessere Wirkung haben.«
Meine Tischnachbarin Maggie stellt sich bei der Diskussion über Tigersex lieber taub und genießt still ihr Glück, denn bei der Nachmittagssafari ist ihr Jeep auf einen leibhaftigen Tiger gestoßen. An Details kann sie sich nicht erinnern, weil das Tier nur von weitem zu sehen war – die anderen Jeeps hatten sich zu ihrem Ärger einfach vorgedrängelt. Immerhin: Die 10.000 Dollar für das Programm Wild India haben sich für Maggie ausgezahlt. »Denn«, so verkündet sie im Brustton der Überzeugung, »vielleicht sind wir die letzte Generation, die einen wilden Tiger sehen kann. Unsere Enkel wahrscheinlich nicht mehr.« Die apokalyptisch angehauchte Tigerkampagne des WWF hat in ihr ein dankbares Medium gefunden. Doch hat das alles wirklich mit Naturschutz zu tun?
Nach dem Dinner führt uns Hausherr Nanda Ranain seine Bibliothek, um uns seinen Schatz zu zeigen: große Schwarz-Weiß-Fotos aus der guten alten Zeit der Tigerjagd. »Die Fotos sind ein Geschenk des Hauses Windsor an meine Familie.« Ich erfahre bei dieser Gelegenheit, dass Herr Rana ein Spross des nepalesischen Königshauses ist, das die Tigerjagden für die britischen Herrscher veranstaltete. Er zeigt auf ein Foto, auf dem Elefanten einen Kessel bilden. »Bevor König Georg kam, wurden aus dem ganzen Land 1000 Elefanten zusammengeholt. Sie trieben die Tiger in ringförmigen Kesseln zusammen. Bei dieser Jagd hier wurden 120 Tiger erlegt, an einem einzigen Tag. Ziemlich unfair dieser Sport.« Auf dem Foto daneben sieht man Dutzende abgezogener Tigerfelle, die zum Trocknen nebeneinander auf die Leine gehängt wurden wie nasse Handtücher.
Bei meiner Frage, ob auch Prinz Philip, Herzog von Edinburgh und Gründervater des WWF, bei den Tigerjagden mitgemacht hat, sieht der Adlige aus Nepal mich leicht misstrauisch an und entscheidet sich für eine diplomatische Antwort: »Er war wohl mal dabei, geschossen hat er meines Wissens nicht. Er war doch Naturschützer. Als Ausrede behauptete er, er hätte eine Zerrung im Zeigefinger.«
Prinz Philip im WDR-Interview, 2011
© WDR
In Presseberichten aus der Zeit hört sich das ganz anders an: Im Januar 1961 brachen Königin Elisabeth II. und ihr Prinz im Rahmen eines Staatsbesuches zu einer Tigerjagd nach Rathambore auf. Jagdgehilfen hatten vorher Dutzende Ziegen an Bäume gebunden, um das Raubtier anzulocken, und die Treiber jagten es direkt vor die Flinte der Königin. Doch als der Tiger in Sichtweite war, legte sie das Gewehr beiseite und griff zu ihrer Fotokamera. Den tödlichen Schuss überließ sie Prinz Philip. Bald darauf zirkulierte in Großbritannien das Foto der Jagdgesellschaft. Vorne streckt sich das erlegte Tier, dahinter stehen die Gastgeber der Jagd mitsamt dem königlichen Paar.
Ziemlich genau 50 Jahre nach dem Jagdausflug ergattern wir im Buckingham-Palast einen Interviewtermin bei Prinz Philip. Er blickt bei der Frage nach der Tigerjagd mannhaft in die Kamera und steht zu seiner Tat: »Ich habe in meinem Leben nur einen einzigen Tiger geschossen, damals in Indien. Man musste den Bestand regulieren. Die Natur kann das nicht allein. Wenn es zu viele Raubtiere gibt, dann muss man sie beseitigen, um andere Arten zu schützen.«
Trotzdem war die Angelegenheit ärgerlich. Das Foto des ermordeten Tigers rief in England große Empörung hervor. Ausgerechnet jetzt! Denn im Frühjahr 1961 standen Prinz Philip und seine Freunde kurz davor, der Welt die Geburt des WWF zu verkünden. Für Prinz Philip war das Gruppenfoto mit dem Tiger ein reines Imageproblem. Jagd und Tierschutz gehören für ihn zusammen, nur Jäger sind nach seiner Philosophie gute Naturschützer. Die meisten Nationalparks in Afrika und Asien waren früher Jagdreservate für die weißen Eliten aus Europa und den USA. Um 1900 gab es in Indien noch 40.000 Tiger – bevor die schießwütigen Windsors und ihre wohlhabenden Freunde auftauchten und dazu beitrugen, die Zahl der Tiere bis zum Ende der Kolonialzeit auf 5000 Exemplare zu reduzieren.
Prinz Philip mit Beute und Elisabeth II., 1961
© AFP/Getty Images
Die Tigerfrau
Es ist spät in der Nacht und die wilden Tiere sind auf Raubzug. Vasudha Chakravarthi geht vor uns her. Es sind nur wenige hundert Meter bis zu ihrem Haus, aber das tausendstimmige Gemurmel des Waldes ist mir nicht geheuer. Sie lacht mich aus und stapft, bewaffnet mit einem langen Stock, festen Schrittes voraus. Ihr Pferdeschwanz wippt energisch im Mondlicht. Die junge Frau lebt seit vier Jahren im Dschungel und hat keine Angst vor wilden Tieren. »Sie kennen mich und wissen, dass ich ihre Freundin bin.« Aber mich kennen sie nicht! Wir sind fast bei ihrem Haus angelangt, als sie plötzlich wie angewurzelt stehenbleibt und mit einer Taschenlampe die Büsche ableuchtet: »Ein Leopard, ganz in der Nähe.« Ich will wissen, ob Leoparden Menschen fressen. »Nein, Menschen gehören nicht zu ihrer Diät. Sie töten Menschen nur um des Tötens willen.« Wie beruhigend. Sie vertreibt den Leoparden mit Zischgeräuschen und wir sind endlich im sicheren Haus. Es wurde vor 160 Jahren als Jagdhütte von einem irischen Ehepaar gebaut, das sich in diese einsame Landschaft verliebt hatte. Noch immer baumelt ein Blechschild über der Eingangstür: Hunting Lodge. Vasudha hat das Haus mit eigenen Händen wieder hergerichtet, am Rand des Mudumalai-Tigerreservates im Süden Indiens.
Bevor sie sich für das Leben in der Abgeschiedenheit entschied, hatte sie einen gutbezahlten Job bei der HSBC-Bank in London: »Es war interessant da, aber ich wusste irgendwann, dass mich ein Leben als Geschäftsfrau nicht glücklich macht. Es entfremdet mich von mir selbst.« Ihr Mann trennte sich von ihr, weil er ihre Leidenschaft für die Wildnis nicht verstand.
Jeden Morgen streift sie ihren gefleckten Tarnanzug über und geht mit dem Fotoapparat auf Spurensuche. Allein und ohne Waffe. Siebenmal ist sie bei ihren Streifzügen schon auf einen Tiger gestoßen, Angst hatte sie nie: »Einmal stieß ich auf eine Tigerin, die gerade einen Hirsch gerissen hatte. Ich saß nur wenige Meter von ihr entfernt und begann zu fotografieren. Sie sah mich an und ließ mich gewähren. 40 Minuten lang saßen wir einander gegenüber. Sie hätte mich jederzeit töten können, aber ich wusste, sie würde es nicht tun. Es gab zwischen uns ein stilles Einverständnis.« Vasudha zeigt mir ihre Tigerfotos auf dem Laptop, veröffentlicht hat sie keines davon: »Das kann ich den Tigern nicht antun. Dann kommen noch mehr Menschen aus den reichen Ländern hierher, um sie anzugucken.«
Als wir am nächsten Morgen von den Sonnenstrahlen geweckt werden, die durch die Ritzen der hölzernen Fensterläden hereindringen, ist Nachbar Antony schon da, um nach dem Rechten zu sehen. Er wohnt drei Kilometer entfernt. Seine 10-jährige Tochter Preebi ist auch mitgekommen. Antony repariert die Wasserleitung, die von Vasudhas Brunnen in die Küche führt. Ein Elefant war in der vorherigen Nacht zu Besuch und hat die Leitung zertreten.
Vasudha stellt mir ihre kleine Freundin Preebi vor, »eine der besten Spurensucherinnen, die es gibt.« Preebi geht oft mit ihr auf Streife, um die Spur der Tiger aufzunehmen. Sie kennt sich im Wald aus, weil sie jeden Morgen sieben Kilometer durch den Tigerwald zur Schule gehen muss. Vor kurzem habe sie einen Tiger mit »sooo einem dicken Kopf« getroffen. Sie erzählt es mit unüberhörbarem Stolz und breitet dabei die Arme aus, soweit sie kann. Hat sie Angst gehabt? Sie sieht mich erstaunt an: »Nein, warum denn?« Nur einmal hatte sie einen Konflikt mit einem Tier. Auf dem Nachhauseweg von der Schule wurde sie von einer riesigen Kobra angegriffen. »Ich musste sie mit einem Stock erschlagen.«
Preebi im Tigerwald
© Wilfried Huismann