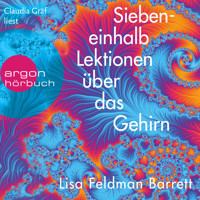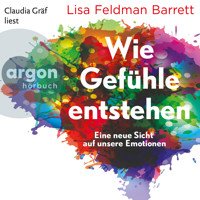9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Warum haben wir eigentlich ein Gehirn? Die renommierte Neurowissenschaftlerin Lisa Feldman Barrett beantwortet in diesem unterhaltsamen und leicht verständlichen Buch in siebeneinhalb kurzen Kapiteln diese und andere Fragen. Sie präsentiert aufschlussreiche Erkenntnisse aus der Forschung, und wir erfahren, wie sich unser Gehirn entwickelt hat, wie es aufgebaut ist (und warum das wichtig ist) und wie es mit anderen Gehirnen zusammenarbeitet, damit wir unseren Alltag bewältigen können: Es ist die Quelle unserer Stärken und unserer Schwächen. Es verleiht uns die Fähigkeit, Zivilisationen aufzubauen, und die Fähigkeit, uns gegenseitig zu zerstören – fangen wir also an, uns mit ihm zu beschäftigen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Ähnliche
Lisa Feldman Barrett
Siebeneinhalb Lektionen über das Gehirn
Über dieses Buch
Warum haben wir eigentlich ein Gehirn? Die renommierte Neurowissenschaftlerin Lisa Feldman Barrett beantwortet in diesem unterhaltsamen und leicht verständlichen Buch in siebeneinhalb kurzen Kapiteln diese und andere Fragen. Sie präsentiert aufschlussreiche Erkenntnisse aus der Forschung, und wir erfahren, wie sich unser Gehirn entwickelt hat, wie es aufgebaut ist (und warum das wichtig ist) und wie es mit anderen Gehirnen zusammenarbeitet, damit wir unseren Alltag bewältigen können: Es ist die Quelle unserer Stärken und unserer Schwächen. Es verleiht uns die Fähigkeit, Zivilisationen aufzubauen, und die Fähigkeit, uns gegenseitig zu zerstören – fangen wir also an, uns mit ihm zu beschäftigen
Vita
Lisa Feldman Barrett (Jg. 1963), ist Professorin für Psychologie an der Northeastern University und lehrt darüberhinaus an der Harvard Medical School und am Massachusetts General Hospital in den Bereichen Psychiatrie und Radiologie. Gemeinsam mit dem Stanford-Professor und Psychologen James Gross gründete sie die Society for Affective Science, die sich der Förderung der Grundlagen- und angewandten Forschung zum Thema Emotionen und Affekt widmet. Darüberhinaus ist sie Mitbegründerin und Chefredakteurin der Zeitschrift Emotion Review. Lisa Feldman Barrett lebt in Boston.
Elisabeth Liebl übersetzt aus dem Französischen, Englischen und Italienischen. U.a. übertrug sie Malala Yousafzai, Amaryllis Fox, Tiziano Terzani und Bob Woodward ins Deutsche.
Impressum
Die englische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel «Seven And a Half Lessons About The Brain» bei Houghton Mifflin Harcourt Publising Company, New York
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2023
Copyright der deutschen Erstausgabe © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg «Seven And A Half Lessons About the Brain» Copyright © 2020 by Lisa Feldman Barrett
Redaktion Steffen Geier
Illustrationen Flow Creative (flowcs.com)
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung zero-media.net, München,
nach dem Original von Pan MacMillan, UK
Coverabbildung oxygen/Getty Images
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-01547-0
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Inhaltsübersicht
Widmung
Eine kurze Anmerkung vorab
Die halbe Lektion Ihr Gehirn ist nicht zum Denken da
Lektion Nr. 1 Sie haben ein Gehirn (nicht drei)
Lektion Nr. 2 Ihr Gehirn ist ein Netzwerk
Lektion Nr. 3 Kleine Gehirne verschalten sich mit ihrer Welt
Lektion Nr. 4 Ihr Gehirn sagt (fast) alles vorher, was Sie tun
Lektion Nr. 5 Ihr Gehirn arbeitet heimlich mit anderen Gehirnen zusammen
Lektion Nr. 6 Gehirne erzeugen mehr als eine Art von Geist
Lektion Nr. 7 Ihr Gehirn kann Wirklichkeit erschaffen
Nachwort
Danksagung
Anhang: Die Wissenschaft hinter der Wissenschaft
Register
Für Barb Finlay
und meine anderen Kollegen,
die mir das Handwerk der
Neurowissenschaften beigebracht haben –
für ihre enorme Großzügigkeit
und ihre noch größere Geduld
Eine kurze Anmerkung vorab
Ich habe dieses Buch und seine kurzen, lockeren Essays zu Ihrer Unterhaltung geschrieben und um Ihr Interesse zu wecken. Es ist kein umfassender Lehrgang in Sachen Gehirn. Jeder Essay bietet spannende wissenschaftliche Informationen über Ihr Gehirn und geht der Frage nach, was diese über die menschliche Natur aussagen. Es empfiehlt sich, die Essays nacheinander zu lesen, aber natürlich können Sie sie auch in beliebiger Reihenfolge angehen.
Als Professorin bin ich es gewohnt, meine Veröffentlichungen ausführlich mit wissenschaftlichen Details zu untermauern, wie sie zum Beispiel in Studien oder in Aufsätzen in Fachzeitschriften nachzulesen sind. Die wissenschaftlichen Belege zu den Texten dieses Buches finden Sie hier: https://sevenandahalflessons.com.
Im Anhang werden darüber hinaus bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse noch genauer dargestellt. Er soll zum einen die Themen der einzelnen Essays vertiefen, zum anderen verdeutlichen, dass bestimmte Punkte von der Wissenschaft noch diskutiert werden. Außerdem nennt er die Wissenschaftler, die dazu Entscheidendes beigetragen haben.
Ich hoffe, es macht Ihnen Spaß zu lesen, was eine Neurowissenschaftlerin an Ihrem Gehirn so faszinierend findet und inwiefern Sie dieser drei Pfund schwere Klumpen zwischen Ihren Ohren zum Menschen macht. Die Essays treffen keine Aussage darüber, was Sie von der menschlichen Natur zu halten haben. Ich hoffe jedoch, dass sie Sie zum Nachdenken darüber anregen, welche Art Mensch Sie sind – oder sein möchten.
Die halbe LektionIhr Gehirn ist nicht zum Denken da
Vor langer, langer Zeit wurde die Erde von Geschöpfen beherrscht, die kein Gehirn hatten. Und das ist keine politische Aussage, sondern eine biologische Feststellung.
Eines dieser Geschöpfe war der Amphioxus. Wenn Sie je ein solches Geschöpf zu Gesicht bekämen, würden Sie es vermutlich für einen Wurm halten, bis Sie die kiemenähnlichen Schlitze auf beiden Seiten des Körpers entdecken. Amphioxi oder Lanzettfischchen bevölkerten die Ozeane vor 550 Millionen Jahren.[1] Sie führten ein recht einfaches Leben. Dank einer simplen «Antriebstechnik» konnten sie sich im Wasser bewegen. Auch ihre Nahrungsaufnahme ging unkompliziert vonstatten: Sie verankerten sich am Meeresboden wie Grashalme und filterten und verdauten alle winzigen Organismen, die ihnen ins Maul trieben. Geschmack oder Geruch waren dabei nebensächlich, denn die Amphioxi besaßen noch keine Sinnesorgane, wie Sie sie haben. Sie hatten keine Augen, nur ein paar Zellen, die Helligkeitsveränderungen registrierten. Und sie konnten nicht hören. Ihr rudimentäres Nervensystem bestand aus einem Klecks Zellen, den man noch nicht als Gehirn bezeichnen konnte.[2] Ein Lanzettfischchen war, so ließe sich überspitzt sagen, ein Magen an einem Stock.
Und doch sind die Amphioxi entfernte Verwandte von uns, die noch heute existieren. Wenn Sie einen modernen Amphioxus betrachten, dann sehen Sie ein Geschöpf, das Ihrem winzigen Altvorderen, der damals die Ozeane bevölkerte, sehr ähnlich ist.[3]
Die heutigen Lanzettfischchen sind nicht unsere direkten Vorfahren, aber wir haben einen gemeinsamen Ahnherrn, der den heutigen Amphioxi vermutlich sehr ähnlich war.
Können Sie sich vorstellen, dass ein winziges, wurmähnliches Geschöpf von fünf Zentimetern Länge, das durch den prähistorischen Ozean trieb, eine entscheidende Rolle bei der evolutionären Entwicklung des Menschen spielte? Zugegeben, ganz einfach ist das nicht. Wir haben so vieles, was der urzeitliche Amphioxus nicht hatte: mehrere Hundert Knochen, eine ganze Reihe innerer Organe, ein paar Gliedmaßen, eine Nase, ein charmantes Lächeln und vor allem – ein Gehirn. Der Amphioxus brauchte kein Gehirn. Seine «Sinneszellen» standen in enger Verbindung zu den Zellen, die seine Bewegung steuerten. Er konnte also auf die Signale seiner notdürftigen Sinnesausstattung reagieren, ohne dass er viel hätte verarbeiten müssen. Sie hingegen haben ein hochkomplexes, leistungsstarkes Gehirn, das so unterschiedliche geistige Zustände hervorbringt wie Gedanken, Emotionen, Erinnerungen und Träume – ein reiches Innenleben, das letztlich Ihr Dasein bedeutsam und unverwechselbar macht.
Warum aber hat sich ein Gehirn wie das Ihre überhaupt herausgebildet?[4] Die naheliegendste Antwort wäre: um zu denken. Man nimmt automatisch an, dass sich Gehirne in aufsteigender Ordnung entwickelt haben, von den niederen Tieren hin zu den höheren, und natürlich steht das komplexeste von allen, das denkende Gehirn des Menschen, an der Spitze. Schließlich ist das Denken die Superkraft des Menschen, nicht wahr? Nun, die naheliegendste Antwort ist leider falsch. Die Vorstellung, dass unser Gehirn sich entwickelt hat, um das Denken zu ermöglichen, ist tatsächlich Grundlage vieler Missverständnisse über unser Geistesleben. Sobald Sie diese lieb gewonnene Idee aufgeben, haben Sie den ersten Schritt getan, um zu verstehen, wie Ihr Gehirn tatsächlich funktioniert, was seine wichtigste Aufgabe ist – und welche Art Geschöpf Sie in Wirklichkeit sind.
Vor 500 Millionen Jahren, als der kleine Amphioxus und andere einfach strukturierte Geschöpfe in aller Beschaulichkeit der Nahrungsaufnahme am Meeresboden nachgingen, trat die Erde in eine entwicklungsgeschichtliche Periode ein, die Wissenschaftler das Kambrium nennen. In dieser Zeit erweiterte eine neue Verhaltensweise das Bühnenrepertoire der Evolution: das Jagen. Irgendwo, irgendwie fing ein Geschöpf an, die Präsenz eines anderen zu erspüren und sich dieses gezielt einzuverleiben. Tiere hatten sich auch schon früher verspeist, doch nun hatte das Ganze plötzlich mehr System. Zum Jagen war zwar noch kein Gehirn erforderlich, aber dieses zielgerichtete Verhalten war ein wichtiger Schritt darauf zu.
Das Auftreten von Räubern im Kambrium machte die Welt zu einem umkämpften und gefährlichen Ort. Sowohl die Jäger als auch die Beutetiere durchliefen bestimmte Entwicklungen, sodass ihre Sinne mehr Informationen aus der Umwelt aufnehmen konnten. Vermochten die Amphioxi lediglich hell und dunkel zu unterscheiden, so konnten die neu entstehenden Tierarten tatsächlich sehen. Wo die Amphioxi nur eine simple Hautwahrnehmung besaßen, konnten die jüngeren Tierarten ihre Bewegung im Wasser umfassender wahrnehmen. Ihr Tastsinn erlaubte ihnen, Objekte durch Schwingungen wahrzunehmen. Haie nutzen diese Art der Wahrnehmung auch heute noch, um ihre Beutetiere zu lokalisieren.
Mit Entwicklung der Sinnesorgane wurde die Frage: «Kann man das dunkle Etwas in der Ferne essen, oder frisst es eher mich?», lebensentscheidend. Geschöpfe, die ihre Umgebung besser wahrnehmen konnten, hatten einen Überlebensvorteil. Der Amphioxus mochte seine Umwelt beherrschen, aber er konnte nicht spüren, dass er eine Umwelt hatte. Diese neuen Tiere waren dazu in der Lage und taten es.
Jäger und Gejagte erhielten einen zusätzlichen Entwicklungsschub durch eine weitere neue Fähigkeit: Sie konnten sich geschickter bewegen. Der Amphioxus, dessen Nerven für Wahrnehmung und Bewegung zusammengeschaltet waren, beherrschte nur sehr grundlegende Bewegungen. Wenn nicht mehr genug Futter in seine Mundöffnung strömte, schlängelte er sich einfach in zufälligen Bewegungen weiter, um sich woanders neu zu verankern. Jeder bedrohlich wirkende Schatten ließ ihn die Flucht ergreifen. In der neuen Jägerwelt entwickelten alle Tiere bessere motorische Systeme, die ihnen erlaubten, sich schneller und geschickter fortzubewegen. Sie konnten sich schneller und gezielter auf etwas zubewegen (zum Beispiel Nahrung) oder von etwas weg (zum Beispiel einer Bedrohung). Wie das genau aussah, hing im Wesentlichen von ihrer Umwelt ab.
Sobald sie fähig waren, Dinge auch von Weitem wahrzunehmen und sich gezielter zu bewegen, begünstigte die Evolution jene Arten, die diese Aufgaben besonders gut meisterten. Waren sie bei der Jagd auf ein Beutetier zu langsam, schnappte es ihnen ein anderer weg. Verbrauchten sie bei der Flucht vor einer potenziellen Bedrohung, die keine war, unnötig Energie, verschwendeten sie Ressourcen, die sie vielleicht später benötigten. Effizient mit der eigenen Energie umzugehen war der Schlüssel zum Überleben.
Am besten stellen Sie sich die Frage der Energieeffizienz so vor, als würden Sie ein Haushaltsbuch führen: Dabei notieren Sie, wie viel Geld hereinkommt und wie viel ausgegeben wird. Für Ihren Körper heißt das, dass Sie Ressourcen wie Wasser, Salz und Glukose eintragen und festhalten, wie viel Sie davon aufnehmen oder verbrauchen. Mit jeder Aktivität, die Ressourcen verbraucht, wie Schwimmen oder Laufen, verbuchen Sie etwas von Ihrem Budget als Auszahlung. Was Ihre Ressourcen auffüllt, wie Essen oder Schlafen, ist gleichsam eine Einzahlung. Das ist eine vereinfachte Erklärung, aber sie macht deutlich, dass der Körper biologische Ressourcen braucht und verbraucht. Alles, was Sie tun (oder nicht tun), ist auch eine wirtschaftliche Entscheidung – darüber, was Sie ausgeben beziehungsweise was Sie lieber sparen.
Der beste Weg, solvent zu bleiben, ist – wie Sie vermutlich aus persönlicher Erfahrung wissen –, Überraschungen zu vermeiden. Also Ihren finanziellen Bedarf zu kennen, bevor er auftritt, und sicherzustellen, dass Sie die Ressourcen haben, um ihn zu decken. Das Gleiche gilt für Ihr körperliches Budget. Die kleinen Geschöpfe des Kambriums brauchten einen energieeffizienten Weg zum Überleben, wenn ein hungriger Räuber in der Nähe war. Sollten sie abwarten, ob das gierige Biest auch wirklich auf sie losging, und erst dann erstarren oder sich verstecken? Oder sollten sie im Voraus mit einer möglichen Attacke rechnen und ihren Körper rechtzeitig auf Flucht einstellen?
Ihr Gehirn steuert die Buchhaltung für Ihren Körper, was Wasser, Salz, Glukose und viele andere biologische Ressourcen angeht. Wissenschaftler nennen diesen Budgetierungsprozess Allostase.
Wenn es um das Körperbudget geht, ist Vorsicht besser als Nachsicht. Ein Geschöpf, das fluchtbereit war, bevor das Raubtier zuschlug, würde den nächsten Tag eher erleben als eines, das wartete, bis es wirklich angegriffen wurde. Alle, die gute Voraussagen trafen (meistens jedenfalls) oder nicht tödliche Fehler machten, aus denen sie lernten, hatten es gut. Jene, die falsche Voraussagen machten, Bedrohungen nicht erkannten oder Dinge für eine Bedrohung hielten, die keine waren, hatten es schwerer. Sie erforschten ihre Umgebung weniger, fanden weniger Nahrung und pflanzten sich seltener fort.
Der wissenschaftliche Begriff für die Körperbuchführung ist Allostase.[5] Dabei werden die Bedürfnisse des Körpers selbsttätig vorausgesehen, bevor sie auftreten. Die Lebewesen des Kambriums erneuerten und verbrauchten Tag für Tag Ressourcen, indem sie ihre Sinne nutzten und sich bewegten. Die Allostase sorgte dafür, dass der Körper – meistens jedenfalls – im Gleichgewicht blieb. Sie durften durchaus etwas verbrauchen, wenn sie dafür sorgten, dass die Vorräte rechtzeitig wieder aufgefüllt wurden.
Wie aber können Tiere wissen, was sie in Zukunft brauchen würden? Ihre beste Informationsquelle ist dabei ihre Vergangenheit: ihr früheres Verhalten in ähnlichen Situationen. Wenn eine Handlung ihnen früher Vorteile verschafft hatte – eine erfolgreiche Flucht oder eine leckere Mahlzeit –, dann würden sie diese vermutlich wiederholen. Alle Tiere, der Mensch eingeschlossen, greifen auf ihre früheren Erfahrungen zurück, um ihren Körper auf bestimmte Handlungen vorzubereiten. Die Vorhersage ist als Fähigkeit derart nützlich, dass sogar Einzeller ihr Handeln planen. Wie sie das anstellen, daran tüfteln Wissenschaftler noch immer.
Stellen Sie sich also eine dieser kleinen kambrischen Kreaturen vor, die durchs Wasser treibt. Über sich nimmt sie etwas wahr, das vielleicht gutes Futter ist. Was nun? Sie kann sich bewegen, aber sollte sie das auch? Denn durch die Bewegung verbraucht sie Energie. Der Aufwand sollte also der Mühe wert sein, wirtschaftlich betrachtet.[6] Unser kleiner Kambrier muss also aufgrund seiner früheren Erfahrungen eine Vorhersage treffen, um den Körper auf eine bestimmte Handlung vorzubereiten. Damit meine ich keine bewusste, wohlüberlegte Entscheidung, die das Pro und Contra abwägt. Ich sage vielmehr, dass irgendetwas in diesem Geschöpf ablaufen muss, das ihm eine Vorhersage und die ein oder andere Bewegung ermöglicht. Dieses Irgendetwas spiegelt eine wertmäßige Einschätzung wider. Der Wert jeder Bewegung hängt eng zusammen mit der Körperbuchführung durch Allostase.
In der Zwischenzeit entwickelten die urzeitlichen Tiere immer größere und komplexere Körper. Das heißt, dass auch ihr Innenleben facettenreicher wurde.[7] Der Amphioxus, der Magen am Stock, hatte fast keine körperlichen Systeme, die er steuern musste. Eine Handvoll Zellen reichte aus, um den Körper im Wasser zu stabilisieren und Nahrung durch das primitive Verdauungssystem zu schleusen. Neuere Tierarten hingegen entwickelten ausgefeilte innere Systeme wie ein kardiovaskuläres System mit einem Herzen, das Blut durch den Körper pumpte; ein Atmungssystem, das Sauerstoff aufnahm und Kohlendioxid entsorgte; und ein anpassungsfähiges Immunsystem, das Infektionen bekämpfte. Systeme wie diese stellten die Körperbuchführung vor neue Herausforderungen. Das ist etwa so, als würden wir ein einzelnes Girokonto mit der Buchhaltung einer großen Firma vergleichen. Diese komplexen Körper brauchten mehr als eine Handvoll Zellen, um sicherzustellen, dass Wasser und Blut und Salz und Sauerstoff und Glukose und Cortisol und Sexualhormone und Dutzende anderer Ressourcen so reguliert wurden, dass der Körper effektiv funktionieren konnte. Sie brauchten eine Kommandozentrale. Ein Gehirn.
Während die Tiere also immer größere Körper bekamen mit immer mehr Systemen, die sie aufrechterhalten mussten, entwickelten sie auch immer komplexere Organe zur Körperbuchführung – das heißt: Gehirne. Spulen wir nun ein paar hundert Millionen Jahre vor. Die Erde ist übersät von Geschöpfen mit komplizierten Gehirnen aller Art, zu denen auch das Ihre gehört. Ein Gehirn, das nonstop über 600 Muskeln zur Bewegung orchestriert, das Dutzende verschiedener Hormone reguliert, etwa 7500 Liter Blut am Tag durch den Körper pumpt, Milliarden von Gehirnzellen mit Energie versorgt, Nahrung verdaut, Abfallstoffe ausscheidet und Krankheiten bekämpft, und das im Schnitt für gut und gerne 72 Jahre. Ihre Körperbuchführung ist vergleichbar mit der Buchhaltung eines multinationalen Konzerns, und Ihr Gehirn ist dieser Aufgabe gewachsen. Außerdem findet diese Körperbuchführung in einer immer komplexeren Welt statt, die von anderen Gehirnen und deren Körpern zusätzlich verkompliziert wird.
Um also zu unserer Ausgangsfrage zurückzukehren: Was ist die wichtigste Aufgabe Ihres Gehirns? Nicht das rationale Denken. Nicht Ihre Gefühle. Nicht Ihre Fantasie, Ihre Kreativität oder Ihr Mitgefühl. Der wichtigste Job Ihres Gehirns ist die Kontrolle über Ihren Körper, um dessen Allostase aufrechtzuerhalten. Das tut es, indem es energetische Anforderungen erkennt, bevor sie auftreten, damit Sie, sobald sie gefordert sind, sinnvolle Aktionen einleiten und überleben können. Ihr Gehirn investiert Ihre Energie in der Hoffnung auf eine gute Rendite, zum Beispiel in Form von Nahrung, Obdach, Zuneigung oder physischen Schutz. Damit Sie die wichtigste Aufgabe der Natur erledigen können: Ihre Gene an die nächste Generation weiterzugeben.
Kurz gesagt: Die wichtigste Aufgabe Ihres Gehirns besteht nicht im Denken, sondern darin, einen kleinen Wurmkörper zu regulieren, der sehr, sehr kompliziert geworden ist.
Natürlich denkt und fühlt und erzeugt Ihr Gehirn tatsächlich Hunderte Erfahrungen, wie zum Beispiel, dieses Buch zu lesen und zu verstehen. Aber all diese mentalen Fähigkeiten sind die Folge seiner eigentlichen Mission, nämlich Sie am Leben zu erhalten, indem es gut mit Ihrem Budget umgeht. Alles, was Ihr Gehirn hervorbringt, von der Erinnerung bis zur Halluzination, von der Ekstase bis zur Scham, ist Teil dieser Mission. Manchmal regelt Ihr Gehirn das Budget kurzfristig, zum Beispiel wenn Sie Kaffee trinken, um länger wach bleiben und ein Projekt fertigstellen zu können. Es weiß, dass es sich Energie genehmigt, für die Sie am nächsten Morgen einen Aufpreis zahlen müssen. Dann wieder kalkuliert Ihr Gehirn auf lange Sicht, wenn Sie beispielsweise etwas Schwieriges lernen, wie Mathematik oder das Zimmern. Hierfür müssen Sie nachhaltig, über einen längeren Zeitraum hinweg, Energie investieren, aber am Ende hilft Ihnen das beim Überleben und Vorankommen.
Sie und ich erleben nicht jeden Gedanken, jedes Gefühl von Glück, Zorn oder Staunen, jede Umarmung, jede nette Geste und jede Beleidigung als Ein- oder Auszahlung auf oder von unserem Stoffwechselkonto, aber letztlich ist es genau das, was dahintersteckt. Diese Sicht der Dinge lässt Sie besser verstehen, wie Ihr Gehirn funktioniert und wie Sie gesund bleiben können, um ein langes und sinnerfülltes Leben zu führen.
Diese kleine Entwicklungsgeschichte ist der Beginn einer langen Erzählung über Ihr Gehirn und die Gehirne, die Sie umgeben. In den nächsten sieben kurzen Lektionen werden wir von bemerkenswerten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus den Neurowissenschaften, der Psychologie und der Anthropologie hören, die das Verständnis dessen, was in unserem Kopf vorgeht, revolutioniert haben. Sie erfahren, was das menschliche Gehirn im Vergleich zu den höchst erstaunlichen Gehirnen vieler anderer Tiere so einzigartig macht. Sie werden entdecken, wie aus dem Gehirn eines Kindes das eines Erwachsenen wird und wie eine einzige menschliche Gehirnstruktur die Ausbildung derart unterschiedlicher Arten von Geist ermöglicht. Wir werden uns sogar mit der Frage nach der Wirklichkeit beschäftigen: Was verleiht uns die Macht, Sitten, Normen und ganze Zivilisationen zu ersinnen?
Dabei greifen wir natürlich immer wieder auf die Körperbuchführung zurück und untersuchen, wie die Vorhersagen des Gehirns sich auf Ihre Handlungen und Erfahrungen auswirken. Und wir werden aufdecken, wie eng Ihr Gehirn mit Ihrem Körper und mit anderen Gehirnen und deren Körpern verbunden ist. Am Ende dieses Buches werden Sie hoffentlich wie ich mit Freude feststellen, dass Ihr Gehirn weit mehr kann als nur denken.
Lektion Nr. 1Sie haben ein Gehirn (nicht drei)
Vor über 2000 Jahren erzählte im antiken Griechenland ein Philosoph namens Platon von einem Krieg. Nicht von einem Krieg zwischen Städten oder Nationen, sondern von einem, der im Menschen selbst stattfindet. Der menschliche Geist, so Platon, sei ein ständiger Kampf zwischen drei inneren Kräften, die unser Verhalten kontrollierten.[8] Eine der Kräfte bildeten unsere grundlegenden Instinkte wie Hunger und Sexualtrieb. Die zweite Kraft setze sich zusammen aus unseren Gefühlen wie Freude, Ärger und Angst. Beide Kräfte sind laut Platon wie Tiere, die unser Verhalten in verschiedenste, mitunter wenig ratsame Richtungen treiben können. Um diesem Chaos entgegenzuwirken, gebe es eine dritte innere Kraft, nämlich das rationale Denken, das die beiden Tiere lenken und uns auf einen zivilisierten, rechtschaffenen Pfad führen soll.
Platons faszinierende Moralgeschichte von den inneren Konflikten ist eines der Lieblingsnarrative der westlichen Zivilisation. Wer von uns hat nie das innere Hin und Her zwischen Verlangen und Vernunft erfahren?
Kein Wunder also, dass die Wissenschaft später Platons geistiges Schlachtfeld auf das menschliche Gehirn projizierte im Versuch, dessen Entwicklung zu erklären.[9] Früher einmal, so hieß es da, seien wir Reptilien gewesen. Unser Reptiliengehirn entstand vor 300 Millionen Jahren und steuerte grundlegende Bedürfnisse wie Essen, Kämpfen und Paarung. Über 100 Millionen Jahre später entwickelte sich das Gehirn so, dass wir nun auch Emotionen hatten; da waren wir dann schon Säugetiere. Schließlich brachte das Gehirn einen rationalen Part hervor, um unsere inneren Tiere zu bändigen. Wir wurden zu Menschen und lebten von da an, uns logisch verhaltend, bis an unser Lebensende.
Diese Version der Entwicklungsgeschichte geht davon aus, dass das menschliche Gehirn aus drei Schichten besteht, die jeweils für Überleben, Fühlen und Denken verantwortlich sind. Man spricht vom Konzept des «dreieinigen Gehirns» (Triune Brain). Die unterste Schicht oder das Reptiliengehirn, das wir angeblich von früheren Reptilien geerbt haben, soll unsere Überlebensinstinkte beherbergen. Die mittlere Schicht, die man als limbisches System bezeichnet, sei verantwortlich für Emotionen und der Erbteil, den uns die prähistorischen Säugetiere hinterlassen haben. Die äußere Schicht, ein Teil der Großhirnrinde,[10] soll nur beim Menschen vorkommen und für das rationale Denken zuständig sein. Sie wird Neocortex (neuer Cortex) genannt. Ein Teil dieses Neocortex, der sogenannte präfrontale Cortex, soll das emotionale und das Reptiliengehirn steuern und unsere irrationalen, animalischen Anteile in Schach halten. Die Verfechter der Theorie vom dreieinigen Gehirn weisen darauf hin, dass der Mensch eine ausgeprägte Großhirnrinde (Cortex cerebri) hat. Das nehmen sie als Beleg dafür, dass rationales Denken nur dem Menschen eigen ist.
Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass ich nun zwei Theorien über die Entwicklung des menschlichen Gehirns vorgestellt habe. In der einleitenden halben Lektion habe ich erzählt, dass Gehirne sich entwickelt haben, um immer anspruchsvollere Systeme für Bewegung und Sinneserfahrung zu steuern, und dass sie die Energiereserven immer komplexerer Körper regulieren. Die Geschichte vom dreieinigen Gehirn aber besagt, das Gehirn habe sich in Schichten entwickelt, damit die Ratio unsere tierischen Triebe und emotionalen Bedürfnisse steuern könne. Wie können wir diese beiden wissenschaftlichen Ideen nun in Einklang bringen?
Die Theorie vom dreieinigen Gehirn
Glücklicherweise müssen wir das gar nicht, denn eine von beiden ist schlicht falsch. Die Geschichte vom dreieinigen Gehirn ist einer der erfolgreichsten und verbreitetsten Irrtümer in der Wissenschaft.[11] Sicher handelt es sich dabei um eine faszinierende Geschichte, zumal sie widerspiegelt, wie wir uns gelegentlich fühlen. Wenn unsere Geschmacksknospen sich von einem üppigen Stück saftigen Schokoladenkuchens versucht fühlen, den wir aber aus dem einfachen Grund ablehnen, weil wir gerade gefrühstückt haben, dann verfällt man leicht in den Glauben, unser impulsives Reptiliengehirn habe, unterstützt vom emotionalen limbischen System, uns in Richtung Kuchen gelockt, doch unser heldenhafter rationaler Neocortex habe letztlich über die beiden obsiegt.
Aber das menschliche Gehirn funktioniert nicht so. Negatives Verhalten kommt nicht von urzeitlichen, zügellosen inneren Tieren. Und sinnvolles Verhalten ist nicht das Resultat rationaler Überlegungen. Rationalität und Emotionalität liegen nicht in ewigem Kampf miteinander … ja, sie haben im Gehirn noch nicht einmal getrennte Wohnsitze. (Und seien wir ehrlich: Manchmal braucht man einfach Kuchen zum Frühstück.)
Das Konzept des dreieinigen Gehirns wurde über die Jahre von mehreren Wissenschaftlern vertreten und Mitte des 20. Jahrhunderts von einem Arzt namens Paul MacLean ausformuliert. Er zeichnete das Bild eines Gehirns, das so strukturiert war wie Platons Schlachtfeld. Er belegte seine Theorie mithilfe der besten Technologie, die ihm damals zur Verfügung stand: visuelle Inspektion. Das heißt, er warf einen Blick durchs Mikroskop auf die Gehirne verschiedener toter Eidechsen und Säugetiere (auch Menschen) und stellte Ähnlichkeiten und Unterschiede allein durch die Draufsicht fest. MacLean kam zu dem Schluss, dass der Mensch neue Gehirnareale besäße, die bei anderen Säugetieren fehlten. Diese bezeichnete er als Neocortex. Im nächsten Schritt fand er heraus, dass Säugetiere Gehirnbereiche besitzen, die Reptilien nicht haben. Diese nannte er dann limbisches System. Und voilà, fertig war eine neue Geschichte der menschlichen Entwicklung.
MacLeans Geschichte vom dreieinigen Gehirn entwickelte in manchen Teilen der Wissenschaftsgemeinde eine ungemeine Zugkraft. Seine Spekulationen waren einfach, elegant und schienen zu Charles Darwins Ideen zur Evolution des menschlichen Erkenntnisvermögens zu passen. Darwin nämlich ging in seinem Buch Die Abstammung des Menschen davon aus, dass sich der menschliche Geist zusammen mit dem Körper entwickelt habe, und daher besäße jeder Mensch ein solches urzeitliches, inneres Tier, das wir mithilfe der Erkenntnis zähmten.
Der Astronom Carl Sagan stellte die Idee des dreieinigen Gehirns einem größeren Publikum vor, als er 1977 sein Buch The Dragons of Eden veröffentlichte, mit dem er den Pulitzerpreis gewann (die deutsche Ausgabe erschien 1978 zunächst unter dem Titel Die Drachen von Eden, später dann unter … Und werdet sein wie Götter). Begriffe wie «Reptiliengehirn» und «limbisches System» geistern heutzutage durch alle möglichen populärwissenschaftlichen Bücher, Zeitschriften und Zeitungen. Während ich diese Lektion niederschreibe, habe ich im Supermarkt eine Ausgabe der Harvard Business Review entdeckt, die erklären will: «Wie Sie das Reptiliengehirn Ihrer Kunden anregen, um ihnen etwas zu verkaufen.» Gleich daneben eine Ausgabe des National Geographic, in der es um die Gehirnareale geht, die das angebliche «Emotionsgehirn» ausmachen.
Weniger bekannt ist hingegen, dass schon zu der Zeit, als The Dragons of Eden erschien, die Wissenschaft eindeutige Belege dafür hatte, dass die Vorstellung vom dreieinigen Gehirn falsch war. Diese Erkenntnisse verdankten sich der damals neuesten Analyse der molekularen Struktur von Gehirnzellen, die man Neuronen nennt. Schon in den 1990ern wiesen Experten das Konzept des Drei-Lagen-Gehirns weit von sich. Es hielt neueren Untersuchungen mit besseren Instrumenten einfach nicht stand.
Zu MacLeans Zeiten verglichen Wissenschaftler ein Tiergehirn mit dem anderen, indem sie es einfärbten und in hauchdünne Scheiben aufschnitten wie einen edlen Schinken aus dem Feinkostladen. Diese fleckigen Gebilde wurden dann unter dem Mikroskop untersucht. Die Neurowissenschaftler, die sich mit dem Gehirn beschäftigen, machen das auch heute noch, aber sie haben darüber hinaus neuere Methoden zur Verfügung, mithilfe derer sie in die Gehirnzellen gucken können, um die Gene darin zu studieren. Und so stellten sie fest, dass Neuronen von zwei verschiedenen Tierarten zwar ganz anders aussehen können, aber immer noch die gleichen Gene enthalten