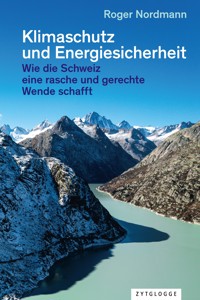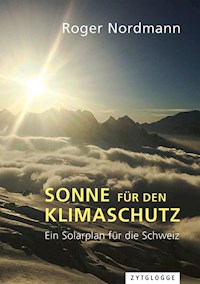
18,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Der Klimawandel ist das drängendste Problem unserer Zeit. Ein Grossteil der CO2-Emissionen wird in der Schweiz von Fahrzeugen und Gebäudeheizungen verursacht. Was können wir tun, um die Ziele des Klimaabkommens von Paris zu erreichen? Roger Nordmann, Experte für Energie- und Klimafragen, beleuchtet in seinem Buch die Energieversorgung in der Schweiz. Als Schlüssel für eine klimaneutrale Zukunft sieht er die Photovoltaik und entwirft eine nach dem heutigen Stand der Technologie konkret umsetzbare Energiestrategie. Sein ‹Solarplan für die Schweiz› ist an der Praxis orientiert und für Laien wie auch für Fachpersonen gleichermassen zugänglich. ‹Sonne für den Klimaschutz› ist die deutsche Übersetzung des 2019 auf Französisch erschienenen Buches ‹Libérer la Suisse des énergies fossiles›.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 178
Ähnliche
ROGER NORDMANN
SONNE FÜR DEN KLIMASCHUTZ
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einemStrukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.
Die folgenden Unternehmen und Institutionen haben zurFinanzierung der Übersetzung dieses Buches vom Französischenins Deutsche beigetragen:
–Asgalium Unitec SA, Cortaillod
–ADEV Solarstrom AG, Liestal
–Energiebüro® ag, Zürich
–Helion (Bouygues E&S InTec Schweiz AG), Zuchwil,
–Planeco GmbH, Münchenstein
–Winsun AG, Steg
–und der Verband Swissolar, Zürich.
© 2019 Zytglogge Verlag AG, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzt aus der französischsprachigen Originalausgabe ‹Le plan solaire et climat. Commentpasser de 2 à 50 GW photovoltaïque pour remplacer le nucléaire, électrifier la mobilité et assainirles bâtiments› (Editions Favre, 2019) von Cornelia Schmidt, TransLations, Weisslingen
Coverbild: © Aline Lehmann
Korrektorat: www.korrigieren.biz
Layout/Satz: Zytglogge Verlag
e-Book: mbassador GmbH, Basel
ISBN epub: 978-3-7296-2268-5
ISBN mobi: 978-3-7296-2269-2
www.zytglogge.ch
Roger Nordmann
SONNE FÜR DENKLIMASCHUTZ
Ein Solarplan für die Schweiz
«KLEINE SCHRITTE, KLEINE SCHRITTE,KLEINE SCHRITTE REICHEN EINFACH NICHT!»
(an der Demonstration vom 2.2.2019 in Lausannevon Klimaschützer/-innen skandierte Parole)
Dank
Der Autor dankt folgenden Personen herzlich, die auf die eine oder andere Weise zur vorliegenden Arbeit beigetragen haben:
Pascal Affolter, Christophe Ballif, Samuel Bendahan, Cédric Chanez, François Cherix, Romaine Fauchère, Benoît Gaillard, Bruno Ganz, Florence Germond, Jordan Holweger, Steve Jaunin, Christian Levrat, Dominique Martin, Cédric Moullet, Edith Nordmann, Jean Nordmann, Marie-France Nordmann, Philippe Nordmann, Ursula Nordmann-Zimmermann, Lionel Perret, Jürg Rohrer, Séverine Scalia Giraud, David Stickelberger, Peter Toggweiler, Tobias Wyss und sämtlichen Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitenden der Geschäftsstelle von Swissolar.
Hinweis
Dieses Buch wurde von Swissolar unterstützt, ist jedoch eine persönliche Arbeit des Verfassers, der allein für den Inhalt verantwortlich ist. Dazu gehören insbesondere mögliche Irrtümer, die auf den Forschungscharakter des Werks zurückzuführen sind.
Weitere Veröffentlichungen des Verfassers:
–‹Atom- und Erdölfrei in die Zukunft›, Orell Füssli Verlag, 2011.
–‹Die Angstgenossenschaft›, mit François Cherix, Vorwort Sergio Romano, Editions Favre 2011.
Weitere Aufsätze und Berichte auf www.roger-nordmann.ch
INHALT
Vorwort
1Das Wichtigste in Kürze
1.1Eine langfristige Klimaschutzpolitik
1.2Den Strombedarf berücksichtigen
1.3Jederzeit genügend Strom
1.4Mit Solarstrom durch den Winter
1.5Kohlenstoffarme Energieversorgung und wirtschaftlicher Nutzen
2Neuste Entwicklungen bei Energieproduktion und -verbrauch
2.1Schweizer Stromproduktion aus Wasserkraft und neuen erneuerbaren Energieträgern
2.2Strom aus Atomkraftwerken
2.3Stromverbrauch
2.4Fossile Energien
3Künftige Stromproduktion und künftiger -verbrauch im Jahresdurchschnitt
3.1Verbrauchsentwicklung und Ablösung der Atomkraftwerke
3.2Gebäudesanierung
3.3Elektrifizierung der Mobilität (ohne Luftverkehr)
3.4Stromproduktionsbedarf für Mobilität und Gebäude
4Das Photovoltaik-Potenzial in der Schweiz
4.1Ein wirtschaftliches PV-Potenzial von 118 TWh
4.2Ökologischer Fussabdruck der Photovoltaik
5Die saisonalen Schwankungen
5.1Aktueller Stand und Produktionsprofil der Wasserkraft
5.2Zukünftige jahreszeitliche Situation bei voller Dekarbonisierung und ohne Atomstrom
6Profil, Schwankungen und Glättung der Photovoltaikproduktion
6.1Wie addiert sich die Stromproduktion vieler Anlagen?
6.2Schwankungen im Stunden-, Tages-, Wochen- und Jahreszeitenverlauf
6.3Effizientes PV-Produktionsprofil in höheren Lagen
6.4Monatliche Produktionsprofile von Photovoltaik und Wasserkraft im Vergleich
6.5Kurzzeitige PV-Produktionsüberschüsse und Peak Shaving
7Stromspeicherung: Bedarf und Möglichkeiten
7.1Kurzzeitspeicherung
7.2Langzeitspeicherung (saisonal)
7.3Synergie zwischen Kurz- und Langzeitspeicherung im Sommer
7.4Vorbild Deutschland
7.5Die Stromspeicherung im Gesamtkontext
8Ergebnisse der Modellierung auf monatlicher Basis
8.1Basisszenario: 50 GW Solarstrom, Elektrifizierung des Strassenverkehrs und Gebäudesanierung
8.2Variante: Gebäudesanierung
8.3Variante: ungenügender PV-Ausbau
8.4Varianten: Einfluss der saisonalen Speicherung
8.5Variante: Windkraft statt Erdgas
8.6Variante: stärkerer PV-Ausbau und Konzentration der Speicherwasserkraft-Produktion auf Wintermonate mit der geringsten Sonneneinstrahlung
8.7Schlussfolgerungen aus dem Basisszenario und den Varianten
9Wirtschaftliche Überlegungen
9.1Was kostet uns die zukünftige Abhängigkeit von fossilen Energieträgern?
9.2Vergleich der Kosten einer Kilowattstunde Strom aus erneuerbaren Energien zwischen 2010 und 2017
9.3Die Finanzierung von Gebäudesanierung und Mobilität
9.4Verteilnetz und Speicherung
9.5Gesamtinvestitionskosten der PV-Strategie in der Schweiz ohne Kapitalrendite
9.6Kosten pro Kilowattstunde Photovoltaik inkl. Kapitalrendite
9.7Wirtschaftliche Auswirkungen des Peak Shaving
9.8Die Eigenart des Strommarktes berücksichtigen
10Aktionsplan
10.1Die Selbstversorgung der Schweiz im Jahresdurchschnitt zum Ziel erklären und kommunizieren
10.2Mehr Mittel für die Einmalvergütung für Anlagen mit Eigenverbrauch bereitstellen
10.3Ein Ausschreibeverfahren für Anlagen auf Landwirtschaftsgebäuden und Infrastrukturbauten einführen
10.4Die verfügbaren Finanzressourcen optimal einsetzen
10.5Rechtliche Grundlagen für das Peak Shaving schaffen
10.6Die acht technischen Massnahmen
11Schlusswort
12Anhang
12.1Statische Daten
12.2Variable Parameter
12.3Keine höhere gegenseitige Abhängigkeit
12.4Abhängige Variablen
12.5Ergebnisse der Szenarien im Vergleich zum Status quo
13Abbildungsverzeichnis
VORWORT
Joseph Fourier war möglicherweise der Erste, dem diese erstaunliche Diskrepanz auffiel. Er war Präfekt des Departements Isère unter Napoleon I. und ein erfolgreicher Funktionär seiner Majestät. Darüber hinaus studierte er die Wärmeausbreitung in Kanonenrohren. Bis zur Temperatur der Erde war es nur noch ein kleiner Schritt, für den er einen grossen Aufwand betrieb. (Nur so am Rande: Fourier erfand auch die nach ihm benannte mathematische Methode, die mir in meiner gesamten Wissenschaftlerlaufbahn immer wieder sehr nützlich war.) Weiter fand er heraus, dass ein Gegenstand in einem Glasgefäss an der Sonne wärmer wird als unter direkter Sonneneinstrahlung. Meine Mutter hatte das Prinzip auch begriffen: Sie legte die Melonen zum Reifen jeweils hinter ein Stück Fensterglas. Ob daraus der Begriff ‹Treibhauseffekt› abzuleiten ist? Auf jeden Fall sind Wasserdampf (H2O), Kohlendioxid (CO2) und einige weitere Luftbestandteile wie Methan (CH4) so genannte Treibhausgase (THG).
Die Temperaturdifferenz zwischen Aufnahme und Abgabe hat einen interessanten Hintergrund. Sie hat mit der Zusammensetzung der Erdatmosphäre zu tun; diese besteht hauptsächlich aus Sauerstoff- (O2) und Stickstoffmolekülen (N2). In der Luft sind ausserdem ein bisschen Wasser (H2O) und ganz wenig – unter einem halben Promille – Kohlendioxid (CO2) enthalten. Das Licht bringt Bewegung ins Ganze, und die aufgenommene Energie wird konstant zurückgeworfen, ebenfalls in Form von Licht.
Der Tanz der zweiatomigen Moleküle (O2 und N2) ist einfach: Sie können nur auf eine Art schwingen. Aus thermischer Sicht sind diese Moleküle allerdings neutral, und wir können sie getrost vergessen. Die dreiatomigen Moleküle hingegen sind komplizierter: Dank ihrer dreieckigen Form können sie unterschiedliche Schwingungsverhalten aufweisen. Das aufgenommene Licht werfen sie in umgewandelter Form zurück. Zwar sind sie aus energetischem Blickwinkel betrachtet ebenfalls neutral, doch nicht bezüglich der Farbe. Sie werfen Licht mit einem höheren Rotanteil zurück, das vermehrt in der Atmosphäre gefangen bleibt und von dem lediglich ein kleinerer Teil ins All entweicht. Deshalb ist die Erde überhitzt: Die Temperatur fällt um 33 °C höher aus als ohne den Treibhauseffekt. Was bedeutet das nun?
Bekanntermassen ist die Zukunft schwer vorherzusagen, doch wir können die Vergangenheit sprechen lassen. Vor 20000 Jahren lag Europa unter einer 1 km dicken Eisdecke. Aus den Eiskappen von Grönland und der Antarktis können wir herauslesen, dass der THG-Gehalt und die Lufttemperatur bereits vor 800 000 Jahren konstant im Verhältnis zueinander standen – also lange, bevor der Mensch die Bühne betrat. Ein Temperaturanstieg oder -rückgang stand immer im Zusammenhang mit einem höheren bzw. geringeren THG-Gehalt. Grob gesagt blieb das Klima in den letzten paar Millionen Jahren stabil. Die Wärmeperioden machten lediglich während einiger Eiszeiten Pause – ideale Bedingungen für das Leben auf der Erde. Svante Arrhenius hatte dies bereits Ende des 19. Jahrhunderts erfasst. Er sah eine neue Eiszeit voraus und stellte sich vor, dass sie mit der Zufuhr riesiger Mengen CO2 in die Atmosphäre verhindert werden könnte. Gilt er nun als Pionier im Bereich der Geophysik? Wie dem auch sei: Unsere hochtechnisierte, industrialisierte Gesellschaft hat seine Idee in die Tat umgesetzt – wenn auch völlig unkontrolliert. Deshalb ist unser Klima aus dem Gleichgewicht geraten. Die THG-Konzentration in der Atmosphäre wird bald doppelt so hoch sein. Hier kann uns kein Blick in die Vergangenheit mehr helfen: So stark ist das Klima schon lange nicht mehr durcheinandergeraten. Um einen Vergleich ziehen zu können, müssten wir wohl 70 Millionen Jahre zurückschauen, als ein Meteor dem Leben der Dinosaurier ein Ende setzte.
Wie Arrhenius vor 150 Jahren wissen auch unsere heutigen Forscher dennoch recht genau, wohin die Zukunft führt. Sie haben all ihr Wissen gebündelt und ihre Schlussfolgerungen im Bericht des IPCC (https://www.ipcc.ch) veröffentlicht. Es besteht kein Zweifel: So kann es nicht weitergehen – wir laufen direkt gegen die Wand! Seit einiger Zeit schon sind die Vorboten für alle erkennbar. Meine geliebten Gletscher verschwinden – doch das ist nicht so dramatisch wie die verheerenden Wirbelstürme oder die gnadenlosen Dürren, die das Leben vieler Menschen in seinen Grundfesten erschüttern. Trotzdem stehen wir erst am Anfang. Denn unsere Erde ist ein riesiges Schiff, das im Abdriften begriffen ist. Wir müssen uns schon sehr anstrengen, um es wieder aufzurichten und möglichst auf Kurs zu bringen.
2015 beschloss die UNO-Klimakonferenz in Paris in weiser Voraussicht, dass die globale Erwärmung auf 2 °C, nach Möglichkeit sogar auf 1.5 °C beschränkt werden müsse. Sollte dies nicht gelingen, würde die Erde zwar nicht stillstehen. Doch nicht nur das bequeme Leben, das viele von uns bis zum Exzess führen, sondern auch unsere gesamte Zivilisation und alle Werte, die unsere Kultur der Menschheit gebracht hat, wären in höchster Gefahr.
Dennoch ist das den meisten von uns ziemlich egal. Ist es wirklich so schwierig, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen?
Den meisten von uns? Natürlich nicht! Viele von uns haben den Ernst der Lage erkannt und bemühen sich, wo sie können. Wir löschen die Lichter beim Verlassen des Zimmers oder fahren vermehrt Rad. Doch wo ist die grosse Bewegung, die bis 2050 unsere Erde aus dem verhängnisvollen Zyklus der fossilen Brennstoffe befreien kann? Glauben Sie, dass es möglich ist? Als einer derjenigen, die am meisten von der technisch-wirtschaftlichen Entwicklung Ende des letzten Jahrtausends profitiert haben, glaube ich es. Schliesslich ist in meinem Alter der Optimismus zur philosophischen Pflicht geworden.
Doch seit Kurzem nimmt die Hoffnung eine neue, viel realere Gestalt an. Für mich wird sie von einem 15-jährigen Mädchen verkörpert: Greta Thunberg, einer entfernten Nachfahrin von Svante Arrhenius. Sie ist ein Kind, das die Wahrheit ganz einfach beim Namen nennt. Im richtigen Moment ist sie die richtige Person für eine Welt, die vielleicht trotz allem bereit ist, ihr zu folgen. Es sind eindrückliche Zeichen, die da ausgesendet werden. Ich durfte an der Bewegung der Jugendlichen teilnehmen, die zum Klimastreik aufriefen. Auch sie sind genau richtig: Sie wissen, wohin sie wollen. Es ist ihnen bewusst, dass sie sich für ihr eigenes Leben einsetzen und dass es niemand anders tun wird.
Doch auch wir, die Vorgängergenerationen, haben ein Wörtchen mitzureden. Und das sollten wir sehr vorsichtig tun, denn wie es Greta Thunberg formuliert: Neue Lösungen können nicht auf «alten Ideen, die uns in dieses Schlamassel gebracht haben», aufgebaut werden.
Doch wie präsentieren sich diese Lösungen? Ich gebe es zu: Das weiss ich leider auch nicht. Doch ich weiss, dass sie aufgrund der Realität und im Einklang mit der Natur entwickelt werden müssen. Hier können die Erfahrung und die Weisheit der ‹Alten› sinnvoll eingesetzt werden.
Gemäss dem IPCC muss die Welt bis 2050 THG-neutral werden. Die Jugendlichen sind hier noch strenger und fordern dies bereits bis 2030. Sie haben recht: Jedes noch so kleine Stück bringt uns weiter. Für die Schweiz sind die Energieträger die grösste Herausforderung. Vier Fünftel davon stammen aus fossilen Quellen. Diese müssen verschwinden. Das Ziel ist klar – und überraschenderweise auch der Weg dorthin. Wir müssen bloss ein bisschen sparen und die Solarstromproduktion um das 25-Fache steigern.
Sie denken: Das 25-Fache, der spinnt ja!
Aber halt, keine Angst! Die Sonne spendet uns grosszügig ihr im Überfluss vorhandenes Licht. Und die Technologien, um es zu nutzen, bestehen bereits. Roger Nordmann ist Experte auf dem Gebiet der Solarenergie. Als erfahrener Parlamentarier kennt er auch die politischen und gesetzlichen Grundlagen, die den Wandel herbeiführen müssen. Mit seinem Buch ‹Sonne für den Klimaschutz› liefert er eine Roadmap für all jene – ob jung oder weniger jung –, die ihn unterstützen wollen. Ich gehöre auch dazu. Mein Dank geht an Roger Nordmann, der sich die Mühe gemacht und die Zeit dafür aufgewendet hat, dieses Rezept für die Hoffnung zu schreiben.
Morges, im April 2019
Jacques Dubochet
Chemie-Nobelpreisträger 2017
1DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
Die weltweite Klimakrise ist hauptsächlich ein Energieproblem, denn der Einsatz fossiler Brennstoffe verursacht rund zwei Drittel des Treibhausgasausstosses1, vor allem durch Kohle, Erdöl und Erdgas.
Zur Bekämpfung der globalen Erwärmung müssen Gesellschaft und Wirtschaft deshalb auf ein klimaneutrales Energieversorgungsmodell umsteigen. Dafür braucht es nicht nur die Zusammenarbeit aller Staaten, sondern auch ein entschlossenes innenpolitisches Handeln jedes einzelnen Landes. Der Umstieg muss für alle ohne Einbussen beim Komfort geschehen beziehungsweise einen angemessenen Lebensstandard für jene schaffen, die ihn noch nicht haben. Ohne den Wandel kann der Wohlstand nämlich nicht dauerhaft sichergestellt werden. Im Gegenteil: Die Zerstörung der Umwelt – Grundlage allen menschlichen Lebens – führt unaufhaltsam zu einer Verarmung der Menschheit insgesamt.
Die UNO-Konvention zum Klimawandel und die Folgevereinbarungen, etwa das Ende 2015 unterzeichnete Pariser Klimaabkommen, bilden das international geltende Regelwerk zur Eindämmung der globalen Erwärmung. Das weltweite Ziel besteht in der Beschränkung der Erderwärmung auf höchstens 1.5 °C bis 2 °C. Für die Umsetzung muss jeder Staat seinen eigenen Beitrag leisten. Gemäss dem neusten Bericht des IPCC2 müssen bis 2050 alle menschlichen Aktivitäten klimaneutral sein, damit die globale Erwärmung auf 1.5 °C beschränkt werden kann. Das heisst, die CO2-Emissionen müssten netto bis Mitte des 21. Jahrhunderts auf null reduziert werden.
Die Schweiz ist jedoch von diesem Ziel noch weit entfernt. Zwischen 1990 – dem Bezugsjahr für die weltweite Klimapolitik – und 2016 ging der Treibhausgasausstoss lediglich um 10.1% zurück. In dieser mittelmässigen Leistung ist der neuste Anstieg der Emissionen durch die Luftfahrt nicht einmal berücksichtigt. Deshalb steht die Schweiz beim Klimaschutz noch längst nicht dort, wo sie sein sollte.
Nahezu unsere gesamte Wirtschaft müsste dekarbonisiert werden. Der Verbrauch an fossilen Energieträgern muss drastisch gesenkt werden, um eine Verringerung des CO2-Ausstosses als wichtigsten Verursacher von Treibhausgasen zu erreichen. Der grösste Handlungsbedarf besteht im Gebäudebereich und im Verkehr, wie Grafik 1 zeigt. Vier Fünftel des Treibhausgasausstosses stammen aus der Nutzung fossiler Brennstoffe (in Grau und Schwarz). In Orange sind die Emissionen aus den übrigen Bereichen dargestellt. Folgerichtig leitet sich daraus das erste energie- und klimapolitische Ziel für die Schweiz ab: eine möglichst vollständige Dekarbonisierung unserer Energiewirtschaft.3
Grafik 1: Treibhausgasemissionen 2017 in der Schweiz (ausgenommen graue Energie durch Importe)
Die vorliegende Arbeit will aufzeigen, wie Solarstrom – also die Photovoltaik – entscheidend zur Dekarbonisierung, zum konsequenten Abbau der Kohlenstoffintensität der Schweizer Energiewirtschaft beitragen kann. Mit einem Solarplan soll die Grundlage einer auf Sonnenenergie basierenden Elektrifizierungsstrategie geschaffen werden.
Die Plausibilität dieser Strategie wird hauptsächlich auf Grundlage des heutigen Stands der Technik und der aktuellen Kosten nachgewiesen, ohne fortlaufende Entwicklungen zu berücksichtigen. Am Einsatz der Wasserkraft wird mit Absicht wenig verändert. In Anbetracht der absehbaren Fortschritte etwa bei Energieeffizienz und Ökobilanz der Speicherlösungen sind die Hypothesen tendenziell vorsichtig formuliert. Sie haben dafür den Vorteil, dass sie für spätere Diskussionen eine einfache, gut verständliche Basis bilden.
1.1Eine langfristige Klimaschutzpolitik
Damit die Abkehr von kohlenstoffhaltigen Energieträgern gelingt, müssen die Herausforderungen mit einem langfristigen Zeithorizont angegangen werden.
Erstens, weil sich die Auswirkungen unseres Energieverbrauchs auf die Umwelt, insbesondere auf das Klima, erst über längere Zeit zeigen. Die Wahl der momentan kostengünstigsten Lösung kann langfristig sehr teuer zu stehen kommen.
Des Weiteren hängen Energieversorgung und -nutzung von riesigen technischen und baulichen Infrastrukturen ab, deren Einsatz und Finanzierung sich über Jahrzehnte erstrecken. Deshalb werden kurzfristige Lösungsansätze dem Anliegen nicht gerecht. Symbolisches Handeln und persönliches Engagement mögen ihre Bedeutung haben, doch sie reichen längst nicht aus, um die Energiewirtschaft nachhaltig umzustrukturieren.
Auch aus geostrategischer Sicht muss eine langfristig nachhaltige Strategie greifen. Um die Ressource Energie werden auf der ganzen Welt zahlreiche Konflikte ausgetragen.
Folglich lässt sich die globale Erwärmung nur mit einer auf Jahrzehnte hinaus anwendbaren Energiepolitik in Schranken halten. Ausnahmslos jeder Staat muss jetzt handeln. Das Laissez-faire-Prinzip ist kein gangbarer Weg (siehe Kapitel 9 und 10).
Die Situation der Schweiz ist natürlich das Ergebnis früherer und aktueller politischer Weichenstellungen. Historisch gesehen zeichnet sich der heutige Stand der Schweiz durch vier Hauptmerkmale aus:
•eine enorme Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen Erdöl und Erdgas, die vollumfänglich importiert werden müssen;
•erste erfolgreiche Massnahmen im Bereich Energieeffizienz zur Senkung des Verbrauchs, vor allem bei fossilen Brennstoffen und Strom;
•erste bescheidene Effizienzgewinne im Transportbereich, die aber durch den starken Verkehrszuwachs wieder zunichtegemacht wurden;
•eine Stromproduktion, die im jährlichen Mittel den Bedarf noch knapp deckt, deren Kraftwerke jedoch in die Jahre gekommen sind. Die Schweiz hängt insbesondere von Anlagen ab, die zwischen 1950 und 1984 erbaut wurden. Deren Tragpfeiler sind unter anderem die Atomkraftwerke, doch diese erreichen in den nächsten 20 Jahren das Ende ihrer Betriebsdauer.
So sieht die Ausgangslage der Schweiz aus. Den Wandel muss unser Land durch die laufende Dekarbonisierung seiner Energiewirtschaft herbeiführen.
1.2Den Strombedarf berücksichtigen
Es stellt sich immer deutlicher heraus, dass die Elektrifizierung entscheidend zur Dekarbonisierung beitragen wird. Elektrizität ist nämlich fast vier Mal effizienter im Betrieb als die fossilen Energieträger. Elektromotoren und Wärmepumpen arbeiten von Natur aus effizienter als Diesel- bzw. Benzinmotoren und Ölheizungen. Oftmals beträgt der Verbrauch fossiler Energie bei gleicher Leistung 4 Kilowattstunden und bei Elektrizität nur 1 Kilowattstunde. Deshalb ist Elektrizität eine der wertvollsten Energieformen. Wahrscheinlich kommt es in Zukunft zur sogenannten ‹Sektorenkopplung› zwischen dem Stromsektor, der Mobilität und der Gebäudetechnik. Diese wird den Energieverbrauch insgesamt reduzieren, dafür aber zu einem beachtlichen Zuwachs beim Elektrizitätsverbrauch führen.
Bei den Gebäuden hat die Dekarbonisierung bereits begonnen, muss jedoch noch beschleunigt werden. Durch Effizienzgewinne lässt sich ein grosser Teil des CO2-Ausstosses reduzieren. Hier gilt es, bewährte bestehende Massnahmen zu verstärken und die Standards für Sanierungen zu verschärfen (Wärmedämmung und Wechsel auf erneuerbare Energien). Doch für die energetische Gebäudesanierung braucht es nicht nur mehr erneuerbar gewonnene Wärme, sondern auch mehr Strom. Man sollte dabei nicht den Fehler machen, Wärmepumpen in Gebäude einzubauen, die schlecht isoliert sind und deshalb im Winter einen höheren Stromverbrauch aufweisen. Der Handlungsbedarf in diesem Bereich wird unter Punkt 3.2 erörtert.
Unter 3.3 folgt die Analyse des Strombedarfs zur Sanierung der Mobilität, ohne jedoch detailliert auf Pro und Kontra eines elektrifizierten Individualverkehrs einzugehen. Im Zentrum steht die Versorgung mit Strom ohne kohlenstoffhaltige Ressourcen.
Für die Dekarbonisierung von Verkehr und Gebäuden dürfte der Strombedarf um etwa 20 bis 25 Terawattstunden (TWh) ansteigen. Dazu kommt der Zusatzbedarf von rund 20 TWh, der sich aus der Abschaltung der Atomkraftwerke ergeben wird. Insgesamt muss die Schweiz also rund 45 TWh mehr Strom generieren.
1.3Jederzeit genügend Strom
Damit die Dekarbonisierung gelingt, braucht es jederzeit genügend sauberen Strom. Daraus folgt das zweite energie- und klimapolitische Ziel für die Schweiz: die Deckung des gesamten Strombedarfs im mehrjährigen Mittel durch eigene Stromproduktion – mit einem möglichst hohen Einsatz an erneuerbaren Energieträgern und unter Gewährleistung der Versorgungssicherheit im Winter.
Diesem Ziel muss sich die Schweiz verpflichten – nicht nur, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, sondern auch, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Zum einen ist unsicher, ob die EU langfristig genug Strom produziert, dass wir unseren Bedarf durch Importe decken können. Unsere Nachbarländer müssen in erster Linie ihre eigenen Bedürfnisse stillen. Ausserdem ist bei massiven Stromimporten irgendwann eine physikalische Grenze erreicht – von möglichen politischen und administrativen Schwierigkeiten ganz zu schweigen. Durch ein Stromabkommen mit der Europäischen Union könnte sich die Schweiz absichern. Damit liesse sich das Speicherpotenzial der Stauseen effizienter nutzen sowie der Energiehandel und der Betrieb des Übertragungsnetzes vereinfachen. Ein solches Abkommen befreite die Schweiz jedoch nicht von der Notwendigkeit, selbst genügend Strom zu produzieren, denn daraus entstünde sonst ein in wirtschaftlicher und praktischer Hinsicht nachteiliges Kräfteverhältnis.
Im Übrigen können die Umweltbeeinträchtigungen der Stromerzeugung kaum guten Gewissens auf die Nachbarländer abgewälzt werden. Auch aus diesem Blickwinkel muss die Schweiz ihren eigenen Strom generieren. Wer viel Strom importiert, riskiert zudem, dass im Ausland mehr Emissionen aus fossilen Brennstoffen entstehen. Schliesslich verfügt die Schweiz über sehr wenige eigene Rohstoffe und ist daher weitgehend vom Import abhängig; da sollte sie wenigstens ihren eigenen Strom produzieren können. Wie die Geschichte der Wasserkraft und der Holznutzung aus Schweizer Wäldern zeigt, haben die Erschliessung und der sparsame Einsatz lokaler Ressourcen zum Wohlstand unseres Landes beigetragen.
Es würde keinen Sinn ergeben, Verkehr und Gebäudetechnik mit weitgehend kohlenstoffbasiertem Strom zu elektrifizieren. Denn im Endeffekt muss ja durch den Umbau der CO2-Ausstoss massiv reduziert werden.
Doch dieses zweite Ziel, das man ‹Selbstversorgung im Jahresdurchschnitt› nennen könnte, lässt sich nicht von heute auf morgen erreichen. Der Aufbau einer umfassenden Produktionsinfrastruktur erfordert erhebliche Ressourcen. So betrachtet ist die Schweiz heute in einer ähnlichen Lage wie in der Nachkriegszeit: Es müssen sehr viele Anlagen gebaut und erneuert werden. Dennoch fällt der Aufwand gegenüber dem BIP viel kleiner aus als damals.
Mit der Annahme der ‹Energiestrategie 2050› im Mai 2017 durch das Stimmvolk wurde der Atomausstieg grundsätzlich beschlossen, jedoch ohne festen Terminplan. Das ist zwar ein erfreulicher erster Schritt, doch das Dispositiv zur Umsetzung der erneuerbaren Stromgewinnung reicht bei Weitem nicht aus. Damit lässt sich die Produktion für gerade einmal die Hälfte des Stroms aufbauen, der heute von den Atomkraftwerken geliefert wird. Es muss deshalb sofort massiv verstärkt werden, damit die übrigen 50% der Atomstromproduktion ersetzt und das Land mit dem darüber hinaus noch für die Dekarbonisierung benötigten Strom versorgt werden kann. Bei einem solchen Volumen reichen kleine Schritte nicht mehr; eine zielorientierte Energiepolitik ist zwingend erforderlich. Wir haben nur 30 Jahre Zeit für die Umsetzung, sollen die Treibhausgasemissionen bis spätestens 2050 auf null gesenkt werden.
1.4